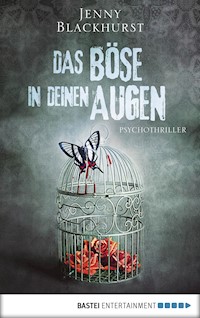9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Am Abend ihrer Hochzeit stürzt sich Evie White von einer Klippe in den Tod. Ihre Leiche wird nie gefunden, doch es gibt Zeugen für den Sturz. Was hat Evie dazu gebracht, ihr Leben so plötzlich zu beenden? Als ihr Bräutigam und ihre beste Freundin versuchen, diesem Rätsel auf den Grund zu gehen, stoßen sie auf dunkle Abgründe im Leben der Verstorbenen. Allmählich beginnen sie zu begreifen, dass sie die wahre Evie nie wirklich kannten - und dass sie die Vergangenheit besser ruhen lassen sollten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungPrologKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Einen Monat späterKapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41Kapitel 42Kapitel 43Kapitel 44Kapitel 45Kapitel 46Kapitel 47Kapitel 48Kapitel 49Kapitel 50Kapitel 51Kapitel 52Kapitel 53Kapitel 54Kapitel 55Kapitel 56Kapitel 57Kapitel 58Kapitel 59Kapitel 60Kapitel 61Kapitel 62Kapitel 63Kapitel 64Kapitel 65Kapitel 66Kapitel 67Kapitel 68Kapitel 69Vier Monate vor der HochzeitKapitel 70Kapitel 71Kapitel 72Kapitel 73Kapitel 74Kapitel 75Kapitel 76Kapitel 77Kapitel 78Kapitel 79JetztKapitel 80Kapitel 81Kapitel 82Kapitel 83Kapitel 84Kapitel 85Kapitel 86Der Abend der HochzeitKapitel 87Kapitel 88Kapitel 89Kapitel 90Kapitel 91Kapitel 92Kapitel 93JetztKapitel 94Der Abend der HochzeitKapitel 95JetztKapitel 96Kapitel 97Kapitel 98Acht Monate nach der HochzeitKapitel 99Kapitel 100EpilogJetztEvieDanksagungÜber dieses Buch
Am Abend ihrer Hochzeit stürzt sich Evie White von einer Klippe in den Tod. Ihre Leiche wird nie gefunden, doch es gibt Zeugen für den Sturz. Was hat Evie dazu gebracht, ihr Leben so plötzlich zu beenden? Als ihr Bräutigam und ihre beste Freundin versuchen, diesem Rätsel auf den Grund zu gehen, stoßen sie auf dunkle Abgründe im Leben der Verstorbenen. Allmählich beginnen sie zu begreifen, dass sie die wahre Evie nie wirklich kannten – und dass sie die Vergangenheit besser ruhen lassen sollten …
Über die Autorin
Jenny Blackhurst lebt in Shropshire, England. Sie ist 29 Jahre alt, verheiratet und hat einen zweijährigen Sohn. Sie arbeitet als Systemadministratorin für die Feuerwehr, und in ihrer Freizeit schreibt sie an ihrem zweiten Roman.
JENNY BLACKHURST
MEIN HERZ SO SCHWARZ
PSYCHOTHRILLER
Aus dem Englischen von Anke Angela Grube
BASTEI ENTERTAINMENT
Deutsche Erstausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2018 by Jenny Blackhurst
Titel der englischen Originalausgabe: »The Night She Died«
Originalverlag: Headline Publishing Group, London
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anita Hirtreiter, München
Titelillustration: © CuteLala /shutterstock; © Leah Joy Kelton /shutterstock
Umschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverde
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-7238-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für meine wunderbaren Söhne Connor und Finlay, ohne die ich das Buch in der Hälfte der Zeit geschrieben hätte. Euch liebe ich auf der ganzen weiten Welt am meisten.
Prolog
Sie steht am Rand der Felsklippen, und ihr langes blondes Haar flattert im leichten Wind. Ihre Füße unter dem langen Kleid sind nackt und schmutzig, aber obwohl das Gras feucht ist, spürt sie die Kälte nicht. Als sie auf das stille dunkle Wasser hinausblickt, empfindet sie ein Gefühl von Frieden. Evelyn braucht nicht hinabzusehen, um zu wissen, dass das Wasser am Fuß der Klippen gegen schroffe Felsen brodelt, und fürchten tut sie sich nicht vor ihnen. Sie stand schon oft vor diesem Meer. Die Wellen kennen ihren Namen, kennen ihre Geschichte.
Sie hebt die Hand, um den Schleier abzunehmen, und die Diamanttiara, die einmal ihrer Mutter gehörte und davor deren Mutter, fällt lautlos zu Boden. Hier oben ist es still, nichts ist zu hören außer dem Flüstern des Meeres und ihren eigenen langsamen, sanften Atemzügen.
Auf der gegenüberliegenden Seite der Steilküste stehen zwei Menschen, die sie beobachten. Sie sind weiter entfernt, als ihr lieb wäre, doch der Abend ist so klar, dass ihre hochgewachsene, geschmeidige Gestalt in dem eng anliegenden Hochzeitskleid auch im Zwielicht noch gut sichtbar ist. Sie sind nahe genug, um ihrem Mann bestätigen zu können, dass sie es war, aber zu weit entfernt, um zu reagieren, wenn ihnen ihre Absicht klar wird. Im Augenblick, in den folgenden Sekunden, ist sie eine Frischvermählte, die sich eine kurze Auszeit von ihrem rauschenden Hochzeitsfest gönnt, für einen Moment der Musik und dem Wein entfliehen will, den unablässigen Gratulationen und Scherzen über das Eheleben. Es ist ein Pärchen, das die laue Abendluft genießt und sich ausmalt, ebenfalls eines Tages seine Freunde zu versammeln, damit sie ihr Gelöbnis hören, der Braut gratulieren und dem Bräutigam ihr Mitgefühl ausdrücken. Die Frau lässt ihren Schleier los und schaut zu, wie er zum Klippenrand hinabsegelt, und dann tut sie einen Schritt vorwärts, zuversichtlich und ohne Zögern, und wirft sich in die Dunkelheit. Noch vor wenigen Augenblicken waren sie einfach Liebende. Jetzt sind sie Zeugen.
Kapitel 1
Der Abend der Hochzeit
Rebecca
Die verbliebenen Hochzeitsgäste versammeln sich auf dem Rasen, vom Schock ernüchtert, durch fassungslose Trauer verstummt. Eine Frau, Evelyns Großtante Beth, schluchzt leise in ein Taschentuch, das ihr Mann, ein Männchen mit Hühnerbrust und schwachem Willen, ihr gereicht hat. Nur drei Stunden zuvor hatte er mit gerunzelter Stirn zustimmend genickt, während Beth sich über rein alles beschwerte, von der »unkonventionellen« Trauzeremonie über die Musik, von der Deko bis zu den »Hippiefreunden«, die Evelyn aufgetan habe. Ihre erst kürzlich verstorbene Nichte, Evelyns Mutter, würde sich im Grab umdrehen, wenn sie miterleben müsste, dass ihre Familie und ihre Freunde dazu gezwungen wären, mit solchen niveaulosen Menschen Umgang zu haben. Nun herrscht Schweigen, denn so wie es aussieht, wird die Tochter sich zu der Mutter gesellen.
*
Mein Herz hämmert, als ich vor der Tür des Hotelzimmers stehe und dem gedämpften Stimmengemurmel lausche, das gelegentlich von einem wütenden Ausbruch unterbrochen wird. Richard.
Ich wappne mich und will hineingehen, zögere jedoch, als Richard wieder herumzubrüllen beginnt. Er sollte da draußen sein und sie suchen, schreit er, und seine Frau hätte ihm das nie im Leben angetan. Das ist mein Stichwort – ich weiß, ich als Evies beste Freundin und Brautjungfer habe meine Rolle zu spielen –, aber plötzlich will ich mir das Ganze nicht antun. Ich will den Ausdruck auf Richards Gesicht nicht sehen, ich will nicht mit ansehen müssen, wie es ihm das Herz bricht.
Schritte auf der anderen Seite der Tür lassen mich endlich aktiv werden, und ich hämmere mit der Faust dagegen.
»Richard!« Die Tür geht fast sofort auf, und vor mir steht einer der Polizisten, die Richard vor zwanzig Minuten fortgeführt haben. Es waren die längsten zwanzig Minuten meines Lebens. »Ich muss mit Richard sprechen.«
»Tut mir leid«, setzt er an, doch eine Stimme aus dem Zimmer schneidet ihm das Wort ab.
»Lassen Sie sie rein«, sagt Richard, und ein resignierter Seufzer verrät mir, was ich wissen muss. »Sie ist Evies beste Freundin, sie hat es verdient, es zu hören.«
Der Polizist tritt zur Seite, und ich dränge mich an ihm vorbei in das kleine Hotelzimmer mit den weiß getünchten Wänden und dem fast perfekten Blick auf die Klippen, von denen Richard Bradleys Frau sich gerade gestürzt hat.
»Richard!« Ich stürze auf ihn zu und packe ihn an den Armen. »Wo ist Evie? Unten heißt es, dass sie von den Klippen gesprungen ist, aber das ist doch verrückt. Wo ist sie?«
Als er nicht antwortet, schüttle ich ihn, aber er kann es trotzdem nicht aussprechen. Die Kollegin des ersten Polizisten sieht aus, als wolle sie weinen, als sie vortritt, mir die Hand auf den Arm legt und mich sanft, jedoch entschieden fortführt.
»Ich bin Detective Michelle Green, und das ist Detective Thomas.«
Michelle, die mir ihren Vornamen verraten hat, spricht langsam und freundlich, Detective Thomas steht einfach da und sieht grüblerisch drein. Er ist groß und breitschultrig, hat olivenfarbene Haut und dunkles Haar. Er sieht aus wie ein Fernsehkommissar – auch wenn es bislang keine Sprechrolle ist. Dann und wann wirft er mir einen abschätzigen Blick zu, der mich dazu bringt, mich schuldig zu fühlen, als täte ich mit meinem Hiersein etwas Falsches. Er beobachtet lediglich, wartet. Worauf?
»Berichten zufolge ist eine Frau, bei der es sich der Beschreibung nach um Mrs. Bradley handeln könnte, vor etwa vierzig Minuten ins Meer gestürzt. Haben Sie Mrs. Bradley in der letzten Stunde irgendwo gesehen?«
Ein Bild erscheint vor meinem inneren Auge: meine beste Freundin, als ich sie vor einer Dreiviertelstunde zum letzten Mal sah. Sie geht auf den Gartenpavillon zu, dann dreht sie sich um. Sie hält nach mir Ausschau, und als unsere Blicke sich treffen, lächelt sie mir beruhigend zu. Sie wirkt nicht so, als würde sie sich fürchten, wie ich es tue, sie ist unbeirrbar und zögert nicht. Sie wendet sich ab und verschwindet in der Dunkelheit, und für den Bruchteil einer Sekunde würde ich am liebsten hinter ihr herrennen, sie festhalten und nicht loslassen. Aber meine Füße bewegen sich nicht, und der Moment ist vorbei. Sie ist fort.
»Nein«, sage ich, »ich habe sie nicht gesehen.«
*
Ich habe mir die Augen ausgeweint, und zu meiner Überraschung waren es echte Tränen. Das war’s dann also, sagt eine Stimme in meinem Kopf. Sie ist fort. Du bist auf dich allein gestellt. Und der Gedanke ist fast mehr, als ich ertragen kann.
Richard spricht immer noch mit der Polizei, und ich habe den Eindruck, dass sie ihn hierbehalten, damit er nicht zu den Klippen hinausläuft, damit er nichts Dummes tut. Ich starre aus dem Fenster, wo Taschenlampen die Gegend absuchen und die weißen Scheinwerfer des Such- und Rettungshubschraubers den Himmel erhellen.
»Sie haben einen Hubschrauber«, sage ich, und meine Stimme klingt, als gehöre sie jemand anderem. Ich wünschte, es wäre so, denn dann würden diese Lichter in der Dunkelheit nach der besten Freundin einer anderen suchen.
»Der gerade erst gekommen ist. Dabei ist es schon fast eine Stunde her, verdammt«, blafft Richard. Er geht zum Fenster, tritt aber sofort wieder zurück und nagt an einem Häutchen seiner Oberlippe – eine ärgerliche Angewohnheit, die immer in Erscheinung tritt, wenn er ängstlich und besorgt ist. »Ihr wird eiskalt sein. Und warum konzentriert sich die Suche auf den Bereich unterhalb der Steilküste? Mittlerweile könnte sie schon halb nach London zurückgeschwommen sein.«
Weil sie nicht nach einer Schwimmerin suchen. Ich will die Worte nicht aussprechen und die Polizisten ebenso wenig. Er muss selbst den offensichtlichen Schluss ziehen. Er muss selbst darauf kommen, dass heute Abend seine Frau, meine beste Freundin, am Tag ihrer Hochzeit ins Meer gesprungen ist, um zu sterben. Und ich bin der einzige Mensch, der weiß, warum sie das getan hat.
Kapitel 2
Rebecca
Ich erinnere mich an meine erste Begegnung mit Evie White, obwohl ich damals noch nichts von der Dunkelheit ahnte, die sie in mein Leben bringen würde. Ich war achtzehn Jahre alt, unsterblich in einen Bassgitarristen namens Steve verliebt, der natürlich ein absoluter Idiot war, und rechnete fest damit, er würde dafür sorgen, dass ich an der Uni endlich Anschluss fand. Ich war bereits ein ganzes Jahr an der University of London und hatte es geschafft, ganze drei Freunde zu finden: die übergewichtige Sandra, eine Geschichtsstudentin, deren Vorstellung von einer wilden Ausgehnacht war, sich nach dem Treffen des Debattierclubs noch eine Portion scharf gewürzter Hähnchenteile von Nando’s zu holen; Christopher – nicht Chris, niemals Chris –, der hochrot anlief, wenn jemand ihn ansprach, und der sich nur mit mir angefreundet hatte, nachdem er gezwungen war, mit mir zusammen im Café zu arbeiten; und Sunny, ein chinesischer Austauschstudent, mit dem mich unsere gemeinsame Wertschätzung der Twilight-Saga verband. So hatte ich mir mein erstes Studienjahr nicht vorgestellt – das Jahr, in dem ich eigentlich nicht länger eine Außenseiterin sein und erhobenen Hauptes zwischen meinen Kommilitonen einherschreiten wollte.
Steve und ich lernten uns im zweiten Jahr eines Wirtschaftsstudiengangs kennen. Ich hatte mich für dieses Fach eingeschrieben, weil ich glaubte, dass es mir bestimmt war, als erfolgreiche Unternehmerin die nächste Karren Brady zu werden, und er, da sein Vater das von ihm verlangte und dieser ihm sonst den Geldhahn abdrehen würde. Ich glaube, Steve wurde schnell klar, dass er seinen Abschluss auf keinen Fall ohne fremde Hilfe schaffen würde (also war er doch kein totaler Idiot), und am besten käme er durch die unscheinbare, schüchterne, aber ganz annehmbar aussehende Frau, die allein hinten im Raum saß, an sein Ziel. Ich. Ich hatte keine Ahnung, was ich mit mir anfangen sollte, als er sich neben mich setzte und »Hi« flüsterte.
»Meinst du mich?«
Selbst sein Lächeln war träge und leichtsinnig. Seine Augen waren kaum sichtbar unter der rotblonden Lockenmähne, die er sich alle paar Minuten aus dem Gesicht strich.
»Na klar. Wollen wir uns für diese Projektarbeit zusammentun?«
Ich stöhnte. »Du meinst, ob ich die Projektarbeit für uns beide schreiben will?«
Man musste ihm hoch anrechnen, dass sein Gesichtsausdruck unverändert blieb. Erst später wurde mir klar, dass er nur diese eine lammfromme Miene aufsetzen konnte.
»Jetzt bin ich aber gekränkt.«
»Komm schon. Was hätte ich denn davon?«
»Also, okay.« Haarsträhne aus dem Gesicht streichen. »Mir ist zufällig aufgefallen, dass es dir bislang gelungen ist, jede einzelne Projektarbeit alleine zu machen. Du hast keinen Kontakt zu irgendjemandem hier, und die einzige Person, mit der ich dich je zusammen gesehen habe, ist diese fette Tusse.«
Ich machte den Mund auf, um Sandra zu verteidigen, aber er gab mir keine Gelegenheit dazu.
»Also dachte ich mir, ich bekomme ausnahmsweise eine gute Note für eine Projektarbeit, und du kannst dich dafür mit jemandem zeigen, der nicht riecht, als hätte er einen Marathon gelaufen, wenn er sich bloß eine Cola geholt hat.«
»Das ist echt gemein.«
Da lächelte er. Er hatte wirklich ein unwiderstehliches Lächeln, und ich wusste, ich würde sein Angebot auf gar keinen Fall ablehnen.
»Haben wir einen Deal?«
»Gut, abgemacht.«
Eine Woche später schliefen wir miteinander. Zwei Wochen später bezeichnete er mich auf einer Party vor seinen Freunden als seine »Freundin«. Gut, er war betrunken und high, aber soweit es mich betraf, zählte es trotzdem. Ich brachte meine Abende nicht mehr damit zu, über das Leben anderer Leute zu lesen, sondern lebte tatsächlich meins. In Steves Wohnung war fast immer etwas los, Leute kamen auf ein paar Drinks vorbei, die Band probte bis in die frühen Morgenstunden, oder Leute pennten bei ihm, nachdem sie nachts durch die Clubs gezogen waren. Es machte großen Spaß, doch irgendwann wurde es ein bisschen viel für eine brave Wirtschaftsstudentin und Einserkandidatin wie mich.
»Heute Abend übernachte ich in meiner eigenen Wohnung, Babe.«
Steve, der neben mir im Bett lag, stützte sich auf einen Ellbogen auf.
»Was ist los? Hast du schon genug von mir?«
Ich lächelte. Nichts hätte weiter von der Wahrheit entfernt sein können. »Sei nicht albern. Ich muss nur ein wenig Schlaf nachholen. Ich habe jetzt in drei Vormittagsseminaren hintereinander gefehlt. Nach der Wirtschaftsvorlesung komme ich bei dir vorbei.«
»Okay, klasse. Schreib für mich mit, ja?«
»Mach ich doch immer.«
Am nächsten Morgen, frisch geduscht nach acht Stunden Schlaf und einem richtigen Frühstück, fühlte ich mich großartig und folgte zum ersten Mal seit zwei Wochen aufmerksam der Vorlesung. Ich machte mir ausführlich Notizen für meinen neuen Freund. Auf dem Weg zu seiner Wohnung besorgte ich Kaffee und Bacon-Sandwiches, eine Geste, die er nach einer durchzechten Nacht zweifellos zu schätzen wissen würde. Gott, er konnte wirklich von Glück sagen, dass er mich hatte.
Wir waren noch nicht so weit, dass wir unsere Wohnungsschlüssel ausgetauscht hätten, also klopfte ich an seine Tür und bereitete mich auf eine zwanzigminütige Wartezeit vor. So lange dauerte es normalerweise, bis er sich aus dem Bett gequält hatte. Noch überraschender als der Umstand, dass die Tür nach wenigen Minuten aufging, war das halb nackte Mädchen, das vor mir stand.
Sie war hochgewachsen wie eine Amazone und hatte gebräunte, scheinbar endlos lange Beine. Ihre Füße waren nackt, ebenso wie der Rest ihres Unterkörpers, abgesehen von einem grauen Tanga, der irgendwann, bevor nach Studentenart alles in eine Maschine gestopft wurde, zweifellos weiß gewesen war. Obenherum trug sie ein kurzes weites graues T-Shirt mit eindeutig nichts darunter. Ihr Gesicht war ebenso gebräunt wie ihre Beine, und der Hauch von Sommersprossen zeigte, dass die Bräune nicht aus der Tube kam. Ihr blondes Haar war zerzaust, und sie hatte die müde, entspannte Haltung einer Frau, die die Nacht damit zugebracht hat, Sex zu haben. Mit meinem Freund.
»Ich wollte zu Steve«, brachte ich töricht hervor.
»Ist gerade unter der Dusche.« Sie öffnete die Tür ein Stück weiter, um mich einzulassen, und verschwand in der Wohnung, ohne auch nur zu fragen, wer ich sei.
Als ich endlich den Mut aufbrachte einzutreten, saß sie auf dem Sofa und drehte einen Joint. Ich setzte mich auf den Sessel ihr gegenüber und hielt verlegen die Tüte mit den Sandwiches umklammert.
»Äh, wer bist du?«, fragte ich sie.
Das Mädchen musterte mich eingehend. Da war sie, ein bildschönes Ding, und doch schaute sie mich an, als wäre ich ein seltener Schmetterling unter dem Mikroskop. Ihre Augen hatten die Farbe von Pfefferminz-Sorbet. Sie zündete den Joint an und nahm einen tiefen Zug.
»Evie«, antwortete sie. Ihre Stimme war weich, melodisch. »Willst du auch?« Sie hielt mir den Joint hin und blies den Rauch durch träge geöffnete Lippen.
»Nein, danke.«
Sie lehnte sich achselzuckend auf dem Sofa zurück. Ich rutschte auf meinen Sessel herum.
»Eigentlich doch, gern.«
Der Ausdruck auf Steves Gesicht, als er aus der Dusche kam, war unbezahlbar. Offensichtlich hatte er keine Ahnung, wie spät es war, nachdem er die Nacht damit zugebracht hatte, die Göttin zu vögeln, die jetzt auf seinem Sofa lag, und er stammelte eine Entschuldigung, der keine von uns richtig zuhörte. Evie sprach mit solcher Leidenschaft auf dem Gesicht über kulturelle Klischees in der Werbung, dass meine Beziehung mit Steve noch vor dem Joint, den wir drei uns teilten, beendet war. Er dachte damals, er könne sich glücklich schätzen, weil ich nicht ausrastete, sondern graziös beiseitetrat, damit die schöne Evie White meinen Platz einnehmen konnte.
»Was studierst du, Evie?«, fragte ich, während Steve mir verdatterte Blicke zuwarf.
»Fotografie. Man kann der Seele Bildung im Gesicht lesen.« Sie griff nach einer teuer aussehenden Kamera mit langem Objektiv und enthüllte noch mehr gebräunte Haut, als sie es mit dem Saum ihres T-Shirts abstaubte. Sie stützte die Ellbogen auf den Knien ab und blickte in den Sucher. »Es heißt, wenn jemand dich fotografiert, raubt er dir einen Teil deiner Seele.«
Sie drückte auf den Auslöser, und die Kamera surrte.
»Siehst du, nun habe ich deine Seele.«
Kapitel 3
Rebecca
»Was zum Teufel ist hier los?«
Der starke französische Akzent, der vernichtende Ton – Evies Vater ist eingetroffen. Dominic Rousseau stürmt an Detective Thomas vorbei ins Zimmer, und ich krümme mich innerlich, als ich sehe, dass ihm Verzweiflung in das schöne Gesicht geschrieben steht. Der Mann, dem immer alle Frauen zu Füßen lagen, eine so bedeutende Persönlichkeit im Bereich der Wirtschaft, macht einen völlig gebrochenen Eindruck. Sein Tonfall lässt Michelle sichtlich zusammenfahren.
Nach einem kurzen Augenblick tritt Richard vor. »Dominic, sie sagen, sie ist gesprungen –«
Dominic sieht aus, als wollte er auf ihn losgehen, und Detective Thomas macht einen Schritt nach vorn, bereit einzugreifen, falls die Lage sich verschlimmern sollte – als ob dieser Abend noch schlimmer werden könnte.
»Unmöglich! Heute ist Evies Hochzeit! Warum zum Teufel sollte sie ausgerechnet an dem Tag versuchen, sich umzubringen, der der glücklichste ihres Lebens sein sollte?«
»Sie wurde gesehen, Sir«, stottert Michelle. »Zwei Zeugen, die auf der Steilküste gegenüber standen, riefen die Polizei, als sie sahen, wie eine Frau in einem Hochzeitskleid ins Meer stürzte. Es wird alles Menschenmögliche getan, um sie zu finden.«
»Aber offensichtlich nicht genug. Du«, er wendet sich an mich, »hat sie irgendwas zu dir gesagt? Hat sie irgendetwas verstört?«
»Ich, nein, es schien ihr gut zu gehen, als ich sie zuletzt gesehen habe.«
In gewisser Weise ist es schwieriger, Dominic anzulügen als Richard oder die Polizei. Es ist fast, als könnte er direkt in mich hineinschauen und meine Gedanken lesen, wie ein menschlicher Lügendetektor.
»Was hast du ihr angetan?« Der verräterische Feigling in mir stößt einen erleichterten Seufzer aus, als er sich wieder Richard zuwendet.
»Was meinst du damit, ihr angetan?« Richard findet seine Stimme wieder, und er ist wütend. »Ich habe ihr gar nichts angetan! Ich liebe sie. Wir haben gerade geheiratet.«
»Nun, irgendetwas musst du getan haben, um meine Tochter so unglücklich zu machen, dass sie am Tag ihrer Hochzeit so etwas durchzieht!«
»Evie hat nie irgendjemand anderen für ihr Glück verantwortlich gemacht. Gerade du solltest das wissen.«
»Was meinst du damit, gerade ich? Was soll das bitte heißen? Ich war ja nicht mal hier!«
Einen flüchtigen Moment lang geht mir der Gedanke durch den Kopf, dass das genau das ist, was Evie gewollt haben würde. Sie hätte es nicht besser planen können, wenn sie hier gewesen wäre, um den Köder auszuwerfen. Die beiden Männer in ihrem Leben streiten sich darüber, wer sie mehr geliebt hat, und selbst jetzt noch, als ihr Körper gegen die Felsen geschmettert wird und ihre Seele ins Meer hinaustreibt, ist sie die eindrucksvollste Gestalt in jedem Raum. Siehst du, nun habe ich deine Seele.
Und die hatte sie. Für die nächsten sieben Jahre besaß Evie White meine Seele, und jetzt hat sie mir meine Seele zurückgegeben, und ich weiß nicht mehr, was ich damit anfangen soll. Evie war das Wichtigste in meinem Leben, sie hat so oft entschieden, wo wir hingehen wollten und was wir anziehen sollten, dass ich keine Ahnung mehr habe, wer ich ohne sie überhaupt bin. Welche Filme werde ich mir ansehen, nachdem ich sie mir nun allein aussuchen muss? Was für Musik gefällt mir? Jede CD, die ich besitze, wurde mir von meiner anderen Hälfte mit ansteckender Begeisterung empfohlen. Versuch mal das, Becky, du wirst es lieben. Dieser Duft würde wunderbar zu dir passen. Blau ist wirklich deine Farbe. Was soll ich jetzt bloß anfangen?
»Genau«, fährt Richard seinen Schwiegervater an. »Vielleicht, wenn du am glücklichsten Tag ihres Lebens hier gewesen wärst …«
Ich ziehe die Luft ein und warte auf eine Explosion, die nicht kommt. Dominic wirkt nur müde, reibt sich das Gesicht und wendet sich Michelle zu.
»Was wird unternommen? Ist irgendjemand da draußen und sucht nach ihr? Jede Sekunde, die Sie abwarten, ist eine Sekunde, in der meine Tochter draußen im Dunklen allein ist. Sie wird noch erfrieren.«
»Hubschrauber suchen die Gegend ab, Sir.«
»Nun, offenbar reicht das nicht.« Michelle will etwas entgegnen, aber er hebt eine Hand, und ihr Mund schließt sich wieder, wie bei einem Fisch. »Ich will Ihre leeren Platituden nicht hören. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Vorgesetzten mich augenblicklich kontaktieren. Ich bin in meinem Zimmer. Ich will wissen, wie sie genau vorgehen wollen, um meine Tochter zu finden.«
Und damit geht er, ohne auch nur einen Blick auf Richard oder mich zu werfen.
Einen Monat später
Kapitel 4
Rebecca
Der Junge hinter mir in der Supermarktschlange packt eine Ecke meiner Nudelpackung und zerrt daran. Ich schalte zu spät – obwohl er das jetzt bestimmt zum hundertsten Mal getan hat –, und der kleine Racker bricht in hysterisches Gelächter aus, als die Packung Conchiglie zu Boden kracht. Seine Mutter, die hektisch auf ihrem Smartphone herumtippt, blickt nicht einmal auf. Als ich mich bücke, um die Pasta wieder aufzuheben, bewirft der Junge mich mit einer Plastikfigur; ich spüre, wie sie meine Haare streift. Er lacht und streckt die Hand aus, damit ich ihm die Figur zurückgebe. Mit einem schnellen Fußtritt befördere ich sie unter die Kasse – ein kleiner Sieg.
Ich wuchte meine Einkaufstüten in den Kofferraum meines Wagens und knalle ihn zu, und er schließt sich mit einem befriedigenden Klicken. In letzter Zeit scheine ich mein halbes Leben in Supermärkten zu verbringen, da ich meinen eigenen Haushalt am Laufen halten und gleichzeitig dafür sorgen muss, dass Richard etwas zu sich nimmt. Denn wenn ich das nicht täte – machen wir uns nichts vor –, würde er vermutlich verhungern.
Seit der Hochzeit sind vier Wochen vergangen, vier Wochen ohne Leiche und ohne Antworten. Wir – Richard und ich – haben die erste Woche in dem Hotel verbracht. Hauptsächlich saßen wir in seinem Zimmer herum und warteten darauf, dass der Anruf kam.
Es war Michelle, die dann ruhig vorschlug, Richard solle nach Kensington zurückkehren und versuchen, so etwas wie ein normales Leben wiederaufzunehmen. Sie hat versprochen, ihn sofort anzurufen, sollte sich auch lediglich die kleinste Veränderung ergeben.
Das war vor drei Wochen, und sie hielt ihr Versprechen. Anfangs meldete sie sich jeden Tag bei ihm, nur um zu sehen, wie er zurechtkam. Dann rief sie bloß noch alle paar Tage an. Ich weiß nicht genau, ob er diese Woche überhaupt schon etwas von ihr gehört hat.
Keine Leiche bedeutet keinen Abschluss, und wir sind nach London zurückgekehrt. Ich arbeite von zu Hause aus als Online-Sachbearbeiterin, also kann ich ein Auge auf Richard haben. Solange Evie nicht gefunden wird, kann er nicht einmal anfangen, den Verlust zu verarbeiten, sondern steckt in einem schrecklichen Schwebezustand aus Verwirrung, Hoffnung und Schuld fest. Wie kann man verzweifelt auf die Bestätigung hoffen, dass die eigene Frau tot ist, ohne sich schuldig zu fühlen? Und doch, solange es noch Hoffnung gibt, hat er keine Chance, die Nicht-wahrhaben-wollen-Phase der Trauer hinter sich zu lassen. Er will Antworten – und die Hauptfrage lautet: Warum?
Er ist reizbar und mürrisch, so sehr, dass ich zwei Wochen nach unserer Rückkehr nach London kurz davor war, ihn alleinzulassen, damit er sich in dreckiger Unterwäsche ganz seinem Selbstmitleid hingeben konnte, aber Evies Stimme zwang mich zu bleiben. Wir haben ihm das angetan, hörte ich sie mir ins Ohr flüstern, nun musst du ihm da auch durchhelfen.
Und langsam gibt es Anzeichen für eine Veränderung. Jetzt ist er meistens bereits angezogen, wenn ich morgens bei ihm aufkreuze, und ganz allmählich kommt der alte Richard mit seinem trockenen Humor und den unendlich vielen Anspielungen auf Kultfilme der Achtziger wieder zum Vorschein. Dann und wann merke ich allerdings, dass er sich wieder diese Frage stellt: Warum?
»Vielleicht war sie krank«, sagte er erst gestern Abend zu mir, als wir eine der Serien guckten, die wir beide nicht mögen, die Evie jedoch nie versäumt hat. Auf dem Bildschirm ergriff ein alter Mann die Hand einer jungen Frau – es war seine Tochter, glaube ich –, und bat sie, ihm zu helfen, wenn die Zeit gekommen sei. »Vielleicht war es wie bei diesem Typen, vielleicht hatte sie Krebs und wollte nicht, dass wir leiden. Das würde ihr ähnlich sehen.«
»Vielleicht«, grübelte ich. »Aber hätte sie nicht eher gewollt, dass wir Bescheid wissen?«
»Trotzdem: Ich frage mal meinen Anwalt, ob ich Einsicht in ihre Patientenakten bekomme.«
Heute Abend mache ich Spaghetti Carbonara, obwohl ich genau weiß, dass Richard vermutlich seine Portion auf dem Teller hin- und herschieben wird, um das Ganze dann in den Mülleimer zu befördern, nachdem er ein paar Bissen gegessen und mir versichert hat, wie köstlich es war. Momentan scheint er praktisch ausschließlich von Zucker zu leben.
Ich lege den Rückwärtsgang ein und will gerade vom Parkplatz fahren, als mein Handy in der Mittelkonsole piepst. Leise fluchend wische ich über das Display und hoffe, dass es nicht Richard ist, der will, dass ich noch einmal in den Supermarkt zurückgehe, denn ich weiß, ich würde es tun, wenn er mich darum bittet. Wie wär’s mit ein bisschen Rückgrat, Rebecca, oder hast du vor, auf dir herumtrampeln zu lassen? Aber das ist unfair – seine Frau wird vermisst, wahrscheinlich ist sie tot, da hat er wohl das Recht, mich zu bitten, ihm ein paar Kekse mit Schokoladenstückchen mitzubringen oder was immer er auch sonst haben will.
Doch es ist keine Textnachricht, sondern eine Facebook-Benachrichtigung.
Evelyn Bradley hat dir eine Freundschaftsanfrage gesendet!
Kapitel 5
Evie
»Papa! Papa! Mère est morte!« Das fünfjährige Mädchen stürzte ins Arbeitszimmer ihres Vaters. »Morte!«
»Beruhige dich, Evelyn.« Ihr Vater sprach langsam und in perfektem Englisch. Er liebte seine Muttersprache, aber seit sie nach England gezogen waren, hatte er sich damit einverstanden erklärt, zu Hause nur Englisch zu sprechen, wie es der Wunsch von Evies Mutter war. Wir wollen doch nicht, dass sie hier in der Gegend als das französische Mädchen gilt, Dominic. Hier ist es wichtig, dass Mädchen sich anpassen. »Deine Mutter ist nicht tot. Ich habe noch vor einer halben Stunde mit ihr gesprochen. Was sollen diese Albernheiten? Auf Englisch bitte.«
»Auf dem Sofa … morte! Elle a … ähm, sie hat, sie hat Schlaftabletten genommen und rührt sich jetzt nicht mehr.« Evie warf sich an die Brust ihres Vaters, und Tränen liefen ihr über die Wangen. »Viens, s’il te plaît! Bitte komm!«
Evies Vater seufzte und legte seinen Stift hin. Er hob seine Tochter hoch und drückte einen Kuss auf ihre Stirn, die von wirren blonden Locken umrahmt wurde.
»Deine Mutter ist sehr lebendig, Evelyn Rousseau, und um dir das zu beweisen, werde ich der dummen Trine eine Tasse Wasser ins Gesicht schütten.«
Evelyn riss die Augen auf. Sie war sich sicher, dass ihre Mutter tot war, aber es war trotzdem ein riskanter Plan.
»Wenn du das tust, Papa, hoffst du besser, dass Mama tot ist«, warnte sie ihn mit ernster Miene.
Ihr Vater lachte. Es war sein echtes Lachen, das, das er mit Evelyn lachte (obwohl sie nicht immer wusste, warum er lachte) sowie mit Emily, der Englisch-Tutorin, die er für sie eingestellt hatte, nur dass Mama sie dann weggeschickt hatte, allerdings nie mit den Geschäftskunden, die kamen, und nicht einmal mehr mit Mama. Die bekamen das falsche Lachen, das Bastard-Lachen. Evelyn nannte es bei sich so, weil Papa ein Bastard war, wenn er mit diesen Leuten zusammen war und so tat, als wären sie witzig und interessant, und Evelyn völlig ignorierte. Er fasste die Frauen an, wenn Mama nicht hinsah oder sich in ihr Schlafzimmer zurückgezogen hatte, da sie sich nicht wohlfühlte. Er dachte, Evelyn sei zu klein, um zu merken, was vorging, wenn er ganz dicht an irgendeine Frau heranrückte und ihr etwas ins Ohr flüsterte oder wenn eine Frau ihm die Hand auf die Brust legte, den Blick senkte und lächelte. Evelyn wusste, was diese dreckigen Schlampen wollten. So nannte Mama sie, Daddys dreckige Schlampen und diese Bastarde von Männern.
Er marschierte mit ihr auf dem Arm zum großen Haus hinüber und trug sie in die Küche, wo er sie absetzte und ein Glas mit Wasser füllte.
»Komm, Evie.«
Sie blieb zurück und schüttelte den Kopf. Mama war tot, und Evie wollte sie nicht noch einmal so sehen. Es war schon beim ersten Mal ein furchtbarer Schock gewesen. Ihr Mund stand offen, und ihre dicke rosa Zunge hing an der Seite heraus.
»Schön, Spatz, du wartest hier.«
Sie hörte, wie ihr Vater ins Wohnzimmer ging, wo Mama lag. Tot, sie wusste es. Sie hörte, wie er eins der schlimmsten bösen Wörter sagte und ihr das Wasser ins Gesicht schüttete, und sie hörte, wie ihre Mutter aufschrie und dann ebenso böse Wörter sagte.
Sie lebt! Also warum schreit er dann herum? Weshalb ist er so wütend, Mama ist doch am Leben, Gott sei Dank!
»Du dämliche Kuh! Was glaubst du wohl, was du dem armen Kind damit antust? Willst du etwa, dass sie mal genauso verkorkst wird wie du?«
»Wenn ich verkorkst bin, Dominic, dann deinetwegen! Du und deine dreckigen Schlampen. Du treibst mich dazu, ist dir das klar? Wenn ich mich umbringe, klebt mein Blut an deinen Händen. Ich würde lieber sterben, als dich zu verlieren.«
Evie erschauderte. Sie war erst fünf Jahre alt, aber trotzdem wusste sie, dass Liebe so nicht sein sollte. Und eins wusste sie mit Sicherheit – sie würde nie zulassen, dass sie jemanden so sehr liebte, um aus diesem Grund sterben zu wollen.
Kapitel 6
Rebecca
Ich sitze auf dem Supermarkt-Parkplatz und starre auf die Freundschaftsanfrage auf meinem Handy, und – so dumm es auch scheinen mag – mein erster Gedanke ist: Es ist sie. Sie ist es! Sie ist am Leben!
Mein Herz hat zu hämmern begonnen, aber fast genauso schnell meldet sich meine normale, rationale Seite zu Wort.
Du Idiotin! Wenn Evie am Leben wäre, würde sie sich nicht über ein Facebook-Profil, das du noch nie zuvor gesehen hast, mit dir in Verbindung setzen. Das war niemals Teil irgendeines Plans.
Ich klicke auf das Profilbild – aus einiger Entfernung aufgenommen, doch da steht sie, in ihrem Brautkleid am Rand der steilen Klippen. Am Tag ihrer Hochzeit, an dem Abend, an dem sie starb. Unmöglich kann Evie dieses Foto selbst aufgenommen haben.
Ich kann bloß herausfinden, wer dahintersteckt, wenn ich auf Bestätigen klicke. Mir ist klar, wie seltsam es aussehen muss, wenn irgendjemand aus unserem Freundeskreis in meiner Chronik liest: »Rebecca Thompson und Evelyn Bradley sind jetzt Freunde«, aber spielt das eine Rolle? Wenn jemand nachhaken sollte, kann ich einfach die Wahrheit sagen – irgendeine abartige Person hat ein Facebook-Profil erstellt, und ich habe die Anfrage angenommen, um herauszufinden, um wen es sich handelt.
Ich bin auf der Profilseite und scrolle weiter. Evelyn Bradley ist nur mit mir befreundet, eine Ironie, die mir nicht entgeht. Obwohl alle, die Evie begegneten, sich in ihren Charme, ihre Schönheit und ihren Esprit verliebten, gab es bloß sehr wenige Menschen, denen sie ihre Gegenliebe schenkte. Da waren ein paar Mädchen aus ihrer Schule in Wareham, prätentiöse Schnepfen, die beim Anblick von Evie in ihrem Hochzeitskleid kreischten und auf und ab hüpften, doch so beliebt meine beste Freundin auch war, die Menschen, die sie wirklich kannten, lassen sich an den Fingern einer Hand abzählen. Und Richard gehört nicht dazu.
Abgesehen von dem Foto von Evie auf den Klippen ist die Profilseite leer, und es scheint keinem echten Zweck zu dienen. Darunter steht: »Schön ist wüst, und wüst ist schön.«
Dann, und ich glaube, das habe ich geahnt, seit ich die Freundschaftsanfrage sah, piepst mein Handy, und ein Kreis erscheint mit Evies Profilbild darin. Eine Nachricht. Als ich sie anklicke, taucht vor meinem inneren Auge das Bild einer Evie auf, die vom Grunde des Meeres hochtreibt. Ihre Haut ist von Entenmuscheln überwuchert, Vögel und andere Aasfresser haben sie angeknabbert. Ein Auge quillt aus der Höhle. Mir wird übel. Vier lange Wochen, in denen ich darauf gewartet habe, dass die Leiche meiner besten Freundin aus dem Meer gezogen wird, haben ihren Tribut gefordert. Einen kurzen Moment lang bete ich, dass die Nachricht tatsächlich von ihr stammt, dass sie am Leben ist und eins ihrer albernen Spielchen spielt.
Lange nicht gesehen, beste Freundin. Was geht ab? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. HAHAHAHAHA
Mit einer Mischung aus Enttäuschung und Erleichterung stoße ich die Luft aus, die ich angehalten habe. Das ist sie nicht.
Kapitel 7
Rebecca
Ich sehe mich auf dem Parkplatz um. Die Sonne auf Windschutzscheiben der übrigen Autos blendet; alle könnten leer sein, oder es könnte sich in jedem ein axtschwingender Wahnsinniger verbergen. Mir fallen Szenen aus unzähligen Horrorfilmen ein, und ich werfe einen flüchtigen Blick über die Schulter. Der Rücksitz ist leer. Wie habe ich mich früher immer über die dummen Mädels lustig gemacht, die schreiend die Treppe hinaufrannten – üblicherweise mit wogendem Busen, der aus dem Teenie-Top quoll – und darauf warteten, von einem heldenhaften Mann gerettet zu werden. Evie pflegte immer den gesichtslosen Mörder anzufeuern und gab ihm Tipps, wie er sein mörderisches Wüten erfolgreicher gestalten könne. Ich wünschte, sie wäre hier, um mir zu sagen, wie albern es ist, sich wegen einer Textnachricht zu erschrecken – kein Mörder hat je am helllichten Tag auf dem Parkplatz eines Supermarktes zugeschlagen.
Die Frau, die in der Schlange vor der Kasse hinter mir stand, bemüht sich, ihren kleinen Psychopathen in den Kindersitz zu bugsieren, und in einem Audi sitzt ein alter Mann mit zerknittertem Jackett, der aussieht, als würde er gleich einschlafen. Offenbar wartet er darauf, dass seine Frau mit Einkaufen fertig wird. Sonst ist niemand in der Nähe.
KALT
ICHBINNICHTINEINEMAUTO
Mein Daumen erstarrt auf dem Handydisplay. Ich schaue schnell auf die spiegelnden Fenster des Supermarkt-Cafés. Ist er oder sie da drin? Ich ziehe in Erwägung, hineinzumarschieren und den Schuldigen damit zu konfrontieren, aber die Vorstellung, dass ich jemandem das Smartphone aus der Hand reiße, nur um festzustellen, dass er gerade seiner Mutter eine SMS geschickt hat, hält mich davon ab. Sei nicht so paranoid. Niemand beobachtet dich.
Ich tippe als Antwort:
Wer sind Sie?
Und warte.
Ich muss nicht lange warten, »Evelyn« antwortet schnell.
DASWEISSTDU.
Ich werfe das Handy auf den Beifahrersitz, immer noch mit dem ekelhaften Gefühl, beobachtet zu werden, lege den Rückwärtsgang ein und setze aus der Parklücke. Prompt beginnt die Haupteinheit des Infotainmentsystems zu klingeln, ein Anruf von einer privaten Nummer. Als ich auf die grüne Taste drücke, bricht der Anruf ab und mein Handy piepst erneut. Ich trete auf die Bremsen.
IGNORIERMICHNICHT!
Jemand geht vorne an meinem Auto vorbei, und ich fahre zusammen. Aber es ist nur eine elegant gekleidete Frau mittleren Alters in einer Steppjacke, die mich ohne erkennbaren Grund finster ansieht.
Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber das ist doch krank. Wir trauern um meine beste Freundin. Lassen Sie mich in Ruhe und löschen Sie dieses Profil, oder ich rufe die Polizei.
Die blöde Tussi mit dem verzogenen Kind hält hinter mir und hupt, was mich zwingt, mit dem Smartphone auf dem Schoß loszufahren. Als ich auf die Hauptstraße einbiege, klingelt die Haupteinheit wieder, laut und beharrlich, bloß um erneut abzubrechen, als ich den Anruf annehme. Ich greife nach dem Handy, klemme es mir zwischen die Knie und versuche, die Flut der Textnachrichten zu lesen, ohne die Kontrolle über den Wagen zu verlieren.
SCHADE, DASSDULOSMUSSTEST. DASHATSPASSGEMACHT. WARUMSCHNEIDESTDUSOLCHEGRIMASSEN? DENNAMENDESCHAUSTDUNURAUF ’NENSTUHL.
WARUMDASLANGEGESICHT, BECKY?
WARUMIGNORIERSTDUMICH?
WARUMIGNORIERSTDUMICH?
Mit einem frustrierten Knurren werfe ich das Handy auf den Rücksitz und drücke auf die Bluetooth-Taste, um die Verbindung zum Auto zu unterbrechen. Ich kann das Telefon auf dem ganzen Weg zum Haus von Richard und Evie piepsen hören, und als ich vor dem Haus halte, habe ich vierzehn verpasste Anrufe von privaten Nummern und zwei weitere Nachrichten.
DUKANNSTMICHNICHTEWIGIGNORIEREN
Meine Hände zittern, als ich rückwärts in die Auffahrt setze. Ich sollte den Motor wieder anlassen und zum nächsten Polizeirevier fahren, aber ich bin mir sicher, dass man dort nichts unternehmen wird, außer eine Anzeige aufzunehmen und mir zu raten, das Schwein zu blockieren, und genau das werde ich auch tun.
Ich tippe: »Wer sind Sie? Was wollen Sie?« Es ist ein letzter Versuch herauszufinden, wer hinter dem Profil steckt, aber ich erwarte nicht, dass der Troll mit der Sprache herausrückt und mir seinen Namen und seine Adresse verrät. Die Antwort kommt sofort.
DUHÄTTESTMICHRETTENKÖNNEN
Mich? Soll das heißen – Evie?
DUHÄTTESTMICHRETTENKÖNNENDUHÄTTESTMICHRETTENKÖNNENDUHÄTTESTMICHRETTENKÖNNENDUHÄTTESTMICHRETTENKÖNNENDUHÄTTESTMICHRETTENKÖNNENDUHÄTTESTMICHRETTENKÖNNENDUHÄTTESTMICHRETTENKÖNNEN
So geht es immer weiter, bis ich das Evie-Profil aufrufe und auf Blockieren klicke.
Kapitel 8
Evie
Klaviermusik aus der Empfangshalle unten tönte zu Evies Zimmer hinauf. Die Party hatte begonnen. Diesen Teil von Mamas und Papas Partys hatte Evie am liebsten, wenn die Gäste eintrafen, alle prachtvoll gekleidet, die Frauen wie schimmernde Engel, die Männer so attraktiv in ihren schönen Anzügen. Je weiter der Abend fortschritt, desto mehr begannen die Blumen zu verwelken, und die Schwäne erinnerten eher an hässliche Entlein, wenn das Make-up verblasste und die Augen glasig wurden. Die Stimmen wurden lauter, und alle wirkten ein klein wenig realer und einen Hauch weniger ansprechend. Doch für den Moment, solange die Masken noch nicht verrutschten, waren sie alle ätherisch.
Evie hatte jahrelang heimlich die Partys ihrer Eltern beobachtet und festgestellt, dass sie sehen konnte, wie die eintreffenden Gäste aus der Empfangshalle in den Ballsaal geleitet wurden, wenn sie sich in ihrem Zimmer auf den Boden legte und die Tür einen Spalt weit öffnete.
Gesichter, die sie aus dem Fernsehen und aus Zeitungen kannte, wurden von Papa wie alte Freunde begrüßt, und Evie sehnte sich danach, in ihrem schönsten Abendkleid an seiner Seite zu stehen, um auf die Wange geküsst und als das hübscheste Mädchen im Raum bezeichnet zu werden. Aber sie musste sich noch eine Weile gedulden, bevor sie sich hinunterschleichen konnte – das ging erst, wenn Papa vollauf mit seinen »Gästen« beschäftigt war. Also lag sie erst mal flach auf dem Bauch, verfolgte das Eintreffen der Gäste und wartete auf ihre Chance, um nach unten huschen und sich umsehen zu können.
Ihre Mutter sprach das Wort »Gäste« immer so aus, als sei es ein böses Wort, als hinterließe es bei ihr einen unangenehmen Geschmack im Mund, aber das bildete Evie sich sicher nur ein, denn ihre Eltern mochten doch ihre Gäste, oder? Warum sollten sie sie sonst zu einer Party einladen? Aber vielleicht war es ja wie bei Evies Geburtstagsfeier, zu der sie die ganze Klasse eingeladen hatte, obwohl ein paar der Jungs ein bisschen gemein und grob waren, doch sie konnte den Gedanken nicht ertragen, irgendjemanden auszugrenzen – nicht wenn der Rest der Klasse noch wochenlang darüber reden würde. Also mochte Mama vielleicht insgeheim ein paar der Gäste nicht, wollte allerdings nicht, dass sie sich ausgeschlossen fühlten.
Als das Haus so voll war, dass sicher niemand sie bemerken würde, schlüpfte sie in den Ballsaal und hielt sofort nach Papa Ausschau. Sie konnte ihn nirgends entdecken; er war immer so beschäftigt bei diesen Partys, dass es ihr fast immer gelang, ihm aus dem Weg zu gehen.
Endlich hatte sie Gelegenheit, sich im Ballsaal umzusehen. Es war magisch. Tagsüber war der Raum zu groß und zu leer, es machte keinen Spaß, sich darin aufzuhalten. Ihre Stimme hallte wider, und es war immer ein wenig zu kühl. Doch heute Abend war es nicht kalt. Alles schimmerte, war in goldenes Licht getaucht. Tische und Stühle mit cremefarbener Seide und goldenen Schleifen, mit Federn geschmückte Tafelaufsätze, Spiegel und Perlen. Am Flügel in der Ecke saß ein Mann und spielte. Evie kannte ihn, er hieß Serge und war extra aus Frankreich gekommen. Sie war ihm schon einige Male begegnet, und zuerst hatte er ihr ein bisschen Angst gemacht mit seinem wilden lockigen Haar und dem Mund und der Nase, die zu groß für sein Gesicht waren. Und immer zog er an irgendeiner furchtbaren Zigarette. Aber er war nett zu ihr gewesen, hatte sie geneckt und ihr übers Haar gestrichen und ihr vorgesungen, und jetzt freute sie sich immer auf seine Besuche. Mama allerdings nicht, sie schien immer leicht genervt von ihm zu sein. Evie hatte gehört, dass sie ihn einmal als »verdammte Belastung« bezeichnet hatte. Papa hatte nur gelächelt und erwidert: »Du weißt, warum er solche Sachen macht, Monique. Und es funktioniert, die ganze Welt kennt seinen Namen.« Am liebsten wäre Evie zu ihm hingegangen, doch Papa würde sie sicher wieder nach oben schicken, wenn sie sich zu dem Musiker gesellte, der bereits eine Frau auf seinem Schoß sitzen hatte und eine Zigarre von der Größe einer zusammengerollten Zeitung rauchte.
Evie glitt durch die Menge, praktisch unbemerkt in einem Meer von Champagnertrinkern, von denen einige sich zur Musik wiegten, während andere sich laut und angeregt unterhielten und den Champagner so hastig hinunterkippten, dass er überschäumte und auf den blank polierten Parkettboden spritzte. Dort hinterließ er klebrige Spuren, die das extra angeheuerte Putzpersonal morgen würde beseitigen müssen. Auf der Terrasse hatten sich weitere Gäste versammelt, um unter dem wachsamen Auge des Mondes Zigaretten und Zigarren zu rauchen.
Im Garten saß ein Junge, vielleicht ein paar Jahre älter als Evie, unter einer Eiche und spielte ruhig vor sich hin. Er trug eine beigefarbene Hose und ein weißes Leinenhemd und hatte den Blick auf den Spielzeugsoldaten gerichtet, den er in der Hand hielt. Dunkle Locken fielen ihm in die Augen; Evie konnte nicht erkennen, welche Farbe sie hatten, aber sie stellte sich vor, dass sie intensiv grün waren, genau wie ihre Augen. Sein Gesicht war gebräunt, die Stirn konzentriert in Falten gezogen. Abgesehen von ihrem Vater war er der schönste Junge, den sie je gesehen hatte.
Unvermittelt blickte der Junge auf, und ihr blieb keine Zeit mehr, den Blick abzuwenden. Er entdeckte sie, hob die Hand und winkte. Sie überlegte, ob sie zurückwinken sollte, aber ihre Hand rührte sich nicht. Er lud sie mit einer Geste ein, näher zu kommen, zu ihm unter den Baum, und sie zwang ihre Beine, sich vorwärtszubewegen. Ihr Herz hämmerte. Wie sollte sie mit ihm sprechen? Was, wenn sie irgendwas Dummes sagte und er sie auslachte?
Evelyn Rousseau, wenn jemand dich auslacht, ist das kein Mensch, auf dessen Meinung du Wert legen solltest, sagte Papas Stimme in ihrem Kopf. Aber trotzdem würde es ihr etwas ausmachen, wenn dieser Junge lachte, sogar sehr, wie es schien.
»Hallo«, sagte er, als sie bei ihm angelangt war. »Wer bist du denn?«
Evie sah, dass seine Augen nicht grün waren wie die ihren, sondern von einem klaren Kornblumenblau, wie der Ozean an einem windstillen Tag. Fast hätte sie vergessen zu antworten.
»Evie«, sagte sie schließlich. »Und wer bist du?«
»James Preston-Addlington junior«, sagte er wie jemand, der sich gewohnheitsmäßig mit vollem Namen vorstellte. »Mein Vater ist James Addlington, und meine Mutter heißt Daphne Preston. Wer sind deine Eltern? Und warum bist du im Schlafanzug?«
Evie zögerte. Sie wusste, wenn sie die Wahrheit sagte, wäre der Junge höchstwahrscheinlich tief beeindruckt, schließlich war es ihre Party, auf der er sich befand, ihr Baum, unter dem er spielte. Aber Papa hatte ihr ausdrücklich verboten, zur Party zu gehen. Wenn dieser Junge plauderte, könnte sie ernste Schwierigkeiten kriegen.
»Meine Mutter arbeitet hier in der Küche«, log sie. Es fiel ihr ganz leicht. Solange sie denken konnte, hatte sie Mama das tun sehen; solange man etwas mit Zuversicht vorbrachte, glaubten die meisten Leute alles. Und wenn es schwierige Fragen zu beantworten gab, reichte ein schlichtes »Oh, Darling, spielt das eine Rolle?« normalerweise aus.
»Solltest du hier draußen bei den Gästen sein?« Sein Tonfall war irgendwie unhöflich. Evie spürte, wie sie trotzig das Kinn hob, obwohl sie doch vorgehabt hatte, einen guten Eindruck zu machen.
»Warum denn nicht?«
Der Junge sah aus, als hätte man ihn auf dem falschen Fuß erwischt, als hätte er nicht erwartet, herausgefordert zu werden, oder vielleicht auch deshalb, weil die Antwort so offensichtlich war.
»Na, weil du zur Küchenhilfe gehörst.« Er zuckte die Achseln. »Du solltest nicht hier draußen bei den richtigen Gästen sein. Du solltest in der Küche sein.«
»Ich wüsste nicht, warum«, erwiderte Evie gekränkt. Sie hatte fast vergessen, dass sie nicht wirklich die Tochter einer Küchenhilfe war. »Ich arbeite schließlich nicht hier.«
»Schau mal.« Der Junge lächelte leutselig. Noch vor fünf Minuten hätte Evie gesagt, dass ihn das noch schöner machte. Jetzt fand sie, es war ein arrogantes Lächeln, das sie nur zu gern von seinem aparten – nein, überheblich wirkenden – Gesicht gewischt hätte. »Ich will nicht unhöflich sein. Ich lasse dich bloß wissen, für den Fall, dass es dir neu sein sollte, dass es bei solchen Anlässen eine bestimmte Etikette gibt. Die Gäste sind hier draußen, und die Küchenhilfen bleiben da drinnen.« Er wies auf das Haus. »In der Küche, außer Sicht. Es sei denn, sie servieren Getränke und Ähnliches, aber dann sollten sie adrett aussehen. Sie tragen keinen Schlafanzug, und sie sollten nicht mit den Gästen reden. Ich versuche nur, dir zu helfen.«
Mit ihren sieben Jahren war Evie gut genug erzogen, um zu wissen, was Etikette war. Das hieß, man sollte immer Bitte und Danke sagen, sich nicht die Nase am Ärmel abwischen, wenn man in Gesellschaft war, lächeln, wenn jemand einen Witz zu machen versuchte, selbst wenn er gar nicht lustig war, und niemals, auf gar keinen Fall, vor Erwachsenen »verdammte Scheiße« sagen. Aber niemals hatte sie Mama oder Papa sagen hören, dass das Küchenpersonal in der Küche zu bleiben hatte oder nicht mit den Gästen sprechen durfte. Du liebe Güte, Yasmin gehörte praktisch zur Familie!
»Aber, aber … das Küchenpersonal, das sind doch ganz normale Leute, so wie du und ich.«
James Preston-Addlington junior lächelte wieder, und diesmal musste Evie ihre Hand festhalten, um ihm keine zu scheuern.
»Selbstverständlich. Ich behaupte nicht, dass sie das nicht sind. Sie sollten bloß ihren Platz kennen, genau wie alle anderen auch. Ich kenne meinen Platz, und du solltest deinen kennen. Es können nicht alle gleich sein, oder? Manche Leute sind eben bessergestellt. Das zu sagen ist nicht unhöflich.«
»Doch, das ist es, verdammt noch mal!«, rief Evie aus und vergaß dabei die Regel über die Schimpfwörter und die Regel, dass man nie die Stimme erheben sollte. »Du verhältst dich wie, wie –« sie rang um ein Wort, das stark genug war – »ein Bastard!«
Der Junge hob eine Hand und legte sie an seine Wange, als hätte Evie ihn geschlagen. Aber er erholte sich schnell und nickte.
»Siehst du, was ich meine? Küchenhilfen haben in der gehobenen Gesellschaft nichts verloren. Du verschwindest besser, sonst sorge ich dafür, dass deine Mutter gefeuert wird wegen dem, was du gerade zu mir gesagt hast.«
Evie konnte kaum sprechen, so wütend war sie. Sie wünschte, dieser grässliche Junge würde nach seinem Vater rufen, denn dann würde ihnen klar werden, wer sie war, und sie konnte ihn rauswerfen lassen. Aber, wurde ihr niedergeschlagen klar, was würde sie damit beweisen? Dass sie nur deshalb ein wertvoller Mensch war, weil ihr Vater Dominic Rousseau hieß und sie nicht die Tochter einer Küchenhilfe war? Die Feier war für sie verdorben. Sie drehte sich auf dem Absatz um, stürmte zurück ins Haus und nach oben in ihr Zimmer, ohne sich in der Küche ihre warme Milch geben zu lassen.
*
Vor Zorn weinte sie bitterlich, als es ganz leicht an ihre Tür klopfte.
»Du warst heute unten auf der Party, Evelyn Rousseau?«
Evie riss die Augen auf, dann blickte sie zu Boden. Die Katze war also aus dem Sack. Sie nickte und wartete auf das Donnerwetter.
Ihr Vater legte einen Finger unter ihr Kinn und hob ihr Gesicht an, sodass sie ihn ansehen musste.
»Was habe ich erwartet? Ich habe eine starke, unabhängige junge Dame großgezogen, also sollte es mich nicht überraschen, wenn sie auch mal ungehorsam ist.«
Evie dachte an die Party, an diesen grässlichen Jungen, der sie dazu gebracht hatte, sich so schlecht zu fühlen, und begann wieder zu schluchzen. Papa machte ein schockiertes Gesicht und zog sie an seine Brust.
»Ach, Evie, Spatz, was ist denn los? Was habe ich gesagt? Achte nicht auf mich, ich habe doch keine Ahnung davon, worauf Frauen empfindlich reagieren. Frag deine Mutter. Ich bin sicher, sie hat einen ganzen Aktenordner, in dem genau aufgeführt ist, was ich alles Dummes zu ihr gesagt habe.«
»Es liegt nicht an dir, Papa«, brachte Evie unter Schluchzern hervor. »Da war ein Junge auf der Party.«
»Autsch. Jungs, jetzt schon?« Dominic Rousseau hielt seine Tochter auf Armeslänge von sich ab. »Ich muss zugeben, ich dachte eigentlich, ich hätte noch ein paar Jahre Zeit, bevor ich mich mit diesem speziellen Problem befassen muss. Also sag, Spatz, wie lautet der Name des Jungen, den ich umbringen lassen soll?«
Evie lächelte und wischte sich die Tränen mit dem bereits ziemlich schmuddeligen Ärmel ab. »Papa!«
»Na schön, ich werde ihn nur von Phillip verprügeln lassen. Nein?« Er riss die Augen auf, und Evie lachte. »Also sag mir, was soll ein Vater denn machen, wenn ein Junge seine kleine Prinzessin zum Weinen bringt? Was hat er dir angetan, mein Engelchen?«
»Er hat gemeine Sachen gesagt.«
»Über das schönste Mädchen der Welt? Was könnte er da schon sagen?«
»Es ging nicht um mich, Papa.« Evie seufzte ungeduldig. »Er dachte, ich wäre die Tochter einer Küchenhilfe.«
»Und warum sollte er das annehmen?«
»Weil ich es ihm erzählt habe«, murmelte Evie und hob trotzig das Kinn. »Und er hat gesagt, ich hätte kein Recht, mich unter …« Sie versuchte, sich an den Wortlaut zu erinnern. »… die gehobene Gesellschaft zu mischen. Unter wichtige Personen.«
Dominic kräuselte amüsiert die Lippen. »Und warum macht dich das so traurig, Evie? Du weiß, du bist nicht die Tochter einer Küchenhilfe. Du weißt, wer du bist.«
»Aber, Papa, was er gesagt hat … Glaubst du, dass es stimmt? Glaubst du, ich wäre weniger wichtig, wenn du und Mama in der Küche helfen würdet? Wäre ich dann weniger wert?«
Nun lächelte ihr Vater wirklich, und Evie spürte neue Wut in sich aufsteigen, jetzt über ihn.
»Du solltest mich ernst nehmen, Papa.«