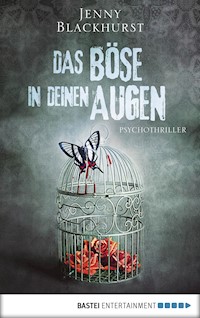9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Lauras beschauliches Leben endet jäh, als die Nachricht von einem Skelettfund in Kanada schreckliche Erinnerungen wachruft: Vor 15 Jahren wollte die damals Zwanzigjährige gemeinsam mit einer Wandergruppe den legendären West Coast Trail bezwingen. Doch der Jugendtraum wird zum Albtraum, als sie eines Nachts mitansehen muss, wie ihre Freundin Seraphine brutal ermordet wird. Beweisen kann sie die Tat nicht, denn die Leiche verschwindet anschließend spurlos. Wurde sie nun Jahre später endlich gefunden? Während die Polizei die Ermittlungen wiederaufnimmt, erhält Laura plötzlich rätselhafte Geschenke - Dinge, die einst Seraphine gehörten. Hat der Mörder von damals es nun auf sie abgesehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressum1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374EpilogÜber dieses Buch
Lauras beschauliches Leben endet jäh, als die Nachricht von einem Skelettfund in Kanada schreckliche Erinnerungen wachruft: Vor 15 Jahren wollte die damals Zwanzigjährige gemeinsam mit einer Wandergruppe den legendären West Coast Trail bezwingen. Doch der Jugendtraum wird zum Albtraum, als sie eines Nachts mitansehen muss, wie ihre Freundin Seraphine brutal ermordet wird. Beweisen kann sie die Tat nicht, denn die Leiche verschwindet anschließend spurlos. Wurde sie nun Jahre später endlich gefunden? Während die Polizei die Ermittlungen wiederaufnimmt, erhält Laura plötzlich rätselhafte Geschenke – Dinge, die einst Seraphine gehörten. Hat der Mörder von damals es nun auf sie abgesehen?
Über die Autorin
Jenny Blackhurst ist seit frühester Jugend ein großer Fan von Spannungsliteratur. Die Idee für einen eigenen Roman entwickelte sie nach der Geburt ihres ersten Kindes; inzwischen ist sie eine erfolgreiche Autorin, deren Thriller in mehreren Sprachen erscheinen und alle zu SPIEGEL-Bestsellern wurden. Die Autorin lebt mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern in Shropshire, England.
J e n n y B l a c k h u r s t
DERFINSTERE
PFAD
Eine FrauEine WanderungEine mörderische Falle
Aus dem Englischen vonAnke Angela Grube
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2022 by Jenny Blackhurst
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Arno Hoven, Düsseldorf
Titelillustration: © Alexandre Cappellari /Arcangel; © Ruslan Suseynov/Shutterstock; © Pakhnyushchy/Shutterstock; © cherezoff/Shutterstock; © Ungar-Biewer/Shutterstock; © nani888/Shutterstock; © Al Kelly/Shutterstock
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-2123-3
luebbe.de
lesejury.de
1
Samstag, 27. November
Drei Wörter – mehr war nicht nötig, um mein Leben ein zweites Mal zu ruinieren.
Menschliche Überreste gefunden …
Es ist ein Samstag, ein besonders ungelegener Tag für die Zerstörung meines Lebens, weil ich meine beiden Kinder bei mir habe. Die siebenjährige Faye und der vierjährige George sitzen auf dem Rücksitz und streiten sich darüber, ob der rotnasige Mr Tumble ein Dummi ist. Ich will gerade nach einem Wendemanöver rückwärts in den letzten Eltern-Kind-Parkplatz – Treffer! – bei Asda setzen, als ein schwarzer Mercedes an mir vorbeizieht und in die Parklücke fährt. Ich trete heftig auf die Bremsen und lasse das Autofenster herunter, als der Fahrer des Mercedes herausspringt, ohne Kind und frei von Gewissensbissen, und auf den Schlüssel drückt, um das Auto abzuschließen. Ich lehne mich aus dem Fenster und winke.
»Entschuldigen Sie, aber ich war gerade dabei, in diese Parklücke zu fahren«, sage ich, falls er aus irgendeinem Grund nicht in der Lage ist, meinen silberfarbenen Nissan zu sehen, der jetzt allen anderen den Weg versperrt. Ein weiteres Auto hält an und wartet darauf, dass ich die Durchfahrt räume, aber die Leute werden eben ausharren müssen.
»Machen Sie sich deswegen keine Gedanken«, entgegnet der Mercedesfahrer, ein großer Mann mittleren Alters. Er trägt einen Anzug, der seinen Bierbauch nur unzureichend kaschiert, und ist kahl geschoren. Vermutlich hofft er, damit seinen zurückweichenden Haaransatz verbergen zu können. Er hat die Art Ganzjahresbräune, die »Urlaub am Mittelmeer« verkünden soll, aber stattdessen »dreimal wöchentlich im Sonnenstudio« herausschreit.
»Das ist nicht so gemeint gewesen, dass ich mich entschuldigen will.« Ich öffne die Autotür, steige aus und ignoriere die Frau im wartenden Wagen, die angefangen hat, hektisch zu gestikulieren. »Ich wollte darauf hinweisen, dass dies meine Parklücke ist. Und Sie haben nicht mal Kinder. Das hier ist ein Eltern-Kind-Parkplatz.«
Er mustert mich, als wäre ich ein hartnäckiger Moskito, und – ich schwöre es – ich kann tatsächlich spüren, wie mein Blut zu kochen beginnt. »Ich habe Kinder«, erklärt er. »Ich habe sie nur nicht dabei. Und ich habe die Parklücke zuerst erreicht. Das sehen Sie doch wohl, schließlich steht mein Auto hier, oder?«
»Aber ich war gerade dabei –«, setze ich an.
»Aber Sie haben es nicht getan«, unterbricht er mich mit aufreizend leiser, gelassener Stimme. »Also steigen Sie wieder ein, und suchen Sie sich einen anderen Parkplatz. Sie halten ja den ganzen Betrieb auf. Ein höchst egoistisches Verhalten.« Damit stolziert er in Richtung Supermarkt davon. Ich schaue ihm fassungslos hinterher.
»Mein Verhalten soll egoistisch sein?!«, brülle ich hinter ihm her. »Ich – und egoistisch? Asoziales Arschloch!«
Einer der Fahrer in der Schlange drückt heftig auf die Hupe. Ich stoße die Luft aus und steige wieder ein, feuerrot im Gesicht. Ich drehe das Steuer herum und fahre an der Schlange der wartenden Autos vorbei, eine Hand in einer beschwichtigenden Geste erhoben.
»Das war ein Schimpfwort, Mummy«, sagt Faye mit allerliebster Stimme. »Du musst einen Penny einzahlen.«
Der nächste freie Parkplatz, den ich entdecke, ist einen gefühlten Kilometer vom Haupteingang des Supermarkts entfernt, aber wenigstens grenzt er an eine Bordsteinkante, sodass ich die Autotür weit genug öffnen kann, um George herauszuheben, ohne andere parkende Wagen zu beschädigen. Danach verschließe ich den Nissan mit der Zentralverrieglung und lasse den Schlüsselring so in die Handfläche gleiten, dass der Schlüssel zwischen den Fingern herausragt. Gleiches tat ich schon in meiner Jugendzeit, wenn ich nach Einbruch der Dunkelheit noch unterwegs sein musste. Das hat meine Mutter mir beigebracht, die zu sagen pflegte: Spiel nicht mit dem Handy herum, trag keine Kopfhörer, trink nicht zu viel, und wenn du überfallen wirst, ramm dem Angreifer den Schlüssel ins Auge. Die einzigen nützlichen Ratschläge, die sie mir je gegeben hat.
»Kommt, meine Süßen«, sage ich und nehme Georges Hand. Faye ergreift seine andere Hand, und wir eilen über den Parkplatz.
»Mummy, du machst einen Umweg«, beschwert sich Faye. »Der Eingang ist da drüben.«
»Ich hab noch was zu erledigen«, erkläre ich und steuere auf den schwarzen Mercedes zu. Als ich daran vorbeigehe, lasse ich den Ärmel meiner Strickjacke über die Hand fallen und ziehe den Schlüssel mehrere Zentimeter über den glänzenden schwarzen Lack. Ich drücke so fest zu, wie ich kann, und achte darauf, nicht nach unten auf den Schaden zu sehen, den ich gerade anrichte. Ein befriedigendes Kreischen ist zu vernehmen. Ich habe die Seite des Mercedes gewählt, die nicht von den Überwachungskameras erfasst wird, und werde mich nicht selbst als offenkundige Täterin entlarven, indem ich mich hinunterbeuge, um mein Werk zu begutachten. Der Kerl wird wissen, dass ich es war; das reicht mir. Unauffällig reibe ich mit dem Daumen die Lackreste vom Schlüssel und lasse ihn in die Tasche gleiten.
»Was hast du denn hier erledigen müssen, Mummy?«, fragt Faye einige Augenblicke später, die nichts von dem kleinen Racheakt mitbekommen hat, der von ihrer Mutter gerade begangen worden ist.
»Mummy musste jemandem zeigen, dass niemand sie behandeln kann wie den letzten Dreck«, antworte ich. »Ich selbst habe das vor langer Zeit gelernt – von jemandem, den ich mal kannte.«
Meine Protestaktion hat mir Auftrieb gegeben, und ich erledige rasch die Einkäufe. Faye und George benehmen sich mustergültig. Als ich wieder im Auto sitze, ist der Mercedes-Mann noch nicht zurück. Zwar bin ich ein wenig enttäuscht darüber, dass ich nicht sehen werde, was für ein Gesicht er macht, wenn er den Kratzer entdeckt. Doch sicher ist das nur zum Besten – noch eine wütende Auseinandersetzung vor den Kindern kann ich nicht brauchen.
»Mummy, können wir wieder die Filmmusik von der Eiskönigin hören?«, fragt Faye. Ich stöhne innerlich.
»Der CD-Player ist kaputt, tut mir leid, Süße«, lüge ich. »Daddy wird ihn nachher reparieren. Im Moment haben wir nur das Radio.«
»Geht es nicht auf deinem Handy?«
Ich halte mein Smartphone hoch, wie zum Beweis. »Der Akku ist leer.« Noch eine kleine Notlüge. Ich mache das Radio an, bevor Bluetooth sich automatisch einschaltet und mich verrät. Es ist der Lokalsender, und die Stimme meines Lieblingsmoderators lässt mich lächeln. Ihm zuzuhören ist immer so, als hielte man einen Plausch mit einem alten Freund.
»Das war Suspicious Minds vom King selbst, Elvis Presley. Ein Klassiker. Jetzt folgen die Elf-Uhr-Nachrichten mit Piper Brent. Guten Morgen, Piper!«
»Morgen, Jim! Das sind heute unsere Top-Themen. Umstrittene Parlamentsdebatte: Der Premierminister hat erklärt, er werde sich nicht für Kommentare entschuldigen, die er während der gestrigen Fragestunde im Unterhaus abgegeben hat. Er sagte, er habe mehr Beleidigungen eingesteckt als ausgeteilt. Die Opposition fordert seinen Rücktritt.«
»Keine Chance«, schnaube ich.
»Menschliche Überreste gefunden: Laut den zuständigen Stellen in Vancouver steht man kurz davor, die im September auf dem berühmten West Coast Trail gefundenen Skelettteile zu identifizieren. Noch ist unklar, ob es sich um die Leiche der vermissten britischen Rucksackreisenden Seraphine Cunningham handelt, und der Druck auf die kanadische Polizei wächst …«
Auf dem Rücksitz kreischen Faye und George, als wir voll auf den Waitrose-Lieferwagen vor uns auffahren.
2
27. Juli 1999 – Maisie
Als Maisie das Handy in ihrer Tasche summen hörte, wusste sie sofort, dass das ungute Gefühl, das sich den ganzen Morgen in ihr aufgebaut hatte, berechtigt gewesen war. Sie hatte recht gehabt. Tamsin würde nicht kommen.
Sie hätte es wissen müssen, als sie beim Flughafen ankam: Vor den Automatiktüren der Abflughalle war keine auf sie wartende Freundin, die hektisch an der letzten Zigarette vor dem zwölfstündigen Rauchverbot sog. Oder als sie die Halle betrat, um aus der Kälte herauszukommen, und sah, dass der Check-in-Schalter geöffnet war und keine laut redende Brünette die Warteschlange mit Geschichten über die »grauenhafteste Bahnfahrt aller Zeiten« unterhielt, die sie hinter sich hatte – oder über den »schlimmsten Taxifahrer überhaupt«. Bei Tamsin war immer alles der reinste Horror, ob es nun um eine Mitbewohnerin ging oder ihren derzeitigen Freund oder … Maisie zog ihr Handy hervor und las die SMS.
Tut mir ja SOOOO leid! Die Woche war höllisch. Harry sagt, wenn ich nach Vancouver fliege, ist es aus mit uns, und das kann ich einfach nicht riskieren, Süße. Das verstehst du doch, oder?
Sie ließ das Handy wieder in die Handtasche gleiten. Sie machte sich nicht mal die Mühe, auf die SMS zu antworten. Tamsin würde kaum neben dem Telefon sitzen und gespannt auf die Mitteilung warten, dass Maisie ihr verzieh. Wahrscheinlich vögelte sie in genau diesem Moment mit dem wunderbaren Harry, den sie auf gar keinen Fall verlieren wollte. Es wäre Maisie ja egal … Aber sie wusste nur zu genau, dass Tamsin vor weniger als einem Monat von einem gewissen Kent noch völlig hin und weg gewesen war; Harry stellte also ein komplett neues Unterfangen dar.
Was sollte sie jetzt machen? So wenig überraschend es kam, dass Tamsin sie im Stich gelassen hatte … Doch Maisie hatte wirklich geglaubt, dass sie diese »Reise ihres Lebens« zusammen antreten würden. Es war nicht mal so, als sollte die Reise den ganzen Sommer dauern – mit Hin- und Rückflug waren es nur zehn Tage. Nur zehn Tage für beste Freundinnen aus Kindheitstagen, die sich ein Jahr nicht gesehen hatten, weil Tamsin in einer anderen Stadt studierte. Aber nein, der derzeitige Lover war wichtiger. Und was es noch schlimmer machte, viel schlimmer, war, dass ihre Mutter sie genau davor gewarnt hatte.
»Sie wird dich im Stich lassen, dieses Mädchen. Das tut sie doch immer.«
Es war kein Trost für Maisie, dass ihre Mutter recht behalten hatte. Sie hatte das nur gesagt, weil sie den Gedanken nicht ertragen konnte, sich zehn Tage lang allein um ihre restlichen Kinder kümmern zu müssen, ihnen Abendbrot zuzubereiten und ihre Betten zu machen. Es passte ihr sehr gut in den Kram, dass Maisies Freundinnen alle Unis in anderen Städten besuchten. Das bedeutete, dass Maisie allein zu Hause saß und nur ein paar Kolleginnen von ihrem Job im Café hatte, mit denen sie abends mal weggehen konnte.
Sie blickte hoch zur Abflugtafel. Es war noch Zeit zum Einchecken, sie konnte aber auch kehrtmachen und wieder nach Hause fahren. Nach Hause, wo sie sich mit ihren neunzehn Jahren ein Zimmer teilen musste, wo sie morgens um fünf mit ihrer vierjährigen Schwester aufwachte, weil das Baby ihre Mutter die ganze Nacht wach gehalten hatte. Nach Hause, wo sie mehr Windeln gewechselt hatte, als man vernünftigerweise von einer Neunzehnjährigen erwarten konnte, die noch nicht ein einziges Mal Sex gehabt hatte. Auf dieser Reise wollte sie einmal der Verantwortung entkommen, die ihr aufgebürdet worden war.
Aber sie hatte so etwas noch nie alleine gemacht. Sie hätte diese Reise überhaupt nie gebucht, wäre sie nicht von Tamsin angefleht worden, mit ihr zu reisen.
»Wir haben uns doch ewig nicht gesehen, Mase«, hatte sie einschmeichelnd gejammert. »Das wird die Reise unseres Lebens! Du und ich, wieder vereint; beste Freundinnen.«
Und Maisie war darauf hereingefallen, weil sie sich gebauchpinselt gefühlt hatte. Schließlich hätte Tamsin ja eine ihrer feinen neuen Freundinnen von der Uni fragen können, aber stattdessen hatte sie Maisie aufgefordert. Zu spät wurde ihr jetzt klar, dass diese Uni-Freundinnen Tamsin vermutlich längst durchschaut hatten, ganz im Gegensatz zu ihr, Maisie. Aber das stimmte nicht so ganz, oder? Sie hatte gewusst, wie ihre beste Freundin war, seit Tamsin sie mit dreizehn allein in der Stadt zurückgelassen hatte. Nachdem Tamsin auch das für die Rückfahrt mit dem Bus vorgesehene Geld verbraten hatte, war sie zu einer Gruppe Jungs ins Auto gestiegen.
»Ist nur noch ein Platz frei«, hatte sie gesagt und sich in den Wagen reingequetscht. »Du kommst doch zurecht, nicht wahr?«
Maisies Handy summte erneut, und fast hätte sie es ignoriert. Sie stellte sich vor, wie sie oben in der Luft die Tür des Flugzeugs öffnete, das Handy hinauswarf und zusah, wie es mit den Nummern sämtlicher Freunde und Bekannten ins Meer stürzte. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie zum letzten Mal froh über eine SMS gewesen war, wann dieses Summen ihr Herz hatte höherschlagen lassen, anstatt sie zu beunruhigen und zu erschrecken. Sie gab nach und zog das Telefon aus der Tasche. Die SMS war von ihrer vierzehnjährigen Schwester.
Hast du Geld dagelassen? Mum hat schon wieder die Waschmaschine überladen, und jetzt ist sie kaputt.
Ohne einen weiteren Gedanken schaltete Maisie das Handy aus, griff nach ihrem Rucksack und ging zum Check-in-Schalter.
3
Samstag, 27. November
»Nein, uns geht’s gut, ehrlich«, versichere ich, gefühlt zum tausendsten Mal. »Danke.«
Der Fahrer des Waitrose-Lieferwagens, ein junger Kerl, vielleicht Anfang zwanzig, scheint wie gelähmt vor Schreck, obwohl ich es war, die ihm hinten reingefahren bin. »Sind Sie sicher? Die Kinder sind ziemlich durcheinander, und es war ein heftiger Aufprall. Soll ich nicht doch jemanden für Sie anrufen? Oder einen Rettungswagen?«
»Nein.« Ich schüttle den Kopf. »Vielen Dank, aber uns geht’s gut. Ein Rettungswagen wäre übertrieben. Ich rufe meinen Mann an; der wird uns abholen. Uns geht’s gut, ehrlich.«
Er wirkt erleichtert bei der Erwähnung eines Mannes, der zur Rettung herbeieilen wird, und nickt. »Na gut, wenn Sie sicher sind. Ich ruf nur kurz meinen Chef an und frage, ob ich noch irgendwas tun muss. Und … Oh, warten Sie.« Er stiefelt zur Seitentür des Lieferwagens, und ich verdrehe ungeduldig die Augen.
Er könnte jetzt wirklich mal verschwinden. Ich habe das Auto an den Straßenrand gefahren und die Polizei über den Auffahrunfall verständigt, damit sie nach herumliegenden Gegenständen auf der Fahrbahn suchen kann, ich habe die Werkstatt angerufen, damit der Nissan abgeschleppt wird, und mit einer App ein Taxi bestellt.
Der wie ein Junge wirkende Mann taucht wieder auf, zwei Eislutscher in der Hand. »Die waren auf der Ersatzliste, und die letzte Kundin wollte sie nicht. Hier, für die Kinder. Gegen den Schock.«
Sofort habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich dem Fahrer in Gedanken mitgeteilt habe, er solle sich endlich verpissen. »Danke«, sage ich und nehme die Eislutscher entgegen. Ich öffne die Tür und beuge mich ins Auto. Faye hat aufgehört zu schreien, und die beiden Kinder sehen mich entsetzt und mit weit aufgerissenen Augen an.
»Müssen wir jetzt ins Gefängnis?«, flüstert Faye.
Menschliche Überreste.
Ich zwinge mich zu einem Lächeln. »Nein, mein Schatz, das war ein Unfall. Das Eis ist von dem netten Mann, für euch. Ihr könnt es essen, während wir auf das Taxi warten.«
»Aber du hast gesagt, du willst Daddy anrufen«, sagt Faye. »Ich will, dass Daddy kommt.«
»Will Daddy«, plappert George ihr nach. Er bringt sein halbes Leben damit zu, einfach zu wiederholen, was seine ältere Schwester spricht.
Ich zögere. Natürlich könnte ich Rob anrufen; er würde sofort herkommen und uns abholen. Aber Tatsache ist, dass ich mich bereits um alles gekümmert habe. Ich brauche ihn hier nicht.
»Wir müssen ihn deswegen nicht auf der Arbeit stören«, antworte ich. »Es sei denn, du willst nicht, dass er genug Geld verdient, um dir dieses Riesentrampolin zum Geburtstag zu schenken.«
Faye grinst breit. Ihr Gesicht ist inzwischen gelb und klebrig vom Eislutscher, und alle Gedanken an den Unfall und ein Telefonat mit Daddy sind vergessen.
»Wir brauchen Daddy nicht, Georgy«, erklärt sie ihrem Bruder. »Mummy hat alles im Griff. Wir wollen doch das Trampolin, oder?«
Alles im Griff. Das habe ich auch geglaubt, Kleine, denke ich. Aber jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Während wir auf das Taxi warten, gebe ich »West Coast Trail, Leichenfund« bei Google ein.
Den ganzen Oktober waren die Nachrichten voll davon. Wie konnte mir das nur entgehen? Ich muss blind gewesen sein. Die menschlichen Überreste wurden ungefähr fünf Kilometer von der Küste entfernt entdeckt, am Cribs Creek, und man vermutete, dass es sich um Leichenteile der britischen Rucksackreisenden Seraphine Cunningham handelte. Sie hatte im Juli 1999 eine Wanderung auf dem berühmten West Coast Trail unternommen, als sie von ihrer Trekkingpartnerin und Freundin, der Britin Maisie Goodwin, als vermisst gemeldet worden war.
Danach folgen noch ein paar kleinere Artikel, in denen aber nichts Bedeutsames steht. Heute jedoch hat die Polizei bekannt gegeben, dass die Untersuchungen fast abgeschlossen seien und eine endgültige Identifizierung bald erwartet werde.
Jetzt ist es so weit. Ich habe so hart daran gearbeitet, die Vergangenheit hinter mir zu lassen, und nun wird alles wieder an die Oberfläche gezerrt.
Niemand weiß, wer du jetzt bist, beharrt die Stimme in meinem Kopf. Niemand außer dir. Es muss doch gar nichts rauskommen. Es ist zwanzig Jahre her. Keinerlei Spuren werden zurückgeblieben sein. Du wirst nicht ins Gefängnis gehen.
Bei diesem Gedanken steigt mir ein saures Brennen den Hals hoch, und ich presse die Hand auf den Mund. Ich kann nicht ins Gefängnis gehen. Nicht jetzt, wo ich Faye und George habe – und Rob. Ich habe jetzt ein schönes Leben, eine Familie. Damals hatte ich nichts zu verlieren. Vielleicht hätte ich gleich gestehen, die Strafe auf mich nehmen und sie absitzen sollen. Aber dann hätte ich Rob nie kennengelernt, und die Kinder wären nie geboren worden. Alles, was ich habe, habe ich wegen der Lügen, die ich damals erzählte. Und wenn ich meine Kinder ansehe, weiß ich, dass ich es wieder tun würde, sollte dies nötig sein. Ich würde alles tun, um das Leben zu verteidigen, das ich mir aufgebaut habe. Sogar töten. Schließlich habe ich das schon einmal getan.
4
27. Juli 1999 – Maisie
Maisie hatte erwartet, in Panik zu geraten, sobald sie in den Flieger steigen und es kein Zurück mehr geben würde, aber alles, was sie empfand, war ein Gefühl tiefen Friedens. Erst dann wurde ihr eines klar: Ihr Stress war hauptsächlich durch das Wissen ausgelöst worden, dass Tamsin sie irgendwann im Stich lassen würde, auch wenn sie sich das nicht hatte eingestehen wollen. Zugegeben, sie hätte nicht gedacht, dass es gleich am Flughafen passieren würde. Aber wie viele Jahre hatte sie damit zugebracht, Entschuldigungen für das Verhalten ihrer besten Freundin zu finden, und wie viele ihrer Erinnerungen waren von Tamsins Egoismus getrübt worden? Jetzt würde Maisie jedenfalls nicht hinter irgendeinem Jungen herlatschen müssen, in den ihre beste Freundin gerade verknallt war, oder mehr als zwanzig Kilometer extra laufen, nur damit Tamsin irgendeinem Harry eine SMS schicken konnte. Das war ein so befreiender Gedanke, dass Maisie friedlich einschlummerte, sobald das Flugzeug abgehoben hatte. Seit sie angefangen hatten, die Reise zu planen, hatte sie nächtelang wach gelegen und sich Sorgen gemacht: Wie sollten ihre Schwestern mit dem zunehmend sprunghaften Verhalten der Mutter klarkommen? Würde Tamsin dafür sorgen, dass sie verhaftet wurden oder sich verirrten? Aber nun war sie unterwegs, und nichts in der Welt unten war von Bedeutung. Zumindest für die neun Stunden Flug war sie frei von ihren Ketten.
Ein paar Stunden später erwachte sie mit verspanntem Nacken. Ihr Sitznachbar, ein Mann mittleren Alters, lächelte und bot ihr einen Bonbon an.
»Nein, vielen Dank«, sagte sie. »Ich hoffe, ich habe nicht geschnarcht.«
»Nicht so laut, dass die Leute in der vordersten Sitzreihe es gehört hätten«, meinte er und zwinkerte ihr zu.
Maisie sah’s mit Schaudern. Für solche Situationen wäre Tamsin immerhin nützlich gewesen: Sie hätte ihm mitgeteilt, er habe wohl etwas im Auge, oder sie wäre sichtbar zusammengeschaudert und hätte »Krass« gesagt. Aber Maisie lächelte nur verlegen, griff in die Tragetasche mit den Sachen, die sie am Flughafen gekauft hatte, und zog eine Zeitschrift hervor, was hoffentlich ein deutliches Signal für den Mann war.
Jetzt freute sie sich darüber, dass sie stets diejenige gewesen war, die alles Organisatorische erledigt hatte. Sie hatte Wanderkarten und Infos über den Trail besorgt, alle Reiseunterlagen waren auf ihren Namen gebucht, und sie hatte von allem Ausdrucke in ihrer Tasche. Wenn Tamsin ein wenig verlässlicher wäre oder man ihr zutrauen könnte, sich selbst um so etwas zu kümmern, hätte Maisie jetzt vielleicht gar nichts in der Hand. Andererseits, wenn Tamsin ein bisschen verlässlicher wäre, würde Maisie jetzt nicht die große »Freundinnenreise« allein antreten.
Als der Flieger zur Landung auf den Airport Vancouver International ansetzte, merkte Maisie, wie sie wieder nervös wurde. War sie verrückt, das allein durchzuziehen? Würde sie als Hauptfigur in Fernsehsendungen wie »Investigativ« oder »Spektakuläre Kriminalfälle« enden – oder als Suchbild auf einem Milchkarton? Sei nicht albern, wies sie sich zurecht und bereitete sich innerlich auf die Landung vor. Tausende von Leuten gehen diesen Wanderweg jedes Jahr. Es ist statistisch unwahrscheinlich, dass du von Bären gefressen wirst. Oder dass gruselige Bergbewohner dich umbringen, wie in einem dieser Slasher-Filme, die ihre Schwester so liebte. Oder …
»Hör auf damit«, murmelte sie, woraufhin ihr Sitznachbar sie anblickte. »Oh, ich meinte nicht Sie, tut mir leid.«
»Reisen Sie alleine?«, fragte er. Offensichtlich hatte er ihre Bemerkung als Gesprächsauftakt gewertet.
»Freunde holen mich vom Flughafen ab«, log sie. Er hob die Augenbrauen, als er ihren abweisenden Ton hörte, und wandte sich wieder seinem Handy zu. Der arme Kerl machte vermutlich nur ein bisschen Small Talk, und sie reagierte, als wäre er ein Serienkiller. Ihre Mutter hatte recht; sie musste wirklich dringend lockerer werden. Vielleicht würde das ja auf dieser Reise endlich passieren.
Der Blick vom Flughafen Vancouver International war schlichtweg atemberaubend. Maisie hatte das Gefühl, stundenlang aus den riesigen Panoramafenstern schauen und anschließend mit dem glücklichen Gefühl heimreisen zu können, die schönsten Aussichten gesehen zu haben, die sie je zu Gesicht bekommen würde. Sie hatte noch nicht viel von der Welt gesehen; sie kannte praktisch nur die Stadt in Yorkshire, in der sie aufgewachsen war. Zwar hatte es da noch die Fahrt nach Schottland zu ihrer sterbenden Großmutter gegeben, aber das konnte man wohl kaum als Urlaub betrachten. Als sie jetzt auf das glitzernde türkisblaue Wasser zur Linken und die schneebedeckten Berge zur Rechten blickte, wusste sie, dass es die richtige Entscheidung gewesen war, allein herzukommen.
Vom Sicherheitspersonal hatte sie erfahren, wo die Gepäckausgabe war und wo die Shuttlebusse und Taxis abfuhren. Das Abholen des Gepäcks war gefühlt die aufregendste und stressigste Erfahrung, die Maisie je gemacht hatte, und während sie darauf wartete, dass ihr riesiger Rucksack auf den runden Förderbändern an ihr vorbeikam, wurde ihr ganz übel vor erwartungsvoller Anspannung. Es war der letzte Teil ihrer Reise, bei dem sie in gewisser Weise »betreut« wurde; denn hier konnte sie sich an jemanden wenden, wenn ihr Gepäck nicht kam oder sie den Taxistand nicht fand. Sobald sie den Flughafen jedoch verließ, war sie auf sich allein gestellt. Sie hatte nicht damit gerechnet, wie schnell der Rucksack an ihr vorbeisausen würde oder wie viele Leute sich vordrängten, um zu überprüfen, ob ihr Name auf dem Schild stand. Wussten die denn nicht, wie ihr eigenes Gepäck aussah?
»Das ist meiner!« Sie versuchte, so laut wie möglich zu sprechen, aber niemand machte Anstalten, sie durchzulassen. »Entschuldigen Sie! Das ist mein Rucksack!«
Doch das Gepäckstück wurde weiterbefördert, zurück in die Dunkelheit, aus der es gekommen war, und Maisie musste weitere zehn Minuten warten, bevor es erneut auftauchte. Aber diesmal war sie vorbereitet. Sie stieß dem Mann neben ihr, der sich vorzubeugen begann, um das Schild auf dem Gepäck zu inspizieren, den Ellbogen in die Rippen und hievte den Rucksack vom Band. Dabei taumelte sie rückwärts, schlug dabei aber eine Schneise für sich und ihren Rucksack. Am liebsten hätte sie ein aufgeregtes Triumphgeschrei ausgestoßen. Sie hatte es geschafft! Sie hatte sich ihren Rucksack erkämpft und fühlte sich unbesiegbar.
5
Samstag, 27. November
Ich kann es nicht länger aufschieben, Rob anzurufen. Wenn er nach Hause kommt und sieht, dass mein Auto nicht in der Auffahrt steht, wird er Fragen stellen; und ich will ihm alles selbst berichten, bevor meine Plaudertasche von Tochter mich verpetzt.
»Er hat einfach gebremst, keine Ahnung, wieso«, sage ich. Meine Stimme bricht fast, was echt ist, da ich kurz davorstehe, in Tränen auszubrechen. Während der Taxifahrt konnte ich mich zusammenreißen. Aber nachdem ich die Kinder mit einem Snack versorgt hatte, setzte ich mich an die Kücheninsel, legte den Kopf auf die kalte Marmorplatte und versuchte, meine Gedanken davon abzuhalten, sich zu überstürzen und gegeneinanderzukrachen. Dennoch wollte ich nicht weinen … bis ich Robs Stimme hörte. Ich weiß nicht genau, ob ich wegen des Unfalls weine, wegen der Nachrichten oder über den Tod von jemandem, den ich vor zwanzig Jahren gekannt habe. Vielleicht alles zusammen.
»Hey, keine Sorge, die Versicherung regelt das schon.« Wie immer hat Rob einen beschwichtigenden Tonfall angeschlagen. Während ich in unserer Beziehung das Feuer bin, ist er das Eis – immer bereit, mich zu beruhigen, wenn ich aufbrause und mal wieder an die Decke gehe. Er hätte garantiert nie zugelassen, dass ich jemanden den Lack zerkratze, weil er mir einen Parkplatz vor der Nase weggeschnappt hat.
»Aber ich bin schuld, oder? Selbst wenn er unvermittelt gebremst hat … Es ist mein Fehler gewesen, dass ich ihm hinten reingefahren bin. Ich bin so eine Idiotin.«
»Hör auf damit, Lollypop.« Wenn er mich so nennt, komme ich mir vor wie ein Kind, und doch hat sein Kosename mir immer gefallen. Jetzt mehr denn je. Wenn er mich so nennt, fühle ich mich geborgen, geliebt – so, wie ich mich als Kind nie geliebt gefühlt habe. »Dafür ist die Kfz-Versicherung da. Weil Unfälle nun mal passieren. Sogar dir, Mrs Unzerstörbar. Geht es den Kindern gut?«
Auch das liebe ich an Rob, obwohl ich ihm das nie sagen könnte, weil es sich anhören würde, als wäre er ein furchtbarer Vater. Er stellt mich an die erste Stelle. Er liebt die Kinder, das kann jeder sehen, und er ist ein perfekter Vater – genau die Art Vater, die ich mir ausgesucht hätte, gäbe es hierbei eine Wahlmöglichkeit. Er spielt mit ihnen, bringt ihnen alles Mögliche bei, unternimmt viel mit ihnen. Er ist wahnsinnig geduldig, sehr viel mehr als ich. Aber trotzdem vermittelt er mir immer das Gefühl, dass ich für ihn an erster Stelle stehe. Ich weiß, dass ich ihm nicht das gleiche schöne Gefühl vermitteln kann; für mich kommen ganz klar die Kinder zuerst. Ohne zu zögern, würde ich mein Leben für sie geben – oder das meines Mannes. Rob hingegen würde unsere zwei Kinder gewiss mit seinem Leben verteidigen, doch ich weiß nicht genau, ob er auch mein Leben für das der beiden opfern würde. Keiner hat mich jemals so hoch geschätzt wie er. Und mit alldem wird es vorbei sein, wenn er die Wahrheit herausfindet und erfährt, was ich getan habe.
Ich hole tief Luft und nicke, obwohl ich weiß, dass er mich nicht sehen kann. Meine Augen stehen immer noch voller Tränen. »Den Kindern geht’s gut. Faye ist in ihrem Zimmer und kommandiert ihre Barbie-Puppen herum – ich glaube, sie tut so, als wäre sie eine Fitnesstrainerin. Und George guckt PAW Patrol: Helfer auf vier Pfoten im Wohnzimmer vorne.«
»Siehst du? Alles bestens. Hast du Schmerzen im Nacken? Ein Schleudertrauma womöglich? Hast du dir den Kopf gestoßen?«
»Nein, ich bin relativ langsam gefahren. Niemand wurde verletzt.«
»Na also. Alles gut.«
Was ich wirklich brauche, damit alles gut wird, sind Informationen. Wenn ich die habe, werde ich mich nicht mehr so ausgeliefert fühlen – und dann kann ich einen Plan detailliert ausarbeiten. Ist es zu früh dafür, Pläne zu machen? In diesem frühen Stadium an Flucht zu denken? Menschliche Überreste gefunden.
Nein. Diese Suchanfrage bei Google vorhin ist dumm von mir gewesen. Und mein Laptop kommt für so etwas nicht infrage; das darf auf keinen Fall in meinem Browser-Verlauf auftauchen. Ich werde ein Prepaidhandy brauchen, wenn ich mich auf dem neuesten Stand halten will. Die kanadischen Behörden sind zuständig, und ich werde Push-Benachrichtigungen für Eilmeldungen bei allen Zeitungen aus Vancouver aktivieren müssen. Ich kann fast spüren, wie meine Panik abebbt, während ich eine Liste von Dingen erstelle, die ich unternehmen kann, damit ich weiterhin alles unter Kontrolle habe.
Ich schnappe mir meine Handtasche und die Schlüssel, die auf der Arbeitsplatte liegen.
»Kinder!«, rufe ich im Wissen, dass sie meine Rufe zunächst ignorieren werden. »Faye! George!«
Ich stelle mich unten an die Treppe. »Faye Johnson! Hol deinen Bruder, wir müssen noch mal weg!«
Sie erscheint am obersten Treppenabsatz. »Wir sind doch eben erst nach Hause gekommen! Ich spiele gerade mit meinen Puppen. Außerdem hast du das Auto geschrottet.«
»Wir fahren mit dem Bus. Du fährst doch gerne Bus.«
Allein bei dem Gedanken, die Kinder an einem Samstagnachmittag in den Bus zu verfrachten, bekomme ich Kopfschmerzen, doch das Bedürfnis, mir irgendeine Art Kontrolle über die Situation zurückzuerobern, ist zu stark. Ich will nicht den ganzen Nachmittag die Versuchung unterdrücken müssen, nach belastenden Informationen auf meinem Smartphone zu googeln. Auf keinen Fall werde ich herumsitzen und zulassen, dass mein Leben zum zweiten Mal ruiniert wird.
In raschem Tempo gehen wir zur Bushaltestelle am Ende der Straße. Ich halte Georges kleine, pummelige Hand, und Faye, die sich langsamer bewegt, bleibt ein wenig zurück. Hoffentlich sieht uns niemand, während wir auf den Bus warten, und erkundigt sich, wo denn mein Auto ist. Das Lügen wäre kein Problem für mich, aber leider haben Rob und ich Kinder, die das ganz anders sehen. Faye würde mich ohne Zögern verpfeifen. Auch wenn es vermutlich nicht die geringste Rolle spielt, so vermute ich doch, dass die Nachricht aus dem Radio bereits angefangen hat, in mir zu arbeiten: Sie schottet mich von meinen Mitmenschen ab und löst in mir den Wunsch aus, mich zusammen mit meiner kleinen Familie in einen sicheren Kokon zurückzuziehen. Es hat begonnen, und ich muss die Lage unter Kontrolle bekommen, bevor die Polizei bei uns vor der Tür steht – oder, noch schlimmer, die Medien.
Niemand weiß, wo du bist, beruhige ich mich selbst. Niemand weiß, wer du bist. Du warst gründlich, du hast deine Spuren gut verwischt. Man hat dich zwanzig Jahre lang in Ruhe gelassen. Es wird schon werden.
Der Bus kommt ein paar Minuten später. Während ich voller Übereifer die Kinder hineinschiebe und mich begeistert darüber auslasse, wie toll Busfahren ist und was für ein Spaß das sein wird, entspanne ich mich unwillkürlich ein wenig. Die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln – egal wie kurz die Entfernung auch sein mag – hat mich immer schon lockerer werden lassen. Wenn ich im Bus, im Zug oder im Flieger bin, bleibt die Zeit stehen. Es gibt nichts, das ich tun könnte. Es ist wie freie Zeit, bei der das Transportmittel alle Arbeit für mich erledigt. Wenn ich allein unterwegs bin, kann ich ein Buch lesen oder die Augen schließen und mal durchatmen. Wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, betrachte ich sie einfach und weiß wieder zu schätzen, wie wunderbar es ist, dass ich sie habe. Faye ist wie eine Miniaturausgabe von mir: eigensinnig, stur, bestimmend. Hat selbstverständlich immer recht. George ist mehr wie sein Vater: entspannt, zufrieden damit, dort hinzugehen, wo man ihn hinbringt. Aber so unglaublich liebevoll. Oft legt er sein Gesicht an meines, schaut mir tief in die Augen und verkündet: »Ich hab dich mehr lieb als die Welt.« Er streichelt meine Hand, wenn wir zusammen fernsehen, oder dreht eine meiner Haarsträhnen um einen Finger. Jetzt teilt er sich mit seiner großen Schwester einen Sitzplatz und winkt den Leuten draußen zu. Was soll aus den Kindern werden, wenn man mich verhaftet? Wie soll Rob damit fertigwerden? Wen wird George mehr lieben als die Welt? Der Gedanke ist mir nicht neu, natürlich, doch vor dem heutigen Tag war es nur eine flüchtige Überlegung, die sich leicht wegschieben ließ – so wie jede Mutter sich sorgt, was ohne sie aus ihren Kinder werden soll. Aber jetzt … Noch nie war diese Befürchtung so dicht daran, zur Realität zu werden.
Menschliche Überreste gefunden.
Ganz plötzlich ist meine Zukunft ungewiss, und wenn die Wahrheit herauskommt, sind all meine Pläne bedeutungslos. Wie lange wird es dauern, bis man die Identität der Leiche festgestellt hat? Wie lange wird es dauern, bis sie vor meiner Tür stehen?
6
28. Juli 1999 – Maisie
Maisie fand ohne Probleme den Bus, der zum Startpunkt des Wanderwegs fuhr, und ließ ihren Rucksack neben einem Trio fallen, das ungefähr in ihrem Alter zu sein schien. Die drei wirkten allerdings ziemlich furchteinflößend. Es waren zwei Männer und eine Frau, alle in Schwarz gekleidet, alle mit rabenschwarz gefärbten Haaren. Die der Frau waren zu Dreadlocks geflochten und mit allerlei Silberschmuck, Pentagrammen und geschlängelten Symbolen verziert. Sie trug zerrissene schwarze Jeans, und ihr schwarzes T-Shirt zierte das Bild einer sexy Frau mit Tätowierungen und Ziegenhörnern, die einen glänzenden roten Apfel verzehrte und von deren Lippen Blut triefte. Außerdem hatte das Mädchen eine lange schwarze Strickweste mit Kapuze an. Beide Männer trugen schwarze Metallica-T-Shirts und verblichene schwarze Jeans, dazu klobige Doc-Martens-Stiefel. Auf dem T-Shirt des einen prangte ein Dreieckssymbol mit Kringeln an den Eckpunkten. Maisie konnte sich nicht vorstellen, dass man imstande war, in so schweren Stiefeln zu wandern.
»Hi!« Das Mädchen erwiderte nun Maisies Blick und hob grüßend die Hand.
Maisie lief dunkelrot an. »Gott, tut mir leid. Ich wollte euch nicht anstarren«, sagte sie, entsetzt darüber, dass sie beim Anstieren ertappt worden war.
Die junge Frau lächelte. »Keine Sorge. Wenn man sich so anzieht wie wir, gewöhnt man sich daran, angeglotzt zu werden.« Sie streckte die Hand aus. »Ich bin Kaz. Das ist Mitch, und der da ist Keddie. Fährst du auch zum südlichen Startpunkt, zum Gordon River?«
Maisie schüttelte den Kopf. »Ich fange am nördlichen Startpunkt an. Pachena Bay.«
Kaz lächelte. »Wenn wir uns das nächste Mal sehen, haben wir also schon die halbe Strecke hinter uns gebracht! Wahrscheinlich werden wir durchnässt und völlig erledigt sein.« Sie zuckte die Achseln. »Unter uns gesagt, weiß ich nicht, ob wir es alle drei schaffen werden. Ich wette, dass Keddie sich den Knöchel bricht.«
»Na, besten Dank auch«, bemerkte der junge Mann mit dem Filzhut. »Vor allem für das Vertrauen.«
Der andere Mann, Mitch, schaute Maisie an und lächelte wissend. »Es stimmt aber. Er ist der ungeschickteste Wanderer, den es gibt. Keddie ist der einzige Mensch, den ich kenne, der betrunken trittsicherer ist als nüchtern.«
Sie lachten alle. Maisie fand es schade, dass sie verschiedene Startpunkte hatten; es wäre schön gewesen, sich einer solchen Gruppe anschließen zu können. Klar, sie sahen anders aus, aber das war ihr egal. Sie war auch anders, und sie hatte soeben begriffen, wie einsam es sein würde, Stunden um Stunden alleine zu wandern. Wenn sie Glück hatte, würden sie einen gemeinsamen Abend an einem der Zeltplätze auf halber Strecke verbringen. Doch wer weiß, vielleicht konnte sie sich ja irgendwann mit einem anderen einsamen Wanderer zusammentun.
Sie warf einen Blick auf die übrigen wartenden Trekkingreisenden. Es gab viele ältere Leute, was Maisie überraschte. Sie hatte hauptsächlich Studenten erwartet, aber abgesehen von Kaz und ihren Gefährten sah sie nur noch ein anderes Paar, das dem äußeren Anschein nach in ihrem Alter war. Eine junge Frau und ein junger Mann, die bei näherem Hinsehen zu streiten schienen. Die blonden, schulterlangen Haare des Mädchens waren zerzaust. Blaue Augen, gebräunte Haut, die geradeste Nase, die Maisie je gesehen hatte. Ihr Gesicht war perfekt proportioniert, als hätte es jemand mit sorgfältiger Hand geschaffen, um Betrachter maximal glücklich zu machen. Ihr Begleiter schien ihre atemberaubende Schönheit allerdings gar nicht wahrzunehmen und machte ihr heftige Vorwürfe, als wäre sie ein ganz normaler Mensch ohne große Bedeutung für ihn. Er gestikulierte wild, und als Maisie näher trat, hörte sie ihn fragen: »Und was sollen wir jetzt bitte machen?«
»Es tut mir leid.« Das Mädchen sah aus, als würde es gleich zu weinen anfangen. »Ich hatte es vorne in meiner Tasche. Jemand muss es gestohlen haben! Du kannst mir doch keine Vorwürfe machen, weil ich beraubt wurde.«
»Was, du schaffst es nicht mal, fünf Minuten lang auf etwas aufzupassen? Jetzt ist unser ganzes Geld weg. Herrgott noch mal …« Dann kam etwas, was Maisie nicht verstand, und anschließend fügte er das Wort »Schwester« hinzu.
Jetzt verstand Maisie die Situation. Kein Wunder, dass er der Frau nicht lechzend zu Füßen lag – sie waren Geschwister. Und es klang, als hätte sie gerade ihr gemeinsames Geld verloren.
»Letzter Aufruf für Pachena«, sagte der Busfahrer laut.
Geschockt blickte Maisie zu ihm hinüber. Der letzte Aufruf? Sie war dermaßen gefesselt von dem Geschwisterpaar gewesen, dass sie fast ihren Bus verpasst hätte. Und wenn sie sich nicht sputeten, würden die beiden ihn auch verpassen. Urplötzlich wurde ihr merkwürdigerweise eines bewusst: Sie wollte nicht, dass die Geschwister den Bus verpassten. Sie wollte nicht, dass sie hier zurückblieben.
»Entschuldigt, aber der Bus fährt gleich ab«, sagte sie, ohne zu wissen, warum es ihr plötzlich so wichtig war, dass die beiden mitfuhren. »Ihr werdet ihn noch verpassen.«
Der Mann drehte sich zu ihr um, und sie sah sofort, dass die Schönheit in der Familie liegen musste. Sein Haar war dunkler, aber seine Augen waren genauso blau wie die seiner Schwester. Beide sahen sie erstaunt an, als hätten sie vergessen, dass der Rest der Welt noch existierte.
»Wir fahren nirgendwohin, dank dieser Idiotin«, erklärte er, auf das finster blickende Mädchen deutend. »Ihretwegen ist unser Geld weg.« Die junge Frau sah unglücklich aus.
»Ich leihe euch das Fahrgeld«, bot Maisie spontan an. Sobald die Worte heraus waren, bereute sie es. Sie hatte lange für diese Reise gespart, sicherlich noch länger, als die beiden es getan haben mussten. Sie hatte ihr Erspartes dafür angegriffen – Geld, das sie beiseitegelegt hatte, seit sie mit fünfzehn angefangen hatte zu jobben. Und jetzt wollte sie einen guten Batzen davon an Leute geben, die sie gar nicht kannte? Aber als das Mädchen sie überrascht ansah, merkte Maisie, wie verzweifelt gern sie wollte, dass sie das Angebot annahmen. Und dann lächelte das Mädchen, und ihre Schönheit ließ Maisie das Herz aufgehen.
»Meinst du das ernst?«, fragte sie atemlos und erwartungsfroh. Sie schaute ihren Bruder an. »Hast du gehört? Sie kann es uns leihen. Wir können trotzdem fahren!«
»Wir werden uns kein Geld von einer fremden Frau borgen«, erwiderte er gereizt. Er sah Maisie an und zuckte die Achseln. »Nichts für ungut. Danke für das Angebot! Wir müssen von hier weg, Sera.«
»Steigt ihr Kids jetzt ein oder nicht?«, brüllte der Busfahrer mit finsterem Gesicht. »Ich fahre jetzt ab.«
Das Mädchen stieß ein leises Stöhnen aus und sah ihren Bruder flehentlich an. »Lass uns mit ihr fahren, Ric. Wir können es ihr doch zurückgeben.«
»Deine Schwester hat recht, ihr könnt es mir am Ende des Wanderwegs zurückgeben. Kein Problem.«
Ric sah Maisie an und dann den finster dreinblickenden Busfahrer.
»Bist du dir ganz sicher?«, fragte er ruhig. »Lass dich nicht von meiner Schwester emotional erpressen. Das macht sie ständig und mit jedem.«
»Ist schon in Ordnung«, log Maisie. »Kommt jetzt, bevor der Busfahrer noch einen Herzinfarkt bekommt.«
Er lächelte, und in dem Moment wäre es Maisie sogar egal gewesen, wenn das Fahrgeld für die beiden ihr gesamtes Budget aufgebraucht hätte. Die Verpflegung war bereits mit eingeplant, also brauchte sie eigentlich sowieso kein Geld. Und hoffentlich würde die junge Frau – wie hatte er sie genannt? Sera? – ihr Geld ja noch wiederfinden.
»Ooh, jaa!«, kreischte Sera und hüpfte auf und ab. »Danke, danke, danke!«
Als sie einstiegen, war Maisie sehr bewusst, wie viele Leute sie feindselig musterten, weil die drei die Abfahrt zu ihrem großen Abenteuer für ein paar Minuten verzögert hatten. Nur Mitch winkte ihr freundlich zu. Sie fand ein paar freie Plätze in der Mitte, und sehr zu ihrer Überraschung ließ sich das Mädchen auf den Sitz neben ihr fallen.
»Vielen, vielen Dank«, sagte sie und umarmte Maisie kurz. Maisie wusste nicht, was sie tun sollte. In ihrer Familie waren Berührungen unüblich, spontane Umarmungen kamen so gut wie nie vor. »Ich bin Seraphine, aber alle nennen mich Sera. Du hast mich wirklich gerettet. Mein Bruder kann so ein Arsch sein.«
»So schlimm ist er bestimmt nicht«, murmelte Maisie und schaute zu Ric hinüber, der ein Buch herausgekramt hatte. Seine langen Haare fielen ihm ins Gesicht, als er zu lesen begann.
»Ach Gott, lass dich bloß nicht von seiner grüblerischen Intensität täuschen.« Sera verdrehte die Augen und ließ den Kopf dramatisch auf ihren Arm sinken. »Du musst auf meiner Seite sein. Alle meine Freundinnen daheim ergreifen immer für ihn Partei.«
»Wo kommt ihr denn her?«, fragte Maisie. Sie konnte Seraphines Akzent nicht einordnen, aber bei so viel mühelosem Glamour konnte sie sich die Frau eigentlich nur in Los Angeles oder Kalifornien vorstellen.
»Die letzten fünf Jahre haben wir in Australien gelebt. Aber geboren wurden wir in Nottingham.«
»Sind eure Eltern noch in Australien?«
Seraphine schüttelte den Kopf. »Wir haben dort bei unserer Tante gelebt. Aber genug von mir. Was ist mit dir? Ich will einfach alles über meinen Schutzengel wissen.«
7
ANGSTUMVERMISSTERUCKSACKREISENDEWÄCHST
Sunday Echo, 1. August 1999
Die Trekkingpartnerin der vermissten britischen Rucksackreisenden Seraphine Cunningham »befürchtet das Schlimmste« für die Neunzehnjährige, wie aus gut informierten Quellen zu erfahren war. Allerdings weigert sich Maisie Goodwin immer noch, mit den Medien über den Fall zu sprechen.
Die Studentin lernte Cunningham auf dem berühmten West Coast Trail auf Vancouver Island kennen, und die beiden freundeten sich an. Lediglich drei Tage später ging bei der Canadian Mounted Police ein Notruf ein, der inzwischen traurige Berühmtheit erlangt hat: eine Frau sei auf dem Wanderweg ermordet worden – Seraphine Cunningham. Als jedoch die Polizei am vermeintlichen Tatort eintraf, fand sie zwar Spuren eines Kampfes, aber keine Leiche. Cunningham ist seitdem spurlos verschwunden. Ein Durchkämmen der Umgebung erbrachte kaum Hinweise auf den Verbleib der Neunzehnjährigen, und ihr Gepäck wurde auf dem Zeltplatz entdeckt, wo sie zuletzt gesehen worden war. Es wird mit Hochdruck nach Cunningham gesucht, und die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Sie macht keine Angaben darüber, ob bereits jemand unter Verdacht steht oder ob es für möglich gehalten wird, dass die Vermisste noch am Leben ist. Gerüchte, denen zufolge eine »Sex-Sekte« und Rituale eines Satanskults eine Rolle beim Verschwinden der jungen Rucksackreisenden spielen, blieben ebenfalls unkommentiert. Ein Polizeisprecher erklärte im Namen von Goodwin, sie lehne es ab, mit den Medien über den Vorfall zu sprechen, weil sie fürchte, man würde ihr »die Worte im Mund verdrehen und sie wie eine Lügnerin aussehen lassen«. Er fügte hinzu, zum gegenwärtigen Zeitpunkt bestehe kein Anlass, an der Geschichte zu zweifeln, die Ms Goodwin erzähle, aber es würden »alle Ermittlungsansätze verfolgt«.
8
Samstag, 27. November
Das Stadtzentrum ist so voll, wie ich es schon lange nicht mehr erlebt habe. Normalerweise meide ich das Zentrum an Samstagen, besonders wenn ich die Kinder im Schlepptau habe, und ich bin nicht daran gewöhnt, mich durch die Gruppen von Jugendlichen schieben zu müssen, die die Fußgängerzone blockieren.
»Können wir zu Smiggle gehen?«, fragt Faye.
»Wenn du brav bist, während Mummy ihre Einkäufe erledigt.«
»Was willst du kaufen?«
Meine Schultermuskeln spannen sich an. Wie soll ich Faye erklären, dass ich mir ein neues Handy besorgen will? Wenn sie mitbekommt, was ich kaufe, besteht das Risiko, dass sie es Rob erzählt, und ihm werde ich auf gar keinen Fall eine plausible Erklärung liefern können. Er wird annehmen, ich hätte eine Affäre – natürlich immer noch besser, als wenn er die Wahrheit herausfinden würde. Aber ein Albtraum wäre es trotzdem. Ich kann nicht zulassen, dass diese Sache Auswirkungen auf meine Familie hat. Dieses Versprechen habe ich mir gegeben, und das werde ich halten.
Ich werfe einen Blick auf den Handyshop und auf das Kinderparadies Smiggle, das fast direkt gegenüber liegt. Von dem Laden aus werde ich Faye im Auge behalten können, solange ich ihr nicht den Rücken zukehre.
»Okay«, sage und beuge mich zu meiner Tochter hinunter, damit sie weiß, dass es mir ernst ist. Ich klappe mein Portemonnaie auf und hole meine Bankkarte heraus. Ich habe fünfzig Pfund in bar dabei, die ich aus dem dicken Umschlag geholt habe, den ich in einer ausgehöhlten gebundenen Ausgabe von Daphne du Mauriers Rebecca aufbewahre, aber die brauche ich für das Smartphone. »Du darfst bei Smiggle zwanzig Pfund ausgeben. Zwanzig – hast du verstanden?« Faye nickt. Sie ist erst sieben, aber ich habe angefangen, ihr beizubringen, mit Geld umzugehen, seit sie vier ist. Verlass dich nie auf andere