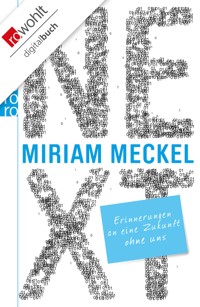10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der technologische Fortschritt hat das Gehirn ins Visier genommen. Schon jetzt ist vieles möglich: Per Denken Texte schreiben oder ein Computerspiel spielen? Kein Problem. Über ein Hirnimplantat Querschnittsgelähmten einen Teil ihres Bewegungsspielraums zurückgeben? Auch kein Problem. Doch mit dem Fortschritt wachsen die Erwartungen an unser Gehirn: Könnte unser Denken nicht effizienter werden? Brauchen wir wirklich acht Stunden Schlaf, um dem Gehirn Erholungsphasen zu ermöglichen? Können wir unsere Stimmungen nicht durch gezielte Hirnstimulationen aufhellen? Wir sind dabei, eine gefährliche Grenze zu überschreiten: Unser Denken wird berechenbar, wir werden optimierbar. Miriam Meckel fordert: Wir sollten nicht alles machen, was machbar ist. Wir müssen die Autonomie über unseren Kopf behalten – als Kreativraum und Refugium des Bewusstseins.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-99058-5
© Piper Verlag GmbH, München 2018
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: Frank Schemmann; Rost-9D/iStockphoto
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Motto
Kopfbahnhof
Das Gehirn als Eroberungszone:an der Schwelle zum Neurokapitalismus
Station 1
Station 2
Station 3
Station 4
Ich – jetzt noch besser:vom Verstehen-Wollen zum Brainhacking
Station 5
Station 6
Station 7
Station 8
Station 9
Identität und Freiheit:Wer bin ich, und woher soll ich das noch wissen?
Station 10
Station 11
Station 12
Station 13
Endstation?
Dank
Literatur
Anmerkungen
Where is my mind?
Pixies, 1988
Kopfbahnhof
Bitte einsteigen und mitdenken
Immer schon war ich anfällig dafür, Dinge auszuprobieren, die mir nicht guttun. Auch gehe ich gerne mal volles Risiko, ohne darüber nachzudenken, was das mit mir machen könnte. Und so ist die Entscheidung für dieses Buch an einem Tag im April 2017 in Boston, Massachusetts, gefallen. Nach 36 Stunden ohne Schlaf und Essen setzte eine prägende Erkenntnis ein: Das Gehirn ist ein sehr feines System, absolut faszinierend, gleichzeitig aber auch noch weitgehend unverstanden, unberechenbar. Wir sollten vorsichtig mit ihm umgehen, respektvoll, bevor es zu spät ist.
Ich hatte in Boston gerade meine erste Erfahrung im Brainhacking gemacht, hatte ein Gerät ausprobiert, mit dem man sein Gehirn ankurbeln kann, um aktiver oder entspannter zu werden. Mit einer App steuert man niedrigschwelligen Strom über zwei Elektroden am Kopf ins Gehirn. Der Strom soll das vegetative Nervensystem beeinflussen, um für mehr Energie oder Entspannung zu sorgen. Eine interessante Erfahrung. Der Test hat bei mir gewirkt. Ich war sehr energetisch. So energetisch, dass ich mich mehrmals übergeben musste, an Essen oder Schlafen die nächsten 36 Stunden nicht zu denken war. Diese Optimierung des Gehirns hat sich alles andere als optimal angefühlt.
Hinter dieser misslungenen Erkundungsübung steckt die Vorstellung, es könne gelingen, sich über die Ankurbelung der geistigen Kräfte noch mehr Schwung zu verleihen, erfolgreicher, begehrter und vielleicht auch glücklicher zu werden. Sie passt perfekt in unsere Zeit. Denn dies ist die Zeit der Selbstverbesserungswilligen. Fast schon prophetisch mutet in diesem Zusammenhang ein Satz an, der dem US-Managementguru Peter F. Drucker (1909–2005) zugeschrieben wird: »Was du nicht messen kannst, kannst du nicht managen.« Drucker dachte dabei sicherlich an das Management von Unternehmen, das sich an vergleichbaren Kennzahlen orientieren sollte. Heute ist diese einfache Formel zu einem Leitsatz unseres gesamten Lebens geworden: Selbststeuerung zugunsten von Selbstverbesserung, und zwar auf allen Ebenen – bis hinauf ins Gehirn.
Fast alles, was wir tun, kann vermessen und also auch verglichen werden. Mit Fitnessarmbändern, Uhren und anderen technischen Geräten ist es möglich, die eigene Leistungsfähigkeit zu erfassen, Schritte, Kalorienverbrauch, Stresslevel zu messen. Zählen und messen alleine reicht aber nicht. Es muss doch auch möglich sein, besser zu werden. Fitnessstudios versprechen, knappe zwanzig Minuten elektronischer Muskelstimulation einmal pro Woche reichten aus, um fit zu werden. Mehr Effizienz und Effektivität sorgen für ein glücklicheres Leben, für mehr Erfolg, Anerkennung, und gesünder ist das alles auch noch. Das Netzwerk »The Quantified Self« (quantifiedself.com) hat sich selbst das Credo »self knowledge through numbers« verpasst. Es ist vielleicht kein Zufall, dass die deutsche Übersetzung doppeldeutig anmutet: »the quantified self« – das vermessene Selbst.
Die Selbstvermesser haben sich erst einmal den Körper vorgeknöpft: mehr Bewegung, mehr Sport, kontrollierter Schlaf, gesünderes Essen, Smoothies, Detox, wohin das Auge reicht. Aber damit nicht genug. Inzwischen sind Selbstvermessung und Selbstverbesserung uns wortwörtlich zu Kopfe gestiegen. Auch das Denken muss besser werden. Was einmal mit Dr. Kawashimas Gehirnjogging begann, ist längst zu einem Wettrennen um die Leistungsfähigkeit des Gehirns geworden, dem kein Hilfsmittel fremd ist. Die Annahme, man könnte das eigene Denken mit technischen Mitteln schneller, präziser, besser machen – nichts anderes bedeutet Brainhacking –, übt heute einen ungeheuren Reiz auf immer mehr Menschen aus.
Es gab noch einen Nachklapp zu der Geschichte in Boston. Niemand wusste von meinem Selbstversuch. Tage später, alles war für mein Empfinden wieder normal, reiste ich zurück nach Berlin. Als ich nach Hause kam, machte meine Frau mir die Tür auf und sah mich erschrocken an: »Wie siehst du denn aus?« Was mir selbst in meiner offenbar verzerrten Wahrnehmung noch gar nicht aufgefallen war, hatte Anne sofort gesehen. Mein Gesicht sah anders aus. An der Stelle, an der die vordere Elektrode gesessen hatte, wirkte es wie eingedrückt. So als hätte jemand meinen Kopf mal kurz in einen Schraubstock gelegt und ein bisschen zugedreht. »Da kann man ja Angst kriegen«, sagte meine Frau. Das kann nicht die Logik der Selbstverbesserung sein. Man kann plötzlich ganz super denken, aber bleibt leider allein.
Nach ein paar weiteren Tagen war alles weg, ich sah wieder normal aus. Aber auf den Fotos, die ich an den Tagen nach dem Experiment gemacht habe, sehe ich, was da war: Ich bin mir fremd auf diesen Bildern. Das ist eine treffende Metapher für dieses Buch. Wenn wir sorglos an unserem Gehirn herumschrauben, glauben, wir könnten unsere Denkfähigkeit, unsere Stimmungslagen und Gefühle beliebig beeinflussen und verändern, dann ist das eine gefährliche, auch überhebliche Annahme. Statt besser, schneller und effizienter zu denken, treiben wir uns vielleicht einfach in den Wahnsinn. Aus dem Versuch der Selbstoptimierung wird dann Selbstbeschädigung. Denn im Gehirn steckt der Kern unserer Persönlichkeit. Das Gehirn zu manipulieren heißt, die Persönlichkeit zu manipulieren. Das Gesicht der Menschheit wird sich verändern, wenn wir beginnen, unser Gehirn als Zone stetiger Selbstverbesserung und als ökonomische Ressource zu begreifen. Wir werden einander fremd werden. Uns selbst auch.
Doch hinter dem Ehrgeiz, das Denken zu optimieren, steckt bereits eine ganze Industrie. Schließlich steigt der Druck auf jeden Einzelnen, immer und überall voll einsatz- und leistungsbereit zu sein. Medikamente, wie Ritalin oder Modafinil, werden eingesetzt, um besondere Leistungen zu erbringen, zum Beispiel in Prüfungs- oder beruflichen Belastungsphasen, man spricht dann von pharmakologischem Neuro-Enhancement. Neurostimulationen durch am Kopf befestigte Elektroden sollen – wie in meinem eigenen Brainhacking-Experiment – das Gehirn und den dazugehörigen Menschen innerhalb von zehn Minuten in die situativ gerade notwendige Aktivitäts- oder Ruhephase versetzen. Überhaupt ginge alles sehr viel schneller, wenn man nicht mehr tippen, wischen oder klicken müsste, um einen Computer oder ein Smartphone zu betätigen. Am besten wäre es doch, ich könnte meine Nachrichten an andere gleich zu ihnen rüberdenken. Auch dieses Buch wäre viel schneller in den Computer gedacht als getippt.
Wenn die optimale Leistungsfähigkeit und das optimale Ergebnis Maßstab für das Denken werden, bekommen wir ein Problem. Denn so geht Denken nicht. Man setze sich auf einen Stuhl und nehme sich fest vor, jetzt eine zündende Idee für einen Text, ein Start-up, ein neues Produkt, ein Musikstück zu haben. Es wird dann viel geschehen. Der Druck steigt, die Anspannung auch, der Frust kommt, nur eines kommt ganz sicher nicht: die gute Idee.
Das Gehirn als Produktivkraft zu betrachten, die sich in ihrer Leistung optimieren lässt, verändert nicht nur das Denken über das Gehirn. Es verändert auch das Menschenbild. Nur die Schnelldenker kommen weiter. Die anderen müssen schauen, wie sie sich und ihr Gehirn selbst optimieren können. Und wer dafür kein Geld hat, darf nicht mehr mitmachen, wird Teil des Hirnprekariats. Das wäre dann eine neue Zeit, in der die Möglichkeiten im Leben gänzlich von der eigenen kognitiven Leistungsfähigkeit abhängen – die Zeit des Neurokapitalismus. Der Anschluss an die Hirn-Daten-Cloud für 299 Euro im Monat ist zu teuer? Da bleibt leider nur Hartz-IV für die allzu ergrauten Zellen.
Es gibt die moderne Legende, wir nutzten nur zehn Prozent unserer Gehirnleistung. Sie ist schlicht falsch. Aber das ändert nichts daran, dass sie sich im Bewusstsein vieler Menschen hält wie eine Klette in Schurwolle. Passt sie doch auch allzu perfekt in die Logik der neuen Effizienz des Denkens. 90 Prozent ungenutzte Ressourcen? Da muss ja ranzukommen sein, neuronale Goldgräberstimmung. Aus diesem Unsinn hat Luc Besson, einer der großartigen Regisseure Hollywoods, sogar kürzlich noch einen ganzen Film gemacht. Der ist so schlecht, dass man den Regisseur eigentlich wegen Beleidigung der geistigen Kräfte verklagen müsste. Und doch landete er gleich nach Filmstart auf Platz eins der deutschen Kinocharts. »Lucy«, das ist die Geschichte einer Frau, die durch eine Überdosis Drogen übermächtige Kräfte verliehen bekommt. Ihr Gehirn dreht auf, und Lucy kann alle Energien um sie herum für sich nutzen, kann über elektromagnetische Felder SMS in die Welt schicken. Sie sieht die Vergangenheit und die Zukunft und blickt in fremde Galaxien. Und als ihr Gehirn tatsächlich 100 Prozent Leistung erreicht hat, wird sie zu purer Energie, zu einem allgegenwärtigen Bewusstsein, das entkoppelt von ihrem Körper existieren kann.
So weit muss man vielleicht nicht gleich gehen. Aber die Vorstellung, wir könnten mithilfe von Medikamenten, Stromstößen oder dauerhaften Implantaten im Kopf mehr aus unserem Gehirn herausholen, ist ein Dauerbrenner. Der amerikanische Psychologe und Philosoph William James schrieb vor mehr als hundert Jahren: »Wir nutzen nur einen kleinen Teil unserer mentalen und physischen Ressourcen.«[1] Seitdem denkt die Menschheit immer wieder darüber nach, ob und wie es möglich sein kann, die Leistung des Gehirns zu verbessern, um die Schwächen und Defizite auszubügeln, die jeder gelegentlich bei sich selbst erkennen kann. Aber kann das funktionieren?
Wenn ich mir morgens einen Kaffee mache, geht das beinahe automatisch. Ein »No-Brainer«, eine Handlung, die fast keinen geistigen Aufwand verlangt. Das ist ein Irrtum. Um einen Kaffee zu machen, muss ich in die Küche gehen, mich der Kaffeemaschine nähern, den An-Knopf drücken, wahrscheinlich Wasser nachfüllen, weil das sonst wieder keiner gemacht hat, in jedem Fall Kaffee, dann die Tasse unter den Auslass stellen und womöglich auch noch Milch und Zucker hinzugeben. Damit das klappt, tobt in meinem Gehirn ein Gewittersturm der Neuronen, von dem ich nichts merke. Zahlreiche Areale im Gehirn ändern ihre Aktivität, sodass Bedürfnisse (»jetzt einen Kaffee«), Bewegungen (»Knopf drücken«) und Sinnesreize (»hmm, lecker …«) miteinander koordiniert werden. Wenn man sich mithilfe der funktionellen Magnetresonanztomografie anschauen würde, was im Hirn passiert, um einen einzigen Kaffee zu machen, würde man sich wohl wundern, wie oft das unfallfrei klappt.
Uns ist gar nicht bewusst, wie hochkomplex selbst banalster Alltag ist und welch unglaubliche Leistungen unser Gehirn in jeder Sekunde vollbringt. Stattdessen wollen wir einfach immer mehr. Früher haben wir Mofas und Autos frisiert, heute sind unsere grauen Zellen dran. Wir stehen noch am Anfang einer Entwicklung rund um das Gehirn als neuem Objekt der Begierde nach Selbstoptimierung. Doch der bessere Mensch scheint bereits zum Greifen nahe, wenn man mit Pillen, Stromstößen oder der Verbindung von Gehirn und Computer, von menschlicher und Künstlicher Intelligenz nachhelfen kann. Oder sagen wir lieber: der schneller und effizienter denkende Mensch scheint zum Greifen nahe. Ob es auch der bessere ist?
Damit stehen wir am Anfang einer Auseinandersetzung um die Möglichkeiten des Brainhacking, die nicht nur jeder Einzelne mit sich selbst führen muss. Es wird eine gesellschaftliche Debatte darüber geben müssen, was möglich und wünschenswert ist. Wo muss das Gehirn als Zentrum des Denkens und der individuellen Persönlichkeit geschützt werden? Welche Ansprüche haben wir an unsere geistige Selbstbestimmung, auch an geistige Intimität und den Schutz privater Gedanken? Und wer wird sie gewährleisten können? Werden wir selbst künftig noch das Recht haben, auf diese Gewährleistung zu pochen? Welche Pflichten haben wir selbst dabei, welche Verantwortung?
Ich bin keine Neurowissenschaftlerin, und ich möchte auch nicht so tun, als wäre ich eine. Mit vielen Forscherinnen und Forschern, Expertinnen und Experten habe ich für dieses Buch gesprochen. Sie alle wissen viel mehr über das Gehirn, als ich je wissen werde. Die Fragen aber, die ich in diesem Buch stelle, gehen nicht nur die Hirnexperten etwas an. Sie betreffen jeden Menschen, der für sich selbst entscheiden möchte, was mit seinem Gehirn und seinem Bewusstsein geschehen soll. Es sind keine wissenschaftlichen Spezialfragen, sondern sie betreffen die Zukunft unserer Menschlichkeit, unserer Eigenständigkeit und unserer Freiheit. Deshalb können wir die Antworten nicht allein den Neurowissenschaftlern überlassen. Wir müssen sie selbst finden.
Als ich vor Jahren begann, mich mit dem Thema zu beschäftigen, kam mir ein Satz in den Sinn, der nun Titel dieses Buches geworden ist: »Mein Kopf gehört mir.« Es ist ein Satz, der ein historisches Echo in sich trägt. Er beschreibt einen anderen Kampf um Selbstbestimmung, der unsere Gesellschaft verändert hat. In den Siebzigerjahren nahm endlich auch in Deutschland die Frauenbewegung Tempo auf. Unter dem Motto »Mein Bauch gehört mir« kämpften Frauen für das Recht auf Abtreibung als Ausdruck der Selbstbestimmung über den eigenen Körper und das eigene Leben.
Dafür reicht es nicht, sich gegen etwas entscheiden zu können. Es gehört das Recht dazu, sich nicht für etwas entscheiden zu müssen. Darum geht es, wenn das Gehirn zur neuen Eroberungszone im Neurokapitalismus wird und wir alle und jeder Einzelne von uns vor vollkommen neue Herausforderungen gestellt werden. Wird Denken eine Frage des Geldes? Haben wir auch zukünftig die Wahl, mit unserer Intelligenz, unseren kognitiven Leistungen zufrieden zu sein, wenn es doch immer mehr Möglichkeiten gibt, sie aufzupolieren, zu verbessern? Haben wir die Wahl, unser Denken privat zu halten, wenn neue Technologien es möglich machen, Gedanken direkt aus dem Gehirn zu lesen und über die digitalen Netzwerke auszutauschen? Haben wir die Wahl, uns für die Unversehrtheit unseres Gehirns zu entscheiden, wenn eine wachsende Zahl von Menschen keine Probleme mehr damit hat, sich über Elektroden, Computerchips oder Nanosonden Zugänge zu ihrem Gehirn legen zu lassen, um Teil eines globalen Netzwerks der Kommunikation und des Wissens zu werden, angeschlossen an eine Datencloud, auf die wir mit jedem Gedanken zugreifen können? Die Antwort erscheint derzeit noch einfach: Klar haben wir die Wahl.
Wirklich? Ein Blick zurück in die Geschichte zeigt, dass sich technologische Fortschritte letztlich durchsetzen, wenn sie das Leben angenehmer machen. Auch wenn irgendwann so viele Menschen Teil der Entwicklung geworden sind, dass die Widerständigen zu Abgehängten werden. Längst haben die meisten Menschen ein Smartphone in der Tasche, das sie nutzen wie eine Fernbedienung für das Leben. In einigen Jahren werden alle Gegenstände unseres Alltags an das Internet angeschlossen sein und miteinander reden. Der Kühlschrank wird entscheiden, wann er Obst und Gemüse nachordert, die Waschmaschine, wann sie wäscht, um die günstigsten Stromtarife auszunutzen. In ein paar mehr Jahren werden wir uns im selbst fahrenden Auto durch die Gegend kutschieren lassen. Wir werden die Strecke fahren, die das Auto auswählt, weil es am schnellsten geht. Diese Entwicklungen machen das Leben einfacher und bequemer. Aber es sind erste Schritte auf dem Weg zu einer Entmündigung des Denkens.
Wenn es medizinisch und technisch möglich ist, das Gehirn zu einem Knotenpunkt in diesem Netzwerk zu machen, wird das geschehen. Längst arbeiten Forscherteams an Universitäten in aller Welt und Unternehmen im Silicon Valley daran, eine Hirn-Computer-Schnittstelle zu entwickeln, die diesen Weg eröffnet. Erste Erfolge gibt es. Menschen können mit ihren Gedanken am Computer Spiele spielen, Texte schreiben, einen Roboterarm bewegen.
Das ist nur der Anfang. Wenn diese Möglichkeiten weiterentwickelt werden, breitere Anwendung finden, wird das Gehirn ein offenes Buch. In ihm können wir dann lesen, wie es um uns und andere bestellt ist. Es erlaubt auch den Blick hinter die Kulisse unseres Gesichts, hinter den »Bildschirm« der Persönlichkeit. Was im Gehirn an Informationen, Gefühlen, Wünschen und Begehren verarbeitet wird, ist Teil der Identität und Einzigartigkeit eines jeden Menschen. Ein wesentlicher Teil unserer Freiheit besteht darin, dass all dies nicht für alle anderen sichtbar und erkennbar ist.
Um 1780 trat ein Text seinen Siegeszug durch die Welt an, der als Protestnote gegen politische Überwachung und Fremdbestimmung in das deutsche Kulturgut eingegangen ist.
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten,
sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen,
mit Pulver und Blei: die Gedanken sind frei.
Tatsächlich wird inzwischen zur Jagd auf die Gedanken geblasen. Es hat seinen eigenen, vielfachen Reiz, das Geheimnis des Denkens zu entschlüsseln und zugänglich zu machen. Nicht zuletzt als großes Versprechen auf neue Märkte und Verdienstmöglichkeiten. Das Unternehmen, das ein erstes marktfähiges Gerät zum Gedankenlesen oder zur Hirn-zu-Hirn-Kommunikation anbieten kann, wird einen Milliardenwettkampf eröffnen. Pulver und Blei sind dazu nicht mehr nötig. Es reicht eine Hirn-Computer-Schnittstelle, um das Denken anzuzapfen. Niemand muss dann mehr Gedanken erraten. Man kann sie einfach auslesen.
Immer mehr Fragen werden sich mit dieser Entwicklung noch einmal neu und drastisch stellen. Wer denkt da eigentlich, wenn unzählige Gehirne im Gedanken-Crowdsourcing zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen? Wer hat das Copyright auf einen Gedanken, der aus dem eigenen Kopf ausgelesen und weiterverarbeitet wurde? Wird es eine Datenschutzverordnung für Gedanken geben? Und wie verhindern wir, dass allein durch das technisch Mögliche eine »Gedankenpolizei« entstehen kann, wie sie George Orwell in seinem Roman 1984 beschrieben hat.
Am Übergang zum Neurokapitalismus gilt nicht mehr der marxistische Leitsatz »Das Sein bestimmt das Bewusstsein«. In der Welt der Gedankenvernetzung bestimmt das Bewusstsein das Sein. Gehört mein Kopf dann wirklich noch mir? Ich hoffe es. Aber ich werde auch etwas dafür tun müssen, dass dies so bleibt.
Denn es darf auch künftig nicht von der Elektrifizierung des Geistes abhängen, ob man in der Welt noch mithalten kann. Wenn pures Menschsein zum Überlebensnachteil wird, kriegen wir ein Problem.
Mein Kopf gehört mir, das ist nicht nur ein Satz, der programmatisch für die Selbstbestimmung eines jeden Menschen über sein Gehirn und sein Bewusstsein eintritt. Es ist auch der Satz, der für mich den Kern einer menschlichen, demokratischen und freien Gesellschaft beschreibt. Im Gehirn kommt zusammen, was einen Menschen ausmacht. Wer das Gehirn manipuliert, werkelt am Ich. Bevor wir damit anfangen, wäre es gut, das Gehirn wirklich in allen seinen Details zu verstehen. Davon sind wir bei allem Fortschritt noch immer weit entfernt. Einstweilen gilt daher: Ob und wie weit man das eigene Gehirn zur Trainingszone der Selbstverbesserung macht, darüber sollte niemand anders entscheiden dürfen als der kluge Kopf, der bald noch klüger werden soll. Wer mit Medikamenten, Elektrostimulation oder der Verbindung zwischen Hirn und Computer die Leistungskraft seiner grauen Zellen erweitern (Neuro-Enhancement) oder verändern (Brainhacking) möchte, kann das tun. So viel Freiheit darf sein.
Freiheit ist aber nicht nur Ermächtigung, sondern auch Verpflichtung. Wir werden diese neue Welt gestalten müssen.
Das Gehirn als Eroberungszone:an der Schwelle zum Neurokapitalismus
Station 1
Das Gehirn – Aufbruch in bekanntes und unbekanntes Terrain
An die erste bewusste Begegnung mit meinem Gehirn erinnere ich mich sehr genau. Wobei: Ich bin nicht sicher, ob diese Erinnerung eine Form der Konfabulation sein könnte. Also eine Ausprägung der Arbeitsweise des Gehirns, mit der es Erinnerung anreichert oder überhaupt erst herstellt. Dann vermischt es die vergangenen Erlebnisse des Menschen, zu dem es gehört oder für den es denkt, mit alternativen Szenarien zu einer Gesamterzählung, die das menschliche Bewusstsein ausmacht. Das geschieht ganz regelmäßig bei Patienten, die einen Hirnschaden erlitten haben. Aber nicht nur bei ihnen. Auch tatsächlich oder vermeintlich gesunde »Hirn-normalos« leben in einer Erinnerungswelt, die nur in Teilen aus tatsächlich gemachten Erfahrungen besteht. Wenn das so ist, dann ist es ein Beleg dafür, wie das Gehirn arbeitet, was für ein kreatives und konstruktives Organ da in unserem Kopf sitzt. Oder besser schwimmt, denn das Hirn schwebt im Liquor cerebrospinalis oder Nervenwasser (das nichts mit einem Beruhigungsschnaps gemein hat). So bleibt es von den äußeren Erschütterungen der Welt verschont. Mit den inneren hat es meist schon genug zu tun.
Es mag also eine Konfabulation sein, wenn ich mich daran erinnere, wie ich als kleines Kind in meinem Bett lag und mir immer wieder mit der Hand an den Kopf schlug, um die Hühner zu verscheuchen, die sich dort eingenistet hatten. Eine ganze Hühnerfarm war da in meinem Kopf. Sie ließen mich nicht schlafen, gackerten laut vor sich hin und machten mich mit ihrem Herumgerenne und -gefliege ganz wirr im Kopf, lange bevor es »Moorhuhnjagd« oder »Angry Birds« gab. Es waren auch keine freundlichen Hühner. Sie waren angriffslustig, hackten aufeinander ein, stoben auseinander, um dann wieder in einer Wolke und mit kratzenden Geräuschen auf dem Boden meiner Gedanken zu landen. An Schlaf war nicht zu denken. Irgendwann habe ich laut nach meiner Mutter gerufen, manchmal eher nach ihr geheult, damit sie mir half, die Farm im Kopf auszusperren. Dazu musste man ganz erwachen, aufstehen, in den Arm genommen werden, und manchmal ging es dann wieder, und der Schlaf kam zurück.
Meiner Erinnerung nach war ich damals vier oder fünf Jahre alt. Das könnte insofern stimmen, als es einige Jahre braucht, bis ein Mensch zur Selbsterkenntnis und Selbstreflexion fähig ist. Ein neugeborenes Baby, dem man einen Spiegel vorhält, weiß nicht, wen oder was es da sieht. Es dauert etwa 15 bis 24 Monate, bis ein Kind sein Spiegelbild erkennt: Das bin ja ich! Sich selbst im Spiegel zu erkennen ist nicht gleichbedeutend mit einem »Ichbewusstsein«. Bis das ausgebildet ist, dauert es noch einmal weitere zwölf bis 36 Monate. Erst dann entsteht eine Verbindung zwischen dem Menschen und seinem Gehirn: Das bin ja ich, die da denkt. Und bis man versteht, was René Descartes mit seinem berühmten Satz »cogito ergo sum« (ich denke, also bin ich) gemeint haben könnte, dauert es in der Regel noch mal viele Jahre, bei manchen ein ganzes Leben. Und bei manchen klappt es gar nicht. Aber die sterben dann vielleicht sogar glücklich, weil sie sich nie mit diesem Problem der Erkenntnisphilosophie haben herumschlagen müssen.
Zurück zu den Hühnern. Ich glaube sie im Alter von vier oder fünf Jahren zum ersten Mal in meinem Kopf erlebt zu haben. Seitdem sind sie bei mir geblieben. Mal in friedlicher, mal in aggressiver Mission. Aber ich weiß: Sie gehören zu mir. Da ist etwas in meinem Kopf, das Bilder, Töne, Gefühle und Gedanken entstehen lassen kann. Das ist eine der aufregendsten Erkenntnisse meines Lebens. Ich habe Ehrfurcht davor, dass so etwas möglich ist, was die Evolution da hervorgebracht hat. Und auch wenn ich nicht an Gott glaube, so gibt es immer wieder Momente, in denen ich zweifele, wie man das Gehirn als Ort unseres Denkens, Fühlens und Seins rein rational erklären will, und ob es überhaupt richtig ist, das zu tun.
Jedenfalls habe ich in meinem Leben dem Gefährten in meinem Oberstübchen viel zu verdanken. Vieles habe ich nämlich nicht gekonnt, nicht gut gemacht, mich nicht getraut. Aber wenn es daranging loszudenken, dann war ich ganz gut. Wenn es darum ging, schwierige Probleme zu durchdenken, war ich ganz gut. Und was ich mich in meinem Leben in der wirklichen Welt nicht getraut habe, darin bin ich in meinem Gehirn zu voller Größe aufgelaufen. Ich war immer eher eine Piratin der geistigen Irrfahrten, glücklich auf dem Abenteuerspielplatz meines eigenen Denkens.
Das Gehirn ist ein Schatz, den uns die Evolution mit auf den Weg gegeben hat und den wir ein Leben lang entdecken. Es macht jeden Menschen erst zu dem, was er oder sie ist. Und so bin ich neugierig geworden, wie das Gehirn funktioniert, ob man seine Arbeit beeinflussen kann und welche Auswirkungen das wohl hätte. Das Gehirn zu manipulieren, schneller und vielleicht auch besser zu machen, kann ein riskantes Unterfangen sein, wenn noch immer viele seiner Funktionsweisen unerforscht und unerkannt sind. Die Verfechter einer konsequenten Ausbeutung unserer Denkressourcen gehen von einer wundersamen Denkvermehrung ohne Risiken und Nebenwirkungen aus. Das muss nicht stimmen. Im Gegenteil ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das kleine Imperium in unserem Kopf zurückschlägt. Die Revolution der kognitiven Erneuerung fräße dann ihre Kinder. Es wäre nicht das erste Mal, dass so etwas schiefgeht.
Das Gehirn ist noch immer ein großes Geheimnis. Vielleicht das einflussreichste Geheimnis der Menschheit. Auch Jahrhunderte der Forschung haben es bislang nicht vollständig lüften können. Zu glauben, man könne es mit einfachen technischen Tricks manipulieren, ist also naiv. »Wenn das menschliche Gehirn so einfach gestrickt wäre, dass wir es verstehen können, wären wir so einfach gestrickt, dass wir es nicht können«, sagt der US-Neurowissenschaftler Moran Cerf.[1]
Wir wissen heute einiges über das menschliche Gehirn, jedoch längst nicht alles. Es ist die Steuerungszentrale unseres Denkens, Fühlens und Handelns. Seit drei bis vier Milliarden Jahren entwickelt sich das Leben auf der Erde. Mehr als 650 Millionen Jahre hat es gedauert, wenn man von den ersten mehrzelligen Lebewesen ausgeht, bis dieses unfassbare Kunstwerk aus Nervenzellen und ihren Verbindungen über elektrische und biochemische Signale so gebaut war und funktionierte, wie es heute der Fall ist. Das Gehirn ist Zentralorgan für die Kommunikation mit uns selbst und der Außenwelt. Es ist nicht autoritär, sondern lern- und veränderungsfähig. Und irgendwo in diesem wunderbaren Organ sitzt auch das Bewusstsein des Menschen oder das, was wir die Seele nennen. So glauben manche. Andere glauben das nicht, was vielleicht an sich schon eine seelenlose Haltung ist, weil man sich fragt: Wenn nicht im Gehirn, wo denn dann?
Unser Gehirn ist auch ein Wunderwerk der Koordination in der Verarbeitung von Sinneswahrnehmungen. Dabei wirken die vielen unterschiedlichen Bereiche des Gehirns zusammen. Das Großhirn ist dafür zuständig, alle höheren kognitiven Funktionen zu organisieren. Das Kleinhirn steuert vor allem die sensomotorischen Funktionen und sorgt zum Beispiel dafür, dass wir die Balance halten können. Und der Hirnstamm ist für die grundlegenden Überlebensfunktionen zuständig: Atmen, Herzschlag, Blutdruck. Er koordiniert aber auch die automatischen Augenbewegungen, mit denen wir uns durch einen Raum und durch die Welt bewegen.[2]
Der Physiker Michio Kaku hat eine schöne Analogie gefunden, die beschreibt, wie diese Koordination gelingen kann. Für ihn ist das Gehirn wie ein großes Unternehmen mit Hierarchien, einer gewissen Bürokratie und ganz vielen Informationen, die hin und her fließen. Bei aller Begeisterung für alternative Führungs- und Entscheidungsmodelle, wissen wir aus vielerlei Erfahrung: Irgendjemand muss mal entscheiden, sonst gibt es Chaos. Im Gehirn ist das die Aufgabe des präfrontalen Cortex. Das ist sozusagen der oberste Planungschef des Gehirns, zuständig für die höheren kognitiven Aufgaben. Er bekommt nur einen ganz kleinen Teil der Informationen, die im Gehirn verarbeitet werden. Aber er übernimmt die große Aufgabe, diese Informationen so zu koordinieren, dass unser Gehirn als Ganzes entscheiden kann. Dazu macht er allerdings keine Top-down-Ansagen, wie das im Management vieler Unternehmen immer noch üblich ist. Vielmehr »telefoniert« der präfrontale Cortex ständig mit allen »Unternehmensteilen« und vermittelt zwischen ihnen.[3] Ein Ansatz, den wir aus der Politik kennen. Auch unser Gehirn »merkelt«.
Ohne diese Koordinationsleistung würden die etwa 86 Milliarden Nervenzellen einfach wild vor sich hin funken. Es gäbe ein Feuerwerk der neuronalen Aktivität, aber ohne jeden Sinn und Verstand. Sinn und Verstand entstehen erst dadurch, dass die Aktivitäten der Nervenzellen im Gehirn zusammengeführt werden. Es ist schon bei einfachen Dingen ausgesprochen kompliziert, ein gelingendes Zusammenspiel zu orchestrieren. Wenn zwei Menschen sich verabreden, gemeinsam etwas zu tun, Kaffee trinken zum Beispiel, kann unfassbar viel schiefgehen. Dagegen ist das, was das Gehirn an Verabredungen und Koordinationsarbeit leistet, eine Mammutaufgabe, und zwar eine, die für jeden Menschen lebenswichtig, ja sogar überlebenswichtig ist.
Für all das verbraucht das Gehirn, das gerade einmal zwei Prozent unseres Körpergewichts ausmacht, 20 Prozent der täglichen Energie, in Stresszeiten gerne auch deutlich mehr. Könnte man eine Leuchte direkt ans Hirn anschließen, sie würde mit der Helligkeit einer Zwanzig-Watt-Glühlampe in die Welt scheinen. Das klingt nach Funzel, aber damit täten wir dem Gehirn unrecht. Es soll ja nicht für Helligkeit sorgen, für Erleuchtung hingegen schon. Und die gibt es beim Gehirn vergleichsweise günstig. Ließe man diese Zwanzig-Watt-Glühlampe das ganze Jahr brennen, es würden Stromkosten von etwa 50 Euro auflaufen. 50 Euro für ein Lebensjahr voller Denken und Fühlen, gefüllt mit Arbeit, Sport, Lieben und Leben? Wäre das Gehirn ein Kühlschrank (was man sich bei manchen Menschen durchaus vorstellen kann), ihm gebührte fraglos die Energieeffizienzklasse A+++.
Das Gehirn ist damit die energieeffizienteste Steuerungszentrale, die es gibt. Auch Hochleistungsrechner kommen da bei Weitem nicht mit und brauchen für dieselbe Rechenleistung noch immer Strom für mehrere Millionen Euro im Jahr. Das Gehirn braucht hingegen vor allem gute Nährstoffe, Eiweiße, Fette, Vitamine, ein paar Kohlenhydrate, Mineralstoffe und Wasser. Wer glaubt, die allein durch Cheeseburger und Bratwurst zuführen zu können, irrt. Das zeigt sich unter anderem an der Müdigkeit und Denkfaulheit, die einen nach einem schweren Essen überfallen kann. Ein bisschen gesünder darf es also schon sein. Fisch, Fleisch, Eier, Nüsse, Gemüse und Hülsenfrüchte, das sind die Dinge, aus denen das Denken wird. Und manchmal ein Stück Schokolade, wegen der Polyphenole und Flavanoide. Und, ja, vielleicht auch manchmal ein Glas Rotwein. Aber dazu gibt es ebenso viele Studien, die abraten, wie solche, die zuraten.
Das sind nur einige wenige beeindruckende Einsichten in die graue Masse, die unser Leben koordiniert. Und doch wird klar, warum es gar nicht sein kann, dass wir nur zehn Prozent unseres Gehirns nutzen. Es mag Situationen der Ruhe oder der Meditation geben, in denen der Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Hirnbereichen tatsächlich reduziert ist. Aber in der Regel arbeiten viele verschiedene Bereiche zusammen, und selbst im Schlaf, wie wir noch sehen werden, passiert im Gehirn sehr viel mehr, als man aus der Betrachtung eines schlafenden Menschen ableiten kann. Dass wir nur zehn Prozent unserer Hirnleistung nutzen, ist jedenfalls ziemlich unrealistisch. Vielmehr verstehen wir vielleicht gerade einmal zehn Prozent davon, wie das Gehirn tatsächlich arbeitet.
Für Jeff W. Lichtman, Molekular- und Zellbiologe an der Harvard University, steht diese Erkenntnis über das eigene Unwissen am Anfang allen Wissens über das Gehirn. In seinen Kursen fragt er die Studentinnen und Studenten erst einmal: »Wenn alles, was wir über das Gehirn wissen müssen, einen Kilometer beträgt, wie weit sind wir in diesem Kilometer schon gekommen?« In der Regel entsteht erst einmal Stille, dann kommen die ersten zögerlichen Antworten. »250 Meter«, »einen halben Kilometer«, »einen Dreiviertelkilometer«. Lichtman hält dann inne, holt einmal tief Luft und sagt: »Knapp zehn Zentimeter.«
Prägende Trugschlüsse: anschaulich, aber seit jeher falsch
Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass seit Jahrhunderten in Naturwissenschaften und Philosophie kräftig über das Gehirn gestritten wird. Eigentlich geht es bei diesem Streit gar nicht nur um das Gehirn. Es geht um den Menschen an sich, seine Freiheit, Individualität und Einzigartigkeit. Und um die Rechte und Pflichten, die mit diesen Merkmalen verbunden sind. Bin ich frei, weil ich ein Gehirn habe, das mir erlaubt, meine Entscheidungen klug, also durch Abwägen von Informationen und Meinungen, zu treffen? Weil niemand anders außer mir diese Entscheidung mit den vorgelagerten Denkprozessen exakt genauso treffen könnte? Oder glaube ich das nur, weil es sich besser anfühlt, während die Nervenzellen und Synapsen in meinem Gehirn sich vor Lachen ausschütten über meine naive Selbstüberschätzung.
Das Gehirn ist nicht nur als Ganzes umstritten und umkämpft. Die Frontlinien verlaufen schon entlang der kleinsten Entscheidungen, die Menschen mit ihrem und für ihr Gehirn treffen. Womit wir wieder bei den vielen unergründeten Kleinstgeheimnissen des Gehirns als größtem Geheimnis der Menschheit wären. Es arbeitet wie eine Maschine, die außerhalb seiner selbst erst noch erfunden werden muss. Eine Intelligenz außerhalb der menschlichen Intelligenz und ihrer Heimat, dem Gehirn, kann nur durch die Zusammenarbeit vieler Gehirne entstehen, die man das menschliche Denken oder auch den Weltgeist nennen kann.
Genau daran arbeitet die Menschheit seit vielen Jahrzehnten. Die eigene Fähigkeit zu denken, also die menschliche Intelligenz zu replizieren, daran arbeiten weltweit Forscherteams im Feld der Künstlichen Intelligenz (KI). Manch einem würde es genügen, Computer so leistungsfähig zu machen, dass sie uns, den Menschen, vorgaukeln können, sie wären wie wir. Und aus der Sicht des Konstruktivismus betrachtet, würde das auch absolut ausreichen. Denn wenn ich als Mensch nicht mehr in der Lage bin, festzustellen, ob ein Computer ein Computer ist, dann ist dieser Computer jedenfalls mindestens so schlau wie ich. Und er hätte den sogenannten Turing-Test bestanden. Das ist die Prüfung, die Alan Turing sich 1950 ausgedacht hat, um festzustellen, ob eine Maschine denken kann wie ein Mensch. 2014 ist es einer Software namens »Eugene Goostman« in der Simulation eines dreizehnjährigen ukrainischen Jungen übrigens zum ersten Mal gelungen, den Turing-Test zu bestehen. Das Computerprogramm überzeugte ein Drittel der Juroren beim Wettbewerb der Royal Society in London von seiner Menschlichkeit und gewann. Einen kleinen Turing-Test machen wir übrigens regelmäßig, wenn wir beim Zugang zu einer Website eine Zahlen- und Buchstabenfolge eingeben müssen, genannt »captcha«. Die Abkürzung steht für »Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart«.
Anderen Verfechtern der Maschinenintelligenz genügt es nicht, sich an die erkenntnistheoretische Maginot-Linie heranzutasten, die menschliche von Künstlicher Intelligenz unterscheidet. Sie wollen die Grenze überschreiten, wollen eine wahrlich eigene Maschinenintelligenz erschaffen, die besser und leistungsfähiger ist als das menschliche Denken und irgendwann in die Autonomie entlassen wird oder, eher: sich selbst entlässt. Wenn sie Erfolg haben, werden Maschinen angetrieben von selbst lernenden Algorithmen, die sich reprogrammieren, immer weiterentwickeln und verbessern können, und uns irgendwann existenziell überholen. Das wäre dann der evolutionäre Scheideweg, an dem wir in unserer psycho-physiologischen Entwicklung abgehängt und von den Maschinen abgelöst werden. Der KI-Forscher Marvin Minsky hat die leichte Verunsicherung, die einen ob dieser Aussichten auf die kommenden künstlich intelligenten »Overlords« beschleichen kann, einmal so kommentiert: »Wenn wir Glück haben, behalten sie uns als Haustiere.«[4]
Wenn so viel und intensiv am Nachbau des menschlichen Gehirns gearbeitet wird, so zeigt das vor allem, wie faszinierend das Organ für uns ist. Das Gehirn mit seiner immensen Leistungsfähigkeit ist bislang einzigartig und unnachahmlich. Das ist ein wesentlicher Teil seines Mysteriums. Könnten wir es in all seinen Details und Funktionen verstehen, wir hätten die Einzigartigkeit unseres Denkens entschlüsselt und uns selbst damit durchschaubar gemacht.
Aber stimmt es denn überhaupt, dass unser Gehirn einzigartig ist? Wenn wir die evolutionäre Entwicklung des Menschen Revue passieren lassen, gibt es gute Gründe für die Annahme, dass dies nicht so ist. Denn im menschlichen Gehirn finden sich verschiedene Teile oder Bereiche, die auf Vorstufen der Entwicklung hindeuten. So wie es auf dem Weg zum derzeitigen Gehirn Zwischenstufen der Entwicklung gegeben hat, so könnte auch unser Gehirn eine Zwischenstufe auf dem Weg zu etwas noch Größerem, Leistungsfähigerem sein. Das ist der Traum, den die Propheten des Neuro-Enhancement aus dem Silicon Valley träumen. Doch dazu später mehr.
Für Michio Kaku ist »das menschliche Gehirn wie ein Museum, das Überbleibsel sämtlicher vorangegangener Stadien unserer langen Evolutionsgeschichte enthält«[5]. So liegt im hinteren Bereich das »Reptiliengehirn«, vermutlich der älteste Teil, der noch heute für sehr grundlegende Lebensfunktionen wie Atmung, Paarung oder auch Verteidigungsverhalten verantwortlich zeichnet. Mehr in Richtung Zentrum des Gehirns findet sich das »alte Säugergehirn« mit dem limbischen System, das vor allem für Emotionen zuständig ist. Und dann gibt es noch die Großhirnrinde, den evolutionär jüngsten Teil des menschlichen Gehirns, der die komplexeren kognitiven Prozesse bewältigen muss.
Das Gehirn heutiger Zeit mag die höchstentwickelte Form organisch basierten menschlichen Denkens sein. Die letztgültige Form muss es keineswegs sein. So zügig die Forschung in den vergangenen zwanzig, dreißig Jahren vorangeschritten ist, so erstaunliche Erkenntnisse sie auch gewonnen hat: Wir müssen noch viel mehr in Erfahrung bringen, um irgendwann einmal wissen zu können, was in Zukunft in unserem Kopf geschehen wird.
Wo etwas schwer begreiflich ist, da macht man sich auf die Suche nach Vergleichsbeispielen oder Metaphern, um das Verstehen einfacher zu machen. Beim Gehirn hat diese Suche nach dem Vergleich für das Unvergleichliche eine lange Tradition. In biblischen Zeiten begann es mit dem aus Lehm geformten Menschen, grobschlächtig und dumm wie Brot. Lehm war in der frühen Menschheitsgeschichte ein wichtiges Baumaterial. Also musste auch der Mensch daraus geschaffen sein. Das ist nur ein Beispiel aus der geschichtlichen Auseinandersetzung mit dem Gehirn, das zeigt, wie wir ticken: Die jeweils gültigen Denkmodelle der Zeit haben immer auch die Interpretation von Hirn und Geist beeinflusst. Was wir nicht denken konnten, wurde gefüllt mit dem, was wir denken konnten.
Der Mensch aus Lehm wurde erst durch eine göttliche geistige Infusion zu dem, als der er gedacht war. Gott konnte denken und deshalb den Menschen schaffen. Und er schuf ihn angeblich nach seinem Vorbild. Der Mensch war in seinen geistigen Befähigungen von Gott abhängig. Diese Vorstellung hat sich über Hunderte von Jahren bis weit ins Mittelalter hinein gehalten. Eine der schönsten Beschreibungen für die geistige Erweckung des Menschen ist die Legende vom Prager Golem aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, den der Rabbi Judah Löw zum Schutz gegen gewalttätige Angreifer schuf. Der aus Lehm gemachte Koloss saß so lange untätig in der Zimmerecke herum, bis der Rabbi ihm einen Zettel mit dem Namen Gottes unter die Zunge legte, worauf der Golem zum Leben erwachte. Und was passierte dann? Vielleicht hat der Golem den Zettel ja irgendwann aus Versehen verschluckt und wurde damit zum Vorfahren der dauerhaft geistig inspirierten und beseelten Menschheit?
Lange hat sich in der Geschichte auch die Vorstellung gehalten, in unserem Oberstübchen wohne ein Homunculus, ein Miniaturmensch, der aus dem Inneren unserer grauen Zellen alle Handlungen und Entscheidungen steuert. Wo es keine besseren Erklärungen gab, musste es wiederum eine Variante des Menschen sein, die Antrieb des Gehirns war. Erkenntnisphilosophisch allerdings gerät diese Erklärung zu einem unendlichen Kurzschluss des Denkens. Was ist denn mit dem Gehirn des Homunculus? Sitzt darin ein weiterer Mini-Homunculus, um dessen Entscheidungen zu treffen? Und in dessen Hirn sitzt ein noch kleineres Männlein, das vorflüstert, was zu tun ist? Das geht dann immer so weiter, bis wir uns den Kopf eines jeden Menschen wie eine Matrjoschka-Puppe vorstellen müssen, ein perspektivisch endloser Tunnel des Denkens, das Menschlein für Menschlein ineinander verschachtelt füreinander vornehmen?
Schon immer hat auch der technische Fortschritt die Konzeptualisierung des Gehirns bestimmt. Mit der Erfindung der Hydraulik entstand die Vorstellung, ein ausgeklügeltes System verschiedener Flüssigkeiten im menschlichen Körper zeichne für dessen physische und geistige Fähigkeiten verantwortlich. Erste Erfolge in der Automatisierung veranlassten den britischen Philosophen Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert zu der Annahme, mechanische Abläufe im Gehirn seien für das Denken verantwortlich. Und die Neuentdeckungen in der Chemie und Elektrizität ließen im 19. Jahrhundert den deutschen Physiker Hermann von Helmholtz sich das Gehirn als Telegrafen vorstellen. Damit sind wir dann schon ziemlich nahe an der Analogie, die seit einigen Jahrzehnten unser Denken über das Denken bestimmt.
Heute ist der Computer der beherrschende Vergleich, der herangezogen wird, wenn man über das Gehirn sprechen will: die Maschine, die uns das Denken ermöglicht. Und das Denken ist dann wiederum, in der Analogie verbleibend, die Software, mit der die Maschine zum Laufen gebracht wird. Unser Gehirn prozessiert Gedanken, so lautet der Satz, in dem diese Analogie am besten zum Ausdruck kommt. Die Suche nach Vergleichen zur Beschreibung und Erklärung des Gehirns steht immer in Verbindung mit der Zeit, in der sie stattfindet. Jetzt leben wir eben im Computerzeitalter. John von Neumann, einer der Väter der Computerwissenschaft, schreibt in seinem Buch The Computer and the Brain von 1958, das menschliche Nervensystem funktioniere »prima facie digital«[6]. Dem ersten Anschein nach digital? Das ist ein attraktiver Vergleich, den von Neumann da hergestellt hat, wie sein Erfolg bis heute zeigt. Leider ist er falsch.
Computeresk: die Grenzen des Menschlichen
Ein tieferer Blick auf Gehirn und Nervensystem zeigt, warum das eben nicht so ist. Wer einen Computer kauft, muss ihn nicht erst in jahrelanger Arbeit an sich selbst, das Familienumfeld, die sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen gewöhnen, bis er funktioniert. Man schaltet ihn an, spielt die Software auf, wenn die nicht bereits vorinstalliert ist – und schon kann es losgehen. Computer müssen nicht erzogen, Daten nicht sozialisiert werden. Sie funktionieren immer gleich.
Beim menschlichen Gehirn ist das anders. Es bildet sich im Laufe der frühen Lebensjahre Schritt für Schritt aus. Dabei spielen die Erbanlagen, also die menschlichen Gene, eine wesentliche Rolle, die individuell unterschiedlich sind. Diese Gene werden außerdem über Umwelteinflüsse verändert, die schon in der Zeit im Mutterleib einsetzen. In den ersten Jahren nach der Geburt entwickelt sich die menschliche Psyche, bestimmt durch Gene und Erbanlagen, aber auch in Auseinandersetzung mit den jeweiligen Lebensumständen, durch Belohnung, durch Gewohnheiten, durch Erziehung und Sozialisation. Ein Kind wächst in sein soziales Umfeld und die Gesellschaft hinein, und sein Gehirn wächst mit. All das ist beim Computer anders. Vor allem aber existiert der Computer nicht in erster Linie aus dem Bedürfnis und Wunsch nach sozialer Bindung. Er kann jahrelang in der Ecke stehen, ohne depressiv zu werden. Man kann den Computer jeden Tag anschreien, das ist ihm egal. Beim Menschen verhält sich das anders. Das macht ihn besonders, auch besonders fragil zuweilen. In jedem Fall unterscheidet es ihn ganz grundlegend vom Computer.
Warum ist dann der Vergleich zwischen Maschine und Gehirn, Software und Gedanken nicht totzukriegen? Dafür gibt es einen Grund, der im menschlichen Bestreben nach Veränderung und Verbesserung liegt. Seit etwa zehn Jahren scheint am Horizont der Zukunftsprognostiker die Vision auf, der Computer könne uns dabei helfen, allerlei Grenzen der menschlichen Existenz zu überwinden. Und eine, vielleicht die wichtigste dieser Grenzen, liegt im Gehirn. So fantastisch dieses Organ arbeitet, so überraschend und kreativ die Ergebnisse sein können, seine Leistungsfähigkeit ist doch begrenzt. Es gibt die Hochbegabten, diejenigen, die 300 Nachkommastellen von Pi aufsagen, komplizierteste Rechenaufgaben lösen oder über ein fotografisches Gedächtnis verfügen. Es gibt diejenigen, die zum Beispiel als Folge des Asperger-Syndroms über ungewöhnliche Gedächtnisleistungen oder Rechenkünste verfügen. Und es gibt Menschen, wie die Amerikanerin Jill Price, die über das absolute Gedächtnis verfügt und sich seit ihrer Pubertät präzise an jeden Tag ihres Lebens erinnern kann. Inklusive Emotionen.
Und dann gibt es die Genies, wie den Astrophysiker Stephen Hawking, der den Anfang und die Unendlichkeit des Universums erklären kann. Menschen wie Hawking gehören zu den Genies des Geistes, wie Arthur Schopenhauer sie einst beschrieben hat: »Das Talent gleicht dem Schützen, der ein Ziel trifft, welches die Uebrigen nicht erreichen können; das Genie dem, der eines trifft, bis zu welchem sie nicht ein Mal zu sehen vermögen.«[7]
Solche Menschen sind die Ausnahmen. Der Normalfall ist, dass Menschen beim Denken an Grenzen stoßen. Und das ist keine schöne Erkenntnis. Man muss ja nicht gleich Genie sein. Aber hätten wir nicht auch gerne die Chance, etwas talentierter, schneller und besser im Denken zu sein? »Das letzte Ziel ist es, die flüssige Intelligenz zu verbessern, also die Menschen schlauer zu machen«[8], so hat es Raja Parasuraman auf den Punkt gebracht, ein Psychologe an der George Mason University in Virginia und militärischer Berater.
Wäre das Gehirn ein Computer, wir müssten nur technisch aufstocken. Schnellere Prozessoren, mehr Speicherkapazität, schlauere Algorithmen, und schon liefe die Sache auf Genialität hinaus. Genauso geht die Logik derjenigen, die überzeugt sind, man könne das Gehirn tunen wie ein Auto, dopen wie einen Körper, der sportliche Höchstleistungen erbringen soll, und man könne es an ein weltweites Computernetz anschließen, bei dem die echten Computer die stumpfen Arbeiten übernehmen, während die menschlichen Gehirne als Megacomputer Kurs auf eine hyperintelligente Zukunft der Menschheit nehmen. Möglich werden soll all das als Erweiterung der menschlichen Intelligenz durch Neurotechnologien und die Verbindung von menschlicher und Künstlicher Intelligenz.
Längst wissen wir, dass durch Technik vieles vorstellbar ist. Umfassende Analysen von Milliarden von Daten in Sekundenbruchteilen machen es möglich, Muster in eigentlich allem zu finden, auch im menschlichen Denken. Aus diesen Mustern lässt sich ableiten, wann Menschen wie entscheiden. Sie erlauben zuweilen sogar vorherzusagen, wie künftige Entscheidungen oder zukünftiges Verhalten ausfallen könnten. Das führt zu großartigen Resultaten, zum Beispiel in der Medizin, wo die Auswertung von Milliarden Krankheitsdaten neue Therapien hervorbringen kann – Ergebnisse, für die man früher noch jahrzehntelang geforscht hätte. Technischer Fortschritt kann also tatsächlich helfen, den Mensch in seinem Denken zu unterstützen und die Gesellschaft voranzubringen. Und wenn der Computer sozusagen mitdenkt, dann ist das natürlich ein Hinweis darauf, dass Denken und Rechnen ähnlich sind. Die Metapher vom Gehirn als Computer bleibt also intakt.
Was aber macht das mit uns? Mit einer Menschheit, die sich aus der Kraft ihres Geistes und Bewusstseins immer wieder neu erfunden hat? Die ihre Schaffenskraft, ihre Kreativität und ihre sozialen Beziehungen aus einem Organ speist, das längst nicht in Gänze verstanden wird? Auch darin unterscheidet sich das Gehirn fundamental vom Computer: Das Gehirn ist die Voraussetzung unseres Denken und Schaffens, während der Computer dessen Ergebnis ist. Wenn die Beschaffenheit der Maschine nun zum Orientierungspunkt, ja, zur Messgröße für die menschliche Intelligenz und Leistungsfähigkeit wird, vertauschen wir Ausgangs- und Zielpunkt, vielleicht sogar Ursache und Wirkung.
Mensch gleich Maschine, Denken gleich Rechnen – in dieser Analogie steckt für den Menschen der Teufel der unverzeihlichen Unzulänglichkeit. Er streckt ihm drohend seinen Dreizack entgegen, wenn der gerade nicht so »performt« oder »prozessiert«, wie die Maschine das kann. Künstliche Intelligenz oder die Computerisierung des Denkens stehen dann für eine schnellere, verlässlichere und damit höhere Form der Informationsverarbeitung. Wie man schnell merkt, weigere ich mich, dies als Denken zu bezeichnen. »Das Denken ist das Selbstgespräch der Seele«, hat der griechische Philosoph Platon im vierten Jahrhundert vor Christus gesagt. Unter den Bedingungen der Hirnoptimierung wird aus diesem Selbstgespräch ein Reiz-Reaktions-Schema. Klug ist dann, wer im Vergleich mit anderen die Kennziffern der jeweiligen Höchstleistung erfüllt. Und überall dort, wo ein Mensch nicht mehr mitkommt, übernimmt der Computer. Der langsam denkende, zuweilen ambivalente, zaudernde Mensch? Brauchen wir nicht mehr. Setzen, Sechs!
Ironie der Geschichte: Während wir beim Computer daran arbeiten, ihn durch bessere Software und schlauere Algorithmen in die Lage zu versetzen, aus Erfahrung zu lernen, also irgendwie menschlicher zu werden, geht es beim Menschen in die andere Richtung. Er soll schneller, besser und effizienter denken, also der Maschine ähnlicher und berechenbarer werden. Er verlöre damit viel von seiner Außergewöhnlichkeit. Vielleicht liegt in dieser Ironie ein existenzieller Irrtum der Menschheit.
Station 2
In der Dunkelkammer – ein Trip durch eine Welt von Sinnen
Wäre es nicht toll, wir könnten mit unserem Gehirn in ein Zwiegespräch eintreten? Es fragen: Möchtest du gerne besser werden? Möchtest du dich mit neuen Technologien verbinden, um mehr leisten zu können? Und würde das dir und mir und uns zusammen guttun? Das wäre ein echtes Aufklärungsgespräch, wenn ein Mensch mit seinem eigenen Bewusstsein aushandeln könnte, was sich verändern soll, was die beiden gemeinsam zulassen und wogegen sie sich wehren wollen. Man hätte sicher schnell herausgefunden, wo die Grenzen der Selbstoptimierung liegen.
Leider geht das nicht. Denn mit dieser ausgedachten Gesprächsszene schlittern wir schnurstracks mitten in ein erkenntnisphilosophisches Problem hinein. Wir können unser Gehirn nicht bei der Arbeit beobachten und es fragen, ob es ihm dauerhaft gut geht oder was sich an ihm verändert. Es sitzt ja in unserem Kopf. Und selbst wenn man es gefahrlos herausnehmen, in den Händen wiegen und verzückt betrachten könnte, würden wir nicht das sehen, was wir sehen müssten, um unsere Fragen beantworten zu können. Man könnte zwar das Gehirn fragen: »Geht es dir gut?« und »Möchtest du mitmachen bei dem, was wir mit dir vorhaben?« Doch wahrscheinlich würde es nur dazu führen, dass uns nahestehende Menschen den baldigen Besuch bei einem Psychotherapeuten anrieten, nicht aber zu einer Antwort.
Das Gehirn als Zentralorgan unseres Denkens und Handelns ist Beobachter und Beobachtungsobjekt zugleich. Das kann nicht gelingen. Warum nicht, damit hat sich die Soziologie intensiv beschäftigt, vor allem der Theoretiker Niklas Luhmann. Er nennt das die System-Umwelt-Differenz, und die ist leider so kompliziert, wie sie klingt. Vereinfachend ausgedrückt, beschreibt der Begriff, dass ein System, also auch ein Mensch, also auch ein Gehirn, immer nur die jeweilige Umwelt beobachten kann, nicht aber sich selbst. Wer versucht, sich selbst zu beobachten, verendet in einem blinden Fleck. Ich kann meine Hand beobachten, wie sie sich bewegt, nach einem Glas greift oder eine andere Hand ergreift. So weit klappt das noch. Aber ich kann nicht beobachten, wie ich selbst beobachte oder denke. Denn in jedem Versuch, das zu tun, stecke ich selbst ja immer schon drin. Ich bin die subjektive Voraussetzung der Beobachtung meiner Subjektivität. Damit bin ich Ausgangs- und Zielpunkt zugleich, und das ist – wiederum im übertragenen Sinne – überhaupt nur in der Quantenphysik möglich, in deren Welt ein quantenmechanisches Ereignis gleichzeitig Ursache und Wirkung oder eine Katze gleichzeitig lebendig und tot sein kann, wie Erwin Schrödinger 1935 in seinem Gedankenexperiment veranschaulicht hat. Um das eigene Gehirn zu analysieren, müsste man aus sich selbst heraustreten, sich als Subjekt objektivieren, also vom eigenen Denken und seinem physischen Ort, dem Gehirn, lösen können, um dann festzustellen, wie das eigentlich beschaffen ist. Die Folgen wären Wahnsinn oder Tod. Einer nach dem anderen.
So sehr man versucht, ins Gehirn hineinzuschauen, selbst noch so ausgeklügelte technische Methoden werden es nicht möglich machen, dem eigenen Denken zuschauen zu können. Hirnströme lassen sich messen, Synapsenaktivität lässt sich dokumentieren. Was das aber mit Denken zu tun hat, bleibt weiter größtenteils Deutung und Interpretation. Wir müssen uns deshalb bislang damit zufriedengeben, unser Sprechen, unsere Entscheidungen, unser Verhalten als Ausprägungen und Folgen des Denkens zu beobachten. Dabei ziehen wir lediglich Schlussfolgerungen aus Verhaltensweisen, von denen wir glauben, dass sie auf eine bestimmte Beschaffenheit oder Aktivität des Gehirns hindeuten.
Ende der Leseprobe