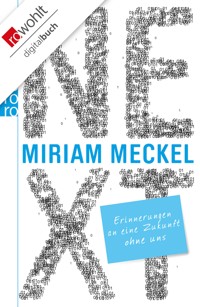9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Brief an mein Leben - Eine schonungslos ehrliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Burnout Miriam Meckel, erfolgreiche Kommunikationsexpertin, Professorin und gefragte Medienpartnerin, erlebt trotz Warnungen das, was sie immer befürchtet hat: Inmitten eines hektischen Alltags voller E-Mails, Vorträge und Geschäftsreisen zieht ihr Körper die Notbremse. Die Diagnose: Burnout. In einer Klinik im Allgäu beginnt sie, einen "Brief an mein Leben" zu schreiben. Mit präziser Analyse setzt sie sich mit ihren Gefühlen, alten Wunden und der Frage auseinander, was geschieht, wenn wir ständig unterwegs sind und kommunizieren, aber nicht mehr sagen können, was uns glücklich macht. Miriam Meckels Geschichte berührt und rüttelt auf, indem sie offen über ihr persönliches Verstummen und ihre Erfahrungen mit einem Burnout spricht - und darüber, wie man damit umgehen und ihn überwinden kann. Brief an mein Leben ist eine schonungslos ehrliche Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt, mentaler Gesundheit und der Suche nach Sinnhaftigkeit und Lebensglück. Ein Buch, das zum Nachdenken anregt und Mut macht, innezuhalten und sich auf das Wesentliche zu besinnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Miriam Meckel
Brief an mein Leben
Erfahrungen mit einem Burnout
«Wenn das Herz denken könnte, stünde es still.»
FERNANDO PESSOA,
Das Buch der Unruhe
EIN FENSTER ZU MIR
Ich stehe am Fenster. Im Zimmer ist es dunkel. Draußen auch. Langsam kommt das erste diffuse Licht. Über der Landschaft liegt ein dicker Nebel. Ich kann nicht einmal die nahen Hügelketten erkennen, geschweige denn die Gebirgszüge der Alpen in der Ferne. Als hätte sich eine Gaze über diese Landschaft gelegt. Aus dem Wald heraus rechts von mir wächst eine Baumgruppe wie eine gestreckte Landzunge in die freie Wiese hinein. Sie kann ich sehen. Eine Reihung von schwarzen Bäumen, einer neben dem anderen, rechts dicht beieinander, links zur Spitze der Flucht hin vereinzeln die Bäume.
Ich stehe nah am Fenster. Durch die Scheibe hindurch spüre ich, dass es draußen kalt sein muss. Mein Atem lässt die Scheibe beschlagen und einen runden Fleck entstehen. Wenn ich durch diesen Fleck auf die Welt schaue, sehe ich alles wie in Watte gehüllt. Selbst die Bäume, die am nächsten bei mir sind, bleiben dann verschwommen.
Kein Geräusch dringt von außen zu mir, und auch hier bei mir ist es still. Ich höre ein leichtes brummendes Rauschen, das kommt und geht. Es nistet in meinem linken Ohr und gehört zu mir, ich habe mich längst daran gewöhnt. So stehe ich und schaue in den Nebel. Der Fleck, den mein Atem an die Scheibe wirft, schrumpft mit jedem Atemzug, den ich tue, ein wenig, um sich dann wieder zu vergrößern, wenn ich meinen Atem fließen lasse. Wie ein pulsierendes Organ, das sich ausdehnt und wieder zusammenzieht.
Ich hocke mich vor das Fenster, das bis zum Boden reicht. Jetzt versperrt mir die Balkonbrüstung noch die letzte Sicht auf die Bäume, die ich sehen konnte. Ich schaue in das konturlose, matte Weiß des Nebels. Da ist nichts, nur dieses dumpfe Weiß. Ich versuche, meinen Blick zu fokussieren, irgendetwas zu erkennen, Unterschiede in dieser großen weißen Fläche auszumachen, aber es gelingt nicht. Alles sieht gleich aus. Das Auge hat nichts, woran es sich festhalten kann, und schlingert durch den Nebel. Ich könnte jetzt überall sein. Im Gebirge, auf dem Meer, auf einer Autobahn. Um mich ist nur weiß.
Wenn ich mich konzentriere und lange auf eine Stelle schaue, sehe ich irgendwann kleine dunkle Punkte, die langsam wandern. Es sind keine Objekte im Außen, die ich nun beobachten kann, sie sind in mir. Kleine Partikelchen in meiner Tränenflüssigkeit, die durch das Öffnen und Schließen meiner Augen durch ihre Welt gewirbelt werden, um sich dann langsam wieder auf die Reise zu einem unbestimmten Zielpunkt zu machen, von oben nach unten, von links nach rechts. Wenn ich mich auf diese kleinen grauen Punkte konzentriere, bewegt sich wenigstens etwas in der Starre des Nebels.
So am Boden ist es nicht lange auszuhalten. Ich richte mich wieder auf. Jetzt sind die Bäume wieder da. Aber der Nebel bleibt undurchdringlich. Nur etwas heller ist es geworden. Rechts, dort, wo die Bäume dicht stehen, sehe ich ein Licht. Es bewegt sich. Das muss ein Auto sein, das eine kleine Straße entlangfährt. Die Straße kann ich von meiner Beobachterposition aus nicht erkennen, aber sie ist da. Ich kann auch die Lichter des Autos nicht sehen, sondern nur das, was sie erleuchten. Zwischen den Bäumen flammt immer wieder ein Lichtfleck auf, der dann für einige Sekunden einen Schneehügel aus dem Nebel hervorhebt. Ein sporadisches Licht, das von rechts nach links wandert. Dann ist es wieder verschwunden.
Es ist noch heller geworden. Und jetzt sieht es für mich so aus, als gäbe es eine Bildstörung in dieser Landschaft. Ich schaue genauer hin. Vor dem Hintergrund zweier großer schwarzer Bäume sehe ich, dass es schneit. Es ist nicht nur der Nebel, der alles optisch verhüllt. Nun legt sich eine weiche, kalte Schicht auf diese Welt. Deshalb ist es so still. Wenn Schnee fällt, ist es immer ganz besonders still.
Ich bin müde. Ich könnte noch etwas schlafen. Wenn die Welt so still ist, verpasse ich nichts.
MEDIZINISCHER STUBENARREST
Ich soll nicht schlafen. Nachts schon, aber nicht tagsüber. Vor allem nicht während dieser beiden Tage meines kommunikativen Stubenarrests. «Inaktivitätstage» heißen die hier eigentlich. Dahinter verbergen sich Minuten, Stunden und Tage, in denen man auf dem Zimmer bleibt und aus dem Fenster schaut. Keine Gespräche mit anderen, nichts lesen, kein Fernsehen, keine Musik hören. Handy und Laptop bleiben ausgeschaltet im Schrank. Als ich zum ersten Mal von diesen Inaktivitätstagen gehört habe, nahmen sie mich gleich gefangen, aus Angst und aus Faszination. Ich wusste sofort, dass ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit diesen kommunikativen Stubenarrest verordnet bekommen würde. Ich weiß ja, was mir schwerfällt.
Es ist acht Uhr zwölf. Ich bin leicht unruhig. Um mich herum sind die anderen langsam aufgewacht. Ich höre Duschwasser fließen, Toilettenspülungen, immer wieder das leicht klirrende, durchdringende Geräusch, das entsteht, wenn man das Zahnputzglas etwas zu schwungvoll auf die Keramikablage stellt. Die Welt wacht auf, meine kleine Welt, in der ich mich doch inzwischen so gut zurechtgefunden habe, dass ich mich freue, morgens zum Frühstück in den Speisesaal zu gehen, mein Dinkelmüsli zusammenzubasteln, um es dann mit kleinen, zu Tagesbeginn noch seichten und leichten Gesprächsfetzen garniert zu essen.
Heute nicht. Heute bleibe ich auf meinem Zimmer und frühstücke hier. Ich habe mir gestern vorsichtshalber alles mitgenommen, was ich dafür brauche. Eigentlich sollte mir das Essen gebracht werden. Aber da ich eine besondere Schonkost essen muss, die schon unter der Voraussetzung meiner physischen Anwesenheit im Speisesaal größeren Einsatz erfordert, bis die Küche das Richtige rausrückt, verlasse ich mich lieber nicht darauf. Wahrscheinlich habe ich damit schon einen Teil der Übung vergeigt, aber das ist mir egal. Wenn ich sonst schon nichts darf, will ich nicht auch noch den ganzen Tag Hunger haben.
Warum sind diese Tage überhaupt eine Herausforderung? Ich muss nicht raus in den Nebel und die schneeige Kälte, ich muss keinen Sport machen, ich muss mich um nichts kümmern. Ich darf sozusagen medizinisch verordnet faul sein. Ich darf, oder ich muss? Eigentlich kann ich das gut, Stunden über Stunden bei mir zu Hause auf dem Sofa liegen und lesen. Das ist mein Traumsonntag. Nichts tun und den ganzen Tag lesen. Dazu schöne klassische Musik, gelegentlich ein Blick in die E-Mails, um mit der Außenwelt in Kontakt zu bleiben. Manchmal schreibe ich auch gerne zwischendurch, eine Kolumne für die Zeitung oder ein neues Posting für mein Weblog. Und dann koche ich etwas Leckeres. So hat ein fauler Tag eine ganze Menge Bestandteile, über die ich mir gerade klar werde und die alle einzeln und in ihrer Gesamtheit durchaus ein Aktivitätsniveau spiegeln, das mir immer neuen Input gibt und mich gedanklich in Bewegung hält.
Bei genauerem Nachdenken fällt mir auf, dass ich an meinen faulen Tagen eigentlich immer permanent online bin. Der Laptop steht aufgeklappt auf dem Tisch, und gelegentlich werfe ich einen Blick in die elektronische Post, schaue etwas im Internet nach oder aktualisiere meinen Status bei Facebook. Ich mache das nicht ständig. Ich habe schließlich verstanden, dass es unklug, manchmal gar zersetzend ist, sich andauernd selbst unterbrechen zu lassen. Aber womöglich reicht schon der Grundzustand des «Angeschlossenseins», um den Tag, an dem ich faul sein möchte, zu verändern und zu einem Aktivitätstag werden zu lassen. Der kontinuierliche Zustand möglicher Kommunikation verändert, ja, verhindert die Momente der tatsächlichen kommunikativen Abgeschiedenheit. Deshalb sitze ich nun hier am Fenster und starre in den fallenden Schnee.
Habe ich also Angst vor Langeweile? Nein, das ist es nicht. Langeweile ist das einzige Gefühl, der einzige Empfindungszustand, von dem ich glaube, dass ich ihn wirklich nicht kenne. Ich kenne die innere Unruhe, das Abschweifen und Abgelenktsein, wenn ich langatmigen Ausführungen folgen soll, deren Ziel und Zweck ich längst glaube verstanden zu haben und die mir die Zeit rauben für Dinge, die mich beschäftigen und mir wichtiger erscheinen. Ist das Langeweile? Ich glaube nicht. Langeweile ist ein Gefühl, das entsteht, wenn die Zeit lang wird, wenn sie sich dehnt und dehnt, ohne dass etwas für mich darin läge, das ihr Vergehen berechtigt. Wenn ich nichts mit mir anzufangen weiß, keine Idee habe, wie ich die Zeit füllen könnte. Das ist Langeweile. Diesen Zustand erreiche ich nicht.
Er kann gar nicht erst entstehen, weil ich immer im Spannungsfeld eines Überangebots von möglichen Aktivitäten, von Dingen, die mich interessieren und neugierig machen, und einem Unterangebot von zur Verfügung stehender Zeit lebe. Es ist immer zu wenig Zeit für die vielen Dinge, die ich tun und erkunden möchte. Also habe ich irgendwann angefangen, alles gleichzeitig zu tun. Das nennt man dann Multitasking, und ich weiß, dass ich als Mensch dazu gar nicht in der Lage bin.
In meinem letzten Buch1 habe ich ausführlich beschrieben und begründet, warum das menschliche Gehirn nicht multitaskingfähig ist. Wir prozessieren in unserem Kopf nämlich alle Gedanken seriell, nicht parallel, so wie die Computer auch. Wenn wir glauben, wir täten Dinge gleichzeitig, erledigten mehrere Aufgaben in derselben Zeit, dann produzieren wir für uns selbst nur die Illusion der Gleichzeitigkeit. Tatsächlich springt unser Gehirn zwischen den verschiedenen Aufgaben hin und her, erledigt hier ein bisschen und dort ein bisschen, immer im Wechsel. Das kostet Kraft und Zeit. Deshalb werden wir durch das vermeintliche Multitasking nicht schneller und besser, sondern langsamer und müde im Kopf. All das weiß ich. All das habe ich ausgiebig recherchiert. Über all das habe ich geschrieben. Zwischen Wissen und Anwenden klafft im Leben häufig eine tiefe Kluft. Und aus Wissen entsteht nicht zwangsläufig Veränderung. Das geschieht sogar sehr selten.
In bin seit langem in einem Zustand, der mit Konzentrationsschwierigkeiten noch sehr dezent beschrieben ist. Mein Kopf brummt, so könnte ich es umgangssprachlich beschreiben. Er ist einfach immer übervoll, und es gelingt mir nicht, einen Teil der Impulse und Gedanken so abzuleiten, dass ich mich auf den verbleibenden Teil wirklich konzentrieren kann. Oft habe ich das Gefühl, in meinem Kopf würden «Die vier Jahreszeiten» von Vivaldi gleichzeitig abgespielt, gelegentlich auch in doppelter Geschwindigkeit. So wie man früher als Kind an den alten Plattenspielern die LP statt mit den vorgegebenen 33Umdrehungen auf Singlegeschwindigkeit mit 45 abgespielt hat. Alles klingt etwas schnell, schrill, Mickey-Mouse-artig. Es tut ein bisschen weh in den Ohren, man erkennt hauptsächlich noch die akustischen Spitzen der Musik und verpasst vor allem die Schönheit des Klangs, die leiseren Töne, die besonderen Tonfolgen, die sich langsam aufbauen, um die Führungsmelodie des Stücks herauszuarbeiten. So ist es auch in meinem Kopf. Mir fehlt die Führungsmelodie.
Seit Monaten schon gelingt es mir nicht mehr, mich länger als einige Minuten mit einer Sache zu beschäftigen. Wenn ich lese, merke ich plötzlich, dass ich ein anderes Problem in meinem Kopf durchdenke, während meine Augen weiter die Zeilen verschlingen. Manchmal weiß ich dann noch, worum es ungefähr in dem gerade gelesenen Abschnitt geht, oft ist nicht einmal das der Fall. Also gehe ich im Text zurück und lese nochmals, nicht ohne die Gefahr, dass mir exakt das Gleiche wieder passiert. Immer wieder springe ich während des Lesens auf, weil mir etwas einfällt, das mit dem Gelesenen nichts zu tun hat, wohl aber mit einem der vielen anderen Themen, die mich ansonsten gerade noch beschäftigen. Weil ich weiß, dass ich diesen Gedanken vergessen werde, schreibe ich ihn lieber gleich auf. Wieder ist das Lesen unterbrochen, ich muss zum Inhalt des Textes zurückkehren und den Faden wiederaufgreifen. Gelegentlich lasse ich mich schon in diesem Moment wieder von mir selbst ablenken.
So wird das Lesen zu einer zähen, verwirrenden Fortbewegung in kleinen Rückkoppelungsschleifen entlang der Struktur eines Textes. Bei wirklich komplizierten Texten, wie ich sie berufsbedingt häufig lesen muss, theoretischen Abhandlungen zum Beispiel, muss ich eine enorme Energie aufwenden, um wenigstens für einige Abschnitte in diesem Text zu bleiben. Das Lesen erschöpft mich so, dass ich sofort Hunger bekomme. Das Essen vergesse ich dann allerdings wiederum über die Dinge, die mir zwischendurch oder auf dem Weg in die Küche eingefallen sind.
Wenn ich einem Vortrag oder anderen längeren Ausführungen eines Menschen folge, habe ich ähnliche Konzentrationsschwierigkeiten. Meine Gedanken floaten durch den Raum, springen vor und zurück und nehmen vorweg, was der Redner vermutlich sagen und worauf er hinauswill. Ab diesem Zeitpunkt kann ich mich gar nicht mehr konzentrieren. Thema abgehakt. Dann greife ich zum BlackBerry, um meinen Kalender und meine Aufgaben zu durchforsten, oder nehme mein kleines schwarzes Moleskin-Büchlein zur Hand, in das ich alles notiere, was mir einfällt und ich für wichtig halte. So kommen mir Ideen für laufende Projekte, ich schreibe schnell einen kurzen Text nieder, den ich später in eines meiner Buchprojekte integriere, oder ich mache eine Skizze für die Lösung eines anstehenden Problems.
Und wenn mir gar nichts anderes mehr einfällt, mache ich To-do-Listen. Dabei spüre ich, dass diese Listen eine Entlastungsfunktion haben: Sie suggerieren mir, ich sei im Zustand des «Dingeerledigens», und sei es nur dadurch, dass ich sie aufschreibe, weil sie noch später meine Aufmerksamkeit brauchen werden. Sie erlauben mir auch, die laufenden Gedanken zu dem, was ich noch zu erledigen habe, zwischenzeitlich an das Moleskin-Büchlein zu delegieren. Wenn sie notiert sind, bleiben sie und werden nicht vergessen, dann kann mein Gehirn sie endlich loslassen, und es entsteht etwas mehr Raum und Ruhe für das, worauf ich mich eigentlich gerade konzentrieren soll, zum Beispiel auf den Menschen, der da vorne jetzt redet und meine Aufmerksamkeit verdient hätte.
In ganz intensiven Momenten zeigt sich diese Fokussierungsschwäche meines Gehirns auch optisch. Dann schaue ich auf eine Gruppe von Gegenständen, und es gelingt mir nicht, einen von ihnen in meiner Wahrnehmung hervorzuheben. Wenn ich es versuche, wachsen alle Gegenstände auf mich zu, als Gruppe, die sich nicht voneinander trennen lässt. Ich zoome dann das ganze Bild für mich heran, in mein Gehirn hinein, aber es bleibt eine optische Masse. Dieses Phänomen, das bislang nur eine dumpfe, verschwommene Empfindung und Erfahrung ist, wird mir erst klar, als ich bei meinem Arzt im Zimmer sitze und längliche Holzklötze gruppieren soll. Jedes der Holzstücke steht für einen Teil meiner Identität. Ich stelle die Klötze auf, schiebe hin und her. Und dann soll ich über die Prioritäten und Rangfolgen nachdenken, um womöglich noch einmal zu korrigieren.
Ich starre auf die Gruppe von Holzstücken und versuche, einen bestimmten Klotz zu fokussieren. Es gelingt nicht. Wenn ich versuche, mich zu konzentrieren, wachsen alle Holzstücke auf mich zu, bleiben in einer diffusen Gruppe. Wenn ich mich wieder entspanne, ziehen sie sich zurück, wieder gemeinsam. Ich könnte froh sein. Ich könnte einfach daraus schließen, dass ich für mich eine ganzheitliche Identität entwickelt habe, in der alle Bestandteile wichtig sind, worin alle integriert sind und zusammengehören. Tatsächlich ist das nicht so. Es gibt Prioritäten und Rangfolgen, und ich weiß das auch. Ich weiß sogar, dass ich den einen oder anderen Bestandteil gerne zurückdrängen oder ganz loswerden möchte. Aber ich kann es nicht. Mein inneres Auge zoomt ein und aus, immer das ganze Bild. Nach mehreren Versuchen ist mir heiß und leicht schwindelig. Das Detail bleibt im Ganzen versteckt. Mir fehlt die Konzentration und Kraft, das Einzelne aus dem Gesamten hervorzulocken und herauszulösen.
Es ist acht Uhr achtundfünfzig. Nicht mal neun Uhr. Ich habe inzwischen mehrfach darüber nachgedacht, ob ich nicht einfach ein bisschen lesen soll. Es merkt ja keiner. Ich bin allein. Niemand kann kontrollieren, ob ich in diesen Tagen gelesen habe oder nicht. Ich habe wunderbare Bücher hier, auf die ich mich schon seit langem freue. Zwei davon habe ich angefangen zu lesen und bin neugierig, wie die Geschichten und das Argument weitergehen werden. Ein bisschen lesen und mich dann wieder ans Fenster setzen, so schlimm kann das ja wohl nicht sein. Schwachsinnige Idee überhaupt, an einem Sonntag mit diesem kommunikativen Stubenarrest zu beginnen.
Nicht lesen zu dürfen, damit verlangen sie mir hier etwas Schlimmes ab. Ich lese, wo ich gehe und stehe, im Zug, im Flugzeug, in der Warteschlange an der Kasse, in jeder freien Minute zu Hause oder zwischen den Vorlesungen. Ich lese Zeitungen, Magazine und natürlich Bücher in rauen Mengen. Ich sauge alles in mich ein. Heute nicht. Heute soll ich aus dem Fenster schauen und warten, was mit mir geschieht. Im Moment werde ich sauer, weil ich nicht lesen darf, an einem Sonntag, der sonst mein besonderer Lesetag ist.
Wenn ich wenigstens Musik hören könnte. Ich liebe es, gleich am Morgen nach dem Aufstehen meine Stereoanlage anzuschalten und dann klassische Musik zu hören. Erst gestern habe ich mir drei neue CDs gekauft, Violinsonaten von Schumann und Schubert. Ich kann mich jetzt auf sie freuen, wenn ich sie in einigen Tagen endlich hören darf. Heute bleibt es hier still. Auch auf das Fernsehen muss ich verzichten. Das fällt mir wirklich leicht. Zugegeben, ich hätte heute Abend sicherlich den «Tatort» geschaut. Das ist eines meiner kleinen Sonntagsfernsehrituale, und es reicht für die ganze Woche. Es ist als Verzicht harmlos gegenüber den anderen beiden Verzichten, dem Lesen und der Musik.
Ich verstehe ja, um was es hier geht. Ich soll alle äußeren Reize ausschalten, die ich immer im Übermaß in mich aufnehme, um mich auf mein Inneres zu konzentrieren. Um einen Raum in mir entstehen zu lassen und zu öffnen, in den ich dann blicken kann, um zu empfinden und zu verstehen. Es wäre schön, wenn das gelänge, aber der Weg dahin ist nicht leicht. Dieser Raum entsteht nicht, indem ich ihn öffne. Er entsteht, indem ich darauf verzichte, eben das immer wieder zu versuchen.
Viertel nach neun. Jetzt habe ich mir erst mal einen Tee gemacht. Zum Glück habe ich dafür vorgesorgt. Seit ich keinen Kaffee mehr trinken darf, ist Tee für mich lebenswichtig geworden. Ich habe ein intensives Gefühl zum Tee entwickelt, eine genussvolle Haltung. So wie zu gutem Wein, aber den darf ich derzeit leider auch nicht trinken. Mit einer Tasse guten Assam-Tees starte ich ganz anders in den Tag. So mache ich es auch hier. Hätte ich nicht einen kleinen Wasserkocher auf mein Zimmer geschmuggelt, wäre ich verloren.
Es gibt auch beim Frühstück eine Teebox mit zahlreichen Variationen, darunter sogar ein Ceylon-Assam, aber natürlich im Beutel. Wer einmal losen Tee versucht hat, mag nie wieder Beutel. Das Schlimmste aber ist: Der Ceylon-Assam schmeckt nach Pfefferminz. Ich vermute, es ist gar nicht der Tee selbst, der so schmeckt. Wahrscheinlich sind Pfefferminztee-Rückstände in den Kannen, im Wasserbehälter, wo auch immer. Aber jedes Mal, wenn ich den Tee trinke, muss ich an Jugendherberge denken. Da gibt es immer Pfefferminztee, und ich habe ihn mein Leben lang noch nie gemocht. Das stimmt nicht ganz. Ich habe dieses Pfefferminztee-Leben nie gemocht, das aus Birkenstockschuhen, Wollpullovern und kreisförmigen Diskussionsgruppen besteht, in denen man erst mal ein aufmunterndes Feedback geben muss, bevor man sagen darf, dass eine Idee wirklich blödsinnig ist. Der Tee ist eigentlich lecker, er kann gar nichts dafür. Ich habe ihn einfach im falschen Erinnerungskontext verankert. Deshalb ist es trotzdem gut, dass ich mir meinen Lieblingstee aus meinem kleinen Teeladen in St.Gallen mitgebracht habe, einen Broken Assam aus Tansania, volles, malziges Aroma. Wenn ich davon morgens eine Tasse getrunken habe, abgestimmt mit etwas Sojamilch, geht der Tag gut los.
Für ein solches kleines, aber lebenswichtiges Vergnügen nehme ich auch einen Regelverstoß in Kauf. Wasserkocher sind auf den Zimmern verboten. Ich weiß nicht genau, warum. Vermutlich aus brandschutztechnischen Gründen. Ich verstecke meinen Wasserkocher daher jeden Morgen nach seinem Einsatz wieder im Schrank. Dort stehen auch der Tee und die Sojamilch, die zum Glück auch ungekühlt eine Weile haltbar ist. Würde die Putzfrau einen Blick in den Schrank werfen und eins und eins zusammenzählen, wäre sofort alles klar. Tut sie aber nicht. Vielleicht hat sie auch alles längst entdeckt und schweigt aus stiller Sympathie.
Ich sitze mit meiner Tasse Tee am Fenster auf dem hölzernen Ablagetisch. Wenn ich in dem gemütlichen Ohrensessel Platz nehme, gucke ich frontal auf die Balkonwand, darüber sehe ich nur gräulich weißen Himmel. Ich kann dann nicht mal erkennen, dass es schneit. Es macht mich unruhig, in diese weiße wattige Masse ohne jede Kontur zu starren. Ein deprimierender Blick. Dann sitze ich lieber in unbequemerer Position auf dem Holztisch, die Beine im Schneidersitz, fast in Yogahaltung. So kann ich den Schnee fallen sehen vor den schwarzen Bäumen. Wenigstens bewegt sich dann etwas.
Ich konzentriere mich wieder auf die Flecken in den Augen. Vorhin waren es einige wenige kleine graue Punkte, die auf meinen Augen hin und her gereist sind. Jetzt sind es ganze Geflechte aus Fäden, Linien, Formationen, die sich vor und zurück bewegen. Ich mache ein kleines Spiel mit mir selbst. Wenn ich meine Augäpfel schnell von links nach rechts und zurück bewege, führen die Figuren vor meinen Augen einen ausgelassenen, schlackernden Tanz auf. Sie schwingen nach rechts und nach links, immer einen Teil ihrer selbst nach sich ziehend. So wie Gummimenschen mit besonders biegsamer Taille. Jetzt versuche ich, einzelnen Punkten mit dem Blick zu folgen. Natürlich gelingt das nicht. Die Punkte spiegeln kleine Stoffpartikel in meiner Tränenflüssigkeit auf meiner Hornhaut. Wenn ich fokussiere und die Augäpfel bewege, verändert sich die Tränenflüssigkeit und schwemmt die Punkte davon. Ich versuche es trotzdem immer wieder. Vielleicht bin ich einmal mit dem Blick schon da, wenn der Punkt noch nicht weg ist. Aber es klappt nicht. Dieses Spiel scheitert in sich. Die Spielfiguren sind von mir abhängig. Wenn ich mich bewege, bewegen sie sich auch. Wie sollen sie mich dann austricksen und überraschen können?
Mir ist ein bisschen flau und schwindelig von diesem Spiel. Ich wende meinen Blick vom Draußen ab und schaue auf meine Teetasse. Sie ist normalerweise einfach ein Gefäß, ein Trinkutensil. Den Tee darin genieße ich mit meinem Geschmackssinn, ich schaue ihn nie an. In Ermangelung anderer Alternativen und mit aufsteigender Verzweiflung starre ich auf den Tee. Er hat eine schöne, warme hellbraune Farbe. Und ich kann selbst am Tee sehen, wie kalkhaltig das Wasser hier ist. Oben auf dem Tee schwimmen kleine Partikel, Kalkbruch sozusagen, der entweder einfach im Teewasser war oder sich von den Heizstäben des Wasserkochers gelöst hat. Vermutlich beeinträchtigt das den Geschmack, aber ich merke nichts. Der Tee ist heiß und lecker, er wärmt mich von innen, wenn ich ihn in kleinen Schlucken trinke. Dann kann ich auch den Geschmack am besten auskosten. Kleine Schlucke, die ich einen Moment im Mund herumwirble. Das kann ich im Speisesaal so nicht machen, es sieht immer aus, als hätte ich zwei Mandarinen im Mund. Ich glaube, andere Menschen fänden das auch unhöflich. Aber es ist die beste Art, Tee zu genießen.
Meine Tasse hat braune Ränder. Ich könnte mal runter an die Wassertheke gehen und sie gründlich spülen. Das wäre wohl notwendig. Aber dann werde ich von anderen Menschen angesprochen, und ich soll ja nicht reden. Ich darf gar nicht aus meinem Zimmer gehen. Bleibt die Tasse eben so. Auch egal. Ich habe Hunger. Natürlich bringt mir niemand Frühstück aufs Zimmer. Ich könnte mir einfach ein Müsli machen. Es ist kurz vor zehn.
MEINE SINNE
Mal sehen, was ich so in meiner Frühstückstüte versteckt habe. Ich stehe am Fenster und bereite mein Müsli zu, ein paar getrocknete Cranberries und Gojibeeren liegen schon in der Glasschüssel, ich schaue nochmal genauer hin. Da bewegt sich etwas. Ein kleines, vielleicht drei Millimeter langes silbergraues Tierchen liegt in der Schüssel. Ich schubse es mit dem Stiel meines Löffels an, und es bewegt sich wieder. Was macht das Tier in meinem Müsli? Es muss in einer der Tüten mit den Beeren überlebt haben. Ich muss kurz lachen bei der Überlegung, dass dies die erste Ration Fleisch wäre, die ich seit Wochen zu mir nähme. Aber ich finde es jetzt schon ein bisschen eklig. Das Tier muss weg, und ein Stück Toilettenpapier hilft mir, ihm ein unwürdiges Ende zu bereiten. Ich ertappe mich dabei, wie ich jede getrocknete Beere, die bereits ihren Weg in meine Schüssel gefunden hat, nochmal aufpicke und von allen Seiten betrachte. Da scheint nichts mehr zu sein. Ich esse mein Müsli mit Dinkelflocken und Sojamilch und schaue weiter aus dem Fenster.
Da draußen ist nichts. Bäume, Schnee, der die Hügel bedeckt und weiter vom Himmel fällt. Während ich esse, finde ich mich ganz schön laut vor dieser Stille da draußen. Es knirscht, kracht und schäumt in meinem Mund, und ich bin mir selbst eine Lärmbelästigung. Sonst höre ich das nie, weil bei mir immer Musik läuft. Wenn genug Außengeräusche da sind, werden die Geräusche in meinem Inneren überlagert. Jetzt höre ich sie gnadenlos. Schön klingt das nicht, aber wahrscheinlich klänge es für Außenstehende anders als für mich. In mir hallt das Knirschen und Krachen wider und findet einen besonderen Resonanzraum. Draußen kommen sicher nur leichte Essgeräusche an. Aber das kann ich nicht überprüfen. Ich kann ja nicht aus mir heraus, um mir von draußen zuzuhören. Ich bin akustisch in mir selbst gefangen.
Ich starre weiter in diese trübe, milchig weiße Landschaft. Meine Güte, wenn heute Totensonntag wäre, ich würde es sofort glauben. Da ist wirklich nichts. Zwischendurch muss ich mich in meiner Sitzposition immer wieder neu arrangieren, sonst schlafen mir die Beine ein auf diesem Holztisch. Ich sitze etwas schräg, weil der Tisch nicht tief genug ist. Dadurch drückt mein rechtes Knie immer wieder an die Fensterscheibe. Kalt ist die. Ich rücke ein bisschen ab, verlagere mich nochmal. Da geschieht draußen etwas. Von rechts kommen zwei Gestalten direkt aus dem Wald, schnell sind sie, laufen quer über die Wiese vor mir.
Das sind keine Menschen, das sind zwei Rehe! Ästhetisch sieht es aus, wie sie mit ihren Körpern abrollen in der Luft, einen Bogen herstellen, der sich mit jedem Sprung auf- und wieder abbaut. Grazil wirkt das, einfach schön zu beobachten. Als die beiden Tiere den Weg erreichen, der mit Holzstäben auf beiden Seiten vom Rest der Wiese abgegrenzt ist, scheint es, als wollten sie sich für die Teilnahme am Riesenslalom bewerben, so springen sie um die Stäbe herum. Vielleicht ist das ein Spiel, so wie auch Kinder es spielen? Ich folge den Rehen, solange ich sie sehen kann. Dann verschwinden sie links in der Fläche hinter einem Hügel. Vielleicht ist heute doch ein besonderer Tag?
Vorgestern waren wir in der Gruppe draußen im Wald, um einige Übungen zu machen. Da hat eine Frau erzählt, sie habe am Vortag zwei Rehe gesehen. Womöglich gar diese beiden. Unser Arzt sagte, Rehe bringen Glück. Der, dem sie sich zeigen, ist etwas Besonderes. Ich sehe häufiger Rehe, im Wildpark Rotmonten in St.Gallen. Aber da sind sie in einem Gehege und zeigen sich nicht mir. Vielmehr zeige ich mich ihnen, ob sie wollen oder nicht. Diese hier sind in der freien Wildbahn vorbeigelaufen, und ich habe sie beobachten dürfen.
Jetzt bin ich ganz auf das Geschehen draußen konzentriert. Was mag als nächstes kommen? Es sind zwei Spaziergänger, die genau dort auftauchen, wo die Rehe ins Nichts verschwunden sind. Ihre Wege müssten sich gekreuzt haben, aber das ist nur die Vermutung einer fernen Beobachterin. Die Menschen gehen schnell. Ich kann nicht viele Details erkennen, sie bewegen sich durch die Landschaft wie zwei dickere kurze Striche, die manchmal hintereinander verschwinden. Im Vergleich zu den Rehen wirken sie plump, so als hätten sie ein viel gröberes Raster der Bewegungsabläufe, als müssten sie zwischen zwei abfolgenden Bewegungsstufen eine viel größere Übersetzung überwinden. Es ist, als würden im Bewegungsapparat der Rehe viele kleine Zahnräder ineinandergreifen, sodass der Beobachter eine stufenlose Bewegungsabfolge sieht. Bei den Menschen müssen es größere Räder sein. Die beiden bleiben stehen. Der rechte scheint etwas mit dem Fuß in den Schnee zu malen, vielleicht schiebt er auch nur seinen Fuß verschämt im Schnee hin und her. Sie scheinen zu diskutieren, dann schubsen sie sich und ziehen sich wieder aneinander heran, vielleicht küssen sie sich auch. Sie verschwinden rechts hinter einem Hügel.
In diesem Augenblick erscheint links wieder ein Mensch, an derselben Stelle, an der zuvor das Paar aus der Landschaft herausgetreten ist. Ich sehe jetzt den Rücken eines Riesen vor mir liegen, die Hügel sind seine Rückenmuskulatur, die nach links in ein riesiges verschneites Hinterteil ausläuft. Die Menschen, die von links kommen, treten aus der Poritze des Riesen in die Welt. Das ist zugegeben ein etwas seltsamer Gedanke. Aber je länger ich in diese Landschaft starre, desto seltsamere Formen sehe ich, und desto wildere Assoziationen kommen auf.
Der Mensch, der gerade dem Hintern des Riesen entstiegen ist, macht schnell vorwärts. Es ist ein Jogger. Da draußen muss es ganz schön glatt sein. Die ganzen vergangenen Tage hat es tagsüber getaut und nachts gefroren. Viele Wege sind vereist und spiegelglatt. Ob er diese speziellen Laufschuhe mit Spikes darunter hat? Jedenfalls kommt er zügig voran. Jetzt sieht es so aus, als würde er in den Boden hineinlaufen. Seine Beine verschwinden, dann sein Unterkörper, dann der Oberkörper, so als hätte jemand an dieser Stelle begonnen, den Weg als abfallenden Schützengraben in die Erde zu treiben. Schließlich macht sein Kopf eine halbe Drehung und läuft wieder zurück. Der Jogger ist den Berg hinab eine Linkskurve gelaufen und verschwindet nun hinter dem Hügel.
Jetzt bin ich doch erstaunt, was ich alles da draußen beobachten kann. Ich muss nur frei sein von alledem, was meine Sinne permanent mit Reizen überflutet, dann nehme ich ganz anders und ganz neue Dinge wahr. So wie bei einer Wahrnehmungsübung vor zwei Tagen. Dabei stehen wir draußen auf der Liegewiese, die im Sommer ein Traum sein muss und von der aus man freien Blick auf den Alpenkamm hat. Und dann konzentrieren wir uns, jeder für sich, nacheinander auf unsere einzelnen Sinne. Erst das Sehen, dann das Hören, dann das Spüren. Das Sehen klappt noch ganz gut. Ich muss etwas blinzeln, weil mir Zwielicht entgegenschlägt aus einer Wolkendecke, die an einigen Stellen so dünn ist, dass die Sonne bald durchkommen wird. Aber ich kann gut sehen und schaue auf die Alpen.
Genau vor mir erhebt sich der Widderstein mit mehr als 2500Metern. Mit ein wenig Phantasie erinnert er an das Matterhorn, die Spitze leicht abgeknickt, so als neige sich der Berg, weil er sich selbst zu schwer geworden ist. Das Matterhorn liegt ganz woanders. Ich glaube, die Alpen zu sehen, und sehe doch nur die erste Gebirgskette. Ich sehe also etwas Ganzes, das doch nur Teil von etwas viel Größerem ist. Dieses Etwas ist das Ganze, das ich mit meinen Augen – jedenfalls von meinem derzeitigen Standpunkt aus – nicht erfassen, sondern nur durch einen Blick auf eine Karte der Alpen verstehen kann.
«Die Landkarte ist nicht die Landschaft.». («The map is not the territory.»2) Dieser Satz, der in der Erkenntnistheorie den Unterschied zwischen der Bezeichnung und dem Bezeichneten so plastisch auf den Punkt bringt, stimmt hier in doppeltem Sinne. Im erkenntnistheoretischen und sprachwissenschaftlichen Denken steckt im Bezeichneten anderes und mehr, als die Bezeichnung mir signalisieren kann. Hier ist es umgekehrt. Ich könnte auf der Karte sehen, wie sich die Alpen in zahlreichen Ketten durch den Süden Deutschlands ziehen. Nur eine davon vermag ich mit bloßem Auge zu erkennen. Aber sie ist dafür um ein Vielfaches schöner als jede schematische Darstellung, die mir zwar die Geographie und Topographie verdeutlichen, aber niemals die Schönheit eines Berges in der Morgensonne vergegenwärtigen kann.
Und während ich den Berg vor mir anschaue, kann ich beobachten, wie dort hinten in der Ferne tatsächlich die Sonne durch die Wolken bricht. Auf der linken Seite des Gipfels fängt eine riesige Schneefläche an zu blinken und zu glitzern, so als hätte jemand Unmengen flüssigen Goldes in die Landschaft gegossen. Ich beobachte das eine Weile, bis die Sonne sich wieder etwas zurückzieht, und schaue mir dann noch den weiteren Verlauf der Alpenkette an. Überall kann ich helle Lichtpunkte erkennen, die kommen und gehen, ihre Form verändern – ein Lichtspiel der Natur, das meine Konzentration fesselt.
Beim Hören wird es schon schwieriger. Dazu sollen wir nämlich die Augen schließen. Sobald ich die Augen zumache, spielt mein Gehirn verrückt. Es überschwemmt mich mit Bildern und Gedanken, die mich so beschäftigen, dass ich mich nicht aufs Hören konzentrieren kann. Irgendwann fliegt eine Ente direkt über mich hinweg und schnattert laut. Das ist wie ein Weckruf. Jetzt fange ich an zu hören, den Wind, sein Rauschen in den Blättern und Zweigen, Autogeräusche in der Ferne, eine Kreissäge, die immer wieder durch die Stille schneidet, das Flügelschlagen eines vorbeiziehenden Vogels und das Knirschen des Schnees unter meinen Füßen. Als ich die Augen wieder aufmache, merke ich: Ich würde normalerweise sagen, dass hier oben auf dieser Wiese Stille herrscht. Aber es ist gar nicht still, es gibt ganz viele Geräusche, die man hören kann, wenn man es zulässt und sich auf das Hören konzentriert. Man kann sogar die Bergluft schmecken, die Kälte spüren, den Kontakt der eigenen Füße mit dem Boden.