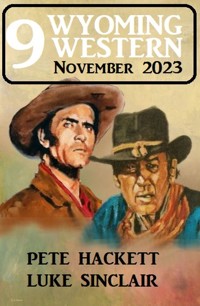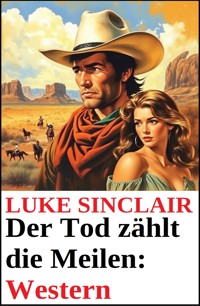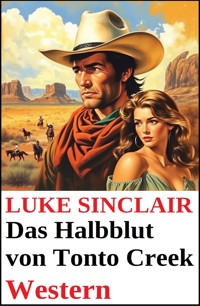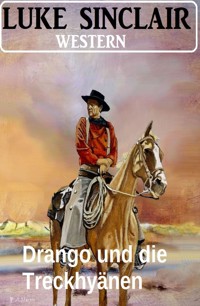Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
„Sie hetzten uns durch 1000 Höllen“ Ich war ziemlich am Ende. Hinter mir lag ein höllisch heißer Trail. Um mich herum war nichts als sengende heiße Wüste, und mein einziger Begleiter war ein Toter. Ich wusste auch, dass auf meiner Fährte der Vater und die Brüder des Toten ritten und dass meine nahe Zukunft alles andere als rosig aussah. Ausgerechnet jetzt musste ich auch noch auf diese sonderbare Frau stoßen. Mitten in der Wüste. Und sie war gerade dabei, ein Grab zuzuschaufeln. Sarah Jane hieß sie, und ihre Geschichte hörte sich verdammt makaber an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luke Sinclair
Mein Ritt mit Sarah Jane: Western
Inhaltsverzeichnis
Copyright
Mein Ritt mit Sarah Jane: Western
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER EDWARD MARTIN
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Mein Ritt mit Sarah Jane: Western
Luke Sinclair
„ Sie hetzten uns durch 1000 Höllen“
Ich war ziemlich am Ende. Hinter mir lag ein höllisch heißer Trail. Um mich herum war nichts als sengende heiße Wüste, und mein einziger Begleiter war ein Toter. Ich wusste auch, dass auf meiner Fährte der Vater und die Brüder des Toten ritten und dass meine nahe Zukunft alles andere als rosig aussah. Ausgerechnet jetzt musste ich auch noch auf diese sonderbare Frau stoßen. Mitten in der Wüste. Und sie war gerade dabei, ein Grab zuzuschaufeln. Sarah Jane hieß sie, und ihre Geschichte hörte sich verdammt makaber an.
*
Es war ein verdammt heißer Tag. Meine Wasserflasche hatte ich schon gestern geleert, und meine Zunge erschien mir so trocken wie ein Eidechsenschwanz. Der Braune hinter mir schnaubte und hob witternd die Nüstern.
Ich drehte mich um.
Der Mann auf dem Braunen litt nicht unter Durst. Für ihn spielte es keine Rolle, wann wir das nächste Wasser bekamen, denn er lag quer über dem Sattel und war in eine hässliche graue Segeltuchdecke gehüllt.
„Du brauchst gar nicht herumzuschnüffeln", sagte ich zu dem Braunen, „es gibt in dieser Gegend kein Wasser. Wir müssen uns noch bis Holbrook gedulden.“
Hinter uns wand sich das Land unter der Hitze wie ein Wurm, aber zum Glück konnte ich keine Staubwolke erkennen. Es fehlte nur, dass sie mich hier einholten und ohne Wasser zwischen den glühenden Felsen festnagelten.
Der Falbe, den ich ritt, hob witternd den Kopf.
„Was habt ihr nur?“, knurrte ich, aber dann roch ich es ebenfalls.
Irgendwo in der Nähe musste ein Feuer brennen. Aber da war noch ein anderer Duft, der direkt aus dem Himmel zu kommen schien.
Ich hatte seit Wochen keinen Kaffee mehr getrunken, und das da vor mir roch so, dass es mein Blut in Erregung brachte. Wo jemand Kaffee kochte, da gab es bestimmt auch Wasser.
Als ich um eine Felsbarriere herumkam, konnte ich den Rauch des Feuers sehen. Ein schlechter Platz für ein Lager, zu wenig Sicht.
Nach Osten hin versperrte die Felsbarriere den Blick, und im Süden erstreckte sich eine Wildnis aus Felsbrocken und Ocotillo-Stauden.
Ich konnte niemanden sehen, und so hielt ich an. Das Pferd hinter mir schnaubte nervös, und ich muss sagen, dass auch ich mich nicht so ganz wohl fühlte, als ich die verkohlten Reste dieses großen Conestoga-Wagens entdeckte. Es musste schon am frühen Morgen passiert sein. Das Feuer hatte ihn etwa zur Hälfte verbrannt, und das verbliebene Holz rauchte nicht einmal mehr.
Ich hatte keinerlei Anzeichen bemerkt, die auf die Anwesenheit von Indianern hingedeutet hätten. Manchmal geschah so etwas auch durch Unachtsamkeit. Bei einem Indianermassaker dieser Art hätte es wohl auch keine Überlebenden und keinen Kaffee gegeben.
Das Feuer war fast niedergebrannt, aber es musste jemand da sein, der es bis jetzt in Gang gehalten hatte. Also ritt ich noch etwas näher heran. Es herrschte drückende Stille, und so hörte ich deutlich das leise Klicken, das entsteht, wenn jemand den Hahn einer Waffe spannt.
Ich hatte gerade den rechten Fuß aus dem Bügel gezogen, aber ich setzte meine Bewegung nicht fort. Geräusche dieser Art gefielen mir ganz und gar nicht.
„Bleiben Sie im Sattel sitzen, Mister, und machen Sie, dass Sie weiterkommen! Und wenn Sie sich auch nur umdrehen, dann schieße ich Sie nieder!“
Sie kam hinter den Trümmern des Wagens hervor, aber nur so weit, dass ich sie sehen konnte - sie und das Schrotgewehr, das sie in den Händen hielt.
Sie war verteufelt hübsch, aber ihre Bekleidung bestand aus Fetzen. Ihre Haare waren zerzaust und voller Staub und das Gesicht eine schmutzige, verschmierte Maske.
„Hallo, Ma’am“, sagte ich, und ich fand, dass es ziemlich albern klang. „Ich wollte nur einen Schluck Kaffee, wenn Sie erlauben, und ein wenig Wasser für meine Pferde, dann reite ich weiter.“
„Nein, ich erlaube nicht“, fauchte sie. „Und versuchen Sie nicht, es dennoch zu tun.“
Durch die Kälte ihrer Stimme klang doch ein wenig Unsicherheit, aber gerade das schien mir gefährlich.
Ich zog meinen Gaul herum und ritt weiter. Sie konnte ja nicht ewig mit dem Gewehr dastehen, und wenn ich mich ihr das nächste Mal näherte, dann würde ich es schlauer anstellen, denn ich war auf ihre Reaktion gefasst.
Ich ritt nach Süden durch die Ocotil los, und als ich sicher war, dass sie mich nicht mehr sehen konnte, schlug ich einen Bogen nach Westen, näherte mich erneut dem Lagerplatz und ließ die Pferde in einiger Entfernung zurück.
Vorsichtig schlich ich heran. Sie hatte das Gewehr gegen die Wagentrümmer gelehnt und damit begonnen, ein paar Steine auf einen frisch aufgeworfenen Erdhügel zu wälzen.
Ich sah, dass ihre Hände aufgeschürft und blutig waren, und begriff allmählich ihr Verhalten. Sie musste schlimme Dinge erlebt haben, die sie in ihrem Innern noch nicht verarbeitet hatte.
Ich wusste nicht, wen sie dort begraben hatte, nicht, woher sie kam oder wohin sie ging. Aber ich konnte sie dort nicht einfach sich selbst überlassen, denn außer ihr schien sich niemand mehr hier aufzuhalten.
Zuerst musste ich ihr Gewehr haben. Ich wartete deshalb, bis sie sich etwas entfernte, um einen neuen Stein zu holen, und lief mit ein paar schnellen Schritten zu dem Wagen.
Sie fuhr herum, als sie mich hörte, aber da hatte ich das Gewehr schon in den Händen. Sie blieb stehen, und ihre blauen Augen waren dumpf und erloschen.
„Kann ich jetzt einen Kaffee haben?“
„Sie nehmen sich ja doch, was Sie haben wollen.“
„Ich weiß nicht, wen Sie da begraben, Ma’am“, sagte ich ruhig, „aber er hätte wissen müssen, dass das hier kein guter Lagerplatz ist.“
„Sparen Sie sich Ihre Ratschläge. Nehmen Sie sich den Kaffee und was Sie sonst noch wollen, und dann verschwinden Sie!“
Ich zuckte mit den Schultern und wandte mich dem Eisenkessel zu, der über dem Feuer hing. Ich musste sie erst an meine Gegenwart gewöhnen. Sie wirkte wie ein frisch gefangenes Tier, das gerade seine Freiheit verloren hat und nur noch Feinde um sich sieht.
Ich hob einen Blechbecher auf, der achtlos hingeworfen neben der Feuerstelle lag, und schöpfte damit Kaffee aus dem Topf. Dabei hatte ich nicht mehr auf sie geachtet, und das erwies sich als dummer Fehler.
Etwas knallte mir von hinten an den Kopf, und mein Schädel dröhnte wie eine Glocke. Es schien, als wäre ich durch einen pechschwarzen Tunnel gekrochen, und es dauerte verdammt lange, bis es wieder hell um mich wurde. Das Dröhnen war noch immer da. Ich versuchte den Kopf zu heben. Es ging, aber ich fühlte mich ziemlich benommen. Ich konnte die beiden Pferde sehen und den Toten auf dem Braunen.
Dann sah ich die Frau. Sie saß auf der anderen Seite neben mir. und sie hatte ihr Gesicht gewaschen. Es sah jung aus und entbehrte nicht eines gewissen Reizes, obwohl sie einen sehr mitgenommenen Eindruck machte.
„Tut mir leid“, sagte sie, doch ihre Stimme klang ohne jede Spur von Emotion.
Ich tastete nach meinem Hinterkopf und fühlte eine riesige Beule, die bei der geringsten Berührung schmerzte.
„Es hätte mir mehr genützt, wenn es Ihnen vorher leid getan hätte“, entgegnete ich ziemlich missgelaunt.
„Immerhin hätte ich Sie töten können.“
„Und warum haben Sie es nicht getan?“
Sie deutete auf den Toten und sagte: „Wegen dem da.“
Ich muss wohl ein ziemlich entgeistertes Gesicht gemacht haben.
„Sie sind ein Mann, der von seinem Revolver lebt“, sagte sie. „Ein Killer!“
Ich schaute sie eine Weile an, und sie hielt meinem Blick stand. Ich hatte den Eindruck, dass der Schmerz aus ihren Augen gewichen und nur noch ein unergründlicher Hass zurückgeblieben war.
„Sie sind sehr schnell mit Ihren Urteilen, und Sie haben eine verdammt direkte Art an sich.“
Sie füllte den Becher, der mir vorher begreiflicherweise aus der Hand gefallen war, neu mit Kaffee und reichte ihn mir. Ich nahm ihn, schlürfte die heiße Flüssigkeit und merkte, dass es mir guttat.
„Wie lange habe ich hier gelegen?“
„Nicht lange. Es hat gerade gereicht, Ihre Pferde zu finden.“
Ich wusste nicht genau, was hier vorgefallen war, aber ich vermied es, sie anzuschauen. Meine Blicke glitten über den verbrannten Wagen und blieben auf einem frischen Grabhügel hängen.
„Mein Mann“, begann sie plötzlich zu sprechen. „Es waren drei Kerle. Sie kamen gestern Abend hier vorbei. An unserem Wagen war ein Rad gebrochen, und sie boten uns ihre Hilfe an. Mein Mann wollte es nicht, aber sie waren zu dritt, und da wäre es wohl nicht klug gewesen, sie mit Gewalt vertreiben zu wollen. Wir hatten einen anstrengenden Tag hinter uns und konnten nicht die ganze Nacht wach bleiben.“
Sie schwieg einen Moment, und ich unterbrach ihr Schweigen mit keinem Wort. Nach einer Weile fuhr die Frau fort:
„Sie müssen ihn im Schlaf getötet haben, und ich habe es nicht einmal bemerkt. Die eine dieser Bestien hatte eine Machete bei sich. Ich erwachte erst, als es schon vorbei war. Ich setzte mich auf, ohne recht zu begreifen. Die Burschen lachten, und der eine warf mir etwas in den Schoss, und ich sah, dass...“
Ihre Stimme versiegte mit einem Zittern, als würde ihr jemand den Atem abschnüren. Erst nach einer Weile war sie in der Lage fortzufahren.
„Sie hatten ihn enthauptet wie einen ... Ich weiß nicht mehr, was ich als nächstes tat. Ich kam erst später wieder zur Besinnung, als sie schon fast mit mir fertig waren. Dann zündeten sie den Wagen an, aus Zorn darüber, weil sie unser Geld nicht gefunden hatten.“
Die Frau hatte nicht viele Worte gemacht, aber sie hatte eigentlich alles gesagt, was über eine so furchtbare Tragödie zu sagen war. Ich goss den Rest des Kaffees in den Sand und erhob mich. In meinem Schädel schien ein Specht zu sitzen, der einen verdammt harten Schnabel hatte. Ich verzog das Gesicht und fuhr mir mit der Hand über den Nacken.
„Womit haben Sie mir denn dieses Ding verpasst?“
Sie deutete auf die Schaufel.
„Ich hatte sie gerade in der Hand.“
„Haben Sie keine Pferde mehr?"
Die Frau schüttelte den Kopf.
„Sie haben sie mitgenommen.“
„Die nächste Stadt heißt Holbrook“, sagte ich. „Mein Pferd wird es schaffen, uns beide bis dorthin zu tragen.“
Sie schien mich gar nicht gehört zu haben. Sie schaute irgendwohin und sagte: „Sechshundert Dollar sind es, die diese Kerle nicht gefunden haben. Zweihundert für jeden. Werden Sie es dafür tun?“
„Der Sheriff in Holbrook wird sich Ihrer Sache annehmen.“
Sie sah mich mit ihren blauen Augen an.
„Ich glaube, Sie haben mich nicht richtig verstanden. Ich bin eine Fremde in dieser Stadt, und ich will meine Geschichte nicht irgendeinem Sheriff erzählen, der dann erklärt, dass die Burschen längst über alle Berge seien.“ Ihre Stimme bekam einen kalten Klang vor lauter Hass. „Nein, ich will sie haben, alle drei, und ich will dabei sein, wenn sie sterben. Und sie sollen wissen, warum, sollen begreifen, was es für ein verhängnisvoller Fehler für sie war, als sie vergaßen, auch mich zu töten.“
„Tut mir leid“, sagte ich. „Ich habe im Moment meine eigenen Probleme.“
„Sind drei Männer zu viel für Sie, oder sind sechshundert Dollar zu wenig?“, fragte sie gehässig.
„Ich bin kein Killer, der für Geld andere Männer umbringt.“
„Dann schleppen Sie wohl zum Vergnügen diesen stinkenden Kadaver mit sich herum?“
„Zugegeben, ich lebe von meinem Revolver, aber die Männer, die ich töte, sind von einem ordentlichen Gericht verurteilt worden. Und ich tue es auch dann nur, wenn sie nicht freiwillig mitkommen.“
Die Frau kam auf mich zu, und zum ersten Mal sah ich trotz der Lumpen, dass sie eine Figur hatte, die einen Mann in Versuchung bringen konnte. Ich wandte mich ab und nahm die Zügel des Braunen.