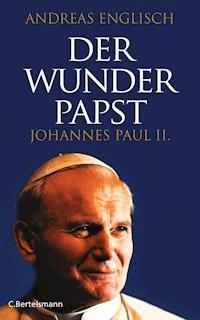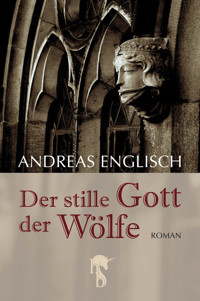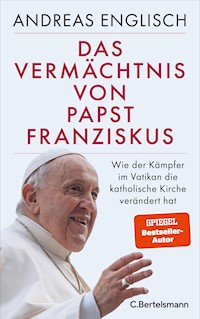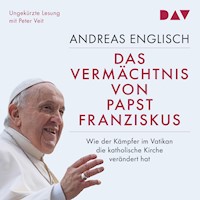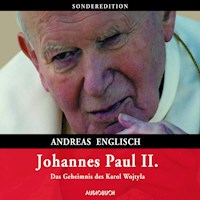17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Unbekannte und überraschende Geschichten über die berühmtesten Sehenswürdigkeiten Roms
Sie wissen schon alles über Rom? Wenn Sie Andreas Englisch kennen, ahnen Sie, dass Sie sich täuschen. Wie kaum ein anderer versteht es der ausgewiesene Vatikan-Experte, der seit drei Jahrzehnten in Rom lebt, dessen mehr als zweitausendjährige Stadtgeschichte zum Leben zu erwecken. Mit dem jungen Römer Leo folgt er Gladiatoren in ihre Trainingsarena, den Spuren genialer Künstler in den Vatikanischen Museen, erzählt von raffgierigen und weisen Päpsten, von verborgenen etruskischen Fresken, Gewinnern und Verlierern der Stadtgeschichte und vom seltsamen Humor eines vielleicht gar nicht existierenden Gottes, der doch das Schicksal Roms bis heute prägt.
Dieses Buch ist kenntnisreich, spannend und amüsant, frech, verblüffend und unwiderstehlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
In »Mein Rom« lädt der Bestsellerautor und Vatikanexperte Andreas Englisch, der seit drei Jahrzehnten in der Ewigen Stadt lebt, zu einer Entdeckungsreise. Er eröffnet neue Blicke auf vermeintlich Altbekanntes, blickt vor und zurück in der römischen Geschichte und enthüllt überraschende Geheimnisse über die berühmten Sehenswürdigkeiten der Tiberstadt. Voller erzählerischer Verve schöpft er aus einem riesigen Fundus an Erfahrungen, Wissen und Begegnungen. Ein außergewöhnliches Rom-Buch.
Autor
Andreas Englisch lebt seit drei Jahrzehnten in Rom und gilt als einer der bestinformierten Journalisten im Vatikan. Seine Bücher sind Bestseller. Zuletzt begeisterte er seine Leser mit »Der Kämpfer im Vatikan – Papst Franziskus und sein mutiger Weg« (2015) und mit der Bildbiografie »Franziskus« (2016).
Andreas Englisch
MEIN ROM
Die Geheimnisse der Ewigen Stadt
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2018 by Andreas Englisch© 2018 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenDieses Werk wurde vermittelt durch die AVA International GmbH Autoren- und Verlagsagentur, München, www.ava-international.dewww.andreasenglisch.deBildredaktion: Annette MayerCovergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenCoverfoto: © Musacchio & IannielloSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-23474-4V005
www.cbertelsmann.de
Wie sagst du noch immer? Ey, Alter. Also, dann versuch ich es jetzt auch mal: Ey, Alter! Ja, du bist gemeint, Leonardo Englisch. Dieses Buch ist für dich oder besser gesagt für uns, unsere Streite, unsere langwierigen Versöhnungen und dafür, dass unsere Heimatstadt Rom nie aufgehört hat, uns beide zu verzaubern.
Inhalt
Auftakt
I
II
III
IV
Petersplatz
Schicksalsort Europas
Traumziel
Antikes Silicon Valley
Grausamkeit und Größenwahn
Zölibat und Kaiserkrönung
Alles Fake?
Was für ein Gott?
Petersdom
Inflation der Heiligen Jahre
Zauber und Gefahr
Spur des Hasses
Krieg im Namen Jesu
Enttarnt
Prüfung I
Letzte Chance
Nacht im Vatikan
Allein mit den Geheimnissen der Päpste
Sixtinische Kapelle
Bildersturm im erstaunlichsten Raum der Welt
Am Ende der Zeiten
Michelangelos neuer Christus
Vatikanische Museen
Borgia – ein Name wie Gift
Die Apokalypse des Raffael
Antlitz einer neuen Zeit
Die Schenkung des Konstantin
Brand im Borgo
Prüfung II
Fernandas Rache
Kolosseum
Inliner und Polterabend
Tödliche Vergnügungsmaschinerie
Santa Maria Maggiore
Die neue Macht von Rom
Santa Prassede
Es hört nie auf
Kapitol
Im Schutz der alten Götter
Stadt mit vielen Gesichtern
Pantheon
Magie der Ewigkeit
Dompteur der Geister
Dank
Register
Der Autor auf der Terrasse neben dem Kapitol: für ihn einer der schönsten Orte der Stadt Rom.
© Privat
Angekommen
Es geschah an der Rezeption eines kleinen, ruhigen, wundervoll auf einem Hügel der Toskana gelegenen Hotels. Der Portier am Empfang schaute skeptisch auf meine Familie: meine Frau Kerstin, meinen damals etwa 13-jährigen Sohn Leonardo und unseren Hund Toffifee. Er sagte nur ein Wort, um zu klären, woher wir kamen: »Roma?« Er hatte Leos Akzent erkannt. Leonardo war in Rom aufgewachsen und sprach wie ein Römer. Mir war klar, was das bedeutete: Römer galten als laut, unzuverlässig, chaotisch. Wenn der Portier uns als Römer einstufte, dann bekamen wir garantiert das schlechteste Zimmer.
Ich wollte also gerade meine Trumpfkarte ausspielen: den italienischen Personalausweis zurücknehmen und meinen deutschen Pass auf den Tresen knallen. Das würde sofort jeden Verdacht, dass wir Römer sein könnten, beseitigen. Deutsche Urlauber galten als vorbildlich leise undrücksichtsvollund bekamen die besten Zimmer.
Aber ich zögerte. Es stimmt: Ich war als Zuschauer nach Rom gekommen, hatte die Spanische Treppe in aller Ruhe fotografiert, während die Römerinnen auf dem Weg zur Arbeit in die Nobel-Boutiquen hinuntergehetzt waren. Ich hatte in den Seitenstraßen des Petersdoms Postkarten ausgewählt, während die Römer dort verzweifelt einen Parkplatz suchten. Rom war eine Kulisse gewesen; aber irgendwann hatte die Kulisse begonnen, uns in das große Theaterstück hineinzuziehen.
Zum Kolosseum gingen wir schon lange nicht mehr, um Selfies zu machen, sondern weil wir dort viele Jahre gewohnt hatten und es irgendwie zu uns gehörte. Unsere Ehe, die mittlerweile die Silberne Hochzeit hinter sich hat, nahm dort ihren Anfang. Am Abend vor unserer Hochzeit haben wir die Party unseres Lebens im Kolosseum gefeiert. Damals trafen sich viele junge Menschen aus unserem Stadtviertel nachts im Amphitheater. Wir hatten Bier, Wein und Pizza dabei und feierten in der Dunkelheit am wahrscheinlich unglaublichsten Party-Ort der Welt.
Nach Trastevere fuhren wir längst nicht mehr, um uns zu amüsieren. Wir hatten einen Großteil unseres Lebens in einer Wohnung in diesem Ausgehviertel verbracht, und inmitten der Unmengen Bars gab es eine, in der wir erfahren hatten, dass wir einen Sohn bekommen würden.
Und auch das beschlagnahmte Tierheim an der Via Ostiense, der Ausfallstraße zum Meer, gehört zu uns, weil wir dort aus einem rostigen Käfig einen verwahrlosten Jagdhund geholt haben, der nie in der Lage sein würde, irgendwas zu jagen – aber eines besonders gut konnte: bei und mit uns sein.
Ich hatte vergessen, dass der Portier auf eine Antwort wartete. Noch einmal fragte er: »Roma?« Und fast gleichzeitig mit meinem Sohn nickte ich und sagte: »Roma.« In diesem Moment begriff ich, dass Rom längst unsere Stadt geworden war.
Aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass Leonardo eines Tages vor einer Aufgabe stehen würde, an der schon ganze Zivilisationen gescheitert waren: diese Stadt innerhalb von wenigen Tagen in den Griff zu bekommen.
Auftakt
I
»Du hast was?«
Ich hoffte eine Sekunde lang, einfach falsch verstanden zu haben. Mein fast erwachsener Sohn Leonardo sah mich mit einer Mischung aus Trotz und Schuldeingeständnis an, die den Auftakt bildet zu jedem heftigen Streit.
Und ich wiederholte, mühsam beherrscht: »Du hast was?«
»Die Aufnahmeprüfung für die Fremdenführerschule nicht bestanden. Ich bin durchgefallen. Fernanda hat gesagt, sie nimmt mich nicht.«
»Und wieso nimmt sie dich nicht?«
»Sie hat was gegen mich.«
»Fernanda hat gegen niemanden etwas. Sie will, dass man nach ihren Regeln spielt, das ist alles. Sie hat dir ein paar Fragen gestellt, das macht sie immer so. Also, sie hat gefragt, und was ist dann passiert?«
Leo schwieg und starrte auf den Küchenfußboden, als hätte er dort etwas verloren.
Ich sah Fernanda vor mir, mit ihrem entschlossenen Gesicht und den blond gefärbten Haaren, die, stets perfekt geschnitten und frisiert, wie ein Helm wirkten. Sie hatte den Satz immer wieder gesagt: Die staatliche Prüfung für die Fremdenführerlizenz in Rom ist ein Gang durch die Hölle. Die Kandidaten müssen über tausend komplizierte Fragen zu Geschichte und Kunstgeschichte beantworten können. Aber dafür verdient man mit der einmal erworbenen Lizenz in der Tasche wirklich nicht schlecht. Die Vorbereitung auf diese Prüfung in ihrer Schule dauert ein Jahr, und an Bewerbern mangelt es nicht. Fernanda hat es nicht nötig, junge Menschen in ihre Schule aufzunehmen, wenn sie nicht absolut motiviert sind. Deswegen ist schon ihre Aufnahmeprüfung gefürchtet. Ich hatte Fernanda versichert, dass mein Sohn der perfekte Kandidat sein würde.
»Was hat sie denn so Kompliziertes gefragt? Musstest du Mark Aurels Selbstbetrachtungen interpretieren, oder was war so unüberwindlich?«
»Es ging um den Petersdom.«
»Um den Petersdom? Und dazu konntest du nichts sagen? Du hast fast dein ganzes Leben in Rom verbracht! Du hast schon als kleiner Junge die Tauben auf dem Petersplatz gejagt!«
Er sah jetzt ziemlich niedergeschlagen aus. Das Kartenhaus, das er und ich uns zusammengebaut hatten, war mit einem einzigen Schlag zusammengestürzt. Er hatte sein Studium mit dem gut bezahlten Job als Fremdenführer finanzieren und vielleicht sogar diesen Beruf ergreifen wollen.
Seine Voraussetzungen waren ideal: Er war in Rom aufgewachsen, kannte jeden Winkel der Stadt und wechselte mühelos zwischen Deutsch und Italienisch. Für seine italienischen Konkurrenten war es ebenso schwer, die Prüfung zu bestehen, aber Fremdsprachen konnten die wenigsten – und die Deutschen gehören mit über 600 000 Besuchern pro Jahr zu den wichtigsten Kunden.
Andreas und Leonardo Englisch vor dem Petersdom. Zusammenhalten zwischen Vater und Sohn ist gefragt: Nachhilfe bei der gemeinsamen Erkundung von Rom.
© Privat
Außerdem war mit der verhagelten Aussicht, Fremdenführer zu werden, sein gewachsenes Ansehen in unserem Stadtteil Trastevere futsch. Ich kenne Dutzende Römer, die noch nie im Kolosseum oder in der Sixtinischen Kapelle waren. Sie halten dieses Desinteresse für einen Ausweis ihres Privilegs. Sie sagen: Ich bin Römer, das Kolosseum ist einfach da, ich könnte es mir ansehen, wann immer ich will. Gleichzeitig empfinden sie es als ungemein schmeichelhaft, sobald jemand die Schätze ihrer Stadt wirklich genau studiert. Denn dann sind sie nicht mehr irgendwer, sondern Bewohner eines der erstaunlichsten Orte der Welt. Als Leo durchblicken zu lassen begann, dass er Fremdenführer werden wollte, überschütteten ihn unsere Bekannten in Trastevere regelrecht mit Wohlwollen, womit es jetzt wohl vorbei war.
Was mich aber am meisten ärgerte, war, dass ich wusste, wie gut er diesen Job machen würde. Ich begleite seit Jahrzehnten Gruppen in Rom, und ich hatte ihn oft mitgenommen. Leo war ein Naturtalent. Es war ihm gegeben, mit Fremden umzugehen, ihnen etwas zu erzählen, sie so zu behandeln, dass sie sich wohlfühlten.
Andreas Englisch in der Kirche Santa Maria Maggiore. Bitte genau hinsehen: Es gibt viel, sehr viel zu entdecken in Rom.
© Privat
Die Voraussetzungen für eine finanziell abgesicherte Zukunft als Fremdenführer waren perfekt, und jetzt hatte er es verbockt, den ersten kleinen, aber entscheidenden Schritt vergeigt, einfach weil er ein stinkfauler Teenager war, der lieber auf Youtube surfte, als Schulwissen zu pauken.
»Aber du hast doch gelernt?«, fuhr ich ihn an. »Ich habe in deinem Zimmer stapelweise Bücher gesehen, und wenn du dich eingeschlossen hast, um nicht gestört zu werden, hast du doch gelernt, oder?«
Hatte er nicht. Er hatte sich auf Fernandas kleinen Eignungstest schlicht nicht vorbereitet.
»Du riskierst deine Zukunft, weil du in einem Kurs für angehende Fremdenführer nichts über deine Heimatstadt weißt, die erstaunlichste Stadt der Welt. Hast du sie noch alle?«
Dass Leo, der in Rom aufgewachsen war, Probleme damit haben könnte, Fernanda etwas über die wichtigsten Monumente der Stadt zu erzählen, das hatte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen können. Vermutlich war es eine ziemliche Herausforderung für einen Schüler in Kuala Lumpur, den Baldachin des Bernini in der Peterskirche zu beschreiben, aber Leo hatte die barocken Prachtstücke Roms ungefähr so oft gesehen wie andere den nächsten Aldi-Markt in ihrer Heimatstadt.
Leo murmelte kleinlaut: »Vielleicht gibt es noch eine Chance.«
»Was für eine Chance?«
»Signora Fernanda war ziemlich sauer, aber dann sagte sie: ›Pass auf, Leo, ich gebe dir die Gelegenheit, mich ein echtes Wunder erleben zu lassen. Du behauptest, du hattest einen Blackout. Ich glaube, du weißt gar nichts. Aber nehmen wir einmal den unwahrscheinlichen Fall an, dass du tatsächlich einen Blackout hattest, dann kommst du am Montag noch einmal und beeindruckst mich mit dem profundesten Wissen, das je ein Schüler vor mir ausgebreitet hat.‹«
Ein bisschen Hoffnung stand im Raum. »Und worüber will sie dich befragen?«
»Über den Petersdom.«
»Nur den Petersdom?«
»Sie sagt, für den Anfang. Möglicherweise stellt sie später auch andere Fragen.«
»Wonach will sie fragen?«
»Na ja, es geht immer um Rom.«
»Es gibt ganze Bibliotheken über Rom.«
»Ich denke, es geht nur um das wirklich Wichtige.«
»Selbst das Wichtigste füllt Bände«, schrie ich, »und du hattest fast ein Jahr Zeit, dich vorzubereiten, und hast gar nichts getan. Wie willst du das an einem Wochenende aufholen?«
»Dass du mir sagen würdest, ich schaffe es sowieso nicht, darauf hätte ich schwören können«, brüllte Leo zurück.
»Wenn du ein paar Monate früher angefangen hättest, dann wäre es zu schaffen gewesen. Was hast du denn das ganze Jahr in deinem Zimmer gemacht? Filme gestreamt und Facebook-Posts geliked, statt mal in deine Bücher zu schauen?«
Er drehte sich um, stampfte die Treppe hinauf zu seinem Zimmer und knallte die Tür zu.
II
Ein paar Stunden später stand Daniele in der Haustür, der beste Freund meines Sohnes, und es geschah etwas Außergewöhnliches: Er nahm mich wahr, als Mensch. Ich war nicht nur, wie sonst, ein Teil des Mechanismus, der die Tür zum Haus seines Freundes öffnete, sondern ein denkendes und möglicherweise fühlendes Wesen. Er nickte mir sogar zu, blieb zu meinem Erstaunen stehen, statt wie sonst immer mit seinem personalisierten Playstation-Controller in der Hand im Keller zu verschwinden, um mit meinem Sohn Zombies den Kopf wegzuballern.
Ich hatte mich früher gefragt, ob er einfach zu schüchtern war, um mit mir zu sprechen. Da er aber keinerlei Hemmungen zeigte, sich am Samstagabend vor einer Party in meiner Küche an mir vorbeizudrücken, sich am Kühlschrank zu bedienen, um sich ein paar Lachsbrote auf dem Tresen zu machen und diese mit meinem besten Weißwein hinunterzuspülen, hegte ich den Verdacht, er habe kein Problem mit Hemmungen, sondern nur fürchterliche Manieren.
Vor unendlich langer Zeit hatte er mich mit »Herr Englisch« angesprochen, aber jetzt war er zu einem »Hörnsema« übergegangen. Er schaute mich an, äußerte das vertraute »Hörnsema« und fuhr dann vertraulich fort: »Sie sind wahrscheinlich ziemlich sauer auf Leo wegen der verhauenen Prüfung, oder?«
»Das ist hoffnungslos untertrieben«, sagte ich, »ich bin stinksauer. Ich kann mir nicht erklären, wie ein Schüler, der Fremdenführer werden will, der in Rom aufgewachsen ist, nichts über diese Stadt sagen kann.«
»Sie sollten vielleicht was wissen«, unterbrach er mich.
»Und was?«
»Na ja, wenn Leo die Aufnahme doch noch schaffen sollte, dann ist er im nächsten Jahr im Fremdenführerkurs mit Carlotta, aber wenn nicht, und es sieht wohl nicht so gut aus, dann wird das wohl nichts.« Er sah mich prüfend an, um sicherzugehen, dass ich die Tragweite des Gesagten verstanden hatte.
Das hatte ich. Carlotta war das mit weitem Abstand schönste Mädchen an der Schule meines Sohnes, sie ging in die Parallelklasse, und er war seit vielen Jahren heimlich in sie verliebt. Ihm schoss schon die Röte ins Gesicht, wenn sie nur auf der anderen Straßenseite vorbeikam. Sie anzusprechen oder einzuladen, hätte er sich nie getraut, und jetzt hätte er also fast den Hauptgewinn gezogen in Form einer Arbeitsgruppe mit ihr. Diese Chance war nun sehr wahrscheinlich vertan, weil er nichts über Rom wusste. Sein Pech.
III
Natürlich hätte ich etwas tun müssen. Verständnis zeigen, nach einem Ausweg suchen, positiv verstärken oder irgendetwas anderes, was in Elternratgebern steht. Stattdessen war ich nur wütend auf ihn, und ich genoss es zu sehr, um ihm zu helfen. Ich hatte ihm die Gelegenheit gegeben, in der wahrscheinlich schönsten Stadt der Welt aufzuwachsen – und hatte ihn diese Stadt im Mindesten geschert? Nein! Die Menschen des Mittelalters hatten ihr Testament gemacht, bevor sie sich auf die damals lebensgefährliche Reise nach Rom begaben, um einmal im Leben die Ewige Stadt zu sehen. Und mein Sohn? Er hätte jeden Tag seines Lebens die unvorstellbaren Kunstwerke Roms verinnerlichen können, eine unfassbare Schatztruhe, wie es sie in keiner anderen Stadt der Welt gibt. Aber mein Sohn hatte das alles ignoriert.
Ich bin sicher, dass ich nicht in der Lage gewesen wäre, über meinen Schatten zu springen und ihm zu helfen, wenn ich nicht in einen Chat seiner WhatsApp-Gruppe geschaut hätte. Natürlich war es mir nicht gestattet, die Peinlichkeiten und Eingeständnisse meines Sohnes auszuspionieren, aber ich hatte mich erfolgreich eingehackt. Das hatte aber nichts mit meinen Hackerqualitäten zu tun; die sind außerordentlich begrenzt. Ich hatte in einem Getränkemarkt einen Mitschüler meines Sohnes gesehen, der versuchte, zwei Kisten Bier, eine Kiste Wein und etwas Schnaps für seine Geburtstagsparty zu kaufen, aber die Kassiererin hatte sich den Ausweis zeigen lassen und gesehen, dass er erst 17 war. Ich hatte ihm den Stoff gekauft und mir dafür die Zugangsdaten zum Chat geben lassen – und vermutlich damit einen jungen Menschen in die lebenslange Alkoholabhängigkeit getrieben.
Ich checkte den Chat routinemäßig, und da war es: Eine Erklärung von Carlotta, die Leo betraf. Ich las es und begriff augenblicklich. Jetzt hatte er eine Chance. Mein Sohn besitzt die Fähigkeit vieler junger Menschen, mit annähernd Lichtgeschwindigkeit auf seinem Smartphone zu tippen. Er war vermutlich der Ansicht, dass er einen sofortigen tödlichen Entzug erleiden würde, wenn er nicht alle paar Minuten alle Chats checkte. Es konnte also nur ein paar Augenblicke dauern, bis Leo den Eintrag von Carlotta las. Ich machte mir einen Kaffee und arbeitete ein wenig, dann war ich sicher, dass Leo Carlottas Message bereits gelesen haben musste. Ich ging zu seinem Zimmer, klopfte an, bekam keine Antwort und machte daher die Tür auf. Er lag in der vollkommenen Verzweiflungshaltung mit dem Bauch auf dem Bett und quetschte seinen Kopf in das Kissen. Es war die gleiche Haltung, die er einnahm, wenn er noch sehr müde war und meine Frau oder ich ihn wecken mussten: achtzig Kilo Verzweiflung, verbunden mit der einzigen Hoffnung, durch schlichtes Liegenbleiben die Tatsache wegzuwischen, dass er in einer Welt aufgewacht war, in der es Prüfungen gab.
Der Autor vor dem Kolosseum. In diesem Stadtviertel am Amphitheater der Flavier wohnte der Autor viele Jahre; für ihn ist es das schönste der Stadt.
© Privat
»Sie will dich zuerst über die Peterskirche prüfen, also, was weißt du über die Peterskirche?«
»Papa, es hat keinen Sinn«, schnaufte mein Sohn in das Kissen. »In meinem Kopf geht alles durcheinander, Michelangelo, Bramante, Barock, Borromini.«
Ich sah auf seinen Schreibtisch, auf dem sich Bildbände türmten.
»Ich verwechsle alles. Giorgio Vasari, Raffael, Canova. Ich kann das einfach nicht; ich hätte eine andere Ausbildung wählen sollen.«
»Und wenn wir zusammen hingehen und uns die Kirche einfach anschauen?«
Mir schlug Stille entgegen. Das pubertäre Hirn, das elterliche Vorschläge nur tröpfchenweise durchlassen kann, schien zu arbeiten. Mein Sohn schnaufte in das Kissen.
»Es geht nicht«, murmelte er schließlich.
»Wieso nicht?«
»Am Nachmittag kann ich nicht. Um 13 Uhr kommt der Mathe-Nachhilfelehrer und bleibt bis zum Abend, weil ich am Montag eine entscheidende Matheklausur habe, und ich kann jetzt nicht auch noch das Abi versauen.«
»Dann gehen wir eben am Vormittag in die Kirche, wenn du am Nachmittag nicht kannst.«
Mir lief es eiskalt den Rücken hinunter. An diesem Sonntagvormittag las der Papst die Messe in der Peterskirche. Wenn ich während des päpstlichen Gottesdienstes meinem Sohn die Kirche zeigte, war ich meinen Job los. Wir konnten uns am Sonntagvormittag die Kirche nicht ansehen, unmöglich.
Leo ahnte nichts von meiner Panik. »Aber selbst wenn wir dahin gehen, ich kann mir das einfach nicht merken.«
»Leo, wenn wir uns eines nach dem anderen ansehen und ich dir was darüber erzähle, dann kannst du dir das merken. Es ist mein Job, das erzählen zu können.«
»Ich kann mir nicht merken, was mir jemand erzählt.«
»Dann nimmst du es mit dem Smartphone auf.«
Was machte ich da? Versprach ich meinem Sohn gerade, dass er mit dem Handy während eines Gottesdienstes des Papstes fotografierend durch die Peterskirche laufen könnte? Ich musste verrückt geworden sein oder ein verzweifelter Vater, was gelegentlich auf das Gleiche hinausläuft.
»Ich könnte die wichtigsten Sachen mit dem Handy fotografieren, und ich glaube, das könnte ich mir merken«, sagte er plötzlich, als habe er jetzt erst verstanden, worüber wir sprachen. Dann geschah etwas äußerst Seltenes: Energie erwachte in ihm für ein Projekt, an dem auch Eltern beteiligt waren, während im Normalfall jede Energie aus diesem jungen Menschen wich, sobald er etwas mit seinen Eltern unternehmen sollte.
»Ja klar, wir sehen uns die Kirche an, du fotografierst mit dem Handy, wir besprechen alle wichtigen Kunstwerke – dann hast du eine Chance, den ersten Prüfungstag bei Fernanda zu bestehen.«
Jetzt war ich komplett übergeschnappt.
Er setzte sich auf. Hoffnung keimte offensichtlich in ihm, dass er Informationen, die einmal in sein Handy gelangt waren, verstehen und behalten könnte. Ich habe einen Freund, der in der Museumsverwaltung der Stadt Rom arbeitet. Er nannte dieses Phänomen GAH, Gehirn-Ausfall-Hilfe. Sie hatten die GAH für Schüler zufällig entdeckt. In den Museen werden die ausgestellten Kunstwerke in der Regel beschriftet. Genannt werden meist der Künstler, der Titel des Werks und wann es geschaffen wurde. Die Erfahrungen hatten gezeigt, dass Schüler sich über Generationen hartnäckig weigerten, diese Beschriftungen zu lesen. Verzweifelte Lehrer unternahmen alles Mögliche, von der Schmeichelei bis zur offenen Androhung von Sanktionen, um die Schüler dazu zu bringen. In den Schülerköpfen schien es aber eine Art automatischer Blockade zu geben.
Ein Zufall führte zur Entdeckung einer GAH. Ein Computerfreak in der Verwaltung hatte aus Spaß zwei Bildunterschriften digitalisiert. Die Nutzer mussten einen Barcode in das Smartphone einlesen, dann erschien dort die Bildunterschrift. Das Ergebnis ist das gleiche: Auf dem Handy-Display erschienen der Titel des Werks, der Maler, das Jahr der Entstehung. Und es geschah etwas, das kein Mensch für möglich gehalten hatte. Die Schüler waren geradezu hingerissen von den Bildunterschriften, aber nur wenn sie den Text vorher mit dem Barcode in ihr Handy eingescannt hatten – und sie lasen sie dort tatsächlich. Während die analoge Bildunterschrift für einen Gehirn-Ausfall sorgte, schufen der Barcode und das Handy Hilfe, GAH.
Vater und Sohn Englisch am Vierströmebrunnen auf der Piazza Navona: Lust auf eine unvergleichliche Stadt, Kunstwerke anschauen statt YouTube, echtes Leben statt Computerspiele.
© Privat
Hier schien eine Art moderner Zauber am Werk: Sobald irgendetwas in ein Smartphone gelangte, schaffte der Inhalt auch den Weg in den Kopf eines Schülers, egal, ob ein Youtube-Video oder Infos über Renaissance-Maler.
»Okay«, hörte ich mich sagen. »Dann gehen wir morgen früh in die Peterskirche.«
Sag ihm sofort, dass das nicht geht – die Stimme in meinem Kopf klang flehend. Ich schwieg und wusste, dass ich dabei war, eine Katastrophe heraufzubeschwören.
Einen Augenblick später fragte Leo: »Was meinte Carlotta wohl mit dem, was sie geschrieben hat? Was denkst du?«
Ich spürte, dass ich rot wurde. Wie zum Henker hat er herausbekommen, dass ich den Chat gehackt hatte? Ich hatte mich als Paolo_66 getarnt. Es musste in der verdammten Gruppe doch irgendeinen Paolo geben.
»Ich weiß nicht, was du meinst.«
»Tu nicht so blöd«, schnappte er, »erspar mir das Theater, dass du angeblich nicht weißt, was sie geschrieben hat. Bitte, es ist für mich wichtig. Was, meinst du, heißt das?«
Ich war erwischt worden und beschloss, das Beste daraus zu machen. »Sie schreibt, dass es ihr leidtut, dass sie mit dir vielleicht im nächsten Jahr nicht die Arbeitsgruppe machen kann, weil du bei Fernanda durchgefallen bist und den Stoff nachzuholen, kaum zu schaffen ist. Entweder ist sie einfach nur höflich, oder aber sie mag dich besonders, und sie ist enttäuscht, dass sie dich nächstes Jahr vielleicht nicht sehen wird.«
»Und wie bekomme ich heraus, ob sie nur höflich ist oder mich mag?«
»Ich glaube, es gibt nur eine Möglichkeit. Du musst die Prüfung bestehen. Das heißt immer noch nicht, dass sie dann deine Freundin wird, aber du hättest eine Chance.«
IV
Wie soll ich meinen Sohn Leonardo vorstellen? Im Allgemeinen bin ich zurzeit ziemlich schlecht darin, junge Menschen vorzustellen. Das liegt an meinem Alter. Ich werde fürchterlich sentimental, sobald ich die Mädchen und Jungs sehe, die mit meinem Sohn aufgewachsen sind. Ich habe sie noch aus der Zeit in Erinnerung, als sie mir bis zur Kniescheibe reichten. Dass sie jetzt Erwachsene sind, nimmt mich sehr mit. Dabei bin ich leider nicht sonderlich geschickt darin, ihnen meine Anteilnahme auszudrücken. Als Susi, Leos Freundin seit dem Kindergarten, mich zu ihrem achtzehnten Geburtstag besuchte und ihren Freund mitbrachte, erzählte ich voller Rührung aus ihren Kindertagen. Ich hatte sie immer ihre kleinen Hände in unser Bidet mit kaltem Wasser halten lassen, denn dann musste sie sofort aufs Klo, und ich konnte sicher sein, dass sie nicht im Schwimmbad Pipi machte. Susi verabschiedete sich mit ihrem Freund überraschend schnell.
Leo wüsste, wie er sich vorstellen könnte. Er hat mir erklärt, dass es für einen Jugendlichen absolut unerlässlich ist, sich mit einer Schulnote einzuordnen. Man musste herausfinden, ob man eine Vier oder gar eine Fünf oder eine Eins oder Zwei war. Als Drei hatte man gute Chancen, eine Drei als Freundin zu bekommen, wenn man Glück hatte, sogar eine Zwei minus, niemals aber eine Eins.
Leo schätzt sich als Drei ein. Zu viel Speck und zu unsicher, um es zu einer Zwei zu schaffen. Er ist muskulös und ziemlich sportlich, aber nicht schlank genug, um als athletisch zu gelten; er kann sehr witzig und charmant sein, aber es reicht nicht zum Leader in der Gruppe. Sein größter Nachteil ist seine Eifersucht. Er hasst es, ausgeschlossen zu werden oder etwas zu verpassen. Sein größter Vorteil ist, dass er viel Mut hat, dass er ziemlich gut einstecken kann und ein ungewöhnlich ehrlicher Mensch ist. Sein dichtes lockiges Haare und seine kräftige Statur lassen ihn etwas älter erscheinen, als er ist. Seine Gesichtszüge sind ständig in Bewegung, denn er macht häufig andere nach, wie in einer Pantomime; er ist in seinem Inneren ein Schauspieler.
Die erstaunlichste Entdeckung, die Leo betraf, machten wir, als er etwa dreizehn Jahre alt war. Meine Frau und ich gehören zu einer Generation, die Mittagessen aus einem Grund, den ich nicht mehr vollkommen nachvollziehen kann, spießig, überholt, also irgendwie doof fanden, möglicherweise hatten wir uns beide während des Mittagsbratens unserer Eltern zu Tode gelangweilt. Soweit ich mich erinnern kann, scheint meine Aversion gegen Mittagessen als junger Erwachsener begonnen zu haben: wenn ich nach Feten am Samstag kurz vor halb zwölf mittags aus dem Bett geworfen wurde, um mich zum Schweinebraten mit meinen Eltern an den Mittagstisch zu setzen, obwohl ich mich eigentlich nur nach einem starken Kaffee sehnte. Wie auch immer. In Rom probierte ich alle möglichen Formen der Nahrungsaufnahme aus, die das Mittagessen ersetzten. Aber die Hauptmahlzeit gab es bei uns zu Hause immer abends. In Rom kostete es mich sogar eine Freundschaft, dass ich das sich endlos in den Nachmittag hineindehnende Pranzo (Mittagessen) der Römer nicht ausstehen konnte. Ich hatte einen süditalienischen Freund, der ständig wollte, dass wir uns mit den Frauen am Wochenende zum Mittagessen trafen. Ich wollte das nicht; ich fand es albern und altmodisch, diese endlose Nudelesserei. Irgendwann rief er mich nicht mehr an.
Als Leo in die Schule kam, blieb es dabei, dass wir abends zusammen aßen. Mittags gab es ein Stück Pizza, manchmal Sushi, irgendwas, das schnell ging. In den Ferien und an den Wochenenden mieden wir Mittagessen weiterhin strikt. Wer nach dem Frühstück irgendwann Hunger hatte, machte sich einen schnellen Snack. Eines Tages, mitten in den Ferien, stellte Leo einen Topf Wasser auf den Herd, deckte für eine Person, also sich selbst, den Tisch, kochte Nudeln und zelebrierte ein über eine Stunde sich hinziehendes Mittagessen. Feierlich verkündete er uns, dass es ihm reiche in dieser Familie; ab jetzt mache er sich das Pranzo selber. Mittags um 13 Uhr gibt es seitdem jeden Tag einen großen Teller mit Pasta (Nudeln). Von einer Sekunde auf die andere verstand ich damals, dass wir mit einem Italiener unter einem Dach lebten. Von diesem Tag an verzichtete unser Sohn nie wieder auf das Mittagessen, und es muss Nudeln geben; jede andere Speise zu Mittag lehnt er ab, egal, ob wir in Italien oder irgendwo im Ausland sind. Er akzeptiert weder Pommes frites noch Schnitzel, Bratwurst, Sashimi oder Kebab. Leo isst Nudeln. Basta. Bei Spielen der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Italien begann er, die Azzurri (die Italiener) anzufeuern, und sang mit Inbrunst die italienische Nationalhymne mit.
Ich weiß nicht, ob es die Hitze in Rom war, das Essen, einfach die Luft oder was auch immer, irgendwie verwandelte sich mein Sohn, der in einer deutschen Familie aufgewachsen war, in einen Italiener, um genau zu sein, in einen Römer. Er fühlte sich nur dann wohl, wenn wir in eine der sehr lauten Trattorien der Römer in Trastevere gingen. Meine Frau und ich hatten uns in Erinnerung an unsere deutschen Wurzeln einmal in der Woche eines der sehr seltenen, guten, aber leisen Restaurants in Rom gegönnt, wo man nur die Gläser klirren hört. Leo fand das entsetzlich. Er brauchte den enorm hohen römischen Geräuschpegel, um sich wohlzufühlen.
Der jahrtausendealte Zauber des Pantheon. Streifzüge durch den Alltag einer ganz besonderen Heimatstadt.
© Privat
Er verlor vollkommen die deutsche Angewohnheit, sich abzukapseln. Ich bemerkte das zum ersten Mal auf dem Flughafen in Hamburg. Wie in Deutschland üblich, saßen die wartenden Passagiere für sich allein, also weit verstreut auf den Bänken, mit mindestens einem leeren Platz zwischen sich und dem Nebenmann. Römer sitzen dagegen vor einem Flug auf einem Haufen so eng wie möglich beieinander, und genauso verhielt sich Leo. Er setzte sich immer neben eine(n) der Wartenden, quatschte den Nebenmann/die Nebenfrau hemmungslos an, selbst wenn der oder die las oder an seinem Handy herumspielte.
Allein – also nur mit der Familie – zu Abend zu essen, begann Leo zu hassen. Er fühlte sich nur dann gut, wenn die üblichen Massenabendessen an unseren fünf Meter langen Tischen stattfanden, mit zwanzig oder mehr Freunden, die stets alle durcheinander redeten und ein infernalisches Geschrei veranstalteten.
Leider entwickelte Leo auch eine andere typisch römische Eigenart: eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber seiner Stadt. Ich habe Freunde in Rom, die in der vierten Generation hier leben und noch nie im Kolosseum oder in der Sixtinischen Kapelle waren. Wenn man sie fragt, wieso das so ist, sagen sie immer dasselbe: Das alles ist ja immer da. Wozu sollte man hingehen? Das kann man auch den Touristen überlassen – und genau dieses Problem musste ich jetzt ausbaden.
Petersplatz
Schicksalsort Europas
Am Sonntagmorgen stand ich etwas früher auf und rief Giuseppe an, der zu den Edelleuten des Papstes zählte, den Gentiluomini di Sua Santità. Sie fungieren in der Peterskirche während der Gottesdienste des Heiligen Vaters als Platzanweiser für VIPs, geleiten also Minister, Kardinäle oder Botschafter zu den für sie vorgesehenen Plätzen.
»Bist du wahnsinnig?«, blaffte er mich an, nachdem ich ihm am Telefon mein Problem erklärt hatte. Ich hörte, dass er sich anzog, während wir telefonierten, die Krawatte umband, in die Jacke schlüpfte. Er musste schon vor der Öffnung für Besucher in der Peterskirche sein.
»Du weißt genau, dass es absolut verboten ist, während der Gottesdienste des Papstes durch die Kirche zu laufen und die Sehenswürdigkeiten zu bestaunen.«
»Aber es ist eine Ausnahmesituation.«
»Zeig ihm die Kirche morgen oder am Nachmittag oder wann immer du willst, aber du kannst unmöglich heute Morgen durch den Petersdom spazieren und deinen Sohn Handy-Fotos machen lassen. Das muss ich dir doch nicht erklären.«
»Du bist ja da! Kannst du nicht die Wachmänner bitten, ein Auge zuzudrücken?«
»Das werde ich ganz sicher nicht tun, und ich warne dich: Beruf dich bloß nicht hinter meinem Rücken auf irgendeine Ausnahmegenehmigung von mir. Der Papst ist der Papst, und wenn er in der Kirche ist, dann ist das seine Kirche. Du kannst mit deinem Sohn gern kommen und in Stille beten. Aber eine Sightseeingtour kannst du vergessen.«
»Es geht nicht anders. Es muss heute Morgen sein!«
Er schnaufte: »Ich werde keinerlei Ausnahme zulassen. Ich beschwöre dich, versuch es erst gar nicht, die Folgen wären fürchterlich, das weißt du. Lass den Mist!« Er legte auf.
Mein Sohn kam mit frisch gewaschenen strubbeligen schwarzen Haaren, mit einem akzeptablen Hemd und einer fast sauberen Hose aus dem Badezimmer, das voll geladene Handy schussbereit in der Hand.
»Und? Geht es los zum Petersdom?«
»Ja«, sagte ich, »es geht los.«
Ich schaffte es einfach nicht, den kurzen Satz über die Lippen zu bringen: Es tut mir leid, es geht heute nicht.
Ich würde mich um Kopf und Kragen bringen.
Trotzdem warf ich meinem Sohn seine Jacke zu, zog meine an, und wir liefen zum Fahrstuhl – ins Verderben.
Wir bretterten mit den Fahrrädern die Via delle Fornaci hinunter, wobei das Umfahren der mitten in der Straße versenkten Kanaldeckel eine ziemliche Herausforderung war. Wir ketteten die Fahrräder in der Nähe der Glaubenskongregation an und gingen auf die südliche Kolonnade zu.
Alle Pilger der Welt
Von dieser Seite, von der Piazza del Sant’Uffizio auf den Platz vor dem Petersdom zu kommen, erscheint mir als die mindeste Geste, um dem überragenden Baumeister Gian Lorenzo Bernini, der den Petersplatz entwarf, Ehre zu erweisen. Er entwickelte die geniale Idee, die Pilger durch die engen Gassen des Borgo-Viertels laufen zu lassen, um sie aus dem Gewirr der schmalen Gänge auf den riesigen Platz zu leiten, der sich urplötzlich vor ihnen öffnete und dessen Kolonnaden wie zwei Arme alle Pilger der Welt umfassen sollten. Der architektonische Vollidiot Benito Mussolini ließ diese wundervolle Idee zerstören und sorgte für eine der dümmsten Bausünden Europas: Er ließ die breite Aufmarschstraße Via della Conciliazione anlegen, die auf den Petersplatz zuführt. Wenigstens ein bisschen Rache an Mussolini kann man üben, indem man die von ihm angelegte Straße ignoriert und nicht von der Engelsburg, sondern von der Seite auf den Petersplatz geht. Den Effekt, den Bernini erzielen wollte, kann man auf diesem Weg immerhin erahnen.
Nach der Ära Mussolini war es der internationale Terrorismus, der ein weiteres Mal die Umgebung des Petersdoms und die Via della Conciliazione drastisch veränderte. Die Straße gehörte jahrzehntelang zu den befahrensten Roms. Ich selbst habe sie mehr als zwanzig Jahre auf dem Weg zu meinem Büro im Vatikan genutzt. Doch nach den Terroranschlägen in Paris und London kam der Polizei in Rom der Gedanke, dass ein mit Sprengstoff gefüllter Lkw, der im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit 2016 mitten in die Abertausende von Menschen auf den Petersplatz rast, eine katastrophale Wirkung erzielen könnte. Die Polizei ließ also für das Heilige Jahr die Via della Conciliazione komplett sperren und hob nach dem Heiligen Jahr die Sperre einfach nicht wieder auf, zum Entsetzen der Taxifahrer und Pilger mit Gehbehinderungen. Der Taxistand am Petersplatz existiert nicht mehr; man kommt bis heute weder mit dem Auto noch mit dem Bus bis an den Platz heran.
Ich ging also mit Leo über den Platz und gab ihm sein Ticket für die Papstmesse.
»Woher bekommst du die eigentlich, kann man die kaufen?«
»Nein. Die Tickets für die Papstmesse sind kostenlos; man muss ein Fax schicken, um sie zu bekommen.«
Leo blieb wie vom Blitz getroffen stehen und sah mich mit einem Ausdruck der Fassungslosigkeit an. »Du bestellst sie also mit einem Fax? Du meinst tatsächlich ein Fax, nicht etwa eine E-Mail?«
»Nein«, antwortete ich, »ist doch egal; aber man muss ein Fax schicken.«
»Ein Fax! Oh Gott, ich hätte wissen müssen, dass eine Messe mit dem Papst eine Sache für Hinterwäldler ist.«
»Wie bitte? Hinterwäldler? Ein Gottesdienst mit dem Papst im Petersdom dürfte eine der exklusivsten Veranstaltungen auf dem Planeten sein. Wie kommst du darauf, das sei eine Sache für Hinterwäldler?«, fragte ich irritiert.
»Weil du ein Fax geschickt hast.«
»Was hat das damit zu tun?«
»Ich will eigentlich nicht in eine Veranstaltung gehen, die man mit einem Fax buchen muss.«
»Wieso?«
»Mann, bist du rückständig. Stell dir mal vor, du willst ein Flugticket buchen, und die Airline bittet dich, ein Fax zu schicken, um einen Platz zu reservieren. Weißt du, womit ich dann rechnen würde? Dass eine solche Airline ein Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg einsetzt, das einen Motorschaden haben und mich in den Tod reißen wird. Solch eine rückständige Airline würde ein Fax als Buchung wollen. Und wenn ich daran denke, dass von diesen Massen an Pilgern, die hier in die Kirche wollen, jeder Einzelne ein Blatt Papier ausdruckte und an ein Faxgerät im Vatikan schickte, dann ist diese gottverdammte Kirche wahrscheinlich schuld daran, dass das halbe Amazonas-Gebiet abgeholzt wurde. Weißt du was: Mein Fitness-Studio lässt mich alle meine Termine über das Internet buchen. Das heißt, dass deine weltumspannende Kirche, von der du ständig faselst, rückständiger ist als ein beschissenes Fitness-Zentrum.«
Jetzt reichte es mir.
»Diese Kirche, die du so lächerlich findest, weil sie sich noch Faxe schicken lässt, hat diesen Planeten verändert und bis heute geprägt, über zwei Jahrtausende.«
»Dass sie was verändert hat, ist Jahrhunderte her und hat mit dem modernen Europa nichts mehr zu tun. Heute gibt’s ohne die Kirche Party in Paris, Prag und Warschau, in Budapest und Bratislava«, erwiderte mein Sohn scharf.
Keine Party in Warschau
»Dein Europa?«, fuhr ich ihn jetzt an, »dein Europa, in dem du dich so wohlfühlst, das gäbe es heute gar nicht, wenn auf diesem Platz die Dinge ein klein wenig, nur ein ganz klein wenig anders gelaufen wären.«
Ich zerrte ihn regelrecht zu dem kleinen weißen Stein, der in der Nähe des Portone di Bronzo auf der linken Seite des Petersplatzes im Boden eingelassen war.
»Hier stand am 13. Mai 1981 Mehmet Ali Ağca und schoss mit einer Pistole vom Typ Browning auf einen Mann, den du gekannt hast. Der mit dir gespielt, dich auf den Arm genommen hat.«
Leo nickte unwillig. »Ich weiß, Papst Johannes Paul II.«
»Genau, Papst Johannes Paul II. Ali Ağca schoss auf den Kopf des Papstes, der Schuss ging daneben; da wurde er nervös, zielte diesmal auf den Bauch des Papstes. Karol Wojtyła brach blutend zusammen – und danach entschied sich hier auf dem Platz das Schicksal Europas, und zwar um Haaresbreite.«
Eine Steinplatte erinnert an das Attentat vom 13. Mai 1981, als Mehmet Ali Ağca auf Papst Johannes Paul II. schoss.
© picture-alliance/epa-Bildfunk/Danilo Schiavella
»Wieso das denn?«
»Wenn du die Via della Conciliazione in Richtung Engelsburg hinunterschaust, siehst du eine Kreuzung.«
»Klar«, sagte Leo. »Da liegt das Santo-Spirito-Krankenhaus.«
»Genau. Das heißt, der Papst, dessen Bauchschusswunde stark blutete und der in einem Toyota-Jeep auf dem Boden lag, war aber Gott sei Dank nur knapp 950 Meter von einem rettenden Krankenhaus entfernt.«
»Und?«
»Es galt damals noch die Regel, dass ein Papst nur auf vatikanischem Boden behandelt werden darf; also begingen die Beteiligten einen katastrophalen Fehler: Statt den blutenden Papst sofort in das Santo-Spirito-Krankenhaus zu bringen, transportierten sie ihn in den Vatikan und luden ihn in einen Krankenwagen des Vatikans um, dessen Blaulicht kaputt war. Dann fuhren sie ihn ohne Polizei-Eskorte durch das Chaos des römischen Stadtverkehrs die lange, genau 10,4 Kilometer lange Strecke bis ins Vatikan-Krankenhaus, die Gemelli-Klinik. Dort angekommen, begingen sie einen weiteren fatalen Fehler. Sie schafften den Papst in das für Päpste reservierte Appartement im zehnten Stock. Erst dort realisierte eine Krankenschwester, dass der Mann, der seit über einer halben Stunde mit einer stark blutenden Bauchwunde durch die Gegend gezerrt wurde, sofort in den OP musste. Endlich dort angekommen, glaubten die Ärzte, dass der Papst vermutlich nicht mehr zu retten sein würde, und baten den Sekretär des Papstes Don Stanisław Dziwisz um die letzte Ölung. Erst danach versuchten sie, das Leben von Johannes Paul II. zu retten.
Was wäre passiert, wenn das schiefgegangen wäre? Was wäre passiert, wenn der Papst auf dem Weg in die Gemelli-Klinik verblutet wäre? Was wäre passiert, wenn Johannes Paul II. an diesem 13. Mai 1981 gestorben wäre, auf Grund einer ganzen Reihe von Fehlern der Funktionäre des Vatikans?
Dann hätte es die von einem Papst und der ganzen Kirche gestärkte polnische Gewerkschaft Solidarność in einem kommunistischen Land nie gegeben, die Sowjets hätten den ersten runden Tisch der Verhandlungen zwischen Opposition und einer Regierung in einem Staat des Warschauer Pakts nicht hinnehmen müssen. Und vielleicht wäre das ganze Sowjetreich nie auseinandergebrochen. Michail Gorbatschow sagte, dass die Berliner Mauer ohne Johannes Paul II. nicht gefallen wäre. Wenn das hier auf diesem Platz anders gelaufen wäre, würde es dein modernes Europa vielleicht gar nicht geben, und es wäre immer noch durch Mauern in Ost und West geteilt. Deine Partys in Warschau oder Prag könntest du dann vergessen.«
Leo sah auf den Boden: »Okay, du hast gewonnen. Es hat einmal einen Tag gegeben, da hätte sich hier auf dem Petersplatz das Schicksal Europas anders entscheiden können.«
»Nein«, widersprach ich. »Nicht an nur einem Tag. Dieser Ort hier hat die Geschichte der Welt über zwei Jahrtausende immer wieder geprägt. Auch das Attentat auf John F. Kennedy in Dallas hat die Weltgeschichte beeinflusst, genauso wie das Attentat auf den Papst Johannes Paul II. hier an dieser Stelle; aber Rom hat die Geschichte der Welt unendlich stärker gelenkt als die Stadt Dallas:
Nach der Entdeckung Amerikas wird die Neue Welt hier im Vatikan zum ersten Mal aufgeteilt, Südamerika wird getrennt in eine spanische und eine portugiesische Zone, dadurch entsteht später Brasilien. Und weil ein Papst hier 1493 einen Strich auf der Karte des gerade entdeckten Südamerika gezogen hat, der allerdings ein Jahr später im Vertrag von Tordesillas nach Westen verschoben wird, spricht man heute in Rio Portugiesisch und fast im ganzen Rest des Halbkontinents Spanisch.
Dieser Ort hier ist einzigartig.
Und der Platz erinnert mich immer wieder daran, wieso ich an Gott glaube.«
Traumziel
»Ich glaube nicht an Gott«, sagte Leo trotzig.
»Das weiß ich, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht an Gott glauben darf.«
Er sah mich herausfordernd an. Möwen segelten über den Petersplatz. »Also schieß schon los. Was hat dieser Ort damit zu tun, dass du an Gott glaubst?«
Ich holte etwas aus, auch auf die Gefahr hin, Leos Geduld zu strapazieren: »Vor zweitausend Jahren war diese Stadt der eindrucksvollste Ort auf der Erde. Während im restlichen Europa die Menschen noch in Lehmhütten saßen, aus denen der Rauch schlecht abzog, wandelten die reichen Römer hier bereits durch Räume mit Fußbodenheizung. Im Grunde war eine Stadt wie Rom damals gar nicht möglich, aus dem simplen Grund, dass man so viele Menschen, etwa eine Million auf engem Raum, nicht mit sauberem Wasser versorgen und die Abwässer entsorgen konnte. Städte dieser Größenordnung überforderten eigentlich das Know-how der damaligen Zeit. Soweit man heute weiß, gelang es keiner Zivilisation vorher, eine solche Metropole zu bauen, erst den Römern.
Elf Wasserleitungen, unter ihnen Fernwasserleitungen, die bis zu 91 Kilometer lang waren, brachten jeden Tag etwa 400 Millionen Liter Wasser in die Stadt. Eine unfassbare Leistung; die Menschen wurden damals besser mit frischem Wasser versorgt als zweitausend Jahre später. Den antiken Römern stand etwa dreimal mehr Wasser pro Tag zur Verfügung als uns heute in Rom. Das Wasser floss in 1200 öffentliche Brunnen, elf große kaiserliche Thermen und 900 Bäder. Ohne es zu registrieren, nutzen wir bis heute diese architektonische Meisterleistung. Die Aqua-Virgo-Wasserleitung versorgt also seit zweitausend Jahren ununterbrochen Rom mit Wasser.
Die Ponte Fabricio, über die man heute noch zur Tiber-Insel geht, ist ein anderes Meisterwerk der damaligen Architektur, das bis heute selbstverständlich zum römischen Alltag gehört; sie übersteht Hochwasser ebenfalls seit zweitausend Jahren. Es gibt keine andere Brücke weltweit in einer großen Stadt, die so lange ununterbrochen genutzt wurde und wird.
Und hier, wo wir uns jetzt befinden, zwischen dem Vaticanus-Hügel und dem Tiber, lag eine große Totenstadt. Die Häuser der Toten, ausgemalt und ausgestattet mit Aussichtsterrassen, waren weit prächtiger als die Behausungen der Stammesfürsten zur gleichen Zeit im Norden Europas. Der Vatikanische Hügel war voller Höhlen, die schon Jahrhunderte vor Christi Geburt als Versammlungsort von Anbetern der Fruchtbarkeitsgöttin Kybele genutzt wurden. Neben diesem Mons Vaticanus und neben der Totenstadt lag der Circus des Kaisers Caligula. Vor zwei Jahrtausenden wären die Leute, die heute hier über den Petersplatz laufen, auf dem Weg in den Circus gewesen. Der Obelisk, der jetzt auf dem Petersplatz steht, stand wahrscheinlich im Zentrum des Circus; der Kaiser soll ihn mit einem Spezialschiff aus Ägypten geholt haben. Es ist der einzige Obelisk in Rom, der nie umgestürzt ist. Nur diese wenigen Beispiele vermitteln eine Vorstellung davon, wie fundamental sich diese Stadt von allem unterschied, was die damalige Zivilisation ausmachte.
Selig sind die, die Frieden stiften
Dann kam Jesus Christus. An einem Ort, der aus Sicht von hier, der Stadt Rom, dem Zentrum der bekannten Welt, in einer unbedeutenden barbarischen Provinz lag, am Ende der Welt, in dem Kaff Nazareth, wurde ein Mann geboren, der Jesus geheißen haben soll. Der Mann zog predigend durch die Dörfer im Norden des heutigen Israel, in Galiläa. Aus römischer Sicht lebten dort ein paar Irre, die sich Juden nannten und an einen Gott namens Jahve glaubten, der in ihnen das auserwählte Volk sah.«
»Ja und? Was willst du damit sagen?«, meckerte Leo.
»Jetzt denk doch mal nach. Hatte dieser Mann irgendeine Chance, mit seinen Ideen, die er weder über Facebook noch über das Fernsehen verbreiten konnte, das römische Weltreich umzukrempeln? Natürlich nicht. Was scherte es die Römer, dass am See Genezareth ein komischer Rabbiner aus Nazareth predigte, dass die selig sind, die barmherzig sind, und die, die Frieden stiften. Diese Botschaft widersprach allem, was die Römer bei ihrem märchenhaften Aufstieg erlebt hatten: Ein kleines unbedeutendes Nest am Tiber, das von den Etruskern unterdrückt wurde, jagte die Tyrannen zum Teufel und stieg zu einer Macht auf, die die ganze bekannte Welt von Portugal bis Indien, vom Norden Englands bis in das innere Afrika beherrschte. Nicht die, die Frieden stifteten, sondern die, die Kriege führten, hatten Rom groß gemacht. Die am meisten hofierten Männer Roms waren Konsuln, bis zu dem damals größten Helden: Julius Caesar. Rom war in den zurückliegenden Jahrhunderten fast ununterbrochen im Kriegszustand und damit zu einem Weltreich aufgestiegen. Nie wieder in der Geschichte hatte es eine solch unglaubliche Erfolgsstory gegeben.
Und dann tauchte also dieser Mann am See Genezareth auf und predigte so unverständliche Sachen, wie dass jene selig seien, die keine Gewalt anwendeten, denn sie würden das Land erben. Aus römischer Sicht war das totaler Blödsinn, weil römische Soldaten genau deswegen Gewalt anwendeten: um Land zu bekommen. Sie zogen in der damals bekannten Welt in den Krieg, weil ihre Feldherren ihnen Land versprachen. Überall im römischen Reich entstanden Siedlungen ehemaliger Soldaten, die gleichzeitig das Territorium sicherten.
Jetzt frage ich dich: Hatte dieser Jesus aus dem Kaff Nazareth, einem winzigen Ort, der im Alten Testament der Bibel nicht ein einziges Mal erwähnt wird, irgendeine Chance, das römische Weltreich mit seinen Ideen auf den Kopf zu stellen? Nein. Was scherte es die Mächtigen in Rom, dass irgendein Spinner weit, weit weg predigte, man solle seinen Nächsten lieben? Und dennoch: Die Ideen eines Mannes aus einem Volk, das die Römer als Feind ansahen, das sie besiegen und in alle Winde zerstreuen würden, krempelte das römische Weltreich um. Wie ist das möglich? Stammt die Botschaft des Jesus von Nazareth tatsächlich von einem unerklärlichen Gott, ist sie deswegen so erfolgreich und lässt sich auch in zwei Jahrtausenden nicht ins Vergessen verdrängen? Oder war es Zufall, dass diese Botschaft die Menschen erreichen, sie verändern konnte, einfach weil sie gut ist?
Als Roms Imperium nach mehr als tausend Jahren am Ende ist, die Stadt in Trümmer fällt, schaffen es die Ideen des Mannes aus Nazareth, diesen Ort auferstehen zu lassen. Rom wird zum Zentrum einer neuen Idee, des Christentums. Der Mann aus Nazareth hat dieser Stadt eine zweite Chance gegeben.
Nach dem Niedergang wird sie schöner und aufregender wiedererstehen. Rom wird Hauptstadt nicht einer, sondern zweier Kunstepochen: Hier werden Renaissance und Barock heimisch. Wieder fließen an dieser einen Stelle auf dem Globus Unsummen in den Ausbau einer Stadt, die sich als Hauptstadt der Welt begreift: Rom. So wird sie wieder das Zentrum eines die Welt umspannenden Reiches, diesmal eines geistlichen Reiches.«
Provinz contra Rom
»Warum erzählst du mir das alles erst jetzt?«
Wir standen auf dem sonnigen Petersplatz inmitten der Scharen von Gottesdienstbesuchern, die auf das Portal zustrebten, und mein Sohn sah mich an, als sähe er mich zum ersten Mal.
»Wie meinst du das?«, fragte ich.
»Sag mir einfach: Warum erzählst du mir das erst jetzt?«
»Wir leben hier schon so lange; ich dachte, dass du von allein alles über die Stadt mitbekommen wirst, dass du allein losgehen und sie dir anschauen wirst.«
Leo überlegte einen Moment: »Weißt du, was der Unterschied zwischen uns ist?«, meinte er schließlich.
»Keine Ahnung.«
»Es ist nicht nur, dass du mein Vater bist und viel älter, es ist etwas anderes. Du kommst aus einem ziemlich hässlichen Ort in Deutschland, Werl in Westfalen, ein Ort, der eine einzige echte Sehenswürdigkeit hat: die Mauern eines großen Gefängnisses. Oma hatte recht; sie hat immer gesagt, dass du es nicht fassen konntest, was du in Rom alles zu sehen bekommen hast, dass dich das total verändert hat.«
»Das kann sein.«
»Aber ich komme nicht aus so einem Kaff wie du, ich bin hier geboren. Ich komme aus Rom. Wenn du mal wieder irgendwem sagen musst, dass du aus Werl bist, was fragen dann die Leute? Die fragen: Wo zum Henker liegt das denn? Aber wenn sie mich fragen, dann sage ich, dass ich aus Rom komme, und schon ist alles klar. Du bist nur ein Provinztyp gewesen, der in Rom aus dem Staunen nicht mehr herauskam. Das ist doch die Wahrheit.«
Ich versuchte mit aller Macht die Beleidigung herunterzuschlucken und ruhig zu bleiben.
»In einem hast du natürlich recht. Für uns war Rom unglaublich weit weg, und es war ein Traum, dort endlich anzukommen. Vor der Peterskirche zu stehen, bedeutete, dass man angekommen war; der Traum wurde anfassbare Wirklichkeit. Wir haben stundenlang auf den Stufen der Kirche gesessen; aber es war verboten, dass wir uns dabei mit unserem billigen Porst-Fotoapparat knipsten.«
»Warum?«
»Weil unsere Mütter uns fertiggemacht hätten, hätten sie auf einem Foto gesehen, dass wir uns auf die Stufen vor einer Kirche setzten. So was machten echte Hippies, junge Leute ohne Achtung vor der Kirche. Meine Mutter drohte mir immer wieder alle möglichen Strafen an, wenn ich es je wagen würde, mich vor einer Kirche auf die Stufen zu setzen.«
»Erzähl mir nicht, dass es zu deiner Zeit noch echte Hippies gab, so mit Flower Power und gegen den Vietnam-Krieg …«
»Na ja, als ich zum ersten Mal heimlich rauchte, mit fünfzehn, war der Vietnam-Krieg erst drei Jahre vorbei.«
»Echt? Dann hast du als Kind das alles noch im Fernsehen gesehen, Hubschrauber, Napalm und so?«
»Als Kind, ja. Aber in Werl galt ein Jugendlicher schon als Hippie, wenn er lange Haare hatte und den Woodstock-Film guckte.«
»Den was?«
»Vergiss es, das war ein Festival, bei dem es jede Menge Hippies gab. In Werl reichte es völlig, auf den Stufen der Klosterkirche zu sitzen, um als Hippie zu gelten. Wenn wir uns in Rom auf die Stufen der Kirche setzten, hatten wir ein schlechtes Gewissen.«
»Wen meinst du mit ›wir‹?«
»Mein bester Freund Peter war eigentlich mein ständiger Begleiter während der Reisen nach Italien. Um nach Rom zu kommen, mussten wir zunächst ein hartes Stück Arbeit in Kauf nehmen, nämlich unsere Eltern davon überzeugen, dass wir trampen durften.«
»Ihr seid getrampt?«
»Es gab nur zwei Möglichkeiten: entweder zu Hause bleiben oder trampen. Alle anderen Fortbewegungsmittel waren für uns unbezahlbar. Niemals hätten wir daran gedacht zu fliegen. Damals überlegten sich (einige wenige) Frauen und Männer ganz genau, welches Kostüm und welchen Anzug sie anziehen sollten, um für einen Flug angemessen gekleidet zu sein. Aber für mich, den Sohn eines Arbeiters, war die Vorstellung, mir ein Flugticket zu kaufen, jenseits der Realität. Zugtickets oder, wie man damals sagte, Bahnfahrkarten für eine so weite Strecke hätten wir uns nie leisten können, und unsere Eltern hätten das niemals bezahlt. Also blieb nur eins: trampen.
Das erste Hindernis bestand darin, am letzten Schultag zur Autobahn-Raststätte zu kommen. Peters Eltern weigerten sich strikt, uns dort abzusetzen; meine Eltern fielen ohnehin aus, weil wir kein Auto hatten. Niemand wollte daran schuld sein, uns an der Raststätte abgesetzt zu haben. Denn sollte tatsächlich etwas schiefgehen, würde sich der oder die Entsprechende anhören müssen, dass er/sie die beiden Jungs schließlich sogar noch zum Trampen an die Autobahn gebracht hatte. Mit dem Fahrrad fahren konnten wir nicht. Die riesigen Rucksäcke mit Isoliermatte, Zelt, Schlafsack, Kochgeschirr und den Unmengen Lebensmitteln, die wir aus Keller und Kühlschrank hatten mitgehen lassen, wogen, als wären sie mit Wackersteinen gefüllt. Zur Raststätte trampen konnten wir auch nicht, weil die Straße, die von einer Waldstraße abzweigte und zur Raststätte führte, nur von Zulieferern befahren werden durfte. Also mussten wir mit dem Bus so nahe wie möglich an die Raststätte fahren und den Rest zu Fuß gehen. Das muss so eine knappe Stunde gedauert haben.
»In der Zeit wärst du mit Ryanair schon in Rom gewesen.«
»Ich weiß. An der Raststätte mussten wir uns dann wieder in halbwegs ansehnliche junge Männer verwandeln. Wir mussten unsere verschwitzten Gesichter waschen und ein gewinnendes Lächeln üben, um jemanden zu finden, der bereit war, uns mitzunehmen.«
»War das schwierig?«
»Klar war das schwierig. Wir mussten erst einmal jemanden finden, der uns in Richtung der Nord-Süd-Trasse, Hamburg–München, also bis nach Kassel brachte. Je näher wir der Abzweigung kamen, desto schwieriger wurde es, jemanden zu finden, der in Richtung Süden abbog und bereit war, zwei Jungs mitzunehmen.«
»Wieso gerade Jungs?«
»Die Fahrer hatten Angst, dass zwei junge Männer versuchen könnten, sie zu überrumpeln und auszurauben oder was auch immer. In Deutschland herrschte eine angespannte Stimmung. Der letzte große Boss der Terrorgruppe RAF, Christian Klar, war noch auf freiem Fuß. Es war nichts Ungewöhnliches, dass man Halbwüchsigen wie uns mit einem gewissen Misstrauen begegnete.«
»Hattet ihr auch Angst?«
»Nein, wir hatten nur einen Gedanken im Kopf: so schnell wie möglich nach Rom zu kommen. Manchmal hatten wir einfach Pech und mussten an dieser blöden Raststätte Kassel-Hasselberg im Zelt übernachten.
»Haben die euch nicht weggejagt?«
»Wir sind auf irgendeinen Acker gegangen in der Nähe der Raststätte. Ich weiß noch, dass wir eines Morgens mal rasch türmen mussten, weil wir einen Trecker kommen hörten. Der Bauer konnte es nicht fassen, dass auf dem Feld, das er pflügen wollte, ein Zelt stand. Jedenfalls war es oft langwierig, jemanden zu finden, der uns mitnahm. Die meisten Autofahrer fielen aus. Eine normale Familie hätte uns allein deswegen nicht mitnehmen können, weil wir zu viel Gepäck hatten. Die zwei riesigen Rucksäcke passten ja nur in ein Auto, das fast leer war; aber einzelne Fahrer waren oft zu vorsichtig. Deswegen hingen wir manchmal tagelang an einer Raststätte herum.«
»Und Lkw-Fahrer?«
»Die hatten meistens nicht genug Platz in ihrer Kabine, aber manchmal konnten wir die Rucksäcke auf der Ladefläche unterbringen. Ich erinnere mich an eine gruselige Fahrt mit einem Lkw-Fahrer, der ständig Rotwein trank, dann aus irgendeinem Grund sauer wurde und uns mitten auf der Autobahn an einer Haltebucht rausschmiss. Wir mussten dann ein paar Kilometer zur nächsten Raststätte zu Fuß gehen.«
Ein Traum, erotische Gymnastik und scharfe Pinienzapfen
»Was für ein Stress in den Ferien.«
»Für uns war das die große Freiheit. Alles besser als in den Ferien in unserer Heimatstadt herumzuhängen. Wir quälten uns nach Süden, und es war ein unglaublicher Triumph, wenn wir spätestens am zweiten Tag in München ankamen. Leider fuhren die meisten nicht nach München hinein, sondern setzten uns an einer Raststätte ab. Ich erinnere mich an einen verdammt anstrengenden Marsch von der Raststätte Vaterstetten bis zum nächsten Bus und dann zur U-Bahn. Aber irgendwann waren wir am Hauptbahnhof in München.«
»Weshalb eigentlich München?«
»Ab München war die Fahrt nach Rom bezahlbar. Wir mussten nur für das kurze Stück bis zum Brenner ein normales Ticket lösen.«
»Und dann?«
»Ab dem Brenner galt das 3000-Kilometer-Ticket der italienischen Eisenbahn FS, das eigentlich für Gastarbeiter gedacht war. Damit durfte man 3000 Kilometer auf dem Streckennetz der italienischen Eisenbahn fahren, und die kosteten nur sehr wenig. Ich habe die Dinger geliebt, es war nur so schwer, sie zu bekommen.«
»Also nicht an jedem Bahnhof?«
»Nein, und du konntest auch nicht einfach in ein Reisebüro latschen und so ein Ticket kaufen. Die hätten gar nicht gewusst, was das ist. Es gab eine Stelle in Dortmund, wo man die bekommen konnte, das bedeutet, ein Tag ging schon dafür drauf, nach Dortmund zu fahren und wieder zurück, um das Ticket zu bekommen.«
»Heute druckst du dir alle Tickets zu Hause aus.«
»Ich weiß, aber ich weiß nicht, ob das so viel besser ist.«
»Wie meinst du das?«
»Wir haben viel mehr Zeit als ihr einfach gewartet, auf Bahnhöfen, an Raststätten oder Bushaltestellen, ohne irgendetwas, das uns hätte unterhalten oder ablenken können: Ganz ehrlich, hätte man uns damals ein Handy gezeigt, wir hätten es für eine unfassbare Maschine gehalten, wie vom Raumschiff Enterprise. Wir hatten Taschenbücher dabei, aber auch nicht immer. Insgesamt haben wir sicher viel mehr Zeit als ihr damit verbracht, zu träumen oder uns was auszudenken. Ich weiß nicht, ob das wirklich schlechter war, langweilig war uns nicht.
Wenn es geklappt hatte, nach der Vergabe der Zeugnisse und dem Schulschluss, also gegen 10 Uhr, an der Autobahnraststätte in Werl zu sein und es zu schaffen, vor 20 Uhr in München anzukommen, war das ein Riesenfest. Wir gönnten uns dann im Augustinerkeller ein großes Bier und freuten uns auf Rom.«
»Wieso musstet ihr um 20 Uhr in München sein?«
»Der Zug nach Rom fuhr so gegen halb neun.«
»Was hatte ihr denn für ein Budget?«
»Na ja, ich glaube es waren etwa hundert D-Mark für das 3000-Kilometer-Ticket.«
»Waaas? Das heißt, es waren weniger als zwei Cent pro Kilometer?«
»Ja. Dann hatten wir noch etwa dreihundert D-Mark für drei Wochen übrig.«
»Wie bitte? Wenn es stimmt, dass der Euro die doppelte Kaufkraft hat gemessen an der D-Mark, hattet ihr 150 Euro für drei Wochen, dafür bekommst du in Rom eine Nacht im Hotel. Wie soll das denn gegangen sein?«
»Das ging wunderbar. Wir hatten mehr als zehn Mark pro Tag und Person, das war ein Haufen Geld.«
»Du musstest mit fünf Euro am Tag auskommen. So viel gibst du mir, damit ich mir in der Schule was an der Bar kaufen kann.«
»Wir haben uns erst mal einen Liter Rotwein gekauft, der kostete so etwa 1200 Lire, dann Brot und Thunfischdosen oder Ölsardinen, weil sie so fettig waren und irre satt machten, das Ganze wird etwa 3000 Lire gekostet haben, also etwa sieben D-Mark. Das reichte für uns beide, dann hatten wir noch dreizehn Mark für den Rest des Tages. Wir fanden, das war viel.«
»Krass! Da wart ihr also richtig arm.«
»Wir empfanden das nicht so, im Gegenteil, wir fühlten uns wunderbar frei und eher wohlhabend. Wir haben damals in Teilen noch das Italien gesehen, das es zur Zeit Goethes gegeben hat. Ich erinnere mich, dass wir einen Hirtenjungen kennengelernt haben. Wir hatten das Zelt wieder auf einem Acker aufgebaut, doch morgens blökte es wie bescheuert. Wir zogen den Reißverschluss hoch – um uns herum jede Menge Ziegen. Ein Junge hütete die Tiere. Er muss so dreizehn oder vierzehn Jahre alt gewesen sein. Wir konnten es nicht fassen, dass der Junge bei seinen Ziegen bleiben musste und nicht in die Schule ging. Er lebte bei seinem Vater, der noch ein Padre Padrone war, eher ein Sklavenhalter des Jungen als sein Vater. Wir haben ihm ein Messer geschenkt, ein Opinel-Messer mit einer klappbaren Klinge. Am nächsten Tag sahen wir, wie traurig der Junge war, der wahrscheinlich weder schreiben noch rechnen konnte, weil sein Vater ihm das Messer weggenommen hatte – nicht, damit sich das Kind nicht verletzte, sondern weil er selber es haben wollte. Heute würde ein solcher Vater wahrscheinlich per Internet-Anzeige vors Jugendgericht gebracht – und das zu Recht. Diesem Italien steckte zutiefst in den Knochen, dass es jahrhundertelang ein Agrarland und kein Industrieland gewesen war.
Aber klar, nach den Maßstäben eines durchschnittlichen jugendlichen Rom-Urlaubers von heute waren wir bitterarm. Ich mache mich noch heute mit meinem Freund Peter darüber lustig, dass wir uns tagelang stritten, weil er aus der gemeinsamen Kasse hinter meinem Rücken ein Öllämpchen für tausend Lire, also etwa 1,50 D-Mark, gekauft hatte.«
»Ihr habt euch um einen Euro gestritten?«
»Wir hatten unser Geld ja hart erarbeitet, zumindest für unsere Begriffe. Ich trug damals die Kirchenzeitung der Diözese aus, das brachte so in etwa eintausend Mark im Jahr, damit konnte ich alle Urlaube finanzieren. Aber weil das Geld war, das ich bei Wind und Wetter auf dem Fahrrad verdient hatte, achtete ich auf jeden Groschen. Das galt natürlich auch in Rom.
Ich erinnere mich, dass wir im Zug den Stadtplan genau studiert hatten, als wir zum ersten Mal nach Rom kamen. Da begriffen wir, dass Rom vor allen anderen Städten in Europa, die wir kannten, einen Vorzug hatte.«
»Und der wäre?«
»Unbebaute Ackerflächen nahe an der Stadt.«
»Wie bitte?«
»Wenn du im Stadtzentrum von London stehst, sagen wir, am Trafalgar Square, oder in Paris am Eiffelturm, wie weit ist es dann bis zum nächsten unbebauten Acker?«
»Ich würde schätzen, mindestens zwei Stunden, wenn man auf Bus und Bahn angewiesen ist.«
»Schätze ich auch. In Rom gibt es aber einen Sonderfall. Die antike Via Appia führt mitten in die Stadt, sie ragt wie ein grüner Pfeil in die römische Innenstadt. Wie alle anderen Großstädte ist auch Rom rundherum mit Schlafstädten zugebaut. Sie reichen bis zum römischen Autobahnring GRA