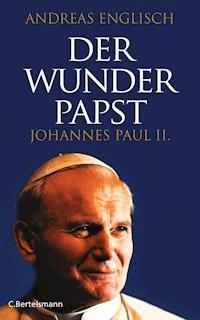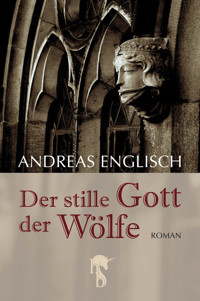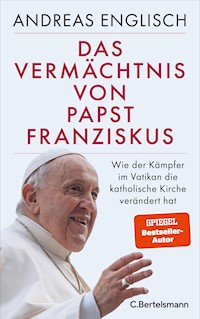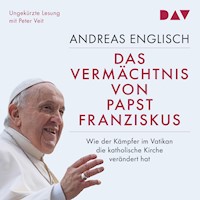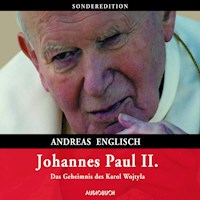Inhaltsverzeichnis
Titel
Inschrift
Widmung
Prolog
Kapitel 1 – Kreuzweg
Kapitel 2 – Pläne
Kapitel 3 – Vorahnung
Kapitel 4 – Spitzenkandidat
Kapitel 5 – Feuerprobe
Kapitel 6 – Botschaft
Kapitel 7 – Propheten
Kapitel 8 – Auguren
Kapitel 9 – Lehrer
Kapitel 10 – Verkündigung
Kapitel 11 – Sibyllen
Kapitel 12 – Gottes Wohnstätte
Kapitel 13 – Elija
Kapitel 14 – Tyros
Kapitel 15 – Geheimnis
Kapitel 16 – Komplott
Kapitel 17 – Seher
Kapitel 18 – Afrika
Kapitel 19 – Kibeho
Kapitel 20 – Fluss voller Blut
Kapitel 21 – Schicksal
Kapitel 22 – Mutter des Lichts
Kapitel 23 – Ngome
Kapitel 24 – Vergebung
Kapitel 25 – Berufung
Kapitel 26 – Konklave
Kapitel 27 – Routen
Kapitel 28 – Skepsis
Kapitel 29 – Fallbeil
Kapitel 30 – Abschied
Kapitel 31 – Pannen
Kapitel 32 – Verbrecher
Kapitel 33 – Regensburg
Kapitel 34 – Beißen und zerreißen
Kapitel 35 – Häme
Kapitel 36 – Autorität
Kapitel 37 – Termine
Kapitel 38 – Gottes Wille
Ende
Epilog
Register
Bildnachweis
Copyright
»Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt«
EVANGELIUM NACH JOHANNES KAPITEL 14, VERS 29
Für Martha, ihren Enkel Leo, Orazio und Kerstin, weil ohne sie dieses Buch nicht entstanden wäre.
Prolog
Als ich 1987 als Vatikankorrespondent nach Rom kam, war ich erst 24 Jahre alt. Schon deswegen nahm mich in der Vatikanstadt niemand ernst. Es gab eine weit verbreitete Methode, mir zu zeigen, wie unerfahren ich war. Die Prälaten erinnerten sich in Gesprächen mit mir an die Zeit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, sodass ich sagen musste, dass ich damals noch gar nicht geboren worden war. Oder sie machten eine Anspielung auf den Tag, an dem Papst Paul VI. einmal im Fahrstuhl des Hauptquartiers der Jesuiten stecken geblieben war. Ich musste natürlich zugeben, dass ich im letzten Regierungsjahr Papst Paul VI. erst 14 Jahre alt gewesen war und meine Firmung noch vor mir gehabt hatte.
»Gott, sind Sie jung«, sagten die Prälaten dann zu mir, ganz väterlich, aber natürlich auch von oben herab. Ich weiß noch, wie unsicher ich war, wenn ich mit Arturo Mari arbeiten musste, dem Papstfotografen, der später ein echter Freund wurde. Vor ihm hatte ich einen Heidenrespekt, weil er schon unter Papst Pius XII. im Vatikan gearbeitet hatte, also lange vor meiner Geburt.
Besonders herablassend allerdings wurde ich von meinen Kollegen behandelt, den »vaticanisti«, den italienischen Journalisten, die sich ausschließlich mit der Berichterstattung aus dem Kirchenstaat beschäftigen. Dieser Club gestandener Veteranen nahm mich, das Küken mit dem deutschen Akzent, überhaupt nicht wahr. Ganz schlimm wurde es auf längeren Papstreisen. Dann frühstückten die Herren schon miteinander und sprachen den Tag durch, während ich von meinem einsamen Tisch aus zu ihnen hinüberschielte. Ich ahnte, dass sie sich auch für die Abendessen verabreden würden. Um das zu tun, scharten sich die Journalisten um einen Mann mit graumeliertem Haar, der aussah wie ein in die Jahre gekommener Filmstar, stets einen Reiseführer dabeihatte und immer wusste, wo sich der »place to be« befand, also in welchem Restaurant man den spannendsten Abend verbringen würde. Seltsamerweise war dieser schlanke Herr in der Lage, in Syrien oder Sant Louis, in Delhi oder Jerusalem treffsicher das beste Lokal auszusuchen.
Ich wurde zu diesen Abendessen nie eingeladen. Ich starrte nach der Arbeit in meinem Hotelzimmer gegen die Wand und stopfte Fast Food in mich hinein. Das Ungeheuerlichste aber war, dass diese Kollegen den wichtigsten Mann, den damaligen Papstsprecher Joaquín Navarro Valls, schlicht duzten. Ich hörte »Joaquín, komm bitte mal her«, »Joaquín erklär doch mal, was meint der Papst denn da?«. Ich selber wagte ihn nur als »Direttore« anzusprechen, mit seinem Titel als Direktor des Presseamtes des Heiligen Stuhls.
Auch vom Informationsfluss war ich ausgeschlossen. Die italienischen Kollegen telefonierten den ganzen Tag miteinander. Sie konnten sich auf ein engmaschiges Netz verlassen. Immer war mindestens ein Kollege in der unmittelbaren Umgebung des Papstes, alle anderen nahmen sich gern mal ein paar Stunden frei, um sich die Städte anzusehen. Sie waren aber stets super aktuell informiert. Während sie auf der Fifth Avenue in New York shoppten, informierte sie der Kollege, der gerade den Papst begleitete, darüber, was der Heilige Vater gepredigt hatte oder wann er wieder in die Nuntiatur zurückkehren würde. Ich selbst wurde nie angerufen und blieb deshalb stets in der Nähe des Papstes, langweilte mich manchmal entsetzlich und bekam nie etwas von dem normalen Leben in den Städten mit, die der Heilige Vater gerade besuchte. Ich sah nur Kirchen, Kirchen, Kirchen.
Es gab aber eine Ausnahme in diesem – aus meiner damaligen Sicht – Senioren-Club der »vaticanisti«: Ausgerechnet der Herr mit dem grauen Haar, der Feinschmecker Orazio Petrosillo, nahm mich unter seine Fittiche. Orazio war zwar auch weitaus älter als ich, ließ mich aber nicht ständig spüren, dass ich von nichts eine Ahnung hatte. Orazio setzte sich sogar manchmal zum Frühstück an meinen verwaisten Tisch, fragte mich nach meinem Leben, nahm mich zu Treffen mit der Entourage des Papstes mit, von deren Existenz ich nichts geahnt hatte, vor allem nicht, dass Journalisten dort hingehen konnten. Es dauerte nicht lange, bis ich begriff, dass es in der Journalistengruppe, die den Papst begleitete, hilfreich war, in der Nähe von Orazio Petrosillo zu bleiben. Es stellte sich zudem heraus, dass wir in Rom fast Nachbarn waren. Ich wohnte damals noch in Trastevere. Zu meiner Freude traf ich ihn manchmal auf den Treppen, die zum Stadtteil Monteverde Vecchio hochführen. Obwohl er ein überzeugter, fast schon glühender Katholik war, gehörte Orazio nicht zu den Menschen, die andere missionieren wollten. Im Gegenteil: Seine Fähigkeit, sich durchzusetzen, war alles andere als ausgeprägt. Ich erinnere mich daran, dass er mich auf der Treppe auf unseren Hund ansprach, einen ausgesetzten Jagdhund, den wir eines Tages am Straßenrand aufgelesen hatten. Er beklagte sich darüber, dass auch seine Töchter dazu neigten, streunende Hunde zu retten, die er dann spazieren führen müsse. Dass es ihm ebenso wenig wie mir gelungen war, durchzusetzen, dass der Vierbeiner nicht ins Haus kommt, machte ihn mir sympathisch. Zumal es bei ihm genau wie bei mir damit endete, dass der Hund auf dem Sofa schlief.
Orazio war auch nicht der Mann, der den schnoddrigen Journalistenton in Gesprächen über Johannes Paul II. übel nahm. Der Jahrtausendpapst brach einen Rekord nach dem anderen. Als erster Papst betete er in einer Moschee, als erster Papst in einer Synagoge, als erster in einer lutherischen Kirche, als erster bereiste er unermüdlich die Welt, als erster zelebrierte er vor Millionen Menschen Weltjugendtage. Wenn die Gruppe der erschöpften Vatikanjournalisten damals auf Papstreisen Sprüche klopfte wie: »Hoffentlich denkt sich der Boss heute nicht wieder etwas Neues aus«, lachte Orazio mit. Er selbst sprach nie abwertend über den Papst, erwartete aber keineswegs, dass die anderen ebenso fromm wären wie er. Im Gegenteil: Orazio trat immer so auf, als wollte er sich dafür entschuldigen, dass er ein wenig schrullig sei, und dass er seinen Glauben zu ernst nehme. Natürlich hatte er nach dem Abitur Priester werden wollen, aber dann, wegen seiner erklärten Zuneigung zu Frauen, doch beschlossen, die Kirche von außen zu betrachten.
Orazio wurde nach und nach mein wichtigster Verbündeter: Wenn der Papst über autokephale Kirchen sprach, verlor Orazio nie die Geduld, mir zu erklären, was zum Teufel das eigentlich war. Wenn ich eines der frühen Briefings um 4 Uhr morgens verpasst hatte, fragte ich Orazio, was passiert war. Er wusste immer alles, er war stets rechtzeitig aufgestanden, und er behielt nie eine Information für sich. Nahezu alle anderen Journalisten-Kollegen winkten jedes Mal, wenn ich eine Frage hatte, rasch ab und sagten mir, dass sie jetzt gerade im Stress wären, was mir klarmachen sollte, wie unwichtig ich war, gemessen an ihnen. Dass Orazio sich immer Zeit für mich nahm, überraschte mich vor allem deshalb, weil mir damals die katholische Kirche und auch das Papsttum zutiefst egal waren. Ich machte nur meinen Job. Ich empfand nichts für Karol Wojtyła, den Orazio natürlich persönlich kannte.
Um Orazio zu ärgern, sagte ich manchmal: »Sag mal, du glaubst den ganzen Quatsch, dass der Papst der Vikar Gottes ist, doch nicht wirklich?« Dann sagte er: »Natürlich glaube ich das.« Aber böse war er mir deswegen nicht.
Für die Bedienung von Computern und das Vernetzen in Internet-Systemen war Orazio einfach nicht geboren. Manchmal stand er vor mir und bat mich um Hilfe, weil er seinen in Rom dringend benötigten Text nicht hatte absenden können. Wenn es mir gelungen war, ein technisches Problem zu lösen, das jeder 14-jährige hätte lösen können, sagte Orazio immer anerkennend: »Du mit deinen mächtigen Maschinen.« Er surfte nie durch Archive, weil er das nicht nötig hatte. Er wusste alles, wirklich alles, einfach auswendig. Wenn der Papst einen Schimpansen streichelte und ich Orazio fragte, ob schon einmal ein Papst einen Affen auf dem Arm gehabt habe, gab er mit unglaublicher Sicherheit die präzise Antwort. Die Päpste und der Vatikan waren sein Leben, und ohne ihn hätte ich meinen Job am Hof der Päpste bereits vor zwölf Jahren verloren.
Orazio war es auch, der mich damals dazu brachte, zum ersten Mal in meinem Leben über das Thema Prophezeiungen nachzudenken: in einem Taxi in Rio de Janeiro.
Am 5. Oktober 1997 beendete Papst Johannes Paul II. seinen Besuch in Brasilien mit einer feierlichen Messe im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro. Ich hatte mich in den letzten Pool, die letzte Journalistengruppe, einteilen lassen, die den Papst in das Stadion begleitete, und auf dem Weg zurück verpasste ich den Bus, der die Journalisten zurückfuhr. Ein sehr netter Herr, der zur Organisation des Papstbesuchs gehörte, bot sich schließlich an, mich zurückzubringen, vom Maracanã-Stadion ins Pressezentrum. Wir fuhren kreuz und quer durch Rio de Janeiro. Ich konnte kaum etwas von der Stadt sehen, die Seitenscheiben waren so stark getönt, dass ich nur ahnen konnte, wo ich war. Plötzlich blieb der Wagen stehen. Ich hörte, wie der Fahrer immer wieder versuchte, das Auto zu starten, doch ohne Erfolg. Der Wagen sprang nicht an.
»Darf ich aussteigen?«, fragte ich.
Der Fahrer sagte nichts, versuchte nur weiterhin vergeblich, den Motor zu starten. Ich stieg aus und stand im Paradies. Das Auto war genau am Strand von Ipanema kaputtgegangen, einem Strand, der noch ein bisschen schöner ist als die Copacabana. Ich stand da im schwarzen Anzug mit schwarzen eleganten Schuhen und blickte auf das blaue Meer, die hohen Wellen und die Frauen in knappen Bikinis, die Volleyball spielten. Nach ein paar Minuten stieg der Fahrer ebenfalls aus, öffnete die Motorhaube, werkelte herum und sagte schließlich zu mir: »Das Auto ist kaputt, tut mir leid.«
»Was soll ich jetzt machen?«, fragte ich.
»Warten Sie hier. Ich werde einen weiteren Wagen senden. Bleiben Sie einfach genau hier stehen. Ich werde ein V für Vatikan hinter die Scheibe legen lassen. Dann erkennen Sie den Wagen. Aber rühren Sie sich nicht von der Stelle. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Der Papst verabschiedet sich nur noch bei den Bischöfen. Danach wird er nach Rom zurückfliegen.«
»Ich weiß«, sagte ich dem Mann. Die Regel hatte ich schon ein paarmal gehört: Der Papst wartet nie.
Der Fahrer verschwand, und ich sah den jungen Männern und Frauen zu, die artistisch auf Brettern über die Wellen des Atlantiks glitten.
Dann machte ich einen schweren, unverzeihlichen Fehler. Ich zog meine schwarze Anzugsjacke aus, die Hosen, das Hemd, die Schuhe, alles – bis auf meine Boxershorts – und legte meine Klamotten in den Sand.
Schon damals bekam jeder Journalist, der den Papst begleitet, eine Kennkarte, wie sie heute noch üblich ist. Diese Karte darf man auf gar keinen Fall verlieren. Man muss die Vatikanische Gendarmerie informieren, wenn es doch geschieht. Mit Hilfe dieser Karte könnten Terroristen theoretisch in das Papstflugzeug gelangen.
Ich riss mir auch diese Karte vom Hals, steckte sie irgendwo zwischen Hemd und Hose und ging schwimmen. Ich war nur etwa fünf Minuten im Wasser, und es war herrlich. Als ich zurück zum Strand kam, waren meine Sachen weg. Alles war weg, die Hose, die Jacke, die Schuhe, die Kennkarte, einfach alles. Ich war entsetzt. Wie hatte ich so leichtsinnig sein können? Wie sollte ich den Verantwortlichen für Sicherheit des Vatikans – den Gendarmen und den Schweizergardisten – erklären, was passiert war? Ich konnte ja wohl kaum die Wahrheit sagen.
Zu meiner maßlosen Erleichterung sah ich das Auto mit einem kleinen V im Fenster. Ich lief mit meinen feuchten Haaren und den nassen Boxershorts auf die Limousine zu und versuchte, mein spärliches Portugiesisch auszuprobieren. Ich sagte dem Mann, dass ich zum »Voho Papal« gehöre, zu den Journalisten, die den Papst in seiner Maschine begleiten. Er sah mich von oben bis unten an, blickte sich um, als suchte er jemanden, kurbelte dann die getönte Fensterscheibe wieder hoch und verschwand. Für was auch immer er mich in meinen tropfenden Unterhosen gehalten haben mag, jedenfalls nicht für einen Begleiter des Papstes. Ich war verzweifelt. In Kürze würden sich die Kollegen im Pressezentrum versammeln, um in den von der Polizei eskortierten Flughafen-Shuttle des Vatikans zu steigen und nach Rom zurückzufliegen. Ich hatte keine Ahnung, wie ich ohne Geld, fast nackt, in das Pressezentrum kommen sollte. Ich hatte nicht einmal eine vage Vorstellung davon, wo in dieser riesigen Stadt das Pressezentrum lag. Ich wusste genau, wenn das herauskam, wenn ich wegen eines solchen Leichtsinns die Papstmaschine verpasste, würde mich der Vatikan nie wieder mitnehmen.
Plötzlich warf sich ein junger Mann vor mir in den weißen Sand. Er hatte ein Bündel im Arm und ließ es in den Sand fallen. Es waren meine Schuhe, mein Anzug und die Kennkarte des Vatikans.
Er schrie beinahe: »Ich will nicht in die Hölle!«
Ich hätte den Mann umarmen können. Er zeigte auf die Kennkarte, auf der auf Portugiesisch erklärt war, dass ich zu der Delegation gehörte, die den Papst begleitete. »Ich will nicht in die Hölle. Segnen Sie mich!«
Ich antwortete: »Aber ich bin kein Priester.«
»Bitte!«, flehte er, »Segnen Sie mich!«
Er kniete vor mir im Sand und schlug das Kreuzzeichen, und weil ich es zu eilig hatte, um mit ihm zu diskutieren, sagte ich einfach: »Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.«
»Danke!« rief er, bekreuzigte sich und verschwand. Ich durchsuchte meine Sachen. Es war alles noch da. Selbst die schwarzen Socken. Aber ich hatte kein Geld dabei. Ich hatte damit gerechnet, vom Vatikan in die Messe, zurück in das Pressezentrum und zum Flughafen gebracht zu werden. Wie sollte ich, ohne Geld und ohne Adresse, in das Pressezentrum kommen? Ich versuchte, Menschen auf der Straße anzusprechen, aber niemand hatte den blassesten Schimmer, was ich von ihm wollte, und ich hatte keine Minute mehr zu verlieren. Ich musste jemanden finden, der zufällig wusste, wo das für die Öffentlichkeit nicht zugängliche Pressezentrum für die Vatikan-Journalisten war. Es gelang mir, ein Taxi anzuhalten, aber der Fahrer konnte mir auch nicht helfen. Ich setzte mich auf eine Bank und dachte: »Das war es jetzt. Die anderen machen sich gerade auf den Weg zum Flughafen, und der Vatikan wird dich nie wieder auf eine Papst-Reise mitnehmen.« Da sah ich ihn. Das heißt: Ich entdeckte in einem Taxi, dass gerade vor einer roten Ampel hielt, den weißen Hut, den er immer in heißen Ländern benutzte. In der Sonne blinkte seine konservative Brille.
Ich schrie über die Straße: »Orazio!«
Er blickte sich verwirrt um. Ich rief noch einmal: »Orazio!«
Endlich sah er mich. Er bat seinen Fahrer, rechts anzuhalten. Ich lief zu ihm hinüber und sprang in sein Taxi. Er hatte einen Stadtplan dabei, auf dem das Pressezentrum rot eingezeichnet war. »Was machst du denn hier?«
Ich erzählte ihm von meinem Leichtsinn. Er lachte und sagte dann: »Siehst du, die Vorsehung hilft sogar denen, die nicht an sie glauben.«
»Vorsehung?«, sagte ich. »So ein Quatsch. Das war reines Glück.«
Er lächelte und schüttelte den Kopf. »Eine Minute später, und ich wäre weg gewesen, und du hättest den Papstflieger verpasst. Das war kein Zufall mein Lieber. Die Vorsehung stand dir diesmal bei. Glaub mir!«
Ich glaubte ihm damals in dem Taxi in Rio kein Wort. Aber ich war dankbar und hörte gut zu, als er mir erzählte: »Weißt du, was Papst Johannes Paul II. im November 1980 in deiner Heimat Deutschland, in Fulda, sagte? Eine deutsche Zeitschrift hat darüber geschrieben, die ›Stimme des Glaubens‹. Der Papst sagte: ›Ich werde bald große Prüfungen erleiden müssen, die mich vielleicht sogar das Leben kosten.‹ Das war ein halbes Jahr vor dem Attentat. Er hatte eine Prophezeiung erlebt. Der Papst wusste, was er erleiden würde, als auf ihn geschossen wurde. Er wusste, dass Gott ihm das Leben retten würde. Das Attentat war eine Prophezeiung, die sich erfüllte.«
Orazio Petrosillo starb am 11. Mai 2007 an den Folgen eines Hirnschlags, den er erlitt, während er Papst Benedikt XVI. im Auftrag des »Messaggero« im Aostatal begleitete. Auch ihm und einer Frau, die ich im Folgenden noch vorstellen werde, ist dieses Buch gewidmet.
1
Kreuzweg
Für mich war dieser Abend der dramatischste Moment in zwei Jahrzehnten am Hof der Päpste. Karfreitag, 25. März 2005: In der Privatkapelle der Päpste im Vatikan sitzt Johannes Paul II. mit einem Kreuz in der Hand. Er schaut auf einen Fernseher, den sie ihm in die Kapelle gebracht haben. Die Kirche gedenkt an diesem Abend des Leidens und des Todes ihres Erlösers, Jesus von Nazareth. Johannes Paul II., der Marathonmann Gottes, kann keinen einzigen Schritt mehr gehen. Er kann kaum noch ein Wort sprechen. Er kann das Kreuz der Kirche dort, wo es geschultert werden muss, nicht mehr tragen. Zum ersten Mal seit 26 Jahren betet er den Kreuzweg nicht im Kolosseum. Der bullige Karol Wojtyła, der Kanufahrer und unermüdliche Wanderer, ist eingeschlossen in einen Körper, der sein Gefängnis wurde.
Es ist kalt an diesem Märzabend in Rom, an dem das Gedenken an die Todesstunde des Jesus von Nazareth für die katholische Kirche mehr bedeutet als ein Ritus. Dieses Mal ist sie selbst betroffen. Ein sterbender Papst braucht seine ganze Kraft, um nur ein kleines Holzkreuz zu halten, während ein anderer das schwere Kreuz vor Zehntausenden von Gläubigen für ihn durch das Kolosseum tragen muss. Ein Mann, den er als Stellvertreter für diesen Abend ausgewählt hat. Die Gläubigen der Welt werden später mit einem Schauer an diesen Moment denken. Es ist das einzige Mal, dass der Chef der Glaubenskongregation, Joseph Ratzinger, eine Aufgabe übernimmt, die einem Papst zusteht: Er trägt das Kreuz durch das Kolosseum. Das Kreuz als Zeichen für das Leiden der Welt. Der Kirchenhistoriker Antonio Socci wird später in seinem Buch »Das vierte Geheimnis von Fatima« schreiben, dass es ihm wie eine »Investitur« vorkam. Der sterbende Papst hatte schon seinen Nachfolger in das Kolosseum geschickt.
Das Bild des leidenden Johannes Paul II., der in seiner Kapelle dem Kreuzweg nur zuschauen kann, geht an diesem Abend um die Welt, und für die Gläubigen scheint eine Prophezeiung einzutreten. Im sogenannten eschatologischen Geheimnis schreibt Melanie Calvat, die von der katholischen Kirche anerkannte Seherin der Marienerscheinung von La Salette in Frankreich (19. September 1846), folgende Worte, die Maria ihr gesagt haben soll: »Der Papst wird sehr leiden. Die Bösen werden mehrfach versuchen, ihm das Leben zu nehmen. Ich werde bei ihm sein bis zum Schluss, um sein Opfer zu empfangen.« Ist es bald so weit? Wird der Leidensweg des Papstes, der während seiner Amtszeit zwei Mordanschläge überlebte, jetzt ein Ende nehmen?
Die Stille im Kolosseum schien damals wie ein Mantel über der Menge zu liegen. Dann sprach Joseph Ratzinger, stellvertretend für den Papst, der todkrank im Vatikan zusehen musste, was im nur wenige Kilometer entfernten Kolosseum geschah. Ratzinger sprach über die Gefahren, in die das Schiff der Kirche geraten ist. Er sagte, »es dringt von allen Seiten Wasser ein«, es drohte zu sinken.
Ein paar Meter von mir entfernt saß ein befreundeter Priester. Er war Lehrer am Institut der Salesianer in Rom. Er erbleichte. Er wurde so blass, dass ich hätte schwören können, ihm sei schlecht geworden. Wie gebannt schaute er auf Joseph Ratzinger. Die Kälte schnitt mir durch den schwarzen Anzug, als ich sein Gesicht sah. »Was hast du denn?«, fragte ich.
»Mir ist nicht gut«, antwortete er.
Ich quetschte mich durch die Menge an seine Seite: »Möchtest du, dass ich dich nach Hause fahre?«
«Nein«, sagte er. Dann fügte er mit hastiger Stimme, voller Ehrfurcht und mit einem Ton des Entsetzens, hinzu: »Hast du nicht gehört, was er gerade gesagt hat, der Kardinal Ratzinger?«
»Dass von allen Seiten Wasser in das Schiff der Kirche eindringt«, flüsterte ich zurück.
»Kennst du die Visionen von Don Bosco nicht, dem Heiligen, der unseren Orden gegründet hat?«
Ich hatte nur davon gehört, dass der Heilige Giovanni Bosco in seinem Leben Visionen und Prophezeiungen erlebte.
»Die Prophezeiung vom Wasser aus dem Jahr 1862 kennst du nicht?«
»Nein.«
»Es gibt eine Vision der Schlacht auf dem Meer um das Schicksal der Kirche. Bisher galt sie immer als Vorhersage für Papst Johannes Paul II.«
»Und?«
»In der Vision beschreibt der heilige Giovanni Bosco, dass er den Papst am Steuer des Schiffes sieht. Er wird getroffen, schwer verletzt, aber er steht wieder auf.«
»Du meinst das Attentat auf den Papst vom 13. Mai 1981.«
»Das habe ich bisher auch gedacht, aber jetzt denke ich, dass die Prophezeiung weitergeht. Großer Gott, was für eine Stunde erleben wir hier.« Er betete leise.
»Was um Gottes Willen willst du mir eigentlich sagen?«, flüsterte ich.
»Der Papst wird in der Vision des Don Bosco später tödlich getroffen. Er stirbt.«
»Und dann?« Mein Freund schwieg.
»Was dann?«, fragte ich ungeduldig.
»Dann übernimmt sofort ein anderer Papst das Steuer. Ich weiß noch genau, dass es in der Vision heißt, dass er das Steuer sehr rasch übernimmt, dass er so rasch gewählt wird, dass die Nachricht von seiner Wahl in einigen Winkeln der Welt zusammen mit der Nachricht vom Tod des Vorgängers eintrifft. Und weißt du, warum er das Steuer so schnell übernehmen muss?«
»Ich habe keine Ahnung«, gab ich zu.
»Weil Don Bosco schreibt, dass die Päpste sich rasch abwechseln müssen, weil in das Schiff der Kirche Wasser eindringt von allen Seiten.«
Das war es, woran ich gedacht habe, kaum vier Wochen später, als am Dienstag, dem 19. April 2005, um 17.43 Uhr Rauch aufstieg aus dem improvisierten Schornstein über der Sixtinischen Kapelle.
Es ist weißer Rauch. Die Katholiken haben wieder ein Oberhaupt. Nach der Glaubenslehre der katholischen Kirche ist damit nicht nur eine Wahl vorbei, sondern der Heilige Geist hat eingegriffen und den Kardinälen klar gemacht, wen Gott als Stellvertreter auf Erden wünscht. Der 264. Nachfolger des heiligen Petrus ist gewählt, sehr, sehr schnell gewählt worden, in nur vier Wahlgängen. Der eine Papst, den man versucht hatte zu töten, war gefallen, und ein neuer Papst hatte das Steuer in die Hand genommen, weil Wasser in das Schiff eindrang, so schnell, dass in einigen Teilen der Erde die Nachricht von der Wahl des neuen Papstes mit der Nachricht vom Tod des alten gleichzeitig eintraf. Ich weiß noch genau, dass ich damals auf dem Platz nicht wagte, mir einzugestehen, was mich im Inneren bewegte, als ich mit Tausenden voller Spannung darauf wartete, zu erfahren, wen die 115 Kardinäle des Konklaves gewählt hatten: Würde sich jetzt, hier auf dem Petersplatz, vor meinen Augen eine Prophezeiung erfüllen?
Mir blieb keine Zeit, diesem Gedanken nachzuhängen. Denn plötzlich stand ein Fernsehteam des Bayerischen Rundfunks vor mir. Die Kamera lief, das Mikrofon war eingeschaltet. »Wer wird der neue Papst sein?«, fragten sie mich. Ich zögerte.
Für mich lagen achtzehn Jahre Berufserfahrung in der Waagschale – und noch etwas anderes. Ein Gefühl, eine Ahnung. Anders kann ich es nicht beschreiben. Wie erklärt man jemandem, dass man den Eindruck hat, die Erfüllung einer Prophezeiung zu erleben? Sagt man einfach: »Ich glaube, der liebe Gott hat uns allen bereits mitgeteilt, was jetzt eintreffen wird«? Klar, dass man sich dann fragen lassen muss: »Wie viel hast du getrunken?«
Aber vor mir stand ein Fernsehteam. Sollte ich ausweichen? Stattdessen wagte ich es. Ich sagte den Namen des neuen Papstes live in die Fernsehkameras, etwa eine halbe Stunde, bevor er öffentlich verkündet wurde: »Joseph Ratzinger.«
Im gleichen Augenblick geschah hinter den dicken Mauern des Vatikans in der Sixtinischen Kapelle etwas Ungewöhnliches: Joseph Kardinal Ratzinger war soeben hinter verschlossenen Türen zum Papst gewählt worden. Noch wusste die Welt es nicht. Er nahm gerade erst, wie es vorgeschrieben ist, die Huldigungen entgegen. Da erhob sich einer der Kardinäle, ein Pole, und sagte laut und deutlich: »Nach einem Polen, und nachdem es fünf Jahrhunderte nur italienische Päpste gegeben hat, sitzt nun ein Deutscher auf dem Thron Petri. Nach einem Polen ausgerechnet ein Deutscher. Was will uns Gott damit sagen?« In diesem Moment war es still in der Sixtinischen Kapelle. Als wären die mystischen Worte eines Propheten erklungen, lauschten die Kardinäle in die Stille. Ja, was wollte Gott ihnen damit sagen?
Der Kardinal, der mir diese Episode später schilderte, sprach mit einer zittrigen, gebrochenen Stimme. »Dass ich Ihnen diese Worte des polnischen Kardinals anvertraue, grenzt fast an die Verletzung des Schweigegebots, kein Wort zu sagen über alles, was im Konklave geschah. Aber ich finde, Sie sollten das wissen.« Ich wusste, was er mir vermitteln wollte: »Trauen Sie sich ruhig, das zu denken, was wir damals alle kaum zu denken wagten.«
Hat Gott an diesem späten Nachmittag in der Sixtinischen Kapelle eingegriffen? Hat Gott selbst diesen Mann, geboren in Marktl am Inn, zum Stellvertreter Christi erkoren? Und hatte er seinen Vorgänger diese Entscheidung zuvor auf geheimnisvolle Art wissen lassen? Hatte ich nicht seit Langem geahnt, dass sich im Vatikan etwas Seltsames anbahnte, dass Johannes Paul II. sich in den letzten Monaten seines Lebens so verhalten hatte, als wüsste er etwas, das er niemandem mitteilen konnte?
Vier Jahre nach dem Konklave sagte der Privatsekretär des Papstes, Georg Gänswein, zu mir: »In der Wahl Benedikt XVI., eines Deutschen, der einem polnischen Papst nachfolgt, darf man ein Zeichen der Vorsehung erkennen.«
2
Pläne
»Warum leben wir eigentlich in Rom?« Diese Frage höre ich immer dann, wenn meine Familie aus irgendeinem Grund genervt ist. Wenn wir wieder drei Tage im Dunkeln sitzen, weil der Elektriker trotz wiederholter Versprechungen nicht auftaucht. Wenn es in der Leitung unseres Festnetz-Telefons monatelang nur rauscht und der Kampf gegen die Telefongesellschaft zur Hauptbeschäftigung wird. Wenn man zwischen 13 Uhr und 17 Uhr keine einzige Besorgung erledigen kann, weil den Bewohnern dieser Metropole die Mittagspause heilig ist. Wenn wir unserem hyperaktiven Sohn ein Laufband kaufen müssen, weil er in unserem Wohnviertel wie ein Hamster im Käfig lebt und der nächste Sportplatz zwar nur zehn Kilometer entfernt ist, man aber neunzig Minuten im Auto sitzen muss, um ihn zu erreichen.
Leonardo, der in Italien geboren wurde und in die vierte Klasse der Deutschen Schule geht, leidet darunter, dass er nirgendwo zu Hause ist. In Italien ist er Ausländer, in Deutschland aber auch. Dabei will er eigentlich nicht anders sein. Bei jedem Verwandten-Besuch zeigt sich irgendwann dieses Problem, etwa am Beispiel des Butterbrots. Leo mag keine Butter, und schuld daran bin natürlich ich. Normale deutsche Eltern schmieren ihren Kindern Butterbrote. Nur wir haben das nie getan, weil kein Mensch in Italien Butter auf ein Brot streicht. »Warum essen wir zum Frühstück Oliven-Pizza?«, will Leo also wissen.
Was soll ich darauf sagen? »Weil wir in Italien leben. Deswegen.«
»Aber warum tun wir das?«, will mein Sohn dann wissen, und das ist eine berechtigte Frage. Warum sind wir nie wieder nach Deutschland gezogen wie alle anderen, früher oder später? Warum bin ich als Einziger unter allen meinen Kollegen geblieben? Warum lebe ich seit 22 Jahren in Rom?
Ich kenne die Antwort, aber ich weiß nicht, wie ich sie meinem Sohn verständlich machen soll. Wir haben in zwei Jahrzehnten Heerscharen von Kollegen und Freunden kommen und gehen sehen, und ich sitze immer noch in dem längst verlassenen Zuschauerraum, blicke auf die Bühne, auf der ein großes Stück der Kirchengeschichte gegeben wurde, und frage mich, was ich eigentlich gesehen habe. Dabei habe ich am Rande manchmal sogar mitgespielt.
Viele Akteure sind längst tot oder in alle Winde zerstreut. Auf einen großen Mann aus einem kleinen Dorf in Polen folgte ein deutscher Papst. Und ich muss mich dem Vorwurf stellen, dass ich absolut alles, ausnahmslos alles, was ich in den vergangenen zwanzig Jahren mit den beiden Päpsten erlebte, falsch verstanden habe, und zwar nicht deswegen, weil ich nichts gesehen habe, sondern weil ich es nicht sehen wollte. Ich glaube, ein Stück Geschichte miterlebt zu haben; aber meine Freunde im Vatikan sagen: »Nein, das, was du erlebt hast, war die Erfüllung einer Prophezeiung.«
Prophezeiung? Gibt es so etwas überhaupt? Was ist eine Prophezeiung? Und hat sich vor meinen Augen eine Prophezeiung erfüllt? Ist unsere Zukunft vorherbestimmt? Oder ist alles, was uns geschieht, einfach die Summe aus selbstbestimmtem Tun und zufälligen Ereignissen?
Mich hat von jeher die Tatsache gefesselt, dass nach Ansicht der katholischen Kirche Gott den Menschen mittels Propheten etwas mitteilt, dass es also einen Kanal aus dem Jenseits ins Diesseits gibt. Schon für die Juden, die »größeren Brüder der Christen«, wie das Zweite Vatikanische Konzil sie nennt, besteht kein Zweifel daran, dass Gott so etwas wie seine »Sprecher auf Erden«, eben Propheten, einsetzt. Diese Sprecher haben die Aufgabe, den Menschen Gottes Willen mitzuteilen, sie zu tadeln, wenn sie etwas tun, was Gott missfällt, und sie haben die Fähigkeit, die Zukunft vorauszusagen. Aber gibt es solche Propheten tatsächlich?
Auf Kuba durfte im Frühjahr 2008 das erste Priesterseminar eröffnet werden. Zehn Jahre zuvor riskierte man dort noch eine Gefängnisstrafe, wenn man das christliche Weihnachten feierte. Eine schöne Entwicklung. Offensichtlich haben die Nachfolger Fidel Castros erkannt, dass es langfristig nichts bringt, eine Religion zu unterdrücken. Ich halte das für einen normalen gesellschaftlichen Prozess, eine geschichtliche Entwicklung, und so habe ich auch darüber geschrieben. Aber genau das ist nach Meinung aller guten Freunde im Vatikan ein Fehler, sogar ein schwer verzeihlicher, weil ich es besser wissen müsste. Ich war doch dabei in Havanna, im Januar 1998, als Papst Johannes Paul II. auf den grauen Himmel über der Karibik blickte, der ausgerechnet mitten in seiner Predigt aufriss.
Ein starker Wind blies die Wolken weg. Diesen Wind halte er für sehr bedeutungsvoll, sagte damals Wojtyła. Er glaubte, dabei zu sein, wie der Heilige Geist die Insel erfasste und schließlich veränderte. Er glaubte eine Prophezeiung zu erleben, die Voraussage, dass Gott diese Insel Kuba mit Hilfe des Heiligen Geistes verändern werde.
Nach dem Besuch des Papstes hat sich Kuba tatsächlich verändert, unbestritten. Die Verfolgung von Christen hat nachgelassen. Dabei hatte Fidel Castro dem Papst noch 1998 vorgeworfen, die Kirche sei schuld an Rassismus und Unterdrückung auf seiner Insel. Aber können diese Veränderungen nicht eine simple historische Entwicklung signalisieren? Muss man sich wirklich fragen, ob hier der Heilige Geist gewirkt hat?
Okay, es gab damals einen Windstoß. Zufällig riss genau während der Predigt des Papstes der Himmel auf. So habe ich das damals beschrieben. Aber es lässt mir bis heute keine Ruhe, dass der Mann, der im Mittelpunkt des Geschehens stand, Papst Johannes Paul II., nicht an einen Zufall glaubte, sondern an eine Prophezeiung.
Der »Jahrtausendpapst« war davon überzeugt, dass Gott zu ihm sprach und ihm die Zukunft voraussagte.
Ich selbst halte meine Entscheidungen und Handlungen für eine Folge von Ideen und Launen. Manchmal sind sie nichts weiter als ein Resultat aus Langeweile oder Ratlosigkeit. Dass ich in Wahrheit nach dem Plan eines anderen leben soll, eines unerklärlichen Wesens, das die Menschen Gott nennen, geht mir nicht in den Kopf.
Es gab in meinem Leben nur einen Menschen, der es völlig richtig fand, dass ich so lange in Rom lebte: meine Mutter Martha. Wir standen uns sehr nahe, und ich erinnere mich, dass ich sie einmal fragte, warum sie so fröhlich sei, wenn ich sie besuchte. »Als ich dich zum ersten Mal im Arm hielt, da dachte ich, jetzt fängt mein Leben richtig an«, antwortete sie. Ich hatte immer gefürchtet, dass sie unter meiner Entscheidung litt, so weit entfernt von ihr zu leben. Als mein sterbender Onkel mich ermahnte, endlich nach Hause zu kommen, fühlte ich mich schuldig. Ich sprach mit meiner Mutter darüber, aber sie sagte nur: »Du wirst schon da unten bleiben.« Sie hegte keinen Groll, als wüsste sie, dass ich am richtigen Ort war; weil hier etwas passieren würde, das ich nicht verpassen durfte, etwas, das mit meiner Bestimmung zu tun hatte.
Sie besuchte mich oft, richtete sie sich während jeder Reise zu mir in meinem Leben in Italien ein. Sie kaufte auf dem Markt in der Via dei Quattro Coronati am Kolosseum ein und lernte, dass Hühnerschnitzel »petti di pollo« heißen. Sie kannte nach ein paar Tagen das halbe Stadtviertel, sprach mit Händen und Füßen. Sie konnte sich nicht genug wundern über die seltsamen Fische, die es auf dem Markt gab, und sie liebte es, mit mir die frischen Granatäpfel, Artischocken und Zucchiniblüten zu bestaunen, die es damals in Deutschland noch nicht gab. Sie hatte in ihrem Leben nur selten öffentliche Verkehrsmittel benutzt. In meiner Heimatstadt Werl war das kaum nötig, und sie wollte auch im großen Rom nicht damit anfangen. Deswegen ging sie zu Fuß. Kilometer um Kilometer erlief sie sich diese Stadt. Wenn ich mit ihr am Petrusgrab in der Peterskirche ein »Vaterunser« betete, hatte ich das Gefühl, dass sie froh darüber war, mich in Rom zu wissen. Als müsste ich hier leben, weil ich etwas finden würde. Sie grub mit mir den ersten Garten um, den ich in Italien hatte, wunderte sich über die Pflanzen, die hier wuchsen, die Bananenstauden und Olivenbäume. Das Einzige, was sie störte, war der ständige Zeitdruck, unter dem ich jahrelang stand. Sie mochte diese Hetzerei nicht. Sie sagte mir immer wieder: »Wenn ich einmal sterbe, dann muss ich mich wohl nach deinem Terminkalender richten.«
Ich wusste, worauf sie anspielte. Wir hatten einmal einen heftigen Streit ausgetragen. Ich muss so 16 Jahre alt gewesen sein und hatte mich aus irgendeinem Urlaub nicht gemeldet. Zu Hause empfing sie mich mit Vorwürfen: Sie hätte in der Zeit, in der ich weg war, sterben können, und ich hätte das nicht einmal mitbekommen. Trotzig erwiderte ich, dass ich wahrscheinlich sowieso nicht zur Beerdigung gekommen wäre, weil ich es viel besser gefunden hätte, mich an einem südländischen Strand in der Abenddämmerung an sie zu erinnern als auf einem hässlichen westfälischen Friedhof. Sie weinte damals, und mir tat das alles leid. Diesen Streit hatten wir beide nicht vergessen, und jedes Mal, wenn sie zum Spaß sagte: »Na, dann werde ich mein Sterben wohl nach deinem Terminkalender richten müssen«, lachten wir beide. Heute fröstelt es mich, wenn ich daran denke. Was diese Worte bedeuteten, konnte ich damals nicht ahnen.
Meine Mutter gab mir vielleicht auch deswegen stets das Gefühl, in Rom am richtigen Ort zu sein, weil ich ihr erzählt hatte, dass es für mich einen sehr persönlichen Grund gibt, über Vorbestimmung nachzudenken.
Es ist fast genau 30 Jahre her: Ich war 17 Jahre alt und ging mit meinem knallorangen Rucksack, auf den ein alter Schlafsack und eine schwarze Isoliermatte geschnallt waren, an dem Kochgeschirr baumelte und in den die streng riechenden Klamotten eines Jugendlichen im Urlaub gestopft worden waren, in die Kirche Santa Maria Novella in Florenz und betete.
Bis heute kann ich mir nicht erklären, warum ich eigentlich in diese Kirche gegangen bin, denn ich war damals bestimmt kein frommer Junge. Ich befand mich mitten in der Phase der Rebellion. Eltern, Papst und Establishment konnten mir gestohlen bleiben. Aber dennoch erinnere ich mich genau daran, dass ich in die Kirche ging und betete. Ich bat Gott: »Lass mich hierbleiben! Lass mich in Italien bleiben! Nur hier kann ich herausfinden, ob es dich gibt.«
Es war eine normale, subjektive Erfahrung, wie sie täglich Millionen Menschen erleben, eine Art inneres Zwiegespräch mit Gott, zu welchem Gott auch immer die Menschen gerade beten mögen. Sie haben, das weiß ich aus einer Unzahl von Gesprächen, das Empfinden, erhört zu werden, und manchmal haben sie sogar das Gefühl, eine Antwort zu bekommen. Das hatte ich auch. Das war alles.
Danach habe ich aus eigener Kraft nie wieder etwas getan, um dem Ziel Italien näher zu kommen. Ich habe nach dem Abitur nicht Italienisch studiert, nie habe ich erwogen, mich an der für Ausländer bestimmten Universität in Perugia einzuschreiben. Stattdessen zog ich nach Hamburg, studierte Journalistik und arbeitete bei Zeitungen. An dem Tag, der mein Leben verändern sollte, hatte ich frei. Ich hätte nicht in die Redaktion fahren müssen. Ich tat es dennoch, weil ich frisch verliebt war in meine heutige Frau und sie nur am Arbeitsplatz treffen konnte. An diesem Tag besuchte der damalige Aufsichtsratschef des Verlages zufällig unsere kleine Lokalredaktion hinterm Deich und schwärmte von den phantastischen Entfaltungsmöglichkeiten, die sich uns boten, weil unser Provinzblatt dem größten Verlagshaus Europas gehörte. Ich schrieb damals über Schützenfeste und Kaninchenzüchter. Der Vortrag des Konzernchefs klang in meinen Ohren irgendwie höhnisch, und weil ich jung und überheblich war und nichts zu verlieren hatte, riskierte ich eine dicke Lippe und fragte, warum ich mich nicht sofort entfalten dürfte: Ich wäre lieber Rom-Korrespondent als Deichreporter. Zwei Tage später saß ich im Flugzeug auf dem Weg in die Ewige Stadt. Ich hatte den Job.
Das war natürlich Zufall. Dennoch bin ich später nach Florenz gefahren, bin in dieselbe Kirche gegangen, Santa Maria Novella, und habe Gott gedankt. Warum? Welchen Sinn machte das, wenn ich so sicher war, dass es nur Zufall sein konnte. Die Antwort lautet: Letztendlich war ich eben nicht sicher, ob es nicht doch einen Gott gab, der Gebete erhörte, der damals einen schmutzigen 17-jährigen in seiner Kirche knien sah und dachte: Okay, der junge Mann da, der will mich nicht im Gebet erfahren, der will mich anfassen, sehen, spüren. Das kann er haben. Er soll eines Tages in einem Vatikan-Bus in Baku sitzen, dem das Dach abgerissen wird, und der Glassplitterregen wird ihm die Haut zerschneiden; er wird mit Hubschraubern und Flugzeugen notlanden und panische Angst um sein Leben haben; er wird tagelang in sengender Hitze sitzen, die Zeit totschlagen, weil er auf Flugzeuge, Busse, Hubschrauber warten muss, die Männer Gottes durch Afrika, Asien und Amerika transportieren; er wird sich von ruppigen Polizeibeamten die Arme verdrehen lassen, er wird Bomben explodieren hören. Aber wenn er das will, wenn er sehen will, wie sich ältere Herren in meinem Namen um die Welt quälen, um sie dabei zum Besseren zu verändern, wenn er sich fragen will, ob es nicht doch einen gütigen, allmächtigen Gott gibt, der hinter allem steckt, dann kann er das haben.
Seitdem denke ich über diese Frage nach: Hat mich ein Gebet nach Italien gebracht, in das Leben, das ich dann in und um den Vatikan führte, oder war es eine Kombination aus Zufällen? Aber um diese Frage zu beantworten, muss man weit zurückgehen.
Im Jahr 1987 machte ich zufällig eine erstaunliche Entdeckung: Im Vatikan regierte ein Papst, der die göttliche Vorsehung nicht nur predigte. Er lebte sie; denn er war überzeugt, dass er nur noch am Leben war, weil dies dem göttlichen Plan entsprach. Der Papst wurde nicht müde zu erklären, dass eine Hand aus dem Jenseits die Kugel ablenkte, die ihn am 13. Mai 1981 auf dem Petersplatz hätte töten sollen.
Für mich war dies unfassbar. Ich hatte christliche Religion in ihrer katholischen Form in meinem Heimatland ganz anders erfahren: Man ging am Sonntag in eine Kirche, sprach Gebete, ließ sich aus der Bibel vorlesen und beichtete seine Sünden. Aber man glaubte doch nicht wirklich daran, dass vor aller Augen übernatürliche Ereignisse stattfanden, weil Gott Wunder wirkte, weil er eine Kugel ablenkte, die der türkische Terrorist Ali Agça auf einen Papst abgefeuert hatte.
Dieser Glaube an die Vorsehung und an die konkrete Kraft Gottes hat mich damals geradezu herausgefordert. Warum sollte es einen Gott in irgendeinem Himmel geben, der ausgerechnet diesem einen Mann, Karol Wojtyła aus Wadowice in der polnischen Provinz, das Leben retten wollte? Für mich gab es keinen Zweifel daran, dass der Papst nur durch Zufall bei dem Attentat nicht starb. Als Michail Gorbatschow 1989 nach Rom kam und dem Papst unmissverständlich sagte, dass ohne ihn die Mauer in Berlin nicht gefallen wäre, fand ich, dass hier ein Staatsmann dem anderen ein nettes Kompliment gemacht hatte, mehr nicht.
3
Vorahnung
Den 28. Juli 2002 werde ich aus einem ganz bestimmten Grund nie vergessen. Ich habe oft in meinem Leben einen Papst beten sehen. Dafür werde ich bezahlt. Aber an diesem Tag habe ich miterlebt, dass Gott ein Gebet des Papstes erhört hatte.
Anders als jedem Staatsmann ist es dem Papst nur selten vergönnt, einen Triumph zu feiern. Der Papst erlebt nie das Hochgefühl, nach einer hitzigen Debatte seine Widersacher überzeugt zu haben, weil Päpste einfach anordnen, was zu glauben und zu tun ist. Darüber hinaus besteht die Aufgabe des Papstes darin, die Menschen darum zu bitten, etwas Bestimmtes zu tun. Die Päpste können bestenfalls mit ihren Botschaften und Gebeten säen. Sie ernten jedoch selten. Was das angeht, dürfte Papst Paul VI. eine der größten Niederlagen aller Zeiten eingesteckt haben. Er veröffentlichte am 25. Juli 1968 die Enzyklika »Humanae vitae«, in der es um ein Verbot künstlicher Verhütung ging. Der eheliche Akt war somit sittlich nur erlaubt, wenn die Frau prinzipiell schwanger werden konnte. Paul VI. und seine Nachfolger mussten erleben, dass die katholischen Gläubigen weltweit nicht daran dachten, sich an diesen Grundsatz zu halten. Papst Benedikt XVI. räumte am 4. Oktober des Jahres 2008 denn auch ein, dass die Gläubigen die kirchliche Lehrmeinung in diesem Punkt offenbar nicht verstehen und ihr deshalb nicht folgen.
Wenn der Papst tatsächlich einmal einen Sieg erringt, muss das, was wirklich geschehen ist, aus Gründen der Staatsraison geheim bleiben. Genauso war es für Papst Johannes Paul II. am 28. Juli 2002 im Downsview Park in Toronto (Kanada), als er den Abschlussgottesdienst für den 17. Weltjugendtag feierte. Der Papst erlebte damals einen Triumph, aber nur ganz wenige Menschen wussten davon. Auch ich hatte keine Ahnung, was vor sich gegangen war.
Bereits im Winter hatte sich die Nachricht verbreitet, dass der Weltjugendtag des Jahres 2002 in Toronto abgesagt werden müsse. Die Begründung schien beschämend, aber plausibel zu sein: Die römisch-katholische Kirche in den USA, die größte Glaubensgemeinschaft des Landes, erlebte den schlimmsten Skandal ihrer Geschichte. Landesweit hatten mehr als 10 000 Opfer von pädophilen Priestern geklagt. Der Missbrauchsskandal verunsicherte die Gläubigen, kostete die Kirche Ansehen und brachte zahlreiche Diözesen an den Rand der Zahlungsunfähigkeit. 1,45 Milliarden US-Dollar mussten die Kirchen insgesamt an Entschädigungen zahlen. Kardinal Bernard Francis Law, der damalige Erzbischof von Boston, legte im Jahr 2002 die Leitung des Erzbistums nieder, weil ihm vorgeworfen wurde, Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern unter seinen Diözesanpriestern nicht in hinreichender Weise verfolgt und angezeigt zu haben.
Angesichts dieses Klimas schien es kaum wahrscheinlich, dass Hunderttausende von Eltern ihre Kinder guten Gewissens mit Priestern nach Kanada reisen ließen, wohl wissend, dass die Geistlichen dort mit ihren minderjährigen Schutzbefohlenen in Zelten übernachten müssten. Toronto in Kanada war ausgewählt worden, um den jungen Menschen auf dem nordamerikanischen Kontinent die Möglichkeit zu geben, am Weltjugendtag teilzunehmen. Aber wenn sich abzeichnen sollte, dass die erwarteten Hunderttausende aus den USA nicht kommen würden, schien dieser Weltjugendtag wenig Sinn zu machen.
Ich fiel auf diese Finte herein und ahnte nicht, dass es in Wirklichkeit um etwas ganz anderes ging. Wie viele andere hielt ich den Missbrauchsskandal für das Thema, das den Weltjugendtag in Toronto überschattete und vielleicht sogar verhindern konnte.
Ich führte fleißig Interviews, traf mich mit dem damals für die Weltjugendtage zuständigen Kardinal, plante und erreichte schließlich auch ein Interview mit dem damaligen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Karl Lehmann, zum heiklen Thema des Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen durch katholische Priester.
In meinen Augen war damals ganz klar: Der Weltjugendtag in Toronto drohte abgesagt zu werden, um ein Debakel zu verhindern. Es konnte nicht im Interesse des Vatikans sein, der Welt zu demonstrieren, wie groß der Schaden war, den verbrecherische Priester in Nordamerika Kindern und auch der Kirche zugefügt hatten. Ein Papst, der vor leeren Rängen in Toronto die Gottesdienste eines Weltjugendtages zelebrierte, würde diese Niederlage deutlich machen. Im Frühjahr 2002 festigte sich der Eindruck, dass der Weltjugendtag abgesagt werden könnte. Ich schrieb fleißig Kommentare.
Bis heute frage ich mich, wie ich so einfältig sein konnte, einen klaren Hinweis darauf zu übersehen, worum es tatsächlich ging. Die Besorgnis wurde stets von kanadischer Seite vorgetragen. Immer betonten kanadische Organisatoren, dass sie wegen der Pädophilie-Skandale in den USA und Kanada fürchteten, statt der erhofften Millionen könnten nur wenige zehntausend Pilger kommen, dass Kanada dem Vatikan diese Schmach ersparen möchte.
Erst fünf Jahre später, im Jahr 2007, zwei Jahre nach dem Tod von Papst Johannes Paul II., erfuhr ich die Wahrheit von einem Funktionär des Vatikans. Wir sprachen beim Spazierengehen über den Schaden, den Priester, die Kinder oder Jugendliche missbraucht hatten, der katholischen Kirche zufügten, und ich ergänzte, dass wegen des Sexskandals ja beinahe der Weltjugendtag in Toronto ausgefallen wäre. Mein Begleiter blieb plötzlich stehen, sah mich an und begann schallend zu lachen. Als er sich gefangen hatte, fragte er: »Du hast den ganzen Quatsch damals auch geglaubt? Ich habe immer gedacht, irgendwann merken die Journalisten was – aber ihr habt nichts gemerkt.«
»Was haben wir nicht gemerkt?«
»Ist euch damals nicht aufgefallen, dass gerade die Aufdeckung der Verbrechen von Priestern, die sich an Schutzbefohlenen vergingen, das Vertrauen in die Kirche langsam wieder herstellte? Es wurde endlich nichts mehr bemäntelt, die Kirche begann selbst, verdächtige Priester bei der Polizei anzuzeigen. Die Gläubigen sahen, dass endlich aufgeräumt wurde, auch wenn das ein schmerzhafter Prozess war. Aber genau deswegen hat der Vatikan nie befürchtet, dass die Eltern ihre Kinder nicht zum Weltjugendtag nach Toronto schicken könnten.«
»Also stimmt es nicht, dass der Weltjugendtag damals abgesagt werden sollte?«
»Sicher stimmt das«, sagte er, »aber aus einem ganz anderen Grund.«
»Aus welchem?«
»Wir waren damals das perfekte Ziel. Das war das Problem«, erklärte er.
Die kanadische Regierung fürchtete das Großereignis, denn ihrer Ansicht nach war der Papst, der mit einer Million junger Menschen auf dem Rasen des Downsview Parks eine Messe feierte, vor allem eins: ein ideales Ziel für den ersten großen Schlag nach dem 11. September.
Heute fällt es schwer, die Entscheidungen von damals nachzuvollziehen; denn die kollektive Angst, dass die Welt durch eine ganze Reihe entsetzlicher Attentate bedroht sei, hat sich abgeschwächt. Doch unmittelbar nach den katastrophalen Anschlägen auf das World Trade Center glaubten viele, dass mit weiteren spektakulären Attentaten zu rechnen wäre. Der katholischen Kirche fiel eine neue Rolle zu: Sie war das ideale Ziel. Die Attentäter des 11. September hatten es nicht auf eine bestimmte Person abgesehen, sondern auf eine Zivilisation. Diese Zivilisation war nun einmal seit Jahrtausenden durch das Christentum geprägt. Bis zum 10. September 2001 war der Papst das Oberhaupt einer Kirche gewesen, die in der modernen globalen Welt mehr und mehr an Bedeutung verlor. Ab dem 11. September aber war der Papst das Symbol der christlich geprägten Zivilisation. Die Drohungen muslimischer Fundamentalisten gegen das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche häuften sich nach dem 11. September drastisch. Papst Benedikt XVI. sah sich später sogar gezwungen, die Entmilitarisierung des Vatikans rückgängig zu machen.
Papst Paul VI. hatte angeordnet, dass alle Mitglieder der beiden Sicherheitskräfte des Vatikans, also sowohl die Gendarmen als auch die Schweizergardisten, ihre Waffen abzugeben hätten. Seitdem gab es im Vatikan nur noch jahrhundertealte Museumsstücke wie die Hellebarden der Schweizergardisten als Dekoration. Doch unter der Regentschaft von Benedikt XVI. erhielten die Gendarmen und Schweizergardisten wieder moderne Waffen, vor allem Präzisionspistolen.
Im Herbst des Jahres 2001 war es also überaus verständlich, dass die Planung des Weltjugendtages in Toronto einem Albtraum glich. Denn alle ungünstigen Umstände kamen zusammen: Die Teilnehmer des Weltjugendtages wirksam zu kontrollieren, war unmöglich. Da der Papst eingeladen hatte, konnte Kanada kaum wirksame Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Das größte Problem für die Kanadier war der religiöse Charakter des Weltjugendtages. Für ein Land ist es beispielsweise möglich, vor einem großen Sportereignis, einem Fußballspiel, einem Autosalon, vor einer Massendemonstration oder einem Rockkonzert bestimmte Personen nicht ins Land zu lassen. Niemand hätte Anstoß daran genommen, wenn Kanada sich geweigert hätte, möglicherweise gewaltbereite Fans vor einem Fußballspiel an der Grenze abzuweisen. Doch Pilgern, die zu einem Weltjugendtag reisen wollten, um mit dem Papst zu beten, konnte man schlecht die Einreise verweigern. Selbst wenn diese Pilger aus einem Land anreisten, in dem es nachweislich gefährliche terroristische Gruppen gab, etwa aus Syrien, Pakistan oder Ägypten, konnte man sie nicht zurückweisen. Zum perfekten Ziel wurde der Weltjugendtag, weil der Papst höchstpersönlich zusammen mit den wichtigsten Mitgliedern der Kirchenregierung am Altar des Downsview Parks in Toronto stehen würde. Die Kanadier wussten, dass es schon sehr schwierig war, die Besucher einer normalen Großveranstaltung, also zwischen 80 000 bis 100 000 Menschen, zu kontrollieren. Aber die erwarteten Besucher des Weltjugendtages, etwa eine Million Menschen, erst nach einem Sicherheitscheck durch Scanner, die nach Sprengstoff und Waffen suchen, auf den Platz zu lassen, war unmöglich. Die Kontrollen, selbst wenn die Organisatoren genügend Mittel für Polizisten und Scanner aufgeboten hätten, hätten länger gedauert als alle Hauptveranstaltungen des Weltjugendtages zusammen.
Nicht nur die Kontrollen am Boden machten den Kanadiern Sorgen, sondern vor allem die Kontrolle des Luftraumes. Natürlich fürchteten damals viele, dass Terroristen weitere spektakuläre Attentate aus der Luft planen und vorbereiten könnten. Der Weltjugendtag mit einer Million Teilnehmern unter freiem Himmel stellte für einen solchen Angriff ein kaum zu schützendes Ziel dar.
Im Herbst des Jahres 2001 setzte sich daher in der kanadischen Regierung die Überzeugung durch, dass man den Weltjugendtag am besten absagen sollte. Aber selbstverständlich durfte die wahre Begründung für die Maßnahme nicht genannt werden. Ein christliches Friedensfest aus Angst vor muslimischen Anschlägen ausfallen zu lassen, hätte ganz klar bedeutet: Die Terroristen haben gewonnen. Ein anderer Grund für die Absage musste gefunden werden. Der Missbrauchsskandal in den USA eignete sich ideal. Konsequent wurde die Sorge, dass die Eltern ihre Kinder nicht mit potenziell pädophilen Priestern auf eine Reise schicken würden, in allen Medien platziert.
Der Vatikan geriet unter erheblichen Druck. Der Papst hatte keine andere Wahl, als genau das zu tun, was seine Gegner sich wünschten. Er beteuerte, dass der Missbrauchsskandal längst unter Kontrolle sei, und heizte damit die Diskussion um das Thema erst richtig an. Papst Johannes Paul II. befand sich in einer heiklen Lage. Einen Weltjugendtag in Kanada ohne Unterstützung der Gastgeber durchzuziehen, schien wenig ratsam zu sein. Was sollte der Vatikan anbieten, um die Sicherheitsbedenken der Kanadier zu zerstreuen? Und wenn die Bedenken begründet waren? Würde der Papst nicht wider besseres Wissen eine Million junger Menschen in eine »Falle locken«? Zudem bestand nunmehr die Gefahr, dass die Pessimisten recht hatten und die Kampagne Erfolg hatte. Riskierte Johannes Paul II. nicht tatsächlich, zu einem Weltjugendtag auf dem nordamerikanischen Kontinent einzuladen, zu dem die Jugend Nordamerikas wegen des Missbrauchsskandals nicht kommen würde?
Gute Gründe sprachen dafür, die Veranstaltung einfach abzusagen. Aber keiner hatte für einen Mann mit dem Gottvertrauen des Papstes Gewicht. Johannes Paul II. ließ seinen Medienfachmann und Papstsprecher Joaquín Navarro Valls wissen, dass er eine Lösung suchen sollte. Der Vatikan sollte den Kanadiern antworten. Es sollte eine kurze Formel sein, die ihnen klar machte, dass der Vatikan den Grund der Sorge durchschaut hatte. Navarro Valls fand diesen einen Satz, den der Papst suchte, und verkündete ihn in einer Pressekonferenz in Rom. »Now, more than ever«: »Jetzt erst recht!« Für die Kanadier stand nach der Veröffentlichung dieser kurzen Stellungnahme fest, dass der Vatikan nicht nachgeben würde.
Ich selbst verstand nichts, konzentrierte mich auf die Debatte um den Missbrauch von Kindern und konnte nach zähem Ringen Kardinal Karl Lehmann, den Chef der Bischofskonferenz, dazu bringen, sich mit mir in Toronto zu treffen, um über den Fall eines pädophilen Priesters in seiner Diözese zu sprechen.
So verstand ich auch nicht, was am Tag des Abschlussgottesdienstes, am 28. Juli 2002, wirklich geschah. Am Himmel über Toronto herrschte damals eine Art Kriegszustand. Was immer fliegen und schießen konnte, befand sich in der Luft. Unten am Boden feierte Karol Wojtyła still und leise einen seiner größten Triumphe.
Alle Voraussagen waren falsch gewesen. Die Spekulation, die Jugendlichen würden nicht kommen, erwies sich als aus der Luft gegriffen. Statt der 25 000, die Pessimisten vorhergesagt hatten, kamen eine Million junger Menschen, vor denen der Papst die Messe zelebrierte. Er stand am Altar des Downsview Parks und zeigte, was sein Gottvertrauen bewirkt hatte. Die westliche Welt würde den Schock des 11. September überwinden.
Musste ihm dieser Augenblick nicht Mut machen? Musste er nicht am Ende des Abschlussgottesdienstes an den Altar treten, um die Formel zu sprechen, mit der er jeden Weltjugendtag beendete: »Auf Wiedersehen in…«? Dieses Mal wäre es Köln gewesen, und wir Journalisten warteten auf diese Worte, die immer eine Woge der Begeisterung, einen aufbrausenden Jubelchor und La-Ola-Wellen ausgelöst hatten: »See you again in Cologne in 2005.« Sollte Gott sich entscheiden, ihn vorher abzuberufen, so war dennoch nichts Verwerfliches dabei, dass er, der Papst, der Gastgeber, persönlich zum nächsten Weltjugendtag einlud, zumal in einem solchen Augenblick, in dem Papst Johannes Paul II. gezeigt hatte, dass seine Erfindung, der Weltjugendtag, mehr war als ein katholisches Woodstock.
Ich stand damals inmitten der Menge, sah auf den Altar und auf die deutschen Jugendlichen, die sich mit ihren Fahnen in die Nähe des Altars drängten. Sie wollten so nah wie möglich dran sein, wenn dieser magische Moment eintreten würde, wenn er sagen würde: »See you again in Cologne 2005.« Ich wartete darauf, dass die deutschen Katholiken voller Stolz ihre Fahnen schwenken würden, in der Gewissheit, dass das Schicksal des nächsten Weltjugendtages jetzt in ihrer Hand lag. Es war ein seltsames, aber ein schönes Gefühl, damals dort auf der Wiese in Toronto daran zu denken, dass der nächste Weltjugendtag bei mir zu Hause stattfinden würde, keine 150 Kilometer von meinem Elternhaus entfernt, von der Kirche, in der ich Messdiener gewesen war.
Ein Weltjugendtag in deutscher Sprache – wie würde das sein? So viele Länder hatte ich mit Karol Wojtyła bereist, und jetzt ging es nach all den Jahren nach Hause. Dann geschah es: Papst Johannes Paul II. winkte noch einmal stumm – und verließ den Altar. Ich blieb fassungslos und wie angewurzelt stehen. Ohne jeden Grund, ohne eine rational nachvollziehbare Einsicht schoss mir in diesem Augenblick durch den Kopf: Er weiß es. Er wird Köln nicht mehr erleben, und er weiß es.
Zum ersten Mal hatte er es nicht gesagt, zum ersten Mal hatte er am Ende des Abschlussgottesdienstes eines Weltjugendtages nicht in die Stadt eingeladen, die den nächsten Weltjugendtag ausrichten würde. Er hatte es nicht ausgesprochen, das »See you again in Cologne 2005«. In diesem Augenblick des Triumphs ging er leise fort von der großen Bühne, die er so lange beherrscht hatte. Das schrieb ich an diesem Tag in einem Kommentar für das Hamburger »Abendblatt«, und wieder und wieder dachte ich darüber nach, was geschehen sein mochte.
Papst Johannes Paul II. war nicht der Mann, der am Ende eines großen Gottesdienstes einen solchen Satz vergaß. Er war nicht der Mann, der diese Formel aus seinen Unterlagen für die Abschlussansprache einfach überlas. Es gab nur einen Grund: Er wollte ihn nicht sagen.
Sicher, es lagen damals noch drei lange Jahre vor ihm; die Diözese Köln hatte die Ausrichtung des Weltjugendtages im Jahr 2004 abgelehnt, weil die Großveranstaltung mit dem Sommer zusammengefallen wäre, in dem die Olympischen Spiele stattfanden. Deswegen war der Weltjugendtag auf das Jahr 2005 verschoben worden. Aber war es nicht Karol Wojtyłas Pflicht, zu sagen, dass er die Jugendlichen in drei Jahren wiedersehen wolle?
Es gab eigentlich nur einen Grund, den Satz nicht zu sagen: Wenn er es bereits wusste. Wenn er wusste, dass er den Weltjugendtag in Köln nicht mehr erleben würde, wenn Gott ihn in die Zukunft hatte schauen lassen, wenn er eine Prophezeiung empfangen hatte.
4
Spitzenkandidat
Nach diesem Sommer im Jahr 2002 habe ich immer wieder Kontaktmänner im Vatikan, Bischöfe und Prälaten, gefragt, ob sich der Papst ihrer Ansicht nach in Toronto von der großen Bühne des Weltjugendtages verabschiedet habe, ganz leise, weil er »wisse«, dass er den Weltjugendtag in Köln nicht mehr erleben werde. Es gab zahlreiche Priester, denen ebenfalls aufgefallen war, dass der Papst den Satz »See you again in Cologne 2005« nicht gesagt hatte. Viele hielten es für selbstverständlich, dass »ihr Chef« eine Prophezeiung empfangen haben könnte.
Unterdessen verschlimmerte sich die Parkinson-Krankheit des Papstes. Und ich hatte den höchst irdischen Auftrag, seine gesundheitliche Verfassung im Auge zu behalten. Lange Zeit hegte ich keinen Zweifel daran, dass sich im Zwergstaat Vatikan, genau wie im Rest der Welt, zwar durchaus komplizierte, aber vor allem erklärbare Prozesse abspielen. Es schien mir, dass alles, was ich erlebte, mit der Erde, aber keinesfalls mit dem Himmel zu tun hatte. Doch ein kleines Detail ließ mich plötzlich zweifeln.
Im Mai des Jahrs 2004 erschien ein neues Buch von Papst Johannes Paul II. mit dem Titel »Auf, lasst uns gehen«. Ich las es aufmerksam und wurde nicht enttäuscht. Es enthielt eine Sensation. Der Papst präsentierte seinen Wunschkandidaten für die Nachfolge, Joseph Ratzinger.
Während er in diesen Lebenserinnerungen an seine Zeit als Bischof von Krakau viele Mitarbeiter und Weggefährten erwähnt, nennt er nur einen Mann »meinen bewährten Freund«: Joseph Ratzinger. Karol Wojtyła wusste natürlich, dass zum Erscheinungsdatum des Buches, als seine Gebrechen sich weiter verschlimmerten, bereits die ganze katholische Welt über seine Nachfolge diskutierte. Ihm musste klar sein, welche Wirkung es haben würde, wenn er in einem solchen Augenblick einen Kardinal unter allen anderen deutlich hervorhob. Es war kein Geheimnis, wen der Papst zu seinen besten Freunden zählte. Dazu gehörte auf jeden Fall Kardinal Marian Jaworski, der sogar einen Arm für Karol Wojtyła verloren hatte. Wojtyła hatte Jaworski in Polen einmal gebeten, ihn während einer Vorlesung in Lublin an der Universität zu vertreten. Jaworski war gefahren, der Zug entgleist. Bei dem Unfall büßte er seinen linken Arm ein. Nicht nur aus Dankbarkeit, auch wegen ihres gemeinsamen Lebensweges, war der Papst Marian Jaworski eng verbunden. Der Kardinal spendete ihm die letzte Ölung.
Noch ein Mann, der fast täglich zum Mittagessen kam, gehörte in den engsten Kreis um Karol Wojtyła: Andrzej Maria Kardinal Deskur. Karol Wojtyła und Deskur kannten sich aus Krakau, verbrachten dann 25 Jahre gemeinsam im Vatikan. Karol Wojtyła hatte Deskur mit den heikelsten Aufgaben seiner Amtszeit beauftragt. So zum Beispiel mit der schwierigen Mission, nach Civitavecchia, der Hafenstadt bei Rom, zu reisen, um nach der Beschlagnahmung einer umstrittenen, angeblich Blutstränen weinenden Muttergottesstatue durch die Polizei den Gläubigen eine neue, vom Papst geweihte Statue zu bringen. Joseph Kardinal Ratzinger war dagegen gewesen, die Muttergottesstatue zu ersetzen. Als Präfekt der Glaubenskongregation hatte er das Wunder der Blut weinenden Madonna nie anerkannt. Kardinal Deskur war auch mit der Aufklärung des Papstattentates aus dem Jahr 1981 vertraut gewesen. Er hatte die Theorie vertreten, dass der Anschlag auf den Papst tatsächlich ein perfektes Verbrechen gewesen sei, dass Ali Agça nicht wisse, wer seine Auftraggeber waren, und dass auch nach einer eventuellen Freilassung Ali Agças niemals bekannt werden würde, in wessen Auftrag er gehandelt hatte.
Die Kardinäle Jaworski und Deskur gehörten also unbestritten zum engsten Freundeskreis des Papstes. Dass beide in seinem Buch nicht vorkamen, musste im Vatikan auffallen. Mehrfach schon hatte Karol Wojtyła aus Schriften absichtlich die Namen Deskur und Jaworski herausgehalten. Bisher hatte man das im Vatikan so verstanden, dass der Papst offensichtlich die Wahl seines Nachfolgers nicht dadurch beeinflussen wollte, indem er immer wieder betonte, wie sehr er Deskur und Jaworski zugetan war. Aber dass er in »Auf, lasst uns gehen!« keinen der engsten Freunde erwähnte, sondern stattdessen ausgerechnet Kardinal Ratzinger hervorhob, galt als Sensation.