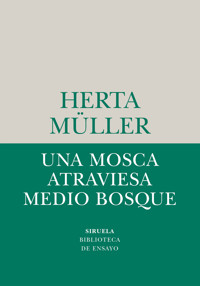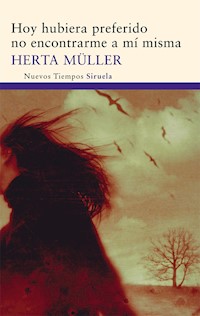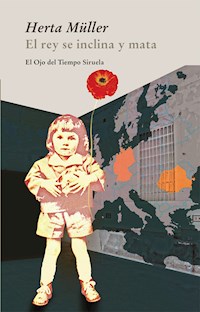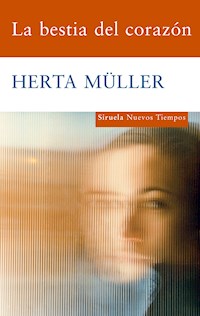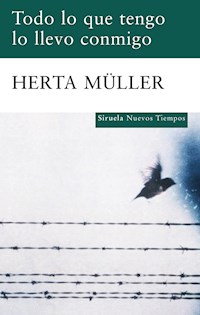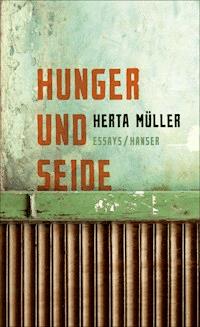Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Ich stehe (wie so oft) auch hier neben mir selbst." So begann Herta Müller ihre Tischrede nach der Verleihung des Nobelpreises. In einem langen Gespräch mit Angelika Klammer erzählt sie von ihrem ungewöhnlichen Lebensweg, der vom Kind, das Kühe hütet, bis zur weltweit bekannten Schriftstellerin im Stadthaus in Stockholm führt. Sie erzählt von der Kindheit in Rumänien, vom Erwachsenwerden und dem erwachenden politischen Bewusstsein, von den frühen Begegnungen mit der Literatur, den Konflikten mit der Diktatur des Kommunismus und dem eigenen Weg zum Schreiben. Mit ihrem Bericht vom Ankommen in einem neuen Land fällt auch ein ungewohnter Blick auf das Deutschland der 80er und 90er Jahre und auf die Gesellschaft, in der wir heute leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
HERTA MÜLLER
Mein Vaterland
war ein Apfelkern
Ein Gespräch
mit Angelika Klammer
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-24835-9
© Carl Hanser Verlag München 2014
Umschlag und Foto: Peter-Andreas Hassiepen, München
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Eulen auf dem Dach
»Die Landschaft der Kindheit«, heißt es in einem Ihrer Essays, »legt Spuren für den Landschaftsblick aller weiteren Jahre. Die Kindheitslandschaft sozialisiert ohne Hinweis. Sie schleicht sich in uns hinein.« In Ihrer Kindheit liefen die Maisfelder um die ganze Welt.
Diese riesigen sozialistischen Maisfelder. Wenn man mittendrin im Feld zwischen den dichten Maisstengeln stand, war das Feld ein Wald. Es reichte einem über den Kopf, man sah nicht hinaus. Aber es fehlten oben die Kronen, es gab keinen Schatten, die Sonne glühte einem den ganzen Tag auf dem Kopf, den ganzen Sommer. Und dann im Spätherbst gab es die vielen vergessenen Felder. Sie blieben dürr und zerzaust stehen, sie wurden nicht geerntet. Man sah sie von weitem. Der Schnee kam und sie zogen über die Ebene. Und so von weitem und von außen gesehen waren sie wie hungrige Herden, die senkrecht um die ganze Welt ziehen. Senkrecht, ja.
In dieser überdimensionierten Landschaft fühlt sich das Kind verloren, es spürt seine erste große Einsamkeit.
Das ist auch so geblieben. Ich glaube, es gibt zwei Menschentypen, und die unterscheiden sich in der Art, wie sie Landschaft spüren. Die einen steigen gerne auf einen Berg, stehen mit den Füßen dicht unter den Wolken und beherrschen das Tal, mit dem Kopf, mit dem Blick. Die kriegen oben einen freien Atem, da wird ganz groß geschnauft und die Brust weitet sich. Und die anderen fühlen sich, wenn sie oben stehen und hinunterschauen, erst richtig verloren. Ich gehör zu den Verlorenen, mir schnürt sich der Hals zu. Je größer der Ausblick ist, desto beengter und bedrängter bin ich. Als könnte ich gleich hopsgehen, mein Vorhandensein wird völlig infrage gestellt. Ich glaub, das passiert wegen der Unendlichkeit, in die ich mich sofort hineinversetze, und vor der bin ich im Grunde nichts. Ich schaue in eine weite Landschaft und spüre mich in einer großen Ausweglosigkeit.
Früher habe ich die Natur als körperliche Drangsalierung erlebt, sie ist ja gnadenlos, sie friert, brennt und du brennst oder frierst mit. Die sengenden, heißen Sommer, der Durst im Hals, der Staub der Erde, du kannst dich nicht wehren. Der Körper ist dafür nicht gemacht, er tut weh und ist müde. Man ist eben kein Stein oder kein Baum. Das Material, aus dem du bist, hält der Natur nicht stand, es ist lächerlich, vergänglich. Es entstand bei jeder Feldarbeit eine Trauer, die ich nicht haben wollte, weil sie noch zusätzlich Kraft kostet. Aber sie kam, sie war gegen mich und ließ mich nicht in Ruhe. So eine grundlose, blöde Trauer war da, als hätte sie jedesmal da auf dem Feld oder im Flusstal auf mich gewartet: Wie lange gehört dir dieser Körper, wie lange bist du am Leben? Du kannst noch so oft in der Landschaft sein, du gehörst nicht dazu. Ich fand die Natur feindselig. Auch im Winter. Später erfuhr ich dann, dass Naturphänomene eingesetzt werden, um Menschen zu quälen, in Gefängnissen, in Lagern. Polarkreis und Wüste, Frost und Hitze können töten und lassen sich wie Folterwerkzeug benutzen, um Leute zu vernichten. Mir fiel das immer ein und ich konnte auch später in der Stadt nicht verstehen, dass andere sich erhaben fühlen, sie stellen sich auf einen Berg und schauen mit den Augen und Zehen ins Tal und sind glücklich. Wie geht das bei denen?
Die Natur erscheint feindselig, weil man ihr ausgeliefert ist und sich in ihr und gegen sie behaupten muss? Natur kommt in Ihrem Werk ja nie als Ort des Spiels oder der Kontemplation vor, sondern nur als einer der härtesten Arbeit.
Für die Dorfleute war die Landschaft weder hässlich noch schön, sondern ein Arbeitsplatz, eine Nutzfläche. Die Bauern brauchen die Landschaft, um zu überleben, das Wetter entscheidet, ob die Ernte was wird oder nicht. Und der ständige Boykott der Natur, mal überschwemmt sie, mal verdorrt sie alles, mal kommt ein Hagel oder ein Sturm und schlägt alles kaputt. Ich habe die Landschaft nie gemocht. Trotzdem hatte ich eine sehr enge Beziehung zu Pflanzen. Ich war oft allein in der Landschaft, das Beobachten hat geholfen. Ich musste dort im Tal sein, den ganzen Tag, und der Tag war endlos lang. Was sollte ich denn tun? Dann habe ich mich eben mit den Pflanzen beschäftigt. Das hat sich so ergeben. Es war mir nicht bewusst, aber ich suchte einen Halt.
Ich habe alle Pflanzen gekostet, jeden Tag von allen gegessen. Alles schmeckte herb, sauer, scharf oder bitter. Offenbar bin ich nie auf etwas Giftiges gestoßen. Vielleicht gab mir die tägliche lange Einsamkeit so einen Instinkt wie bei einem Tier. Warum habe ich zum Beispiel nie eine Tollkirsche oder Maiglöckchen gegessen? Das Tal grenzte an den Waldrand, dort gab es viele Maiglöckchen.
Sie beschreiben es als Wunsch, den Pflanzen mit der Zeit zu ähneln, sich vielleicht sogar zu verwandeln, denn die Pflanzen kommen mit dieser Landschaft zurecht, das Kind nicht.
Ich habe immer gedacht, die Pflanzen sind im Tal zu Hause, sie sind mit sich und der Welt zufrieden, und ich muss dort rumtapsen und weiß nicht, was ich mit mir machen soll. Und ich glaubte auch, wenn ich genug von den Pflanzen gegessen hab, dann gehör ich vielleicht dazu, weil der Körper, mit dem ich herumlaufe, sich den Pflanzen anpasst. Ich hoffte, dass die gegessenen Pflanzen meine Haut, mein Fleisch so verändern, dass ich besser zum Tal passe. Es war schon der Versuch, mich pflanzennah zu machen, zu verwandeln. Verwandeln, das Wort wäre mir nicht eingefallen, ich hätte es auch gar nicht gehabt. Es war nur der Wunsch, einen Platz für mich zu finden, mich zu schonen, mir die Zeit so zu machen, dass ich sie aushalte. Du siehst deine ganze Endlichkeit, für die du auch kein Wort hast, aber es beschäftigt einen ja nicht nur das, wofür man Wörter hat. Um etwas auszuhalten, brauchte ich keine Wörter, jedenfalls keine so abstrakten Begriffe. Und wenn ich sie gebraucht hätte, war es gut, dass ich das nicht wusste. Es gibt Gefühle, gerade bei Kindern, die sind so konkret wie der Körper selbst – nicht mehr und nicht weniger. Die sind einfach da und das reicht. Das ist mehr als genug. Bei mir war es das Fremdsein, ich bin ständig mit diesen Pflanzen allein und gehöre noch immer nicht dazu. Ich bleibe fremd und bin für sie schwer zu ertragen, sie werden meiner überdrüssig, und eines Tages, wahrscheinlich bald, frisst mich die Erde.
Das Feld ernährt die Menschen nur, damit es sie später fressen kann. Dieser Zyklus ist aggressiv gedacht, nicht sanft oder natürlich, und der Mensch ist darin nichts weiter als ein »Kandidat fürs Panoptikum des Sterbens«.
Die Leute pflanzen etwas, es wächst, dann ernten sie und essen es. Ich dachte, man isst in seinem Leben das Mehl von vielleicht dreißig Sack Weizenkörnern oder fünfzig oder hundert, der Weizen ernährt dich so lange, bis die Erde dich frisst. Der Tod hat für mich immer bedeutet, dass die Erde einen frisst. Und ich habe mir gedacht, die Erde ist so dick, weil so viele Menschen und Tiere schon gestorben sind.
Ich habe immer für alles ein richtiges Maß gesucht. Wenn ich so viel Klee gegessen habe, wie viele Kilo ich selber wiege, dann mag mich der Klee, dachte ich. Aber ich wusste nicht, ob das gut oder schlecht wäre, wenn er mich mag. Oder einen ganzen Flecken Spitzwegerich essen, so groß wie ein Bett, dann könnte ich, wenn sich die Kühe faul ins Gras legen, auch eine Weile schlafen. Ich dachte auch, dass alle Atemzüge, die man tut, gezählt werden. Dass sie sich wie Glaskügelchen auf einer Schnur auffädeln und eine Kette bilden. Und wenn die Atemkette eine Länge hat, die vom Mund bis zum Friedhof reicht, dann stirbt man. Weil der Atem unsichtbar ist, kennt kein Mensch die Länge seiner Atemkette. Und darum weiß kein Mensch, weder von sich selbst noch vom anderen, wann er stirbt. Und genauso dachte ich, wenn bei einem Mann die geschorenen Haare ein vollgestopfter Sack sind und der Sack so schwer ist wie der Mann, dann stirbt der Mann. Es ging immer um die Frage, wie lange jemand lebt. Ich wollte der Zeit ein Maß anhängen, damit sie ein Gegenstand wird, den man sieht, mit dem man hantieren kann. Aber das richtige Maß kannte ich nie, so schob ich die gelangweilte oder gehetzte Zeit nicht nur als Rätsel herum – diese ganzen unsinnigen, ergebnislosen Rechnungen machten auch noch mehr Angst.
Und weil ich den Pflanzen ähneln wollte, habe ich selbstverständlich laut mit ihnen gesprochen. Und ich habe stundenlang verschiedene Blüten nebeneinandergelegt, ihre Gesichter miteinander verglichen und gepaart und sie miteinander verheiratet.
Ihre Aufgabe im Tal war es, die Kühe zu hüten. Als Tiere nehmen sie eine Zwischenstellung ein: Sie gehören nicht so eng zur Landschaft wie die Pflanzen, sie sind nicht verwurzelt, ihr aber doch näher als der Mensch.
Ich war mir sicher, dass die Pflanzen nur am Tag bewegungslos sind, dass sie nachts, wenn alle schlafen, wie die Tiere hin und her laufen und einander besuchen oder sich nur eine andere Gegend anschauen. Dass ihre Wurzeln in der Erde bleiben und auf sie warten, dass sie gegen Morgen, wenn es hell wird, wieder zurückkehren und darum auch jeden Tag an derselben Stelle wachsen.
Natürlich habe ich auch jeden Tag gedankenlos oder interessiert diese Kühe beobachtet, die mit sich selbst genug hatten. Kaum angekommen im Gras, bückten sie sich und fraßen, bis man sie abends nach Hause trieb. Die brauchten sonst nichts, schauten keinen Himmel an. Auch mich schauten sie kaum an, Gott sei Dank. Sie schlenkerten die Köpfe, weil ihnen die Fliegen zudringlich in die Augen krochen. Das einzig Schöne an ihnen waren die großen Augen. Manchmal tat es mir um ihre Augen leid, die glänzten wie das Wasser im tiefen Brunnen und mich spiegelten, als würde ich schief aus der Erde wachsen. Und dann wusste ich gar nicht, ob es mir um die traurigen Augen leid tat oder um mich selbst. Doch es gab auch Tage, an denen die Kühe statt zu fressen auf der Weide herumrannten. Und ich hinter ihnen her, denn da musste ich aufpassen, dass sie nicht auf die Staatsfelder rennen, dass sie dort keinen Schaden anrichten und man keine Strafe zahlen muss. Das war nicht auszuhalten, ich wurde todmüde und hasste die Kühe.
Wie viele Kühe hatten Sie denn zu hüten?
Die meiste Zeit hatten wir drei Kühe und ein paar Monate kamen dann noch zwei, drei Kälber dazu. Und wenn die Kälber das nötige Gewicht hatten, mussten wir sie dem Staat abliefern. Drei Kühe, aber jede Kuh ist ein Riesending und nicht so gutmütig, wie sie aussieht, sondern wild und kräftig wie ein Traktor, sehr stur und jähzornig. An diesen wilden Tagen war ich verzweifelt, ich lernte im Laufen weinen und im Weinen laufen.
Gegliedert wurden die Tage nur durch die Züge, die vorbeifuhren. Darin saßen Städter mit schönen Sommerkleidern, das Kind geht so nah wie möglich an die Schienen heran, sieht Schmuck glitzern, ein anderes Leben aufblitzen und winkt.
Ja, das Tal war still, man hörte die Züge von weitem, ich konnte rechtzeitig bis nah an die Schienen gehen. Der Zug war wie ein Besuch. Als wären Gäste ins Tal gekommen, Menschen und sogar solche, die nie ins Dorf kamen. Ich zog schon, wenn der Zug von weitem rauschte, meine Schürze aus, um mit ihr zu winken. Ich überlegte schon morgens beim Anziehen, heute die glatte blaue Schürze zu tragen, falls ich am Vortag die geblümte oder getupfte angehabt hatte. Ich wollte mit einer anderen Schürze winken, falls im Zug dieselben Leute von gestern waren. Der Zug war leider sehr kurz, drei, vier Wagen, mehr nicht. Wenn die vorbei waren, war ich verlassen, als hätte die Luft mir vor der Nase ihre schrecklich große, weiße Tür zugeschlagen. Ich ging langsam von den Schienen weg und zog im Gehen die Schürze wieder an. Im Zug saßen Städter oder schön gekleidete Dörfler, die aus der Stadt wiederkamen. Wenn Dörfler in die Stadt fuhren, zogen sie die Sonntagskleider an, um nicht hässlich aufzufallen. Ich war ein paar Mal in der Stadt mit meiner Mutter, beim Arzt oder Schuhe kaufen. Die Leute in der Stadt wurden nicht so dreckig, die waren nicht den ganzen Tag in der Sonne, nicht im Staub der Maisfelder, sondern im Schatten großer Häuser, auf den Gehsteigen. Die Männer trugen schon in aller Frühe kurzärmlige Hemden, die Frauen Stöckelschuhe und Lacktaschen. Auch im fahrenden Zug sah ich sie, sie standen auf dem Gang am offenen Fenster, waren geschminkt, hatten Broschen, Halsketten, rote Nägel. Und ich winkte mit meiner alten roten oder blauen Schürze, ich in meiner Misere, in meinem dreckigen Alleinsein. Wenn ich woanders geboren wäre oder andere Eltern hätte, das habe ich hin und her gewälzt im Kopf, wär ich dann ein anderes Kind? Oder wär ich dasselbe Kind, egal, wer meine Eltern sind und wo ich geboren bin? Oder bin ich und bleibe an meine Haut angewachsen immer dasselbe Kind, egal, was ich sein will und wie viele Pflanzen ich esse? Bleiben alle immer an sich selber angewachsen? Und parallel dazu spürte ich immer, was ich denke, das ist nicht erlaubt. Niemand darf wissen, dass ich mich mit so was herumschlage. Es darf mir auch niemand ansehen, dass ich Blumen esse und verheirate. Es wär das Schlimmste gewesen, wenn man mich erwischt hätte, denn man hätte geglaubt, ich sei nicht normal.
Aber man hat Sie nicht erwischt. War es die Wortkargheit Ihrer Familie, das stumme Arbeiten oder Sitzen neben-einander, was Sie geschützt hat?
Nein, man hat mich nicht erwischt. Man sah mir überhaupt nichts an. Niemandem sah man etwas an. Wenn es draußen Nacht wurde, kamen alle zum Nachtessen an den Esstisch. Wir aßen und niemand fragte den anderen, wie der Tag für ihn war. An jedem hingen die Geheimnisse. Ich war mir sicher, jeder ist von der Stirn bis zu den Zehen traurig, jeder hat Krallen im Herzen und wehrt sich, aber nur von innen, damit man es nicht sieht. Ich glaubte, diese Dorftrauer hat jeden im Griff, sie ist gleichmäßig über alles verteilt. Man kann ihr nicht entkommen.
Gerade weil man ihr nicht entkommen kann, schreiben Sie, muss man »Trauer ertragen und einordnen lernen«. Und gleich darauf: »Kindheit ist wahrscheinlich der verworrenste Teil des Lebens. Es wird … so viel gleichzeitig aufgebaut und abgerissen wie später nie wieder.«
Ich war sehr oft traurig als Kind, weil ich zu viel allein war, weil ich auch im Haus viel arbeiten musste, Fenster putzen zum Beispiel. Es waren vielleicht hundert Fensterscheiben, dreiflügelige Doppelfenster, bis die fertig waren, war der ganze Tag vorbei. Okay, ein bisschen kannst du schlampen oder dich beeilen. Aber das fraß die ganze Zeit. So war diese Erziehung, ich sollte das Putzen von Fensterscheiben fürs ganze Leben lernen. Seither habe ich nie wieder Scheiben geputzt. Ich kenne das Gehorchen im Überdruss, du sollst präpariert werden für etwas, du sollst es im Leben für unbedingt notwendig halten. Aber im Kopf entsteht genau das Gegenteil, du sagst dir, nie wieder Fenster putzen. Du machst dich frei, mindestens diese umgekehrte Freiheit geht einfach.
Das Leben der Mutter geht ganz und gar in diesen Arbeiten auf, sie putzt und kehrt und hat eine Menge Besen: einen Küchenbesen, einen Kuhstallbesen, einen Schweine- und einen Hühnerstallbesen, einen Holzkammerbesen, einen Selchkammerbesen und zwei Gassenbesen, einen für das Pflaster und einen für das Gras.
Das ist natürlich übertrieben, aber als literarisches Mittel hab ich die Wiederholung des Wortes »Besen« gebraucht, um den Putzwahn darzustellen. Wahrscheinlich war die Putzsucht nicht in allen Häusern gleich stark ausgeprägt, aber für meine Mutter war das der eigentliche Lebensinhalt. Wenn sie nicht auf dem Feld war, hat sie im Haus geputzt. Sie gehört zu den Leuten, die den Kopf nicht allein arbeiten lassen können, es wird immer der Körper gebraucht. Saubermachen war die pure Gewohnheit, das hatte nichts mehr mit Schmutz zu tun. Und so wie ich mich hüte, körperlich zu arbeiten, haben diese Leute die innere Notwendigkeit gehabt, den Körper anzustrengen. Sie waren versessen auf Arbeit, der Körper musste sich total verausgaben. Bei meiner Mutter hat das vielleicht auch mit ihren fünf Jahren Arbeitslager zu tun, dieses Schuften, um einen Halt zu haben, um sich selber nicht zu spüren. Und wir müssen, um uns nicht zu spüren, mit dem Kopf irgendwas machen. Wir sind ja nicht anders, aber wir tun halt was anderes dagegen. Das Arbeiten war bei meiner Mutter mechanisch, es war ihr Naturell. Sie wurde nicht müde, sie war beim Arbeiten sowohl völlig abwesend als auch ganz dabei. Weil sie abwesend war von sich selbst, wurde sie zu dem, was sie mit den Händen tat. Sie verschwand als Person und wurde motorisch, ein Vorgang mit Kleid und Schürze. So erkläre ich mir heute, dass die Müdigkeit sie nie bremste, dass ihr Fleiß keine Grenzen hatte. Ihre Hände arbeiteten immer, außer im Schlaf. Woran sie bei der Arbeit dachte, keine Ahnung. Ob sie vielleicht im Arbeitslager gelernt hatte, an nichts zu denken? Ob es ein Glück ist, den Kopf zu vergessen und sich der schwersten Arbeit selbstlos zur Verfügung zu stellen, wer weiß.
Das Schweigen am Esstisch, das Aufgehen in der Arbeit, bis man zum reinen Vorgang wird – so entsteht eine Atmosphäre, in der sich Zusammengehörigkeit primär über gemeinsame Töpfe und Gewohnheiten herstellt.
Das ist der Blick einer Erwachsenen. Als Kind war es für mich ein Stück Normalität, ob ich mich gut gefühlt habe dabei, ist etwas anderes. Die Leute, bei denen der Körper den ganzen Tag funktioniert, reden ja nicht über sich. Geredet wird nur über die Handgriffe der Arbeit. Wenn aber jemand kein Wort über sich sagt, wodurch existiert dann das Zusammengehören? Vielleicht ist es nur eine Tatsache, die so stark ist, dass man gar kein Gefühl braucht. Oder das Gefühl ist da, aber von der Tatsache nicht getrennt. Vielleicht war die Tatsache des Zusammengehörens so stark, dass man das Gefühl nicht spürte. Es war für alle normal, dass wir zusammengehören, das wurde nicht mit Worten oder Gesten ausgedrückt. Es hat doch etwas Klares und Gültiges, wenn man zusammen am Tisch sitzt, wenn man die gleiche Tür benutzt, das gleiche Besteck und den gleichen Kochtopf, wenn die Kleider nebeneinander auf der Wäscheleine hängen, dann gehört man zusammen, das haben die äußeren Dinge garantiert. Ich weiß nicht, ob die anderen sich einsam fühlten, ob sie sich jemals gewünscht haben, dass man mehr aufeinander eingeht. Ich glaube es gar nicht, an meiner Dorftrauer sollte damals niemand herumbohren. Dass man über sich selber spricht, bei mir kam das auch erst im Nachhinein in der Stadt.
Wenn man Kindheit aufschreibt, wird sie schlimmer, als sie war. In der Kinderperspektive der Literatur steckt ein literarischer Trick. Es ist schon viel Reales drin, aber alles Wörter voreinander, hintereinander, nacheinander gesetzt – aber im Erlebten war es durcheinander, übereinander, gleichzeitig und gestapelt.
Als Kind habe ich mir gewünscht, dass ich nicht so viel arbeiten müsste, nicht immer ins Tal gehen müsste, dass ich mehr spielen könnte, dass ich vielleicht mehr mit anderen Kindern zusammen wäre, aber das waren keine großmaschigen Wünsche, keine ausholenden. Das war unterschwellig. Dieses Schwarz-auf-weiß der Sätze, das die Wörter so mit sich bringen, ist eine andere Art Phantasie als die Gedanken der Kindheit. Es ist eine künstlich nachgebaute Wortwelt, und zwar dreißig Jahre später.
Gilt das auch dafür, dass das Kind in »Niederungen« keinen Verbündeten hat, keinen Freund, keine Freundin in der Schule, keinen Menschen, dem es vertraut? In allen anderen Büchern gibt es ja jemandem, mit dem die Ich-Erzählerin, egal ob im Glück oder Unglück, ihre Erfahrungen teilt.
Vielleicht habe ich die Verbündeten verhindert, weil ich wusste, dass das, was ich im Kopf hatte, verboten ist, weil ich mich für nicht imstande gehalten habe, normal zu sein. Ich wusste nämlich, es ist nicht normal, wenn ich denke, dass die Pflanzen nachts herumlaufen, dass das Leben unsere Atemzüge auf eine Kette fädelt und abmisst, dass uns die Erde frisst. Das war surreal. Aber genauso surreal ist doch auch die Religion, die kam noch dazu: Gott ist überall, er sieht alles. Die Toten kommen in den Himmel. Ich suchte sie in der Form der Wolken und fand sie dort auch, die toten Nachbarn und die toten Tiere. Ich wusste, dass ich mit Gott Probleme kriegen werde. Wenn er alles sieht, weiß er auch, was ich im Kopf denke. Okay, er macht im Moment noch nichts, aber irgendwann einmal wird er mich bestrafen.
Das Grundproblem war doch, dass alles, was ich getan und gedacht habe, nicht im Rahmen des Erlaubten war, wie sollte ich das jemandem erzählen? Ich ging davon aus, dass es allen so geht wie mir und alle vollgestopft sind mit Geheimnissen, mit der Dorftrauer, für die sie nichts können, die das Dorf mit allen seinen Dingen im Kopf der Leute produziert. Alle haben ihre Krallen im Herzen, behalten aber alles für sich. So musste es sein, jeder musste alles für sich behalten.
Ganz selten hat es Ausrutscher gegeben. Als ich nach der Messe auf dem Heimweg zu meiner Großmutter gesagt habe, das Herz der heiligen Maria ist eine durchgeschnittene Wassermelone, hat sie geantwortet: »Das kann sein, aber das darfst du nie jemandem sagen.« Damit war das Thema abgehakt. Auf solche Ausrutscher hat meine Großmutter manchmal auch gesagt: »Denk nicht dorthin, wo du nicht sollst.« DORTHIN hat sie gesagt, als gehe man mit dem Denken an einen ganz konkreten Ort, in eine zu lange Straße oder in einen fremden Saal.
Sie hat vom Denken so gesprochen, als hätte es Füße. Sie war schüchtern, sehr einsilbig, sprach noch weniger als alle anderen, nicht nur mit mir. Und wenn sie dann doch was sagte, war es kurz und flach, der Ton ganz trocken. Aber das Gesagte flatterte in mir. Es hat mich aufgewühlt und ist mir lange nachgegangen. Und es fiel mir immer wieder ein. Heute weiß ich, solche Sätze waren mit dem Schweigen mehr verwandt als mit dem Reden, waren vielleicht gar nicht gesprochen, nur laut gedacht. Die Satzlänge hat sich beim Reden ständig selbst gekürzt. Dieses Reden ohne zu wollen prägt sich einem so kryptisch, wie es ist, ohne zu wollen wortwörtlich ein. Ich glaube, es sind unschuldige Aphorismen, die brauchen nichts Gesuchtes, nicht einmal sich selbst.
Gott erscheint dem Mädchen als richtende, strafende Instanz, Maria hingegen als strahlende Himmelskönigin; es besucht sie immer wieder, bringt ihr kleine Geschenke wie Bonbons, ein Streichholz, eine Drahtspange fürs Haar.
Sie war so schön, eine riesige Gipspuppe mit einem hellblauen Kleid und das Herz war außen draufgemalt. Sie war für mich keine Skulptur, es war die eigentliche Maria, die aus dem Himmel. Ich habe mich nie gefragt, wieso sie hier in der Kirche steht und nicht im Himmel oben. Es war normal, dass sie sich zeigt, sie stand da und ich war bei ihr. Ihr langes himmelblaues Kleid, wer hatte denn schon so was im Dorf? Und dass ich ihr verschiedene Sachen schenkte, war ja auch nicht erlaubt, das durfte auch niemand wissen. Ja, kompliziert, komplizierte Welt. Ich hatte schon ziemliche Probleme, das alles hin und her zu schieben und damit klarzukommen. Kann sein, dass ich mich bei ihr einschmeicheln wollte, damit sie dem Herrgott sagt, er soll mich nicht so hart bestrafen. Wenn man gebeichtet hatte, musste man den Satz sagen: »Ich werd mich ernstlich bessern und die Gelegenheit zur Sünde meiden.« Als hätte ich die Sünde gesucht und nicht sie mich. Ich wusste nach jeder Beichte, dass ich dieses Versprechen nie halten kann, dass es gelogen war. So endete jede Beichte mit einer ganz großen neuen Lüge. Und das blieb dem Herrgott doch nicht verborgen.
In der Religion setzen sich einerseits Angst, Überwachung und Kontrolle fort – im Haus hing der Himmelschlüssel, der sah auch alles –, andererseits liefert sie Stoff für Bilder. Gott, der mit dem langen, weißen Bart, hockt oben in den Bäumen, und die Toten werden als Wolken über den Himmel getrieben wie Rekruten beim Militär.
Die Religion war nie ein Trost, sie hat immer nur gedroht und Schuld verteilt.
Kinder denken erstens surreal und zweitens sehr konkret, aber Surreales ist ja konkret. Ich hab nur angewendet, was mir die Erwachsenen gesagt haben: Gott ist überall. Und: Alle Toten sind im Himmel. Also habe ich sie gesucht und in den Wolken Gesichter gesehen, die dann auch jemandem ähnelten, den ich kannte. Wenn die Wolken so im Wind getrieben sind, war mir klar, Gott treibt die Toten herum wie beim Militär, er weiß, was sie angestellt haben, und wer weiß, wie er mich mal rumtreiben wird. Vorläufig schaut er mir noch zu, aber da sammelt sich was an.
Angst, besonders ungreifbare, ist auch stark mit der Nacht verbunden, sie rückt ganz nah an die Häuser, lehnt ihren Rücken an die Zäune, und es wird sackdunkel und totenstill.
Die Dunkelheit ist unheimlich, weil sie einen einschließt und man ertrinkt, die Umgebung verschwindet, man sieht sich selber nicht. Die Nacht ist eine ungewisse Zeit. Im Schlaf ist man sich selber weggenommen. Aber man hat Glück, dass man im Schlaf die Ungewissheit der Nacht nicht spürt. Wenn man aufwacht, ist sie vorbei, und man hat sich wieder, man ist wie neu, wenn man geschlafen hat. Und wenn man nicht mehr aufwacht, ist man tot. Ich habe mich immer im Dunkeln gefürchtet, die Luft war schwarze Tinte oder schwarze Wolle, dicker Schlamm oder ein riesiges Tierfell. Dunkelheit zeigte einem, wie der Tod später aussehen wird. Der Tod war immer im Dorf, er war ja der andere, spätere Teil des Lebens. Und er hatte wie das Leben seine Wege, seine Pläne und Ziele. Er kannte uns alle und nahm sich mit jeder Person im Dorf etwas anderes vor. Die Nachtangst hatte auch viel mit Glas zu tun. Aus schwarzem Glas wurde alles zerbrechlich. Die Nachtbäume, der Wind in den Dachrinnen, der Regen, die kalten geschliffenen Sterne und der Mond aus Milchglas. Und ich habe im Dunkeln so lang mit den Augen gezuckt, bis die Sterne wackelten und die Umrisse der Gebäude und Zäune. Ich war überzeugt, dass die Gegenstände, genauso wie die Pflanzen, in der Nacht hin und her gehen und erst wenn es hell wird, immer im letzten Moment, kurz bevor man sie erwischt, an ihre Plätze zurückkehren. Ich knipste in der Veranda schnell das Licht an, um den Tisch und die Stühle in ihrer letzten Bewegung noch zu erwischen. Doch es gelang mir nie, immer war ich um einen Hauch zu spät dran. Die Möbel waren schlau und besonders die Spiegel, die kannten das Innere der Leute. Sie sahen in einen hinein. Man sagte, im Spiegel sitzt der Teufel. Wenn jemand gestorben war, musste man im Haus alle Spiegel zuhängen, damit sie dem Toten nicht die Seele nehmen. Ich fürchtete mich nachts auch vor dem sehr großen Mann, der am Dorfende wohnte. Es hieß, er muss nichts arbeiten, er bekommt monatlich Geld aus der Stadt, denn er hat sein Skelett dem Museum verkauft. Das Wort »Skelett« war gruselig, ich hatte es außer im Zusammenhang mit diesem Mann noch nie gehört. Durch dieses Wort »Skelett« ähnelte der große Mann mehr dem Holzgestell der Bäume und den hohen Leitern. Er war mit dem Holz mehr verwandt als mit uns Menschen, und Holz musste nicht schlafen, also lief er wie das Holz nachts herum.
Dass man die Spiegel zuhängen muss, damit der Teufel dem Toten nicht die Seele raubt, gehört zu der Art Aberglauben, die Sie poetisch nennen.
Es gab auch noch den Aberglauben mit den Eulen, dass sie sich ein bestimmtes Dach aussuchen und dort schreien, dass dann im Haus jemand stirbt. Es gab viele Dächer und viele Eulen. Man horchte, ob das Schreien weit weg oder schon sehr nah ist.
Der Aberglaube mit dem Teufel im Spiegel, mit den Eulen auf dem Dach ist ergreifend. Er hat was Magisches, im Grunde ist er Poesie, die Poesie der Nichtschreibenden. Es sind Verbindungen, die über sich hinausgehen und beängstigend schön sind – sprachlich und bildlich von heute aus gesehen. Aber wenn man den Aberglauben praktiziert, hat er nichts Poetisches mehr, dann ist er eine Realität wie alle anderen auch. Wenn die Tür quietscht, muss ich das Gewinde ölen, und wenn jemand gestorben ist, muss ich den Spiegel zuhängen, dann geht die Seele nicht mehr mit dem Teufel davon, sondern gelangt in den Himmel. Für beides gibt es Abhilfe durch praktisches Handeln. Doch es bleibt zwischen beidem ein großer Unterschied: Die Tür quietscht nicht mehr, wenn sie geölt ist, doch wenn der Spiegel zugehängt ist, ist die Angst vor dem Teufel nicht weg. Man tut, was der Aberglaube befiehlt, weiß aber nicht, ob es rechtzeitig war oder lang genug – man kann den Aberglauben nicht wie ein Gewinde bedienen. Man tut, was er sagt, doch die Ungewissheit bleibt, weil sie aus seiner poetischen Dimension kommt, die sich nicht kontrollieren lässt.
Angst, dunkler Aberglaube, Einsamkeit, all das prägt die Dorfwelt. Direkte Zuneigung hingegen oder Zärtlichkeit kommen – wenn überhaupt – nur verdeckt vor, man muss sie aufspüren, zum Beispiel in der Frage: »Hast du ein Taschentuch?«
Die Frage nach dem Taschentuch zeigte mir, dass sich meine Mutter ein bisschen Sorgen um mich macht, wenigstens um mein äußeres Erscheinungsbild. Als Kind aus einem ordentlichen Haus musste man für alle Fälle ein sauberes, glatt gebügeltes Taschentuch haben, zum Naseputzen, Weinen, Hände-Abwischen, Wunde-Verbinden, Sich-zum-Tragen-einen-Griff-Machen oder einen Geldbeutel, eine Kopfbedeckung gegen Sonne und Regen. Ich habe auch immer wieder verlorene Taschentücher gefunden und selbst welche verloren. Die wertvollsten Taschentücher waren Unikate mit selbstgemachten Stickereien, Monogrammen oder gehäkelten Rändern. Taschentücher gehören zu den wandelbarsten Dingen. Als einmal jemand auf der Straße in der Stadt tot umfiel, deckte ein Passant dem Toten das Gesicht mit seiner Zeitung zu. Und ein anderer Passant nahm die Zeitung vom Gesicht des Toten, zerknüllte sie, stopfte sie wortlos in seine Aktentasche und bedeckte das Gesicht mit seinem Taschentuch. Der Mann mit der Zeitung sagte: »Na, ich hab grad kein Taschentuch.« Die halbe Zeitungsseite war wie jeden Tag das Bild Ceauşescus. Aber das war, glaube ich, nicht der Grund, die Zeitung durchs Taschentuch zu ersetzen, mindestens nicht der einzige. Auf dem Totengesicht hätte die Zeitung auch ohne das Bild des Diktators nicht als erstes ambulantes Totentuch getaugt. Sie machte diesen plötzlichen Tod auf einem asphaltierten Parkweg noch elendiger, als er ohnehin schon war. Das Taschentuch veränderte jedoch das Bild, es schmiegte sich an und behütete, es war nicht nur eine praktische Geste, sondern eine praktische Zärtlichkeit, eine wortlose Anteilnahme. Ich vergaß weiterzugehen, innen aufgewühlt und außen gelähmt, wie das so ist. Neugierde und Ekel, man bleibt wie angeklebt stehen, viel länger, als man will. Die beiden Männer waren längst weg. Ich wurde sentimental in der Vorstellung, dass die Anteilnahme trotz aller Roheit dieses kaputten Sozialismus vielleicht doch immer in den Leuten nachwächst, dass Mitgefühl vielleicht doch so plötzlich erscheinen kann wie Falschheit und Denunziation. Ich weinte, aber der Tote war nicht der Grund, nur der Anlass. Vor diesem öffentlichen Tod auf dem Asphalt heulte ich um das große Ganze, das mir diffus einfiel, das ekelhafte Heucheln, das ständige Drohen und die wilde Angst in diesem Staat – und vor allem um mich selbst.
Wenn ich zurück in meine Kindheit schaue, war es mit allen Gefühlen so wie mit dem Zusammengehörigkeitsgefühl, Gefühle waren nur unsichtbar vorhanden. Wo über sich selbst kein Wort gesprochen wird, kann man auch keine Gefühle zeigen. Ich glaube, ich wäre erschrocken, wenn meine Mutter mich plötzlich gestreichelt hätte. Das wäre von mir gar nicht als Streicheln empfunden worden, ich hätte mich wahrscheinlich gar nicht drauf einstellen, es gar nicht als Zärtlichkeit deuten können, ich hätte es in dem unerwarteten Moment gar nicht ertragen. Ich glaube, dass man vor unerwarteter Zärtlichkeit genauso, wenn nicht sogar mehr, erschrecken kann als vor erwarteter Gewalt. Wenn man als Kind regelmäßig geschlagen wird, verliert man jeden Schrecken vor der Prügel. Man spürt den Schmerz, das ändert sich nicht. Aber der Schrecken verliert sich. Es passiert etwas Seltsames, und das ist das Schlimmste daran, das Gefühl der Würde dreht sich um. Wie soll ich das sagen, man wird durch regelmäßige Prügel zwar körperlich nicht unempfindlich, aber man bekommt gegen den eigenen Verstand eine Art Wunsch, sich im Schmerz zu spüren – weil man sich ganz anders spürt als ohne Schmerz. Es entsteht eine Süße, die nach eigenen Moralkriterien verwerflich ist. Und man muss diese Süße sogar vor sich selbst leugnen, um sie jedesmal zu wünschen. Und es ist noch komplizierter, in dieser verleugneten, weil inakzeptablen Süße spürt man eine Würde. Vielleicht eine Würde des Körpers, vor welcher der Verstand sich schämt. Wenn die Würde entsteht, WÄHREND und WEIL man erniedrigt wird, dann ist man doch schon ernsthaft beschädigt. Ich bekam jeden Tag Prügel, wie sagt man, für alles und nichts. Für einen Fleck auf dem Sonntagskleid, eine schlechte Note in der Schule, eine schlecht geputzte Fensterscheibe, zu frühes oder zu spätes Heimkommen mit den Kühen. Mal gab es Prügel mit der Hand, mal mit dem Geschirrtuch, Kochlöffel oder Besen. Das war nicht bei allen, aber bei vielen Kindern so. Ohrfeigen und leichte Prügel waren nicht der Rede wert, sie gehörten zum Alltag. Meine Mutter schrie in ihrer Wut, bei mir sei es schade um jeden Hieb, der danebengehe. Es ging ihr ums Treffen, Gründe gab es immer. Und ich war so abgestumpft, ich gab mir gar keine Mühe, mich so zu benehmen, dass ich nicht bestraft werde. Ich wusste, dass ich sowieso Prügel kriege, das Prügeln hatte sowieso mehr mit ihr zu tun als mit mir. Heute weiß ich, sie war verhärtet und kaputt, sie hatte die fünf Jahre russisches Arbeitslager knapp überlebt, es war noch nicht lange her, als ich geboren wurde. Es waren so viele dort um sie herum verhungert und erfroren, sie hatte mehr Glück als diese Toten, kam verelendet zurück, heiratete schnell, bekam ein Kind, das nach der Geburt blau anlief und starb, und gleich danach das zweite – das war ich. Sie sprach nicht übers Lager, und wenn, dann die immer gleichen, kryptischen Sätze, in denen sie selber nicht vorkam. Sie sagte: »Wind ist kälter als Schnee, Durst quält stärker als Hunger.« Sie zwang ihr Leben in eine gnadenlose Normalität und zu dieser gehörte ihrerseits das Prügeln und meinerseits das Abstumpfen und Vertauschen von Würde und Erniedrigung.
Dieser Verschränkung sind Sie in gesteigerter Form später in einem Kindergarten wieder begegnet.
Über zwanzig Jahre später war ich für ein paar Wochen Kindergärtnerin und die Direktorin hat mich am ersten Tag instruiert: Jeden Morgen zuallererst die Hymne singen. Dann hat sie mir in einem Regal die langen und kürzeren, dünnen und dickeren Stöcke gezeigt. Die Kinder waren auf Prügel getrimmt. Wenn ich mich einem Kind näherte, drückte es die Augen zu, drehte das Gesicht von mir weg und sagte: »Nicht schlagen.« Aber die anderen Kinder schrien im Chor: »Nur drauf, gib ihm, gib ihm.« Ich gruselte mich vor mir selber von früher, wusste, was in diesen auf Prügel dressierten Kindern vor sich ging. Ich rührte diese Stöcke nie an, aber diese Kinder waren verroht und hysterisch. Sie verachteten mich, weil ich sie nicht prügelte, sie forderten mich auf, sie zu prügeln, als wäre es ein Geschenk, eine Gnade. Sie reagierten nicht auf Worte, nicht mal, wenn ich schrie. Mein Versuch, mich durchzusetzen, wurde ein einziges Fiasko. In diesem Kindergarten durchschaute ich mich von damals. Ich wusste, was es heißt, die Prügel zu verlangen, die Erniedrigung störrisch mit einem frechen inneren Stolz zu übertrumpfen – all das kannte ich von meiner Mutter. Dass aber der Kindergarten, also der Staat, unter Erziehung Prügel verstand, war noch ungeheuerlicher, als jeden Morgen die Hymne zu brüllen. Aber ich glaube, das gehörte zusammen, ohne dieses Menschenbild aus Beton und diese alles erdrückende Ideologie wären auch die Stöcke nicht im Kindergarten gewesen.