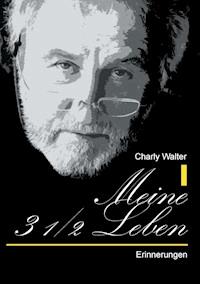
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch wird von Erinnerungen und Erfahrungen erzählt, die der Autor seinem Enkel Julius in geschriebener Form weitergeben möchte. In jungen Jahren schon Vollwaise, meistert der Autor sein Dasein mit den unterschiedlichsten Tätigkeiten, als Musiker, als Experte für Unternehmenskommunikation in einem Weltkonzern, als Künstler, Maler und Dozent. Er liebt die Herausforderung und wertet Misserfolge bei der Erreichung seiner Ziele lediglich als Zwischenergebnisse. Er möchte alles, was sich ihm bietet, wenigstens einmal gemacht haben, wenn möglich gleich. In glücklicher Ehe seit fast 50 Jahren genießt er seine Familie. Seit Ende seines Berufslebens zwingen ihn nun außergewöhnliche Krankheiten in die Knie. Allein die in diesem Teil beschriebenen Erfahrungen sind es wert, dieses Buch zu lesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kindheit und mehr
Studentenzeit und sonst was
Beruf und anderes
USA, Russland und sonstwo
17 Tage, 16 Städte
Events und was dazu gehört
Musik ohne Tabus
Hobbies und was Spaß macht
Kochen und Gaumengenuss
Ein Haus und ein Zuhause
Malen und die Kunst
Krankheit, eine Welt der Eindrücke
Vorwort
Warum schreibe ich dieses Buch überhaupt?
Eigentlich sollte ich mich in meinem Alter und bei meiner Krankengeschichte der letzten Jahre auf Entspannendes, auf Erholung beschränken.
Aber es drängt mich, für meine Freunde, die Familie und meinen nun 1 Jahr alten Enkel Julius ein paar Erinnerungen an gewisse Meilensteine und Erlebnisse meines mehr als turbulenten und facettenreichen Lebens festzuhalten.
Nein, nicht nur 1 Leben, sondern 3 ½ oder eigentlich noch mehr Leben waren es. Doch, bescheiden wir uns auf eben mal 3 ½ :
Kindheits- und Berufsjahre
die Jahre als Musiker in Studios und auf Bühnen
die Zeit als Künstler, Maler und Dozent und
schließlich die Zeit ab dem Tag, als ich in den sogenannten Vorruhestand ging, und als dann meine verdammte Krankengeschichte begann. Wie verwünsche ich diesen Tag oder sollte ich ihn lieben?
Die wunderschönen Jahre in und mit meiner Familie hier in diesem Buch zu erzählen, habe ich auf Grund der Fülle des Erzählenswerten entfallen lassen.
Kindheit und mehr
Auf Pritsche 12 des Flüchtlingslagers, nähe Bahnhof Nord, einem der beiden Eisenbahnhaltestellen in Peiting, lag ich nun mit meinen 3 Jahren im Sommer des Jahres 1946. Was war geschehen? Meine Familie war, wie tausend andere, aus ihrer Heimat, dem Sudetenland, vertrieben worden.
Sudetenland? Was ist das? Was war das?
Ein kleiner geschichtlicher, unvollständiger Exkurs sei mir hier an dieser Stelle erlaubt.
Die Sudetendeutschen besiedelten bis 1946 mehr als ein Drittel der böhmischen Länder. Die Geschichte der deutschen in Böhmen, Mähren und Sudeten-Schlesien begann aber sehr viel früher. Schon um das Jahr 1000 gehörte das Bistum Prag zur Diozöse Regensburg. Später dann, unter Kaiser Karl IV. im 14. Jahrhundert, erreichten die böhmischen Länder eine bis dahin unerreichte Blüte. Als bedeutendster europäischer Regent seiner Zeit baute Karl IV. Prag faktisch zur Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches aus. Husittenkriege, der 30-jährige Krieg und der 1. Weltkrieg beutelten das Sudetenland hin und her.
1939 marschierten Deutsche Truppen ein, und Hitler erklärte das tschechische Gebiet zum Reichsprotektorat. Der von Hitler eingesetzte Reichsprotektor stand hierarchisch sogar über dem tschechischen Staatspräsidenten. Es folgten die furchtbaren Auswüchse des Zweiten Weltkrieges. 1945 dann, nach dem Tod Hitlers, wurde der größte Teil Deutschlands von den Alliierten besetzt. In Tschechien zog im Mai, nach kurzen Straßenkämpfen mit den dort verbliebenen deutschen Einheiten, die Rote Armee ein. Im tschechischen Rundfunk war zu hören: „Wehe den Deutschen! Wir werden sie liquidieren!“ In Prag beschloss die Regierung die Vertreibung der Deutschen. Sie wollten die Grenzgebiete, wie sie es nannten, von den Deutschen säubern. Die drei Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, die USA, Großbritannien und die UdSSR, berieten sich in Potsdam über den Umgang mit den Deutschen. Man erzielte folgendes Abkommen: die Deutschen werden aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn ausgewiesen.
In den eineinhalb Jahren von Mai 1945 bis Dezember 46 wurden etwa 2,8 Millionen der dort 3,2 Millionen Sudetendeutschen vertrieben. Entgegen aller Versprechen wurden auch die Nazigegner enteignet und vertrieben. Wenigen wurde angeboten, in der Tschechei zu bleiben; doch kaum einer nahm dieses Angebot an. Mein Vater arbeitete damals als Baureferent in der Stadtverwaltung von Tepltz-Schönau an der Nordwest-Grenze Sudetenlands.
Wie alle in der Verwaltung, musste er die tschechische Sprache beherrschen. Das half ihm sehr bei der Vertreibung. Ein tschechischer Kollege und Freund war ihm bei der Flucht behilflich. Er besorgte einen Lkw. Gemeinsam wurden all unsere Möbel verstaut und mitgenommen, wie es im Glücksfall den Antifaschisten erlaubt war. Zusammen mit Mutti, meiner älteren Schwester Gerlind und mir gings dann Richtung Grenze. Das Angebot, hier zu bleiben, war für Papa Nonsens. So kamen wir schließlich gemeinsam nach dem Passieren zweier Zwischenlager endlich im Flüchtlingslager in Peiting im schönen Oberbayern an.
Und nun endet auch mein kleiner Exkurs in „die Zeit davor“.
Jetzt hieß es, auf die Beine kommen, das Beste draus machen und hier im Alpenvorland Fuß fassen. Meine Schwester und meine Mutter versuchten, sich im Lager nützlich zu machen.
Mein Vater weißelte in Kreut bei einem Bauern ab und zu einen Hühnerstall. Dafür bekam er dann ein paar Eier. Welch Abwechslung auf unserem kargen Speiseplan!
Seine Papiere und Zeugnisse als Baureferent ließen lange auf sich warten. Endlich, nach vielen Wochen, waren sie da. Nun konnte er sich im Bauamt der Gemeindeverwaltung Peiting bewerben und vielleicht auf eine Wohnung hoffen. Als wir endlich eine kleine Bleibe bekamen, waren wir überglücklich. Im Gehöft der Familie Schmid, einem Bauernhof mit Sägewerk und Mühle, wies man uns ein paar Zimmer der Knechte und Müller zu. Die neue Wohnung war feucht und hatte ihre Macken, aber wir waren endlich unter uns.
Wenn ich in der Nacht aufs Klo musste, wandelte ich schlaftrunken die Außentreppe hinunter, über einen kalten Hof hinein in den rutschigen Kuhstall des Gehöfts, vorbei an stinkenden Kühen und einem schnaubenden, Angst erregenden, pechschwarzen Stier.
Auf dem Plumpsclo war die Öffnung so groß, dass ich gut und gerne hineinpasst hätte. Also aufgepasst! Als ich die Tür wieder öffnete, entleerte sich gerade das schwarze „Ungeheuer“, das Hinterteil mir entgegen streckend. Ich stank, war über und über bespritzt. Dennoch schnell, schnell zurück in die hoffentlich noch warmen Federn --nein, Federn oder geschweige denn Daumen waren es nicht!
Als nach längerer Zeit, ich weiß nicht wie lange, vielleicht ein paar Monate, dann auch meine Großeltern mütterlicherseits hierher kamen, war das ein Lichtblick für mich.
Endlich wieder in Omas Bett Burg bauen dürfen. Mein Vater hatte es wieder mal möglich gemacht!
Jeden Sonn- und Feiertag waren Oma und Opa selbstverständlich bei uns zum Essen. „Rudi, können Sie mir bitte noch etwas von den Paradeisern geben?“. Ich erfuhr nie, ob der Umgang zwischen den Großeltern und ihrem Schwiegersohn Respekt oder gewollte Distanz waren.
Ja, mein Vater mit seiner Gegenwart und seinem Geist füllte jeden Raum. Er war belesen, gebildet, gutherzig, streng, korrekt, fordernd und ist mir bis zu seinem Tod keine Antwort auf meine vermutlich oft dämlichen Fragen schuldig geblieben. Auch in der Zeit, als er uns ein wohliges, neues Eigenheim schaffte und meine Schwester und mich in den ersten Jahren ins Internat nach Kaufbeuren steckte, war er immer für mich da. Die meisten Jahre meiner Oberschulzeit war ich in der Folge als Fahrschüler nach Kaufbeuren mit dem Bimmelzug unterwegs. Bestimmt war ich kein Vorzeigeschüler. Ganz bestimmt nicht! Ein Jahr vor dem Abitur wurde ich ins Direktorat gerufen.
An einem langen Konferenztisch saßen Direktor Thiele und mein Vater. In der Mitte des Tisches stapelte sich ein Berg von Zetteln. Es waren die Entschuldigungen, die ich in der Arztpraxis beim Vater meines Freundes Peter Crell in Bad Wörishofen mit ärztlichem Stempel versehen hatte. Eigentlich war das strafbar, und die Strafe folgte auch zugleich. Direktor Thiele gab mir Demissionsandrohung, die er einige Wochen später in die Tat umsetzte. Unglaublich, wie ich meinen Vater enttäuscht hatte.
Ja, ich war kein Vorzeigesohn. Doch ich schätzte meinen Vater über alle Maßen.
Meine Mutter sah zu ihm auf, fügte sich immer drein und liebte ihn abgöttisch…Leider! Das zeigte sich später, als mein Vater bedauerlicherweise sehr früh, viel zu früh, ganz plötzlich starb.
An diesem Tag kam ich schlaftrunken, mit 18 waren die Nächte oft lang und feucht, am späten Vormittag ins Wohnzimmer. Da saßen Mutti und Papa gemütlich auf dem Sofa. Er las, wie oftmals am Sonntagmorgen, meiner Mutter die neuesten Zeitungsberichte vor und versuchte, das Gedruckte auf seine Weise seiner Frau leichter verständlich zu machen.
Es war immer schön zu beobachten. Kinder fühlen sich eben geborgen, wenn Eltern sich offensichtlich gut verstehen. Leider ist das nicht immer so. Aber ich hatte eben dieses Glück! Jedoch in diesem Moment wirkte sich dieses Gefühl verstärkend auf die Empfindungen der nächsten Minuten aus.
Ich kam, wie gesagt, gerade ins Zimmer, als mein Vater kurz und tief nach Luft japste, drei kurze Laute heraus presste und dann zurück viel. Der Schrei meiner Mutter sitzt mir bis heute in den Knochen: „Hol schnell Doktor Krupa - schneeeeeelll!“ schrie sie bittend und flehend. Ich rannte barfuß, noch im Schlafanzug, dem Bahngleis entlang, von Peiting Nord nach Ost. Wahrscheinlich hätte ich bei diesem Tempo jeden 3000m-Lauf gewonnen.
Telefon hatten wir damals, wie die meisten Leute, leider keines.
Der schon ziemlich kahlköpfige Arzt, mit Stetoskop über meinen Vater gebeugt, stellte nur noch den Tod fest.
4. Nov.1962. Das wars dann!
Alle meine Kindheitseindrücke sausten wie im Formel-1-Rennen an mir vorbei: was hatte Papa alles für mich möglich gemacht. Ich durfte mir einen kitschigen Partyraum einrichten, manchmal auf meinem blauschimmernden Trixon-Schlagzeug üben, vorrausgesetzt die Schulnoten waren gerade nicht im Keller. Auch bekam ich schon als Vierjähriger zwei elegant geformte Holzbretter. Heute nennt man sie Skier. Ja, vieles wurde mir möglich gemacht!
Ich durfte mir ein Instrument selbst aussuchen. Blödersinniger Weise wählte ich Zither. Wie kann man nur so blöd sein! Immer Blasen an den Fingern vom Zupfen der Bass- und Akkordzeiten. Mitleidiges Lächeln meiner Schulkameraden war oft der Lohn!
Aber ich hatte ja auch das Schlagzeug, das mein Vater oftmals konfiszierte. In solch einem Fall holte ich mir beim Metzger eine noch feuchte Schweinsblase und bespannte damit einen Persil-Karton. Wenn das Fell getrocknet war, konnte man ganz prima drauf trommeln, es sei denn, ein etwas zu fester Schlag in die Mitte des Schweinsfells ging ins Tiefe. Kommt Zeit, kommt neue Schweinsblase!
Und weiter rasten die Erinnerungen an den vielen Kindheitserlebnissen vorbei.
In den Nachkriegsjahren hatten wir Kinder alle gleichmäßig wenig und freuten uns über die einfachsten Dinge. Ein weich getretener Fußball löste da manchmal schon ein Glücksgefühl aus. „Räuber und Gendarm“ spielen, an den Marterpfahl fesseln, die Freundin ausspannen und sich verprügeln, waren die üblichen Beschäftigungen.
Wir hatten alle nicht viel, aber es wurde von Tag zu Tag ein bisschen mehr.
Fernsehen gab es schlicht weg nicht. An Handys, Computer und andere Kommuniktionsgeräte war nicht zu denken, da sie ja erst 30 und mehr Jahre später auf den Markt kamen. In dieser Zeit, nach dem Krieg, waren wir Kinder dennoch nicht unzufrieden. Wir waren ja alle in der gleichen Lage.
Halt, Moment mal! Bei mir war es doch ein bisschen anders! Ich hatte nämlich einen Vater, der mir, bei all seiner Strenge und Pedanterie, so einiges „Mehr“ ermöglichte.
Damals hing eine James-Dean-Jacke und später auch eine schwarz-rot-karrierte Elvis-Presley-Jacke in meinem Schrank. Meine Moped-Flausen wurden von ihm weggefegt, als er mir sagte, dass ich mir in München in der Bayerstraße beim Fahrradgeschäft„X“, an dem wir manchmal vorbei geschlendert waren, zum Geburtstag das ersehnte, knallrote Feith-Pirelli-Rennrad abholen dürfe. Gleich am nächsten schulfreien Tag saß ich im Zug und kurz darauf im Sattel. Ich radelte und radelte und radelte! Auf der Landstraße nach Lindau konnte ich irgendwann nicht mehr und ließ mich in die Wiese unter einem Obstbaum fallen, zog meine Hose runter und beäugte meinen Hintern: ein Pavian hatte sicher einen weniger roten Arsch! Die Heimfahrt war entsprechend schmerzhaft.
Das Radfahren war schon immer mein Faible.
An meinem Rennrad Licht vorn und hinten zu installieren, stand nie zur Diskussion. Das hatte man doch nicht, das war doch nicht cool! Die Polizei war da ganz anderer Meinung. Eines schönen Tages ertappte sie mich in den Abendstunden mit Rad. Als ich merkte, dass die beiden Plizisten umkehrten, um mich zur Rede zu stellen, legte ich einen Zahn zu und strampelte mit Vollgas die Landstraße in Richtung Schongau entlang. Ich gab alles, aber sie kamen immer näher. In meiner Naivität ließ ich mich in der nächsten Innenkurve waghalsig in den Straßengraben fallen und glaubte, meinem Unheil entgehen zu können. Hier unten im Graben würden sie mich sicher nicht entdecken! Als ich aufsah, blickte ich in grinsende Polizistengesichter. Schluss mit lustig. Die Strafe tat weh und hinterließ in meinem Geldbeutel wieder mal eine beängstigende Leere.
Einen England-Aufenthalt machte mir mein Vater ebenfalls möglich, nämlich, als meine 4 in Englisch bei ihm wieder einmal Ängste auslöste und seiner Meinung nach sofortige Änderung bedingte. Gleich zu Beginn der Ferien gings los.
So schön ein Englandaufenthalt auch war, so gab es leider auch eine Kehrseite. Um mir nämlich den Aufenthalt möglich zu machen, arbeitete Papa noch mehr als seine üblicherweise 12-14 Stunden am Tag und zeichnete in seinem von Zigarettenrauch überquellenden Arbeitszimmer einen Plan nach dem anderen für ein kleines Eigenheim oder eine Garage für den oder den. Und wie dankte ich es ihm, ich undankbarer Sohn? Ich hatte nur Mädels, Autos und sonstige Flausen im Kopf.
Während meines Aufenthalts in Südengland brachte, nebst anderen Ärgernissen, dann eine verbotene Fahrt mit dem gerade kurz mal einige Stunden ausgeliehenen Geschäftsauto des Verkehrsministers von Sussex, Mr. Hall, bei dem ich die vier Wochen sein durfte, das Fass zum Überlaufen. Sein immer aufgetankter RollsRoyce interessierte mich schon länger. Jetzt war die Zeit gekommen. Alle waren außer Haus und die Garage offen, der Schlüssel am Schlüsselbrett. Die ersten Radfahrer, die mir begegneten, fuhren nach meiner Ansicht auf der verkehrten Straßenseite. Leider war es anders herum. Nach einigen Meilen ging das Fahren so perfekt, dass ich fuhr und fuhr. Es war ein Genuss. Bei dem nicht wahrnehmbaren Motorengeräusch hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Mittlerweile war ich schon lange unterwegs, denn plötzlich war ich in London. Hier wollte ich schon immer mal hin und beschloss kurzer Hand, jetzt nicht aufzugeben. Als ich nach vielen engen und stark befahrenen Straßen endlich an einem großen, runden Platz ankam, traute ich meinen Augen nicht. Ein „Bobby“ stand in der Mitte auf einem Podest und regelte den Verkehr. Als ich auf dem Platz ankam, streckte er seine rechte Hand nach oben und in alle Richtungen und forderte damit alle Fahrzeuge zu stoppen auf. „Er hat sicher gesehen, dass ich zum Autofahren noch zu jung bin“, waren meine Gedanken. Das Herz rutschte mir in die Hose. Als alle Autos standen, deutete er mir an, dass ich weiterfahren sollte, indem er mir fast devot die Richtung mit seinen weißen, langen Handschuhen andeutete. Jetzt würde mein Trip zu Ende sein und die Strafe auf den Fuß folgen. Aber es kam nicht so. Ich fuhr weiter, als ob nichts geschehen wäre, erst eine Straße, dann die nächste und nach einiger Zeit erreichte ich wieder den Stadtrand. Erst jetzt blieb ich stehen und ließ das Geschehene nochmals vor meinen Augen ablaufen. Warum kam ich ohne eine Strafmaßnahme davon? Die Krux an der Sache war: ich hatte auf meinem Nobelgefährt die Standarte des Verkehrsministers stecken, der logischer Weise bevorzugt behandelt wird. Vermutlich dachte sich der Schupo, dass der Minister einen neuen, jüngeren Chauffeur eingestellt hätte.
Ich war froh! Doch bald kamen mir furchtbare Gedanken. Seit mehreren Stunden war ich nun schon unterwegs. Sicher war mittlerweile in meinem Gast-Zuhause wieder Leben in der Bude. Meine führerscheinlosen Fahrkünste waren schneller meinem Vater zugetragen worden, als die Buschtrommeln es vermocht hätten. „Morgen sitzt du im Zug und fährst schnurstracks nachhause zurück!“ waren seine knappen, resoluten Worte. Es brannte am Dach! Ich hatte ihn furchtbar enttäuscht.
Nach der ersten Englisch Arbeit war das Unheil perfekt. Die 4 war zur 5 geworden und mein Vater um eine Enttäuschung reicher.
Spätestens jetzt war Lernen angesagt! In ein paar Wochen war nämlich der päpstliche Legat von England und Irland in Peiting zu Besuch angesagt?
Was hatte ich damit zu tun?
Mein Vater hatte seinem Chef, Bürgermeister Fliegauf, versprochen, dass ich seine Rede, ins Englische übersetzt, vortragen würde. Und das auf dem Marktplatz vor hunderten schaulustigen Einwohnern.
Gott sei Dank wurde mir der ein oder andere Fehler bei meinem Vortrag verziehen. Kräftiger Applaus war mein Lohn!
Und weiter blitzten Erinnerungen an vergangene Jahre auf.
Manche unterstrichen die Strenge meines Vaters.
Wie oft musste ich mit seiner steifen Architektur-Reißschiene im Rücken am Esstisch sitzen, weil ich in seinen Augen zu wenig aufrecht am Mittagstisch saß. Oder wie laut hatte es doch gekracht, als mein Eishockeyschläger auf seinem Knie zerbrach. Ich war gerade mal 5 Minuten zu spät nach Hause gekommen.
Auch die Holzscheite unter meinen Knien im dunklen Keller waren die wenigen Male kein Honiglecken. Diese und viele andere Gedanken flitzen in Sekundenschnelle durch meinen schmerzenden Kopf.
Mein Vater mit geschlossenen Augen vor mir liegend, und meine schluchzende Mutter über ihn gebeugt.
Was jetzt? Erstarren, Ängste und Verzweiflung machten sich bei mir breit. Aber irgendwie spürte ich auch Erleichterung. Alle Verbote waren auf einmal wie weg gefegt.
Jetzt war Ausgelassenheit angesagt. Partys feiern und dabei den süffigen Apfelsaft meiner Mutter vertilgen oder die verdammt gut schmeckenden Marzipankugeln stibitzen und, und, und!… Nein, auch das hatte bald ein Ende. Meine Mutter wollte nämlich unbedingt zu ihrem abgöttisch geliebten Mann, versuchte sich zweimal das Leben zu nehmen, wurde dabei überrascht und machte dann mit einem Sprung von der Echelsbacher-Brücke ihren Sehnsüchten nach ihrem Rudi, so nannte sie ihn liebkosend, ein Ende. Ich durfte sie nicht mehr sehen. Ich sollte sie so gut aussehend, wie sie war, in Erinnerung behalten.
Bei der Beerdigung meines Vaters glich der Friedhof einem Meer von schwarzen Hüten und Mützen. Der Friedhof voller Trauergäste. Ich fragte mich: „War mein Vater so beliebt?“ Ja er war!
Als Marktbaumeister war er anscheinend kompetent und beliebt, galt in vielen sozialen Bereichen als Unterstützer in allen Lagen, gründete Genossenschafts-Wohnanlagen und war, wie ich später erfahren habe, ein blendender Gesellschafter! Daher dieser gewaltige Abschied von ihm!
Wie habe ich noch die unzähligen Versprechungen in den Ohren, die mir beim Kondolieren ins Ohr geflüstert wurden: „Wenn du mal was brauchst, Bubi, ich bin immer für dich da!“ Luftblasen über Luftblasen! Von niemanden bekam ich später hilfreiche Unterstützung. Die sogenannten „Untern-Arm-Greifer“ waren wie vom Erdboden verschwunden. Das erwies sich noch ausgeprägter, als einige Monate später auch meine Mutter unter die Erde kam. Jetzt war ich Vollwaise und gerade mal 18. Also, ich bekam noch bis zum 21. Lebensjahr einen Vormund zugeteilt. Ein Rechtsanwalt aus Weilheim! Er wurde einfach dazu bestimmt. Ich weiß nicht, warum gerade er? Warum ein Fremder und kein Freund der Familie. Obendrein brachte er die letzten Ersparnisse meiner Mutter, die für mich bestimmt waren, an den Mann oder besser an sich. Die vielen Telefonate mit der Schule und anderen Institutionen wären angeblich der Grund für die vielen Ausgaben gewesen. Sehr viel Zeit und Geld habe er dafür aufwenden müssen.
Ich ließ mich jedenfalls nicht von ihm beeindrucken, brachte meine Oberschule mit vielen Hürden hinter mich und versuchte, mich in der Folge mit den verschiedensten Arbeiten finanziell über Wasser zu halten. Musik spielte dabei die Rolle Nr. 1 auf meiner To-do- und Amusement-Liste. Begonnen als Schlagzeuger und Sänger beim „Gabi-Pfanzelt-Quartett“, dann bei den „Ramblers“, später den „Red Jackets“. Ich war auf den meisten Bühnen im voralpenländlichen Gau zu Hause und anscheinend auch beliebt. Das darf ich so sagen, auf Grund der vielen proppenvollen Tanzlokale. Es war die Zeit der Tanzkapellen! Livemusik war angesagt, der Begriff „Groupies“ Wirklichkeit geworden. Mein Zuhause in diesen Jahren nicht mein Elternhaus, in dem jetzt meine ältere Schwester mit ihrem Lover wohnte, sondern ich schlüpfte mal da und mal dort unter die Bettdecke. Einmal bei der Frau eines Bandmitgliedes, dann der Schwester des Betreibers der Eisdiele, wo ich mir noch ein paar Kröten als „flotte Bedienung“ dazu verdiente. Ich erinnere mich genau, dass bei meiner Serviertätigkeit so mancher Eisbecher vorübergehend wieder im Eisfach geparkt wurde, bis mir wieder einfiel, wer ihn eigentlich bestellt hatte.





























