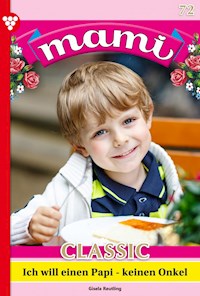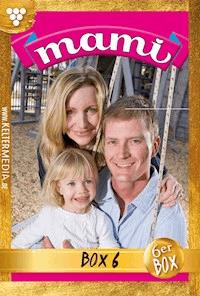Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mami
- Sprache: Deutsch
Die Familie ist ein Hort der Liebe, Geborgenheit und Zärtlichkeit. Wir alle sehnen uns nach diesem Flucht- und Orientierungspunkt, der unsere persönliche Welt zusammenhält und schön macht. Das wichtigste Bindeglied der Familie ist Mami. In diesen herzenswarmen Romanen wird davon mit meisterhafter Einfühlung erzählt. Die Romanreihe Mami setzt einen unerschütterlichen Wert der Liebe, begeistert die Menschen und lässt sie in unruhigen Zeiten Mut und Hoffnung schöpfen. Kinderglück und Elternfreuden sind durch nichts auf der Welt zu ersetzen. Genau davon kündet Mami. Es war ausgerechnet ein ungewöhnlich kühler Apriltag, an dem Frau Professor Gessner in einem lavendelblauen Kostüm vor ihre Studenten trat. Die jungen Damen unter ihrer Zuhörerschaft tauschten vielsagende Blicke aus. Einige kicherten sogar leise. Die gefürchtete Professorin, von vielen nur Eis-Renata genannt, ließ sich doch nicht etwa von Frühlingsgefühlen treiben? Sonst kleidete sie sich eher wie eine nicht mehr junge, aber doch ziemlich graue Maus, bevorzugte Strickwaren in allen Breiten und Längen und liebte Farben, die eher düsteren Schattierungen glichen. Und heute? Sie, die als Leiterin des mathematischen Institus so vorbildlich musterhaft beherrscht und pflichtbewußt ihrer Verantwortung nachging, wollte doch nicht etwa im hohen Alter von über Sechzig ein neues Leben beginnen? Renata Gessner bemerkte das Getuschel, aber es störte sie nicht. Noch nie hatte sie sich etwas aus den Gefühlen anderer gemacht. Freude, Heiterkeit und alles andere, was für junge Menschen lebensnotwendig war, galt in ihren Augen als lästige Störung im Ablauf des Alltags. Sie dachte schon gar nicht daran, ein neues Leben zu beginnen. Auch, wenn heute ein besonderer Tag war. Ihr einziger Sohn Martin würde ihr nach sieben Jahren zum ersten Mal wieder gegenüberstehen. Gegen Abend verließ Renata das Institut eine Stunde früher als sonst, nahm sich ein Taxi und fuhr zum Bahnhof. Im Auto prüfte sie ihr Aussehen ganz flüchtig im Spiegel und strich sich das graue Haar ordentlich aus der Stirn. Solange sie denken konnte, trug sie einen strengen Scheitel und einen zur Schnecke gesteckten Zopf im Nacken. Heute sollte keins ihrer Haare, die mit zunehmendem Alter immer weißer und störrischer wurden, stören. Renata wollte ihren Sohn Martin so empfangen, wie er sie in Erinnerung hatte. Ordentlich und korrekt, diszipliniert und zuverlässig. Das letzte Mal, als Martin aus Argentinien in die kleine Universitätsstadt gekommen war, da hatte die Beerdigung seines Vaters stattgefunden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mami – 1765 –Meine berühmte Mami
Isabell Rohde
Es war ausgerechnet ein ungewöhnlich kühler Apriltag, an dem Frau Professor Gessner in einem lavendelblauen Kostüm vor ihre Studenten trat. Die jungen Damen unter ihrer Zuhörerschaft tauschten vielsagende Blicke aus. Einige kicherten sogar leise. Die gefürchtete Professorin, von vielen nur Eis-Renata genannt, ließ sich doch nicht etwa von Frühlingsgefühlen treiben?
Sonst kleidete sie sich eher wie eine nicht mehr junge, aber doch ziemlich graue Maus, bevorzugte Strickwaren in allen Breiten und Längen und liebte Farben, die eher düsteren Schattierungen glichen. Und heute? Sie, die als Leiterin des mathematischen Institus so vorbildlich musterhaft beherrscht und pflichtbewußt ihrer Verantwortung nachging, wollte doch nicht etwa im hohen Alter von über Sechzig ein neues Leben beginnen?
Renata Gessner bemerkte das Getuschel, aber es störte sie nicht. Noch nie hatte sie sich etwas aus den Gefühlen anderer gemacht. Freude, Heiterkeit und alles andere, was für junge Menschen lebensnotwendig war, galt in ihren Augen als lästige Störung im Ablauf des Alltags.
Sie dachte schon gar nicht daran, ein neues Leben zu beginnen. Auch, wenn heute ein besonderer Tag war. Ihr einziger Sohn Martin würde ihr nach sieben Jahren zum ersten Mal wieder gegenüberstehen.
Gegen Abend verließ Renata das Institut eine Stunde früher als sonst, nahm sich ein Taxi und fuhr zum Bahnhof. Im Auto prüfte sie ihr Aussehen ganz flüchtig im Spiegel und strich sich das graue Haar ordentlich aus der Stirn. Solange sie denken konnte, trug sie einen strengen Scheitel und einen zur Schnecke gesteckten Zopf im Nacken. Heute sollte keins ihrer Haare, die mit zunehmendem Alter immer weißer und störrischer wurden, stören. Renata wollte ihren Sohn Martin so empfangen, wie er sie in Erinnerung hatte. Ordentlich und korrekt, diszipliniert und zuverlässig.
Das letzte Mal, als Martin aus Argentinien in die kleine Universitätsstadt gekommen war, da hatte die Beerdigung seines Vaters stattgefunden. Seine beruflichen Pflichten in Buenos Aires hatten seinen Aufenthalt auf eine Woche beschränkt, aber Renata hatte gemerkt, wie gern er sich wieder verabschiedete.
In den seltenen Telefongesprächen oder kurzen Briefen danach hatten Mutter und Sohn einander nur immer versichert, daß es ihnen gutging. Wie wenig sie sich zu sagen hatten, war Renata dabei aber nie aufgefallen.
Von Martin, der inzwischen Mitte Dreißig war, erwartete sie nur, daß er ihr gesund und nicht übermäßig erschöpft entgegentrat. So ein Flug dauerte zwölf Stunden. In Frankfurt hatte er den Zug bis hierher nehmen müssen. Nun ja, gewisse Strapazen konnte sie ihm zumuten. Sie nahm an, daß er noch immer so kühl und beherrscht auftrat, wie ihr verstorbener Mann und sie es ihm anerzogen hatten. Keinesfalls rechnete sie mit dem Ausdruck von erfreuter Zustimmung, wenn sie ihn in einem frühlingsfarbenen Kostüm empfing.
Sie wollte mit dieser Aufmachung ja nur deutlich machen, daß sie immer noch eine angesehene Frau und bedeutende Persönlichkeit war und die Trauer über den Tod ihres Mannes längst überwunden hatte.
Sie stieg aus dem Taxi und betrat die Bahnhofshalle, um sich dem Gang, der zu den Bahngleisen führte, langsam zu nähern. Dabei tastete sie flüchtig über die Tasche ihrer Kostümjacke. Darin steckte das Lorgnon griffbereit, das sie außerhalb des Instituts benutzte. Sie würde es vor die Augen heben und Martin ins Gesicht sehen. Ähnelte er seinem Vater? Und wenn ja, waren zwischen Nasenwurzel und Mundwinkel nicht endlich die charakteristischen Falten entstanden, die schon damals bei seinem noch sehr jungen Vater Ehrgeiz und Zielstrebigkeit verrieten?
Einmal seufzte sie noch kurz. Zu ihrem Bedauern würde Martin es nie wie sein Vater zum Professor bringen, denn er begnügte sich mit dem Titel eines Diplomingenieurs. Weil er seit sechs Jahren eine bekannte deutsche Firma in Buenos Aires vertrat und in dieser Position gut verdiente, würde er wohl nie nach den Sternen akademischer Ehren greifen. Ihm genügte das, was er sich aufgebaut hatte. Ihr, seiner Mutter, der anerkannten Mathematik-Professorin, genügte es nicht. Das hübsche Blau ihres Kostüms mochte darüber hinwegtäuschen, aber sowie sie in den nächsten Tagen Gelegenheit dazu fand, wollte sie mit Martin ein sehr ernstes Gespräch führen und ihn an die Fa-
milienehre erinnern.
Als sie ihn Sekunden später im Gewühl entdeckte, rührte sich dann doch so etwas wie mütterlicher Stolz in ihr. Martin sah gut aus. Er war hochgewachsen wie sein Vater, und seine Haltung verriet schon von weitem Weltläufigkeit und Selbstbewußtsein. Das mittelbraune Haar war gut geschnitten, die unauffällige Brille vor seinen klugen grauen Augen verriet diskreten Geschmack. Nur sein Blick, seltsam entrückt und sanft, paßte nicht ganz dazu.
Sie wollte ihm entgegengehen, aber sie blieb wie versteinert stehen. Vorn auf dem Kofferkuli, auf den Martin sein Gepäck geladen hatte, hockte ein Kind. Es war ein Bub mit dunklen Haaren, und weil er mit Martin sprach, ließ sich auch dessen nach vorn geneigte Haltung erklären. Was war das für ein Junge? Ob er das Kind für Bekannte mitgenommen hatte und es hier irgendwo seinen Eltren übergeben wollte?
Keinesfalls gehörte das Kind zu ihm, entschied Renata, und ihr Verstand bestätigte diese Feststellung. Martin war nicht verheiratet. Er hatte keine Frau, also konnte er kein Kind haben. Er hatte sich bestimmt nur breitschlagen lassen, um es für kurze Zeit zu betreuen. Martin hatte ja schon als Knabe seltsame Regungen gezeigt und sich für allerlei unwichtige Dinge eingesetzt.
Und schon standen die beiden vor ihr.
»Ich habe mich auf dich gefreut, Mutter«, begrüßte Martin seine Mutter, ließ die Hand des Jungen los und umschlang sie mit beiden Armen. »Wunderbar, dich munter und gesund zu sehen nach so vielen Jahren. Du bist überhaupt nicht älter geworden! Die Arbeit am Institut bekommt dir anscheinend sehr gut.«
Sie lächelte mit ihren schmalen Lippen, dann strich sie sich wieder automatisch übers graue Haar. Martin sah es, lächelte und beugte sich vor, um sie zu küssen. Er kannte diese flüchtige Geste seit seiner Kindheit. Sie war ihm das einzig Vertraute an seiner Mutter, denn sie verriet für Sekunden eine liebenswerte Verstörung.
»Was ist mit dem Kind?« fragte sie auch sofort und zog ihr Lorgnon hervor.
Martin nahm den Jungen auf den Arm.
»Das ist André, mein Sohn. André, das ist deine liebe Großmutter.«
Renata trat unwillkürlich einen Schritt zurück. Sie mußte dem Angriff auf ihre Gefühle zunächst mal ausweichen, indem sie eine gewisse Entfernung zwischen sich, ihrem Sohn und diesem Kind herstellte.
»Ihr werdet euch ja noch kennenlernen«, hörte sie Martin wie aus weiter Ferne sagen. Er setzte den Jungen wieder auf die Koffer und lächelte. »Willst du nicht gleich Renatas Hand nehmen, André? Wenn du sie schön festhältst, weiß ich, ihr beide verliert einander nicht.«
»Bitte nicht!« preßte Renata hervor.
»Mutter! André ist dein Enkel!«
»Kinder haben gewöhnlich eine Mutter. Wo ist sie, Martin?«
»Später!« murmelt er. »Später erfährst du alles. Aber mach ihm den Empfang doch nicht so schwer.«
»Wo ist sie?« wiederholte Renata unerbittlich.
Martin senkte die Stimme. »Marcia ist in London, dann in Paris und Ende des Monats in Amsterdam. Sie ist eine wunderbare Frau, kann sich aber nicht so um unseren Sohn kümmern.«
»Was soll das heißen? Ist sie nicht deine Frau?«
Er lächelte, neigte sich zu ihr und flüsterte: »Nein, das ist sie leider noch nicht. Es ist mir bis jetzt nicht gelungen, sie von den Vorzügen einer Ehe zu überzeugen. Aber sie ist eine gute Mutter. Und nun bitte ich dich, keine weiteren Fragen zu stellen. André versteht Deutsch und Spanisch. Er soll keinen falschen Eindruck von dir bekommen. Ich denke doch, er will seine Großmutter von Herzen liebhaben.«
»Mich? Mich will er liebhaben?« fragte Renata atemlos. »Wenn seine Mutter sich in der Welt herumtreibt und dich mit dem Jungen allein nach Deutschland fliegen läßt, dann soll er mich als Ersatz liebhaben? Das ist wohl die bequemste Lösung, wie? Ich empfinde es als Zumutung!«
Martin Gessner bewahrte Haltung, wie es ihm eigen war. »Ich habe An-dré erzählt, daß du eine wunderbare, sehr gescheite und tüchtige Frau bist, Renata. Also bitte, stell mich nicht als Lügner hin.«
Während der Taxifahrt saß André zwischen ihnen, und der Blick seiner tiefbraunen Augen wanderte unsicher von einem zum anderen. Aber Renata blieb stocksteif, als wäre der Kleine gar nicht vorhanden. Mit verärgertem Gesicht blickte sie hinaus.
»Ich dachte, du hättest in Deutschland für einige Zeit geschäftlich zu tun«, äußerte sie nun auf Englisch.
»Das habe ich«, antwortete Martin hastig in der gleichen Sprache, weil André das Gespräch nicht verstehen sollte. »Ich wollte André nicht wieder ohne seine Mutter in Buenos Aires zurücklassen. Er verbringt sonst immer viel Zeit mit seiner anderen Oma, Marcias Mutter. So war es auch diesmal geplant. Ich habe anders entschieden. Aus einem Gefühl der Ungeduld und Verzweiflung heraus.«
Sie hob die Augenbrauen. »Ungeduld? Verzweiflung? Du? Martin, wo bleibt dein Verstand?«
Martin schwieg. Ja, wo blieb sein Verstand? Aber hätte er sie nicht genauso fragen können, wo bleibt dein Herz, Mutter?
»André wird dir nicht zur Last fallen«, äußerte er nach einer Weile. »Wenn du beschäftigt bist, wird er sich bestimmt mit Josefa vertragen. Sie ist doch noch für deinen Haushalt verantwortlich?« Und als Renata kurz nickte, fuhr er fort: »Du sollst nur Freude, keine Mühe mit ihm haben.«
»Freude?« zischte sie beleidigt. »Ich soll Freude empfinden, wenn du mir ein Kind anbringst, daß aus so zerrütteten Verhältnissen stammt? Aus Verhältnissen, die gar nicht zu einem Mann wie dir passen? Wahrhaftig, Martin, du hättest mir das alles vorher sagen können.«
»Ja, aber du hättest mir abgeraten, ihn mitzubringen. Ich nahm an, An-drés Anblick und seine liebenswerte Art sorgen schon dafür, daß du ihn in dein Herz schließt.«
Es klang bitter, denn Martin mußte sich bereits jetzt eingestehen, daß er sich von einer falschen Hoffnung hatte leiten lassen. Wie hatte er nur annehmen können, seine Mutter hätte sich als Witwe und als neue Leiterin des Institus verändert?
»Ist sie wirklich meine Großmutter?« flüsterte André gleich darauf auf Spanisch.
»Ja, das ist sie, André. Sie wird es schon begreifen und sich dann sehr freuen, daß es dich gibt.«
Er sah zu Renata hinüber. Wie gut, daß sie kein Spanisch sprach. Sie hätte aber auch in ihrer Muttersprache nicht begriffen, wieviel Hoffnung in seinen Worten lag.
*
Noch am selben Abend hatte Martin sein altes Kinderbett vom Speicher geholt und es neben seinem in dem alten Jungenzimmer aufgestellt. Dabei fiel ihm auf, wie wenig sich in seinem Elternhaus verändert hatte. Der Speicher quoll von Erinnerungen über.
Natürlich fand seine beschäftigte Mutter kaum Zeit, etwas auszusortieren oder, wenn es noch für andere nützlich sein konnte, zu verschenken. Vielleicht, fiel ihm ein, erträgt sie den Anblick von Gegenständen aus alten Zeiten auch nicht. Alles, was Gefühle in ihr auslösen konnte, hatte sie immer gemieden. Warum vergaß er es nur immer?
In den folgenden Tagen sah er Renata nur kurz beim Frühstück. Abends kehrte sie wie üblich sehr spät aus dem Institut zurück. Seine Bitte, ihn und André in den Zoo zu begleiten oder eine gemeinsame Stadtrundfahrt zu unternehmen, schlug sie mit der Begründung ab, ihre Studenten bereiteten sich auf das Examen vor und könnten sie nicht entbehren. Wozu auch? André habe sich doch schnell an die alte Haushaltshilfe Josefa gewöhnt.
Martin mußte das hinnehmen und geriet allmählich über sich selbst in Wut. War er nicht tollkühn gewesen, als er annahm, André würde hier mit offenen Armen aufgenommen, geherzt und geliebt?
Das Wochenende näherte sich, und gleich danach mußte Martin nach Hamburg und Berlin, um Geschäftliches zu regeln. In drei Wochen fand eine Messe statt, auf der er wichtige Partner aus den Vereinigten Staaten treffen mußte. Und nach einer weiteren Woche, in der noch Verhandlungen anstanden, konnte er dann mit seinem Sohn den Heimflug antre-
ten.
Er sah dieser Zeit schon mit Grausen entgegen. Wem sollte André sich während seiner Abwesenheit an-schließen? Josefa, mittlerweile gebeugt, aber immer noch geduldig und liebenswürdig, verließ den Haushalt abends gegen neunzehn Uhr, nachdem sie das Abendessen vorbereitet hatte. Obwohl Josefa schon über achtzig war, inzwischen einiges durcheinanderbrachte und am liebsten ein Essen aus Konserven servierte, begnügte Renata sich mit ihrer Hilfe. Josefa gehörte zu den wenigen Menschen, an die sie sich gewöhnt hatte und an denen sie hing.
Dabei hatte es ihr doch immer widerstrebt, sich mit Menschen zu befassen, denen die Mathematik nichts sagte, erinnerte Martin sich mit einem wehmütigen Lächeln.
Und noch mehr fiel Martin so nach und nach ein. Auch, daß Renata nie eine besonders liebevolle Mutter gewesen war. Warum hatte er sich nur eingebildet, sie käme seinem kleinen André so herzlich entgegen wie eine richtige Großmutter?
Nun gut, Renata lebte nun mal für ihre Wissenschaft. Zahlen und Gleichungen bildeten des Inhalt ihres Daseins.
André und er gingen also allein in den Zoo, und am Sonntag amüsierten sie sich prächtig bei der Stadtrundfahrt, weil daran auch andere Kinder teilnahmen.
»Wir werden zusammen essen gehen«, beschloß Martin, als sie den Bus am frühen Abend verließen und André sich fröhlich von den anderen Fahrgästen verabschiedet hatte.
Der machte einen kleinen Luftsprung. »Au ja. Meine Großmutter muß allein essen. Wir bleiben doch nicht mehr lange bei ihr?«
»Sie muß heute Abend zu einem Vortrag, André«, stellte Martin klar, als müsse er Renata trotz allem verteidigen.
Spät an diesem abend wartete er im großen Wohnzimmer auf sie. Gleich daneben lag die Bibliothek, an deren Wände sich mit wissenschaftlichen Werken vollgepropfte Regale reihten. Es ging auf Mitternacht, als er die Zeitungen beiseite legte und gemächlich in diesen Raum trat. Er tat es, um sich die Wartezeit zu verkürzen. Eigentlich wäre er lieber ins Bett gegangen. Aber er wollte noch heute ein klärendes Gespräch mit seiner Mutter führen, um seine Termine planen zu können. Noch immer wußte er ja nicht, ob sie nicht doch dazu bereit war, einige Nachmittage oder Abende ihres Lebens für André zu opfern. Lehnte sie seine Bitte ab, mußte er eine andere Lösung finden. Aber welche?
Nachdenklich setzte er sich hinter den Schreibtisch seines Vaters. Ob er hier irgendwo ein Buch fand, in dem nahe gelegene Kinderheime aufgelistet waren?
Spielerisch zog er eine der Schubladen im Tisch auf. Darin lag ein kleines ledergebundenes Album. Er nahm es heraus. Täuschte seine Erinnerung ihn wieder, oder hatte dies Büchlein eine bedeutende Rolle in seiner Jugend gespielt?
Bevor er es aufschlagen konnte, glitt ein Foto hinaus und segelte gemächlich zu Boden. Martin nahm es hoch, und schon beim ersten flüchtigen Blick darauf blitzte es in seinen Augen auf. Er beugte sich vor, schaltete die Schreibtischlampe an und hielt das Foto in den Lichtkegel. Dann lachte er auf, als habe er nach langem Suchen etwas gefunden, an dessen Existenz er gar nicht mehr glaubte.
»Tante Trine!« schmunzelte er. »Geliebte Tante Trine!«
Das Foto mußte zwanzig Jahre alt sein. Tante Trine bildete den Mittelpunkt. Sie war sonnengebräunt, trug ein weißes schlichtes Kleid und hatte die Arme weit ausgebreitet über die Schultern von vier Kindern gelegt. An jeder Seite der stattlichen Schönheit standen zwei etwa Zehn- bis Zwölf-jährige. Er war damals ein rechter Schlingel gewesen, der sich mit vorwitzigem Gesicht eng an die geliebte Tante schmiegte. Neben ihm strahlte die muntere Alwine in die Kamera. Sie trug Zöpfe bis auf die Schultern. Einer ihrer weißen Kniestrümpfe war herabgerutscht. Als Martin genauer hinsah, erkannte er auch die kleinen Ohrringe, an denen er immer gezupft hatte.
»Alwine!« flüsterte er glücklich. Der hochaufgeschossene Junge neben Alwine war Gunnar, ein entfernter Vetter von ihm. An den dritten der Burschen erinnerte er sich gar nicht mehr. Zu viele Jahre waren seitdem vergangen.
Aber warum hatte er Tante Trine und die wunderbaren Ferienwochen, die er damals regelmäßig bei ihr verbrachte, vergessen? Wie konnte es ihm nur passieren? Irrte er sich, oder hatte er nicht noch vor einiger Zeit von ihr gesprochen? Wie lange war das her? Monate, Jahre?
Nein, nie war Tante Trine restlos aus seinem Gedächtnis entwichen. Immer, wenn er sehr glücklich war, hatte er sich noch ganz deutlich an sie erinnert. Nur waren diese glücklichen Momente seltener geworden. Und hier in seinem Elternhaus kam es schon gar nicht mehr dazu. Das lag an Renata und ihrem Entsetzen über sein Kind.
Und drüben, in Buenos Aires und dem Land, das ihm zur zweiten Heimat geworden war, lag es an Marcia, Andrés Mutter. Besonders an ihren Unstimmigkeiten, wenn die Stunden des Glücks immer kürzer und seltener wurden und ihm keine Zeit mehr ließen, sich in wundervollen Erinnerungen zu verlieren und die Freude daran mit der geliebten Frau zu teilen.
»Du bist noch auf, Martin?«
Martin erhob sich, als er Renatas Stimme hörte. Noch im Mantel trat sie ihm im Wohnzimmer entgegen.
»Ich habe auf dich gewartet, Mutter.«
»Warum? Es ist spät. Schläft… das Kind?«
»Ja. Das Kind schläft. Es heißt André und ist mein Sohn, Mutter«, entgegnete er bitter. Dann legte er das Foto auf den Tisch, nahm ihr den Mantel ab und brachte ihn nach draußen an die Garderobe. Als er zurückkam, hielt Renata das leicht vergilbte Foto in den Händen.
»Woher hast du das?«
Er deutete in die Bibliothek. »Aus einer Lade von Vaters Schreibtisch.«
Sie seufzte. »Dein Vater und seine Cousine Trine! Schrecklich!«
»Lebt Tante Trine noch? Wie geht es ihr?«
Sie sah ihn prüfend an. »Warum interessiert dich das?«
»Ich habe herrliche Zeiten bei ihr verbracht. Eben fiel mir ein, daß ich André zu ihr bringen könnte. Er wird ihr nicht zur Last fallen. Das herrliche Haus gibt es doch noch?«