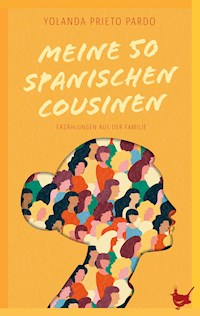Yolanda Prieto Pardo
Meine fünfzig
spanischen Cousinen
Erzählungen aus der Familie
Übersetzt von Anja Rüdiger
Erzählungen
Inhaltsverzeichnis
Meine fünfzig spanischen Cousinen
Widmung
Prolog
Meine Cousine Esther und die Halskette
Meine Cousine Fabiana und der Hund aus der Rue de Montmorency
Meine Cousine Carolina und das perfekte Haus
Meine Cousine Rosi und der extranjero in der Bar in Cuenca
Meine Cousine Ada und wie sie Regisseurin wurde
Meine Cousinen Conchi und Ángela und der koreanische Untermieter
Meine Cousine Raquel und das Erbstück aus dem Pueblo
Meine Cousine Noelia und Roberto, der Mexikaner
Meine Cousine Regina und Ernestos Bitte
Meine Cousine Luisa und ihr
Zu-gut-für-sie-Ehemann
Meine Cousine Irene und der Brief an Marisol
Meine Cousine Manuela und ihr naiver Glauben
Meine Cousine Charo und der Wunsch ihrer Tochter
Meine Cousine Sonia auf der Plaza Mayor
Meine Cousine Elena und die nötige Geduld
Meine Cousine Amparo und der Geldschein
Meine Cousinen Lidia und Verónica und ihre Business-Class-Flüge
Meine Cousine Celia und wie sie ihre wahre Identität fand
Danksagungen
Biografisches
Impressum
Cover
Table of contents
Für meine Patentante Pilar Prieto Matamala
»Nur das, was von uns gegangen ist, ist das,
was zu uns gehört.«
Jorge Luis Borges
Prolog
Ich bin in Madrid in der Nähe von Casa de Campo aufgewachsen, einer der grünen Lungen der spanischen Hauptstadt. Damals Anfang der Achtziger galt das Viertel jedoch als gefährlich. Die Eltern waren alarmiert und haben uns Kinder ständig beschützen wollen. So litten unsere Freizeitaktivitäten unter ihren Ängsten und Sorgen. Deshalb war die Freude riesengroß, wenn an den Wochenenden die gesamte Familie ins Pueblo fuhr, in das Dorf meines Vaters, in der Provinz Toledo. Sobald wir ankamen, mussten wir unsere Tanten besuchen und in der Zwischenzeit gefühlt tausende Menschen begrüßen, die man auf den Dorfstraßen traf, die in irgendeiner Weise verwandt mit uns waren. Danach durften wir – meine Geschwister und ich – das Gefühl von Freiheit genießen, das erst durch den Einbruch der Dunkelheit sein Ende fand.
Das Pueblo war für mich ein Ort voller Cousinen!
Sechsundzwanzig Personen zähle ich allein als Cousinen und Cousins ersten Grades, die ich alle mit Namen benennen kann. Und was die Cousinen des zweiten Grades anbelangt, musste ich mich hinsetzen und anfangen, einen Stammbaum zu erstellen, weil ich sonst den Überblick verliere. Alleine meine Mutter hat schon fünfzig Cousinen und Cousins ersten Grades. Flor, die Barinhaberin und gleichzeitig exzellente Tapas-Köchin, Maite, die Immobilienmaklerin, Pepín, der Elektriker, Manolo, der Gläser, Francisco, der Finanzbeamte. Sie hatte für jede Gelegenheit eine Cousine oder einen Cousin als Ansprechpartner, war stolz auf ihre Angehörigen und vertraute stets auf dieses Netzwerk.
Als junges Mädchen im Pueblo durfte ich dabei sein, wenn meine älteren Cousinen sich samstagnachmittags im Badezimmer die Haare föhnten oder im Zimmer Kleider anprobierten. Den ersten Rat in Liebesangelegenheiten habe ich ebenfalls von ihnen erhalten. Sie schlugen mir vor, für Jungs »schwer zu kriegen« zu spielen. Mit sechzehn oder siebzehn dienten die Cousinen auch als Ausrede, wenn wir den Eltern etwas verschweigen mussten: »Ich war mit den Cousinen unterwegs«. Die »Cousinen-Ausrede« galt als Garantie für sie, dass wir nichts »Unanständiges« machen würden. Wenn sie nur gewusst hätten, wie Irene, Charo oder Celia ihre Zeit mit ihren Freunden im Dunkeln des Parks verbrachten!
Jahre später, als ich und viele meiner Cousinen ins Ausland gingen, wurden diese Cousinen-Wochenendtreffen, die im Pueblo angefangen haben, in die Gegenwart verlagert. Wir treffen uns bis heute und erzählen uns von Menschen, Situationen und Anekdoten aus den verschiedenen Teilen der Welt, in denen wir leben. Mit fünfzig Cousinen ist man nie alleine. Jede weiß Rat, jede kann mitfühlen. Vor allem hat jede von ihnen immer etwas mitzuteilen.
Mit fünfzig Cousinen ist man reich an Geschichten.
Meine Cousine Esther und die Halskette
»Esther …« Die Stimme meines Bruders klang anders als sonst.
»Pablo! Was ist los?« Ich dachte sofort an meine Eltern. Ob ihnen etwas passiert ist?
»Nein, das ist es nicht …«, Pablo verstand sofort meine Sorge, »Se acaba de morir Alba … Bei ihr zu Hause. Ich bin gerade im Taxi unterwegs dorthin. Mariana ist ziemlich mitgenommen … nur, damit du Bescheid weißt … ich melde mich gleich nochmal, sobald ich dort angekommen bin …«
Mein Herz zog sich zusammen. Alba ist gestorben und Mariana war meine Patentante. Sie und ihre Schwester Alba hatten nie geheiratet und hatten keine Kinder. Für Mariana war ich wie eine Tochter. Was sollte ich tun? Den ersten Flug von Frankfurt nach Madrid nehmen? In ein paar Stunden könnte ich bei meiner Familie sein. Sollte ich sofort meinen Mann Joaquín informieren? Meine Kinder allein lassen? Bei der Arbeit Bescheid geben?
Das Telefon klingelte, und ich hörte Pablos ruhige Stimme: »Ich bin jetzt da, mit den Ärzten und einigen Nachbarn. Mariana steht noch unter Schock …«, flüsterte er, »sie ist neben mir … möchtest du mit ihr reden?«
»Ja … bitte …«
»Ach, Esther …!«, hörte ich Mariana schluchzend sagen und dann nur: »Mi hermana … Ach! Meine Schwester …!«
»Sie hat mir das Telefon zurückgegeben!« Wieder mein Bruder im Ohr. »Im Moment ist sie nicht in der Lage zu sprechen. Was wirst du tun?«
»Ich komme … sofort. Joaquín wird sich um die Mädchen kümmern.«
»In Ordnung. Ich muss jetzt auflegen. Alba wird gerade angekleidet.«
Ich riss mich zusammen, rief Joaquín an, besorgte mir das Ticket, informierte die Schule, dass ich zum Elternabend nicht kommen könnte, packte einen kleinen Koffer auf die Schnelle, zog mich in schwarze Klamotten ein und kurz vorm Einstieg im Flugzeug schrieb ich Pablo eine Nachricht: »Heute Abend um 23:00 Uhr komme ich an. Wo muss ich hin?«
Gleich darauf kam die Antwort: »Zum Tanatorio an der M30.«
Als ich am Flughafen in Madrid ins Taxi stieg, spürte ich einen schmerzhaften Stich in der Brust. Ich lebte nun seit zwanzig Jahren in Frankfurt und musste nach all der Zeit zum ersten Mal diesen Satz aussprechen: »Al Tanatorio de la M30 … por favor …«.
Für spanische Verhältnisse eine Selbstverständlichkeit: ein Bestattungsinstitut überführt den Toten in ein Tanatorio, die Leichenhalle. In einem Glaskasten wird der Leichnam mehrere Stunden oder über Nacht zur Schau gestellt. Nach und nach versammeln sich Verwandte, Freunde und Bekannte des Toten und der Hinterbliebenen. Und das alles stand mir bevor.
Der redefreudige Taxifahrer erkundigte sich, ob es sich um einen nahen Verwandten handelte, fuhr los mit Beileidsbekundungen und Sätzen, die sich zu einem unerträglichen Monolog über die Autopista de Circunvalación M30 mit ihren Tunnels und dem Autoverkehr entwickelten, bis mein Handy klingelte.
»Ich bin schon da, Pablo … bezahle gerade das Taxi.«
»Ich komme raus und hole dich ab.«
Zwei Minuten später fiel ich in den Armen meines Bruders zusammen. Seine ersehnte Umarmung und die für Januar angenehme Wärme der Madrider Luft gaben mir die Kraft, in die Leichenhalle einzutreten. Vier, fünf, sechs meiner Cousins waren zum Rauchen herausgekommen. Wie viele Cousins und Cousinen hatte ich eigentlich? Fünfzig? Die konnten unmöglich alle hier sein! Wir küssten uns zur Begrüßung auf die Wange – ein zusätzliches angenehmes Gefühl, wie beim Eintauchen in ein Schwimmbad mit warmem Wasser, überflügelte mich.
Dann die Schritte in der Halle. Stimmen, ein Raum, den man uns zugewiesen hatte, eine Glasscheibe, dahinter der offene Sarg. Ich wandte den Blick ab. Mariana in einem Rollstuhl. Ich suchte mir einen Weg im Gedränge der anwesenden Verwandten und Freunde. Meine Eltern eilten herbei, um mich zu umarmen, ich wäre gern bei ihnen stehen geblieben, aber ich war wegen Mariana gekommen; sie brauchte mich. Ich legte ihr den Arm um die Schultern, ihr Rücken fühlte sich an wie eine unregelmäßige Steinfläche, ein Felsen mit Kanten – das Ergebnis all der Jahre, in denen sie als peinadora gearbeitet hatte und von Haus zu Haus gegangen war, um ihre Kundinnen in deren Bad oder Wohnzimmer zu frisieren. Sie war in der Zeit nach dem Spanischen Bürgerkrieg aufgewachsen und hatte schon früh ihre Mutter verloren.
»Madrina! Cuánto te quiero …«, flüsterte ich Mariana ins Ohr. Ich setzte mich neben sie und nahm ihre Hände. Mariana, die auf die achtzig zuging und ihr ganzes Leben gemeinsam mit ihrer Schwester verbracht hatte – all die Jahre über hatten sie sich unter demselben Dach das Schlafzimmer geteilt.
Während ich sie tröstete, trat Pablo zu uns. Wir müssten bald aufbrechen, Mariana sollte sich ausruhen, der nächste Tag würde sehr anstrengend werden, morgens wieder im Tanatorio und danach die Beerdigung. Mein Bruder sah mir in die Augen. »Ach, Esther, könntest du heute bei Mariana übernachten? Du kannst in Albas Bett schlafen …«
Ich nickte. Diese Lücke zu füllen war das größte Geschenk, das ich meiner Patentante machen konnte. Was sollte ich empfinden bei dem Gedanken, in dem Bett zu schlafen, in dem ein paar Stunden zuvor eine Tote gelegen hatte? Ekel, Angst? Zu meiner Verwunderung: absolut nichts. Ich stand auf, wollte noch einmal Alba sehen und lief zu der Glasscheibe, die den Raum trennte. Unfreiwillig nahm ich das Gespräch zwischen zwei älteren Nonnen aus Albas Nachbarschaft, die Jahrzehnte lang befreundet waren, die ihre tote Freundin betrachteten:
»Sie ist überhaupt nicht geschminkt.«
»Sie hätten ihr wenigstens ein bisschen Rouge auftragen können. So sieht sie ziemlich gelblich aus.«
Sie hatten absolut recht. Alba hatte sich immer gern hübsch zurechtgemacht: blauer Lidschatten, Lippenstift, mehr orange als rot, die Grundierung immer etwas dunkler als der Hautton und das unfehlbare Kennzeichen: Ketten, Ohrringe, Armbänder – stets dieses leise Klingeln, wenn sie ging, sich das Haar toupierte oder lachte. Alba, die hübsche, zurückhaltende, stets kritische. Mariana, die mit jedem gleich ins Gespräch kam. Die Hausarbeit war so aufgeteilt, dass Alba bügelte und das Geschirr abwusch und Mariana den Einkauf erledigte und kochte.
Halb eins. Die Iglesia de San Andrés war hell erleuchtet, die Kuppel mit den zwölf Aposteln schon von draußen ein majestätisches Bild. Mariana und ich gingen über die Plaza de los Carros zu ihrer Haustür. Meine Patentante gab mir Albas Schlüssel, um aufzuschließen.
»Mariana, hier drin riecht es wie immer, frisch und sauber.«
Meine Patentante sah mich an. Lächelte sie? Ich hatte diesen Satz einfach so gesagt, um sie zu erfreuen, doch in dieser Nacht klang er, als hätte er einen Beigeschmack. Ich blickte durch den Flur zum Schlafzimmer hinüber. Albas Stimme hing noch in der Luft. Ich konnte sie hören, obwohl sie nicht mehr da war. Es fiel mir schwer, mir vorzustellen, was an diesem Tag in diesen vier Wänden geschehen war.
»Und die Bettwäsche? Wo ist die noch mal? Die mit dem hellblauen Blumenmuster?«
Ich bezog Albas Bett. Die Bettwäsche war ziemlich verwaschen, und der abgenutzte Stoff fühlte sich an wie Zigarettenpapier. Wenn ich als Kind bei den beiden übernachtet hatte, hatten sie die Matratze mit einem Schonlaken aus Kunststoff bezogen, der unter dem Bettlaken knisterte, wenn ich mich im Bett umdrehte. Mein Blick fiel auf einen Haken an der Wand, an dem mindestens zwanzig Halsketten hingen. Lange Ketten, mit dicken Steinen und den typischen Verschlüssen der Siebzigerjahre. Die verwaschene Bettwäsche, die Ketten und mehrere Liebesromane von Corín Tellado im Regal. In diesem Zimmer schien die Zeit stehen geblieben zu sein. Nur unsere Rollen waren vertauscht. Ich half Mariana beim Ausziehen, ließ sie sich aufs Bett setzen, hob ihre Beine an und legte sie auf das Laken. Dann deckte ich sie zu und breitete zuletzt die Tagesdecke über sie.
»Du hast deine Töchter und deinen Mann, Esther … pero yo sólo la tenía a ella …« Marianas Stimme klang erstickt vom Weinen und von der Tatsache, dass sie nur ihre Schwester im Leben hatte.
Ich schaute erneut zu den Ketten hinüber. Sie sahen aus wie eine Kletterpflanze, die sich an der Wand heraufrankte. Instinktiv griff ich nach einer Kette mit eckigen lachsfarbenen Steinen. Waren es Halbedelsteine? Harze? Der ungewöhnliche Verschluss war vergoldet. Die Kette gefiel mir sehr. Ich löste sie von den anderen.
»Die hat Alba gehört …« Mariana hörte auf zu weinen und putzte sich die Nase.
Ich zog sie mir über den Pyjama und ging zum Bett meiner Patentante hinüber.
»Möchtest du zu mir ins Bett kommen?«, fragte Mariana.
Ich dachte an meine Töchter, denen ich vor dem Einschlafen immer vorlas oder sie kitzelte.
»Nein … ich möchte nur hier bei dir sein.« Ich griff nach meiner Halskette; sie war nicht schwer, aber auch nicht ganz leicht. Steckte die Nase zwischen die Perlen, als röche ich an einem Parfüm. Langweilige Nachmittage mit der Familie beim Essen, meine Eltern, Mariana und Alba, auf dem Tellern callos a la madrileña, – das einzige Gericht, das Alba kochen konnte, und alle genossen die Kutteln auf Madrider Art, außer mir und Pablo – während der Plattenspieler die eindringlichen Lieder von Concha Piquer spielte. Diese Halskette war meine Kindheit. Sie enthielt die Gerüche, Geschmäcke und Laute von damals. Diese Perlen erzählten mein Leben und das von Mariana und Alba.
Ich redete meiner Patentante Mut zu, dass sie am nächsten Tag auf den Friedhof und auf den Moment vorbereitet und stark sein müsse, in dem Alba in der Grabstätte ihrer Eltern zur Ruhe gebettet werde.
»Hast du gehört, Mariana?«
»Wenn es so weit ist, musst du mir die Augen zuhalten. Yo no quiero verlo«, antwortete sie, brach erneut in Tränen aus und klammerte sich an mich. Wer will schon seine einzige Stütze im Leben im Grab sehen?
Die hängende Kette glitt über mein Pyjamaoberteil und fiel auf den Teppich.
»Sie schließt nicht mehr richtig, Esther. Wenn all das vorbei ist, solltest du sie zur Reparatur bringen.«
Ich löschte das Licht. Mariana hustete, als bekomme sie nicht richtig Luft. Als ich sie kurz darauf schnarchen hörte, wusste ich, dass sie eingeschlafen war. Und ich wusste auch, was ich mit der Kette machen würde.
Am nächsten Tag, als es Zeit wurde, zum Tanatorio zu fahren, begannen Marianas Augen zu glänzen, als sie sah, dass ich die Kette umgelegt hatte.
Zwanzig bis fünfundzwanzig in schwarz gekleidete Personen füllten den Raum. Die Wintersonne strahlte herzlich herein. Meine Eltern, Pablo, noch mehr Cousinen und Cousins, die es am Vorabend nicht geschafft hatten, anwesend zu sein, und die beiden Nonnen. Mein Weg durch die Menge wurde immer wieder von freundlichen Fragen und Begrüßungen unterbrochen, Verwandten, die mich seit Langem nicht mehr getroffen haben.
¿Qué tal?
¿Cómo ha pasado la noche?
Cuánto tiempo sin verte.
¿Sigues en Alemania?
Die beiden Nonnen wiesen mit dem Finger auf die Glasscheibe, die den Raum trennte, mit dem offenen Sarg und den Trauerkränzen dahinter.
Sie sahen mich irritiert an.