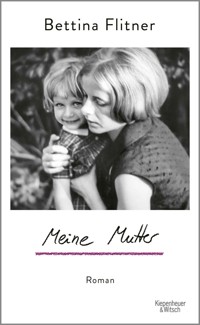
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Bettina Flitner für eine Lesung aus ihrem Buch »Meine Schwester« nach Celle zurückkehrt – dorthin, wo vor 40 Jahren ihre Mutter beerdigt wurde –, springen sie mit unerwarteter Heftigkeit Fragen an, die sie lange von sich fern gehalten hatte: Fragen nach dem großen Unglück im Leben ihrer Mutter und nach einer Familienkatastrophe in einer fernen Zeit und in einem fernen Land. Und so begibt sich Bettina Flitner auf eine Reise voller Überraschungen und Entdeckungen in den Luftkurort Wölfelsgrund im ehemaligen Niederschlesien, dem heutigen Międzygórze, wo ihre Vorfahren bis zur dramatischen Flucht 1946 ein Sanatorium besessen und geleitet haben. Aus den Erlebnissen ihrer Reise ins heutige Polen, den Tagebüchern und Dokumenten ihrer Familienmitglieder und ihren eigenen Erinnerungen an das Leben ihrer Mutter erschafft Bettina Flitner nicht weniger als ein literarisches Meisterwerk, einen hochspannenden Familienroman, der zugleich eine nachgetragene Versöhnung mit der eigenen Mutter ist und die erlösende Kraft des Erinnerns und des genauen Erzählens demonstriert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Bettina Flitner
Meine Mutter
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Bettina Flitner
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Bettina Flitner
Bettina Flitner ist 1961 in Köln geboren, wo sie auch heute wieder lebt. Sie startete als Filmemacherin, arbeitet aber nach ihrem Studium an der Film- und Fernsehakademie in Berlin als Fotografin. Oft kombiniert sie in ihren Arbeiten, die in vielen Galerie- und Museumsausstellungen gezeigt wurden, Fotografie und Text. Sie arbeitet u.a. für Zeitschriften (Stern, Emma, Cicero) und veröffentlichte zahlreiche Bücher. Zuletzt erschien im Elisabeth Sandmann Verlag ihr Bild-Textband »Väter & Töchter«.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Als Bettina Flitner für eine Lesung aus ihrem Buch »Meine Schwester« nach Celle zurückkehrt – dorthin, wo vor 40 Jahren ihre Mutter beerdigt wurde –, springen sie mit unerwarteter Heftigkeit Fragen an, die sie lange von sich fern gehalten hatte: Fragen nach dem großen Unglück im Leben ihrer Mutter und nach einer Familienkatastrophe in einer fernen Zeit und in einem fernen Land.
Und so begibt sich Bettina Flitner auf eine Reise voller Überraschungen und Entdeckungen in den Luftkurort Wölfelsgrund im ehemaligen Niederschlesien, dem heutigen Międzygórze, wo ihre Vorfahren bis zur dramatischen Flucht 1946 ein Sanatorium besessen und geleitet haben. Aus den Erlebnissen ihrer Reise ins heutige Polen, den Tagebüchern und Dokumenten ihrer Familienmitglieder und ihren eigenen Erinnerungen an das Leben ihrer Mutter erschafft Bettina Flitner nicht weniger als ein literarisches Meisterwerk, einen hochspannenden Familienroman, der zugleich eine nachgetragene Versöhnung mit der eigenen Mutter ist und die erlösende Kraft des Erinnerns und des genauen Erzählens demonstriert.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung Barbara Thoben, Köln
Covermotiv © Hugbert Flitner
ISBN978-3-462-31347-5
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Danksagung
Dieser Roman beruht auf Gesprächen mit meiner Familie sowie Freundinnen und Freunden meiner Mutter, den aufgeschriebenen Erinnerungen meines Vaters, meines Großvaters, meiner Urgroßmutter und meiner Großtante, auf Briefen, der Lektüre von Zeitdokumenten – sowie auf meinen eigenen Erinnerungen.
1
»Sie hat nie etwas getaugt.« Das sagte mein Großvater, als wir aus der Trauerhalle in die helle Märzsonne traten und hinter dem Sarg Richtung Familiengrab gingen. Sie, das ist meine Mutter.
Mein Vater, meine Schwester und ich waren am Morgen in den blauen Mercedes meines Vaters gestiegen und von Hamburg nach Celle gefahren. Mein Vater am Steuer, ich hinter meinem Vater, meine Schwester hinter meiner Mutter. Wie immer. Nur, dass der Platz meiner Mutter jetzt leer war. Sie war gestern mit einem grauen Beerdigungswagen vorausgefahren worden.
Wir fuhren auf der Allee, die wir immer nahmen, wenn wir früher zu unseren Großeltern fuhren. Die hohen alten Bäume entlang. Vorbei an den großen traditionellen Gehöften aus rotem Ziegelstein. Die weiten Felder dahinter. Wir werden gleich die ganze Verwandtschaft treffen: Api, den Vater meiner Mutter. Elisabeth, die Mutter meines Vaters. Onkel, Tanten, Cousinen und Cousins. Meine Großmutter Ami, die Mutter meiner Mutter, ist schon tot. Und sie alle werden uns anstarren und denken: Was für ein Schicksal.
Meine Schwester drehte sich zu mir und schaute mich mit zusammengekniffenen Augen an. Dann reichte sie mir eine schlaffe Hand, die ich automatisch ergriff, und sagte mit der heiseren Stimme von Onkel Faust: »Herzliches Beileid, mein Kind.« Ich musste lachen. Mein Vater murmelte: »Lasst das jetzt mal.« Wir aber konnten nicht anders. Wir mussten uns wappnen gegen das, was da kommen würde. Ich schaute aus dem Fenster. Der Mercedes glitt auf der asphaltierten Straße dahin. Wir hatten den Tod nicht kommen sehen.
Früher waren wir mit unserem alten VW-Käfer über das Kopfsteinpflaster gerumpelt. Früher, als meine Mutter noch da war, war sie es, die den Tod kommen sah, sie konnte das.
Es war auf einer unserer Fahrten auf dieser Straße zu meinen Großeltern nach Celle gewesen. Die Sonne stand tief, und die Bäume der Allee warfen lange Schatten auf die Straße. Hell dunkel hell dunkel. Da kam uns auf der Gegenfahrbahn ein Auto entgegen. Meine Mutter erkannte ihn gleich. Er saß reglos auf dem Beifahrersitz, den Blick starr nach vorne gerichtet. Er war ganz in Weiß gekleidet, mit einem weißen Tuch um den Kopf. Eine Art Turban, der sein Haar – hatte er überhaupt welches? – ganz verhüllte. Es war nur ein kurzer Augenblick, dann war er vorbei.
Das war der Tod, sagte meine Mutter ganz ruhig. Eine Sekunde lang war es still im Auto. Wir hatten ihn alle gesehen. Aber erst, als meine Mutter es aussprach, erkannten wir ihn. Ja, das war der Tod gewesen. Ich war acht Jahre alt und war dem Tod begegnet. Er hatte genauso ausgesehen, wie ich ihn mir immer vorgestellt hatte. Nur eins hatte mich ein bisschen enttäuscht: Der Tod hatte in einem orangefarbenen Ford Taunus gesessen. »Ein Ford Taunus«, lachte mein Vater, »da kommt er ja billig davon.«
Kurze Zeit später passierten wir eine Unfallstelle. Ein Motorrad lag auf der Seite. Der Krankenwagen kam gerade angebraust, und die Polizei stellte Sichtschutzwände auf. Langsam rollten wir vorbei. Ich blickte von hinten auf meine Mutter. Sie konnte so etwas sehen, manchmal. Das wollte ich auch können, damals.
Wir bogen jetzt in die kleine Sackgasse vor dem Celler Waldfriedhof ein, parkten den Wagen unter den noch kahlen Bäumen. Der Parkplatz war voll, die anderen waren schon da. Mein Vater drückte uns zwei Rosen in die Hand und nahm selber die dritte. »Da müssen wir jetzt wohl durch«, sagte er.
Wir betraten den Waldweg und gingen geradeaus, an den metallenen Wasserbecken vorbei, hinter denen kleine Schaufeln und Harken lagen und grüne Plastikgießkannen. Die waren für andere Menschen, die hier schon wohnten und deren Verwandten sich hier schon eingerichtet hatten. Ich wollte mich hier nicht einrichten.
Wir kamen auf dem Vorplatz der Trauerhalle an. Einige wenige standen noch vor der Tür. Tante Almut, eine Cousine meiner Mutter. Herr Blanke, ein Freund meines Großvaters, mit dem Monokel im rechten Auge. Und Jürgen, einer ihrer früheren Liebhaber. Alle anderen mussten schon drin sein, hinter dem roten Samtvorhang, der vor dem Eingang hing.
Jürgen. Ihn hatte ich seit vielen Jahren nicht gesehen. Schlank und elegant wie immer, in seinem Burberry-Trenchcoat und dem dazu passenden beige-braun karierten Kaschmirschal. Er stand vor der Tür der Kapelle mit einem geschmackvollen kleinen Frühlingsstrauß in der Hand. Mit solchen Sträußen hatte er früher vor unserer Haustür gestanden, wenn er meine Mutter besuchte.
»Warum?«, sagte Jürgen und schüttelte betrübt den Kopf. »Es ist doch unbegreiflich. So eine schöne Frau«. Almut schaute erst ihn an und dann auf den Frühlingsstrauß. »Vielleicht deswegen«, murmelte sie, kaum hörbar.
Wir standen, den Moment hinauszögernd, vor der Tür der Trauerhalle. Ich sah unser Spiegelbild in der Glasscheibe. Mein Vater links, mit leicht ergrauten Haaren, in einem schwarzen Anzug, seine Brillengläser waren in der Sonne dunkler geworden. Rechts meine Schwester mit blonden Locken, in einem hellen taillierten Mantel. Eine kleine schwarze Handtasche hing diagonal über dem Körper, als wäre meine Schwester mit einem Filzstift durchgestrichen. Und ich selbst zwischen ihnen, mit schwarz gefärbten kurzen Haaren, in brauner Lederjacke, schwarzen Jeans und Cowboystiefeln mit glänzenden Metallspitzen. Die hatte ich vor ein paar Tagen draufgehämmert.
Da standen wir mit blassen Gesichtern in der hellen Frühlingssonne und waren nur noch drei. Die Vierte, die hier sein müsste, war unsichtbar, verschwunden hinter der spiegelnden Fläche. Wir mussten da jetzt rein.
Mein Vater nickte uns zu, öffnete die Tür und schob den Samtvorhang beiseite. Wir betraten den dämmrigen Raum. Er war voll, jeder Platz schien besetzt zu sein. Es gab keine Fenster, nur runde Bullaugen ganz oben knapp unter der Decke, die auf uns herunterstarrten. Das unangenehme Gefühl eines untergehenden Schiffes.
Wir gingen auf dem Mittelgang über den roten Läufer, der wie eine lange gerade Blutspur auf dem Steinboden nach vorne zum Sarg führte, mein Vater links, meine Schwester rechts, ich in der Mitte. Überall saßen meine Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins und auch zwei meiner Großeltern. Die Köpfe schauten geradeaus, aber die Augen verfolgten uns bis zur ersten Reihe. Da blieben wir stehen und zögerten.
Wir hatten bei einer Beerdigung noch nie in der ersten Reihe gesessen. Onkel Heiner, der Bruder meiner Mutter, saß in der zweiten Reihe. Er nickte und wies mit dem Kinn auf die Bank vor ihm. Es fühlte sich an wie der kantige Befehl eines Bundeswehrobersts, der er ja auch war. Aber aus seiner viereckigen großen schwarzen Brille schauten riesenhaft vergrößerte Augen heraus, die Augen einer tieftraurigen Stubenfliege.
Wir nahmen Platz, mein Vater links von mir, meine Schwester rechts. In der ersten Reihe sitzt man nur, wenn man ein wichtiger Trauernder ist. Wenn man am traurigsten von allen ist. Aber das war ich nicht. Wenn es nach der Trauer gegangen wäre, hätte ich in der fünften oder sechsten Reihe sitzen müssen. Vielleicht sogar in der siebten oder achten. Ich saß hier vorne, aber in Wahrheit fühlte ich nichts. Meine Gefühle waren hinter einer dicken Panzerglasscheibe.
Ich schlug die Beine übereinander, gar nicht so einfach mit engen schwarzen Jeans. Die Lederjacke ließ ich geschlossen. Wir schauten nach vorne. Drei Meter vor uns stand der Sarg.
Da lag sie, zwischen zwei großen weißen Kerzen, dahinter der Altar. Vor ihr, an die steinernen Stufen gelehnt, standen Kränze. Mit weiß-goldenen Schleifen. Stiller Gruß, Lebe wohl, Ruhe in Frieden. Wie still kann ein Gruß sein? Kann man noch wohlleben, wenn man tot ist? Und kann man in Frieden ruhen, wenn man sich im Badezimmer erhängt hat?
»Die Mädchen haben sich ja um nichts gekümmert«, wisperte eine Tante hinter mir. Stimmt. Meine Schwester und ich hatten keine Scheiß-Kränze bestellt und »Ruhe sanft« druntergeschrieben. Ich verschränkte die Arme, meine Lederjacke knarzte.
Tante Gudrun, die Schwester meiner Mutter, setzte sich neben uns. Sie hatte sich meine Mutter kurz vorher noch mal angesehen, ihren Ärztinnen-Blick auf sie gerichtet. Sie sah ganz friedlich aus, hatte Tante Gudrun gesagt. Und dann war ihr schlecht geworden.
Meine Mutter war ohne ein einziges Wort verschwunden. Einfach abgehauen. Weg. Von einem Tag auf den anderen. Und jetzt lag sie da vorne und war plötzlich wieder da. Anwesend und abwesend zugleich. Eigentlich war das immer so gewesen. Ihre Anwesenheit wurde von ihrer gleichzeitigen Abwesenheit neutralisiert. Ich saß da, die Spitzen meiner Cowboystiefel glänzten im Schein der Kerzen. Hinten schnäuzte jemand in ein Taschentuch. Dabei hat es doch noch gar nicht angefangen, dachte ich.
Auf der großen Kerze vorne prangte ein rotes Wachskreuz mit der Jahreszahl, oben die 1 und die 9, unten die 8 und die 4. 1984. Eingerahmt von zwei Buchstaben, oben das Alpha, unten das Omega. Anfang und Ende. Zwei Klammern. Und dazwischen: 47 Jahre Leben. Ich werde nicht älter als 47, hat meine Mutter immer gesagt. Und dann hatte sie selber die Klammer geschlossen. Mit 47 Jahren.
Da steht immer noch eine Kerze, fast an der gleichen Stelle. Aber sie zeigt jetzt eine andere Jahreszahl. Oben die 2 und die 0, unten die 2 und die 3. 2023. 39 Jahre später. Gerade habe ich Platz genommen, in der ersten Reihe. Warum? Was will ich hier?
Ich hatte nicht vorgehabt, noch einmal hierherzukommen. Vor einer Stunde war ich in Celle angekommen, für eine Lesung aus meinem Buch »Meine Schwester«. Ich war viele Jahre nicht mehr hier gewesen, aber als die Anfrage kam, hatte ich sofort zugesagt.
Dann könnte ich noch mal in das Haus meiner Großeltern gehen, hatte ich gedacht und einen Zug früher genommen. Ein großer Teil des Buches spielt dort. Beim Schreiben hatte ich mir verboten, das Haus wiederzusehen, ich wollte mein inneres Bild nicht von dem aktuellen überlagern lassen. Doch jetzt, wo »Meine Schwester« erschienen war, war das doch ein guter Abschluss, oder? Und so hatte ich mich vor ein paar Wochen bei den drei Ämtern des Landkreises angemeldet, die ihre Büros in dem alten Haus eingerichtet hatten.
Als ich dann vor einer Stunde den Vorplatz des Celler Bahnhofes betreten hatte, stand da plötzlich der Bus Nummer 13 in Richtung Waldfriedhof, in die entgegengesetzte Richtung. Ich überlegte nicht lange und sprang hinein, durch die sich schließenden Türen. Fünf Stationen später war ich da.
Ich ging den gleichen Weg wie damals, an den metallenen Wasserbecken vorbei mit den grünen Gießkannen und den Harken. Und dann stand ich vor der Trauerhalle. Sie war da, unverändert.
In der Glastür sehe ich mein Spiegelbild in der hellen Märzsonne. Ja, es ist wieder März, wie damals. Und da stehe ich, allein. Meine Haare sind nicht mehr schwarz gefärbt, sondern haben ihre ursprüngliche Farbe, ein undefinierbares Aschblond, ich trage einen Regenmantel, die spitzen Cowboystiefel habe ich gegen weiche Sneakers eingetauscht. Ich drücke die Klinke herunter, die Tür ist abgeschlossen.
Der Gärtner lehnt seine Harke gegen den Baum. »Sagen Sie Bescheid, wenn Sie gehen«, sagt er, als er den Schlüssel im Schloss dreht. Ich schiebe den roten Vorhang beiseite, gehe über den Läufer nach vorne und setze mich in die erste Reihe. Und da bin ich jetzt, auf dem gleichen Platz wie damals.
Ich habe lange nicht mehr an sie gedacht. Schon kurz nach der Beerdigung hatte ich vergessen, wie sie aussah. Ich konnte mich einfach nicht mehr an ihr Gesicht erinnern. Es war wie ausgelöscht. In den Jahren, die folgten, machte ich keinerlei Anstrengungen, das zu ändern. Die wenigen Fotos, die ich von ihr gemacht hatte, steckten irgendwo in einer Schachtel, tief im Inneren meines Fotoschrankes.
Aber vor ein paar Monaten war etwas Seltsames passiert. An einem Morgen, als ich in Köln den Briefkasten meines Ateliers öffnete, lag dort ein großer brauner Umschlag. Auf der Vorderseite stand mein Name in geschwungenen Buchstaben, geschrieben mit türkisfarbener Tinte. Noch während ich die Eingangshalle des Atelierhauses durchquerte und die Treppe hochging, drehte ich den Umschlag um und sah auf den Absender. Der Stempel einer Fotografin aus Bonn. Eine Kollegin, die mir schreibt, dachte ich.
Ich schloss die Tür auf und legte den Brief auf den Tisch. Nachdem ich Kaffee gemacht hatte, setzte ich mich und riss den Umschlag auf. Ich schaute nur eine Sekunde hinein, dann ließ ich ihn auf den Tisch zurückfallen. Der Kaffee schwappte über den Tassenrand. Ich stand auf, öffnete das Fenster und schaute auf die herbstlichen Bäume. Auf die roten und gelben und braunen Blätter, die vorbeiflogen.
Nach einer Weile setzte ich mich wieder und griff erneut nach dem Umschlag. Zuoberst lag ein Brief, mit derselben türkisfarbenen Tinte geschrieben. »Diese Bilder habe ich 1982 gemacht.« Darunter vier Kontaktbögen und vier Filme. Ich zog die Bögen unter dem Brief hervor. 6 × 6, Mittelformat, Farbe.
Da ist meine Mutter. 1982, zwei Jahre vor ihrem Tod. Sie ist 45 Jahre alt. Ihr Haar ist so undefinierbar aschblond wie meins, schulterlang, Mittelscheitel. Die vorderen Strähnen sind mädchenhaft mit zwei Klammern rechts und links nach hinten gesteckt. Da ist ihre hohe Stirn, und ja, die großen blaugrünen Augen. Auf den Augendeckeln hellblauer Lidschatten, auf den Lippen rosa Lippenstift. So war sie geschminkt, seit ich denken kann.
Sie trägt Biedermeierohrringe und ein Medaillon um den Hals. Ich vermute, da ist ein Foto von Hermann drin, ihrem neuen Lebensgefährten. Das Foto im Foto. Meine Mutter hat ein blau-weiß gemustertes Kleid an. Sie ist offenbar bei der Fotografin zu Hause, im Hintergrund ist eine Tapete im Empirestil zu sehen, eine Biedermeierkommode, gerahmte Bilder mit unbekannten Menschen.
Meine Mutter posiert, aber es ist deutlich zu erkennen, was für eine Mühe sie das kostet. Sie schaut die Fotografin nicht an, sie schaut durch sie hindurch. Meine Mutter sitzt auf einem Stuhl, sie steht auf einer Terrasse, sie lehnt an einer Wand. Aber sie hat keinen Halt. Auf keinem der Fotos scheint sie da zu sein. Sie sieht aus, als sei sie der Welt und sich selber verloren gegangen.
Warum hat sie sich fotografieren lassen? Für wen? Oder wollte sie sich nur versichern, dass sie da ist? Ich sah mir jedes der 26 Fotos lange an. Ja, so sah sie aus. Und ja, ich wollte es damals nicht mehr sehen. Ich konnte ihren Schmerz nicht mehr mittragen. Ich wollte ihn nicht mehr mittragen.
Ich holte die Fotos meiner Schwester hervor. Ich hatte sie ein paar Monate, bevor auch sie sich das Leben genommen hatte, fotografiert, vor sechs Jahren. 33 Jahre nach meiner Mutter, fast auf den Tag genau. Ich legte sie neben die Fotos meiner Mutter. Meine Schwester strahlt mich an, meine Mutter hingegen schaut mit einer radikalen Traurigkeit in die Kamera der anderen Fotografin. Aber beide wirken seltsam durchsichtig, als ob sie sich allmählich in der Umgebung auflösen würden. Meine Mutter, meine Schwester. Was ist eigentlich passiert? Warum? Wo ist der Ursprung für das alles?
Hinter mir knarrt eine Bank, als hätte sich jemand gesetzt. Ich drehe mich um, die gläserne Eingangstür der Trauerhalle steht auf, der rote Vorhang bauscht sich im Wind. Aber da ist niemand. Alles ist leer.
Damals war es voll, bis auf den letzten Platz besetzt. Da saßen wir, mein Vater, meine Schwester und ich. Und da war sie. Allein. Wir und sie. Das war schon lange so. Hinter uns war Onkel Konrad, mit langen Haaren und Schnäuzer, Lehrer und Künstler, der jüngste Bruder meiner Mutter. Daneben Onkel Rudolf, der zweitjüngste Bruder, Forscher, aus den USA angereist.
Hinter mir Onkel Heiner, ihr ältester Bruder, der Bundeswehroberst mit den riesigen Traueraugen. Daneben ihre Cousine, Tante Almut. Und ganz dahinten Herr Blanke mit dem Monokel im rechten Auge. Auf der anderen Seite, in der ersten Reihe, Api, ihr Vater, mein Großvater. Api hatte den Stock vor sich aufgestellt und schaute nach unten auf den Boden. Links neben ihm saß Elisabeth, die Mutter meines Vaters. Auf der anderen Seite Hermann. Meine Mutter und Hermann hätten im April, nach der Scheidung von meinem Vater, heiraten sollen. Er war ihr zukünftiger Mann. In einer Zukunft, die es nun nicht mehr gab.
Die letzten Töne einer Orgelmusik verklangen. Dann war Stille. Mein Vater, meine Schwester und ich saßen da, alle schwiegen, und wir schwiegen auch. Wenn viele schweigen, ist das Schweigen lauter. Das Schweigen hing wie eine Bleidecke über uns, eine Bleidecke an einem Bindfaden. Meine Schwester pikste mich in die Seite. Das Piksen schien das einzig Richtige zu sein. Viel richtiger als diese verordnete Andächtigkeit. Ich pikste zurück.
Der Pfarrer räusperte sich und begann zu sprechen. Er trug einen schwarzen Talar, am Hals ein weißes Beffchen und stand links vor dem Sarg. Er hatte ein paar Tage zuvor bei meinem Vater angerufen. Zunächst hatte er sein Beileid ausgesprochen. Dass es immer eine Lücke hinterlässt, wenn ein geliebter Mensch von uns gegangen ist. Und dann war er geschäftlich geworden. Ich brauche noch ein paar Eckdaten, hatte er gesagt. Eckdaten. Da sollte jetzt irgendwie Ordnung rein.
Mein Vater hatte im Wohnzimmer gesessen, die Sterbeurkunde lag auf dem Tisch. Gisela Elfriede Helene Annemarie, am 23. März 1984 gegen 9 Uhr 30 Minuten in Hamburg verstorben. Geboren am 6. Juli 1936 in Wölfelsgrund, Kreis Habelschwerdt.
Da stand nicht, dass sie einen Biedermeierstuhl ins Badezimmer getragen hatte, nachdem Hermann das Haus verlassen hatte. Da stand nicht, dass sie den Stuhl neben die Wandheizung gestellt hatte. Da stand nicht, dass sie den Gürtel ihres Bademantels genommen und um ihren Hals gelegt hatte. Da stand nicht, dass sie den Gürtel an der Heizung festgebunden hatte. Da stand nicht, dass der Biedermeierstuhl umgefallen und auf der Seite liegen geblieben war.
Mein Vater gab die Eckdaten durch.
Wenige Monate zuvor hatte er genauso hier im Wohnzimmer gesessen und mit meiner Mutter telefoniert. Ich hatte ihn im Sessel sitzen sehen mit dem Telefonhörer am Ohr. Nur aus seinen Antworten reimte ich mir zusammen, was da gerade verhandelt wurde. Meine Mutter wollte offenbar zu meinem Vater zurückkehren. Sie war mit Hermann vor wenigen Monaten nach Hamburg gezogen. Hermann hatte einen hohen Posten in der Wissenschaftsbehörde und war durch eine Laune des Schicksals der Vorgesetzte meines Vaters geworden, der Kanzler der Universität war.
Vor Kurzem hatten meine Mutter und mein Vater einer Scheidung zugestimmt, etwas, was sie beide eigentlich nicht wollten. Aber kurz nach Hermanns Berufung hatte der Bürgermeister bei ihm angerufen. Er könne nicht mit der Ehefrau eines anderen Mannes zusammenleben. Das würde Gerede geben. Also war der Scheidungstermin auf April festgelegt worden.
Warum aber wollte meine Mutter Hermann jetzt so kurz vor der Hochzeit verlassen? Hatte er eine Neue? Mein Vater hing an dem beigen Spiralkabel des Telefonhörers und schaute auf den gleichen Tisch, auf dem ein paar Monate später die amtliche Sterbeurkunde liegen würde. Ich holte meinen Fotoapparat und machte ein Foto von ihm, wie er mit meiner Mutter telefoniert. Das letzte gemeinsame Foto meiner Eltern.
Als er aufgelegt hatte, schaute er mich an. »Soll ich sie zurücknehmen?«, fragte er. Er hatte inzwischen eine neue Freundin, eine Frau mit zwei kleinen Töchtern, die im Obergeschoss des Hauses wohnten. Zurücknehmen. »Wie soll das gehen«, sagte ich. Mehr eine Feststellung als eine Frage. Mein Vater schwieg. »Ihr hättet euch schon viel eher trennen sollen, 15 Jahre früher. Und das soll jetzt wieder von vorne losgehen?« Er hatte mir zugeschoben, das auszusprechen, was er nicht sagen wollte. Er schwieg. Dann sagte er: »Sie tut mir leid.« Wir wussten nicht, warum meine Mutter zurückkommen wollte. Darüber hatte sie kein Wort verloren. Wir und sie.
Die Sargträger waren gekommen. Sie stellten sich rechts und links von meiner Mutter auf, nahmen ihre Mützen ab und verbeugten sich. Eine Geste, die mir so unaufrichtig schien wie die verordnete Stille. Ich betrachtete ihre dunkelroten Gesichter. Das kommt vom Grabschaufeln, dachte ich, oder vom Saufen. Oder von beidem. Ich pikste meine Schwester, sie pikste zurück.
Die Sargträger hoben meine Mutter auf einen Wagen, dann öffneten sie die beiden Flügeltüren der Trauerhalle. Mit einem Mal flutete die Sonne herein, und ein plötzliches grelles Licht erleuchtete die Szene im Gegenlicht. Ich schloss die Augen. Aber das Nachbild blieb. Das Bild des Sarges und der sechs Männer erschien als Negativ auf meiner Netzhaut. Ein heller Sarg und sechs helle Gestalten, drei rechts, drei links, in einer tiefschwarzen Landschaft.
»Sie hat nie etwas getaugt«, sagte Api, der Vater meiner Mutter, zu Elisabeth, der Mutter meines Vaters, als wir hinter dem Sarg Richtung Familiengrab gingen. Das sagte er wirklich, in diesem Moment.
Ich sah uns für einen kurzen Augenblick von außen. Der mit Kränzen und Blumen geschmückte Sarg. Dahinter wir, mein Vater, meine Schwester und ich, drei blasse Gestalten in der hellen Frühlingssonne. Und dann ein langer Zug schwarz gekleideter Menschen.
Der Weg war kurz, und schon standen wir vor der mit grünem Filz ausgeschlagenen Grube. Nebenan lagen schon meine Großmutter Ami und meine Urgroßmutter Mamazel, die Mutter von Api. Und da war ein Stein für Walter, den ältesten Bruder meiner Mutter. Der lag nicht wirklich hier, sondern irgendwo auf einem Acker in Pommern.
Mein Vater, meine Schwester und ich standen neben dem offenen Grab und wurden von der Familie umarmt, von Tanten und Onkeln, von Cousinen und Cousins. Onkel Faust reichte uns eine schlaffe Hand und sagte mit seiner heiseren Stimme: »Herzliches Beileid, mein Kind«, und meine Schwester pikste mich wieder in die Seite. Dann hatten wir es überstanden.
Ich schaue auf das Handy, es ist schon fast 15 Uhr. Ich muss jetzt wirklich los. Erst noch ins Haus meiner Großeltern und dann ins Hotel. Ich will für die Lesung heute Abend noch ein paar Stellen ändern, mehr Celle reinnehmen. Das hatte ich eigentlich schon im Zug machen wollen. Und dann? Hatte ich aus dem Fenster geschaut und die flache Landschaft mit den alten Bauernhöfen aus rotem Backstein vorbeiziehen lassen. Die alten Alleenstraßen mit den hohen Bäumen. Hell dunkel hell dunkel hell. Ich verlasse die dunkle Trauerhalle und trete hinaus in das helle Licht der Märzsonne.
Eigentlich hatte ich mich bei der Personalabteilung im Nebenhaus anmelden sollen, aber als ich jetzt vor der Tür stehe, drücke ich einfach den Knopf der runden Messingklingel meiner Großeltern, der immer noch da ist, ausgemustert und ein bisschen beleidigt, wie mir scheint, neben der modernen Klingelanlage. Es ertönt das vertraute durchdringende Bellen, und ich höre eilige Schritte die Treppe herunterkommen, auch das war immer so gewesen. Eine Frau öffnet die Tür. Sie empfängt mich so herzlich, dass ich meine Anmeldung in der Personalabteilung vergesse.
An der Haustür ist noch der gleiche Türknauf, dieselbe schmiedeeiserne Blume vor dem kleinen Türfenster mit der geriffelten Milchglasscheibe, dieselben dunkelgelben Fliesen auf dem Eingangsboden. Im Flur das gleiche geschwungene Treppengeländer. Das gleiche Knarzen der dritten Stufe von unten. Die eingebauten Küchenschränke in der ersten Etage haben noch die gleiche Farbe, Elfenbein. Der Schnitt der Zimmer ist unverändert, nur die Einrichtung ist anders, nüchterne Arbeitsräume mit Schreibtischen und Terminkalendern. Lass dich von den Bürostühlen und Flachbildschirmen nicht täuschen, flüstert mir das Haus unter seiner Bürokostümierung zu, ich bin’s. Ich bin noch da.
Im Esszimmer, wo Hedi, die lebenslange Haushälterin meiner Großeltern, einst Kassler mit Sauerkraut servierte, ist jetzt der Natur- und Landschaftsschutz. Die Küche ist Kopierraum. Und im Schlafzimmer von Mamazel, meiner Urgroßmutter, in dem rechts am Fenster die Frisierkommode mit der silbernen Toilettengarnitur stand, sitzt nun das Jugendamt. Aber die beste Neubesetzung hat eindeutig das Arbeitszimmer von Api. Dort, wo früher der respektheischende schwere Eichenschreibtisch des Familienpatriarchen den Raum einnahm, ist die Gleichstellungsbeauftragte eingezogen. Manchmal hat das Schicksal wirklich Humor.
Die Frau, die mich so herzlich empfangen hatte, ist die Gleichstellungsbeauftragte. Nach einem kurzen Rundgang sind wir wieder unten in Apis Arbeitszimmer angekommen. »Der Kaffee kommt gleich«, ruft sie und verschwindet nach nebenan. Ich setze mich. Hier standen früher die Sessel mit dem kratzigen Bezug, auf denen meine Schwester und ich saßen, während Api die Odyssee vorlas.
Da hatte der Papierkorb gestanden, den meine Schwester und ich eines Nachmittags mit selbst gebastelten Zigaretten in Brand gesetzt hatten. Am Abend hatten wir dann die mit meiner Großmutter Ami am Nachmittag eingeübte Entschuldigung aufgesagt. Wir hatten uns in einer Reihe aufgestellt und gerufen: »Api, wir entschuldigen uns.« An all das hatte ich mich erinnert, als ich das Buch »Meine Schwester« schrieb.
Ja, ich habe versucht, den Suizid meiner Schwester in einem Buch zu verarbeiten. Aber jetzt war auch mal gut. Genug über die Vergangenheit nachgedacht, nun geht’s wieder in die Gegenwart. Ich bin Fotografin. Und für ein Foto zählt das, was in diesem Moment geschieht, in diesem Augenblick. Oder? Ist nicht auch der Moment, in dem man den Auslöser drückt, immer begleitet von einem Davor und einem Danach? Von dem Wissen, dass diese für eine 60stel Sekunde festgehaltene Gegenwart im gleichen Augenblick schon Vergangenheit ist? Erst später wird dieser aus dem Strom gefischte Moment zu einer Markierung. Zu einem Kilometerstein am Fluss.
Nebenan klappern die Tassen, der Kaffee der Gleichstellungsbeauftragten ist gleich fertig. Ich stehe auf und gehe zum Fenster. Draußen scheint die Sonne auf die Trift, diese Grünanlage, die schon immer da war. Die ersten Krokusse kommen raus. Unterm Fenster der nahezu unveränderte Vorgarten von Ami und Api, der gleiche schmiedeeiserne Zaun, früher hellblau, jetzt grün. Der Ausblick hat sich nicht verändert. Den hatte ich als Kind so gesehen und meine Mutter seit ihrer Jugend.
Als wir damals nach der Beerdigung im Haus zusammengekommen waren, war ich auch in dieses Zimmer gegangen, es war der einzige Raum, in dem niemand war. Eine Etage über mir, im Esszimmer, waren lange Tafeln aufgebaut worden, man hörte seltsam fröhliche Stimmen und das Rücken von Stühlen. Die Teller klapperten, Frau Lindewedel und Frau Burgwedel servierten in ihren weißen Schürzen Hühnersuppe. Frau Lindewedel und Frau Burgwedel wurden seit 1950 für alle Gesellschaften meiner Großeltern gebucht, also auch für die Beerdigungsfeier meiner Mutter.
Auch damals stand ich hier am Fenster und sah hinaus. Die Schiebetür zum Nachbarraum war leicht geöffnet. Da nahm ich leises Stimmengemurmel wahr und drehte den Kopf. Durch den schmalen Spalt sah ich Tante Ulrike und Hermann, den Fast-Ehemann meiner Mutter, eng zusammensitzen. Sie bemerkten mich nicht, so sehr waren sie ins Gespräch vertieft. »Sie sah so wunderschön aus«, sagte Hermann in diesem Augenblick. »So hübsch zurechtgemacht. Und sie hatte ihren schönsten Schmuck an.«
So hübsch zurechtgemacht, ja, das hatte er damals gesagt. Es hatte mich schockiert, ich hatte das nicht wissen wollen. Jetzt stehe ich hier, 39 Jahre später, und schaue in das gleiche Zimmer durch die gleiche Schiebetür, die jetzt halb geöffnet ist. So wunderschön. So zurechtgemacht. Blauer Lidschatten, rosa Lippenstift, die vorderen Strähnen ihrer Haare rechts und links mit Spangen nach hinten gesteckt. Blau-weiß gemustertes Sommerkleid, Biedermeierohrringe, Medaillon.
So hatte ich sie gerade gesehen, auf den Kontaktbögen der Fotografin. Auf den Fotos der Bonner Kollegin sah sie exakt so aus. Genauso, wie Hermann sie aufgefunden hatte, die gleiche Kleidung, der gleiche Schmuck. Meine Mutter war so gestorben, wie sie sich zwei Jahre zuvor hatte fotografieren lassen. Wie lange hatte sie das schon geplant?
»Kaffee und Kuchen!«, ruft die Gleichstellungsbeauftragte und lacht. Sie balanciert das Tablett durch den Raum und stellt es auf dem Tisch ab. Es sind noch zwei Kolleginnen dazugekommen. Wir sitzen um einen großen Tisch herum, mit Baumkuchen und Bienenstich. »Das muss doch seltsam für Sie sein, wieder hier zu sein«, sagt die Gleichstellungsbeauftragte und schaut mich freundlich forschend an. »Och«, höre ich mich aufgeräumt sagen, »schöne Erinnerungen.« Wir machen zu viert ein Selfie, die halb geöffnete Schiebetür im Hintergrund.
Dann gehen wir auf den Dachboden. In Hedis Zimmer ist noch die gleiche grau-weiß gestreifte Tapete. Hedi war seit 1912 in der Familie, erst Dienstmädchen und dann auch Kinderfrau von allen: von meiner Großmutter und deren Geschwistern, von meiner Mutter und deren Geschwistern. Und in den Ferien auch von uns, meiner Schwester und mir. Als meine Großmutter heiratete, bestand Hedi darauf, sie von nun an zu siezen.
Hedi hatte nie geheiratet, ihr Verlobter war im Ersten Weltkrieg geblieben. So sagte man, und für mich als Kind schien er damit auf immer und ewig im Krieg. Hedis Verlobter lag seit 1915 hinter irgendeinem Sandsack und schoss. Hedi war in der Familie geblieben, ihr ganzes Leben lang. Erst mit Anfang 80 ging sie in Rente und zog zu ihrer Nichte nach Freiburg.
Hedi war klein und dünn, hatte eine glatte, weiche, ganz helle Haut und roch nach Veilchen. Wir wollten sie ständig umarmen, aber Hedi hielt uns immer ein wenig auf Abstand. Hedis ganzes Zimmer roch nach Veilchen. Wenn sie am Sonntag mit Kostüm und Hut in die Kirche ging, öffneten meine Schwester und ich, sobald wir unten die Haustür zufallen hörten, sofort die Tür von Hedis Zimmer und steckten unsere Köpfe durch den Spalt. »Aber immer nur ein Mal«, ordnete meine große Schwester an, »sonst riechen wir alles weg.« Dann atmeten wir einmal tief ein. Und schlossen die Türe wieder.
Den Gang hinunter, da ist das Zimmer, in dem meine Mutter und ihre Schwester Gudrun wohnten. Es war auch das Zimmer, in dem meine Schwester und ich schliefen, wenn wir unsere Großeltern besuchten. Klein, gerade Platz für zwei Betten. Hier hat unsere Großmutter Ami abends an der Tür gestanden und mit ihrer von vielen HB-Zigaretten rauchigen Stimme gesungen. Erst bei meiner Mutter, dann bei uns. »Guten Abend, gut’ Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, schlüpf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will…«
Und wenn er mal nicht will?, hatte ich jeden Abend gedacht und beunruhigt über meine Bettdecke hinweg auf den dunklen Umriss meiner Großmutter geschaut, die im Gegenlicht in der halb geöffneten Tür stand. Wenn sie die Tür leise schloss, in der friedlichen Gewissheit, meine Schwester und mich in den Schlaf gesungen zu haben, lag ich da, hellwach, mit pochendem Herzen.
Jetzt stehe ich an der halb geöffneten Türe und sehe in den Raum hinein. An die Decke klammert sich immer noch dieselbe kegelförmige Lampe aus gefaltetem Plastik. Sie hatte schon auf meine Mutter hinuntergeschaut, wenn sie abends im Bett lag, und dann auf uns.
Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt sich viel Zeit und führt mich in dem ganzen Gelände herum. Der Garten meiner Großeltern ist jetzt ein Parkplatz, nur der alte Baum steht noch da, wo früher die Garage war und gegen den mein Großvater in schöner Regelmäßigkeit den zunehmend verbeulten BMW setzte. Die Ausfahrt, an der das zerknautschte Schild »Arztausfahrt, bitte freihalten« hing, ist zugemauert. Nebenan war die Wohnung des Landrates, gediegenes großbürgerliches Ambiente.
Auf dem Rückweg schauen wir in eines der Büros hinein. Die Frau hinter dem Schreibtisch sieht auf, als sie meinen Namen hört. »Für Sie ist heute ein Brief angekommen.« Ein Brief? Für mich? Wer sollte mir hierher schreiben? Es weiß doch niemand, dass ich da bin. »Ach nein«, sagt die Frau dann, »der Vorname war ein anderer. Er lautete Gisela.«
Ein Brief für meine Mutter? 39 Jahre nach ihrem Tod? Und der kommt heute an? Ausgerechnet heute? Ausgerechnet jetzt? »Wo«, frage ich, »ist dieser Brief?« »Den habe ich an die Poststelle zurückgegeben«, sagt die Frau. »Er geht an den Absender zurück.« Sie schaut auf die Uhr. »Aber wenn Sie sich beeilen, kriegen Sie ihn vielleicht noch, die haben noch drei Minuten auf.«
Wir rennen über den Hof in das Nachbargebäude. Die Poststelle hat schon den Rollladen heruntergezogen. Ich hämmere an die Glastür. Da ist ein Schatten. Ein Schlüssel dreht sich im Schloss, eine Frau schließt uns auf. Der Brief ist noch da. Ein weißer Umschlag, adressiert an meine Mutter, an die Adresse ihrer Eltern. Darauf der frische Stempel des Landkreises Celle: Unbekannt verzogen!
Ich reiße den Umschlag auf. Der Brief ist von der Deutschen Bank. Sie informiert meine Mutter über die Änderungen des Einlagensicherungsfonds. Meine Mutter hatte ein Konto auf die Adresse ihrer Eltern. Warum? Seit wann?
Am nächsten Morgen stehe ich auf Gleis 6 des Celler Bahnhofes. Die Lesung gestern war ausverkauft, die Stimmung gut. Jetzt warte ich auf den Zug nach Hannover. Der Brief an meine Mutter ist in meiner Tasche. Er war in dem einzigen Moment angekommen, in dem er mich erreichen konnte. Nur an diesem Tag, in diesem Augenblick konnte er am Ziel ankommen. Aber ich bin ja gar nicht das Ziel. Oder doch?
Der Zug hat Verspätung, was sonst. Ich setze mich auf die Bank von Bahnsteig 6, ziehe den Brief aus der Tasche und rufe bei der Deutschen Bank an, Serviceline für Nachlassangelegenheiten. Und tatsächlich geht da jemand ans Telefon. »Ja, das ist ein Sparbuch«, sagt die Frau am anderen Ende, »aber da war ja schon lange keine Bewegung mehr drauf. Wir nennen das ein nachrichtenloses Konto.« Nachrichtenlos.
»Seit wann existiert es?«, frage ich. »Moment«, sagt die Stimme, und dann klickt es ein paarmal, »seit dem 1.1.1930.« »Das kann nicht sein, da war sie noch gar nicht geboren.« »Auf jeden Fall schon sehr lange, dann hat der Computer wohl einfach ein Datum eingesetzt.« »Und wie viel ist da drauf?« »Das darf ich Ihnen nicht sagen.« »Ungefähr?« »Reich werden Sie nicht, knapp unter 70 Euro.« Warum hatte meine Mutter dieses versteckte Konto, ausgestellt auf die Adresse ihrer Eltern? Und seit wann? Was war das für eine merkwürdi… »Hallo?«, ruft es durch das Telefon. »Ja«, sage ich, »ich bin noch dran.« »Sie können mit der Sterbeurkunde in jede Filiale gehen und das Konto auflösen.«
Ich schaue über die Gleise auf die Stadt. Vor mir liegen Gleis 4 und 5, wo sich gerade zwei Züge kreuzen. Der eine von links, der andere von rechts. An allen französischen Bahnübergängen hängen Warnhinweise: Attention! Un train peut en cacher un autre. Achtung! Ein Zug kann einen anderen verdecken. Ich hatte ein Buch über meine Schwester geschrieben. Und jetzt taucht hinter ihr meine Mutter auf.
Sie ist schon so lange weg. Und es ist schon so lange vorbei, erledigt, ad acta gelegt. Meine Mutter, unbekannt verzogen, nachrichtenlos. Seit 39 Jahren. Und nun? Meldet sie sich plötzlich wieder. Ist mit einem Mal auf eine seltsame Weise wieder da. Erst die Fotos der Bonner Fotografin. Und nun der Brief.
Gestern hatte ich mit entfernter Vertrautheit ihren Namen gelesen, in Stein gehauen, auf dem mit Moos überwachsenen Grabstein. Heute steht er ganz gegenwärtig auf diesem Brief, der vor ein paar Tagen aus dem Computer der Deutschen Bank gespuckt wurde. Der Name, der 47 Jahre lang von jemandem getragen wurde, der meine Mutter war.
Der Zug fährt in den Celler Bahnhof ein. Wer war sie? Was weiß ich von ihr? Und warum habe ich sie vergessen? Ein Zug kann einen anderen verdecken. Vielleicht sollte ich das alles nicht als Zufall verstehen. Vielleicht ist es jetzt der richtige Moment. Aber





























