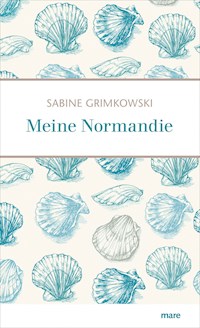
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Während all ihre Bekannten in die Bretagne fuhren, zog es Sabine Grimkowski schon vor zwanzig Jahren in die Normandie. Dort suchte sie »nichts Präzises, eher etwas Atmosphärisches«. Sie wandelte auf den Spuren von Marcel Proust, der im Grand Hôtel von Cabourg an seiner »Suche nach der verlorenen Zeit« schrieb, von Marguerite Duras, die mit ihrem Geliebten Yann Andréa ihre letzten Jahre im Hôtel des Roches Noires am Strand von Trouville verbrachte, von Nouvelle-Vague-Klassikern. Auf ihren Streifzügen zwischen Pont-Audemer und dem Mont-Saint-Michel, zwischen Étretat und Lisieux fand die Autorin aber noch viel mehr: eine zweite Heimat im Hôtel des Roches Noires, eine ungewöhnliche Liebe, schimmernde Jakobsmuscheln, Freundschaften fürs Leben, besondere Flohmarktschätze, fast einen Hund – und nicht zuletzt ihre literarische Figur Kommissar Leblanc, den Helden ihrer Normandie-Krimis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sabine Grimkowski
Meine Normandie
© 2022 by mareverlag, Hamburg
Karte Peter Palm, Berlin
Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag
Coverabbildung Irina Molochnaia / Alamy Stock Vector
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-807-6
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-652-2
www.mare.de
Inhalt
Madame Colette
Auf der Suche nach Marcel Proust
Hôtel des Roches Noires
Ein Haus mit Vergangenheit
Jean
Gestundete Zeit
Ein aschkenasischer Jude mit Pariser Akzent
Bric-à-Brac
La mer
Fast ein Hund
Ein unwiderstehlicher Gentleman
Der kleine Albert und der Mont-Saint-Michel
Schlangen und Drachen
Manga in Bayeux
Kommissar Leblanc
Madame Colette
Wo willst du hin? In die Normandie?«, fragten Freunde mit unverhohlener Verständnislosigkeit, als ich ihnen von meinem Plan erzählte. Alle Welt, zumindest die deutsche, fuhr, wenn es Frankreich sein sollte, in die Bretagne. Warum also die Normandie? Ich hatte mich gerade länger mit Marcel Proust beschäftigt und wollte mir sein »Balbec« ansehen, Cabourg und das Grand Hôtel, in dem er in den Sommermonaten zwischen 1907 und 1914 an seinem großen Werk, der Recherche, schrieb. Und wenn schon Normandie, dann auch Trouville und das Hôtel des Roches Noires, wo Marguerite Duras, deren Bücher und Filme zu einem früheren Zeitpunkt eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hatten, ihre letzten Jahre verbrachte. Und Deauville, wo Claude Lelouch in seinem Nouvelle-Vague-Klassiker Ein Mann und eine Frau die schöne Anouk Aimée und den jungenhaften Jean-Louis Trintignant in langen Einstellungen über den scheinbar endlosen Strand laufen lässt.
Diese Normandie suchte ich, den Ort der Literaten und Filmemacher, nichts Präzises, eher etwas Atmosphärisches. Bilder geisterten durch meinen Kopf, und ich hätte nicht sagen können, ob sie tatsächlich von Fotos und aus Filmen stammten oder meiner Fantasie entsprungen waren. Was erwartete ich? Eine Marguerite-Duras-Normandie vorzufinden, in der die Zeit stehen geblieben war? Oder meine eigene jugendliche Begeisterung wiederzuentdecken, mit der ich in den Siebzigerjahren die neue Welle, die aus Frankreich heranrollte, begrüßte? Oder glaubte ich, in Cabourg, Prousts »Balbec«, auf Spuren des 19. Jahrhunderts zu stoßen? Wahrscheinlich ein bisschen von allem. Mir scheint, ich denke erst jetzt, beim Schreiben, über meine Beweggründe nach. Damals, vor zwanzig Jahren, gab ich, ohne zu überlegen, einfach einem Wunsch nach, einem Impuls, den die Lektüre eines Romans ausgelöst hatte, in dem Erinnerung und Vorstellung über die Wirklichkeit triumphieren. Die Vorstellung an der Wirklichkeit zu messen oder beide in ein Verhältnis zueinander zu bringen, ist ein schwieriges Unterfangen. Häufig stellt sich Enttäuschung ein, manchmal Verwunderung, seltener glückliche Überraschung. Ob ich damals auch nur einen Moment an das Risiko dachte, desillusioniert zu werden, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass mein Kopf angefüllt war mit Bildern, die Gelesenes oder Gehörtes bei mir ausgelöst hatten und die wie Sedimente aus verschiedenen Phasen meines Lebens in mir aufgeschichtet waren. Diesen Bildern wollte ich nachgehen.
Im Mai 2001 nahm ich an der Gare Saint-Lazare in Paris den Zug nach Trouville. Diese Eisenbahnstrecke hat auch Marcel Proust genutzt, als er in die Normandie fuhr, und vor ihm viele andere Pariser und Wahl-Pariser. Bereits 1837 wurde in der Nähe des jetzigen Bahnhofs für die erste Eisenbahnlinie in den Westen Frankreichs eine Station konstruiert, und 1867 besaß die Gare Saint-Lazare annähernd ihre heutige Gestalt. Claude Monet hat auf seinem Gemälde von 1877 eine wild dampfende, in die Bahnhofshalle einfahrende Lokomotive verewigt. Und auf einem Bild des Kollegen Pissarro, das sechzehn Jahre später entstanden ist, lässt sich ein enormer Auftrieb von Kutschen auf dem Bahnhofsplatz beobachten. Um die Jahrhundertwende hatte sich bereits, begünstigt durch die Entstehung luxuriöser Hotels, ein lebhaftes Badeleben an der normannischen Küste entwickelt. Der Zug brauchte damals von Paris etwa fünf Stunden, heute weniger als die Hälfte.
Im Jahr 2001 trug die Bahnhofshalle noch nicht die Zeichen der Umwandlung in einen mehrstöckigen Konsumtempel, der mittlerweile alle Bahnhöfe unterliegen. Sie hatte schon bessere Tage gesehen, aber es war alles für die Reise Notwendige vorhanden, ein Stand mit Croissants und Sandwiches, ein Kiosk mit Zeitungen und Zeitschriften, ein Café. Der Zug, der morgens und abends Pendler in die Hauptstadt bringt, war auf der Gegenstrecke am Mittag fast leer. Als er die Pariser Vororte hinter sich gelassen hatte, nahm er Kurs gen Westen, immer südlich der Seine entlang, die sich wie eine Schlange in zahlreichen Windungen auf ihre Mündung bei Le Havre zubewegt.
Die erste normannische Station ist Évreux. Bis dahin bietet die Landschaft keinen herausragenden Anblick, Felder, Wiesen und Hecken wechseln sich in schöner Eintönigkeit ab. Erst vor Lisieux wird sie waldreicher und etwas hügeliger. In Lisieux thront die Basilika, weithin sichtbar, über der Stadt. Sie ist der heiligen Thérèse gewidmet, die sich der Hingabe an Gott verschrieb und in ihren Gebeten Fürbitte für die Hilfesuchenden hielt. Einige der Bitten sollen in Erfüllung gegangen sein, weshalb sie schon zu Lebzeiten als Heilige verehrt wurde. Mit vierundzwanzig starb die Gottesfürchtige an Tuberkulose. Ein früher Tod trägt bekanntlich zur Entstehung eines Mythos bei, und Thérèses Grab und die Basilika gehören zu den beliebten Pilgerorten von Gläubigen und Wünschenden. Ich kenne Thérèse aus Joseph Roths traurigem Roman Die Legende vom heiligen Trinker, in dem all das Wunderbare, das ihm geschieht, den Helden nicht dazu bringen kann, seine Trunksucht zu überwinden. Wahrscheinlich können Wunder nur dann ihre Wirkung entfalten, wenn man sie nicht nur herbeisehnt, sondern auch fest daran glaubt, dass sie sich erfüllen. Dann erst setzt sich die Triebkraft menschlichen Handelns in Gang.
Kein Wunder, aber eine Überraschung, bescherte mir der Himmel. Ich hatte mir die Normandie grau, regnerisch und stürmisch vorgestellt, war ausgerüstet mit Regenjacke und Wollpullovern. Aber nun: wolkenloses Blau und eine kräftige Maisonne. Von Pont-l’Évêque – den Namen kannte ich bisher nur von einem cremigen, würzigen Weichkäse, dem Brie nicht unähnlich – war es nicht mehr weit, und der Zug fuhr in den Kopfbahnhof von Trouville-Deauville ein. Die wenigen Mitreisenden strebten eilig dem Ausgang zu. Ich dagegen ließ mir Zeit und betrachtete ausgiebig das normannische Fachwerkgebäude, die Halle mit den beiden Fahrkartenschaltern und einem Kiosk und die beiden Wandgemälde unterhalb der Decke. Eins zeigt Stadtpläne von Trouville und Deauville, das andere die gesamte Normandie, stilistisch erinnern sie an mittelalterliche Landkarten.
Für mich waren Bahnhöfe und Züge schon immer die verkörperte Verheißung von Weite und Fremde. Als Kind hörte ich, wenn ich abends im Bett lag, das Tuten der Lokomotive, die mit ihren Waggons im Schlepptau unser Städtchen in der Lüneburger Heide umrundete. Die Welt rief, und ich träumte mich weit weg in ferne Länder. Im Alter von sechs wagte ich zum ersten Mal den Versuch, eigenständig eine Reise zu unternehmen. Nach der Schule schlug ich nicht den Heimweg ein, sondern begab mich zum Bahnhof, um in einen Zug zu steigen und es mindestens bis zum übernächsten Halt zu schaffen. Das Vorhaben wurde von einer Tante vereitelt, die mich unterwegs entdeckte und nach Hause brachte. Zum Glück war meine Abwesenheit noch nicht bemerkt worden. Dass ich gelegentlich herumtrödelte, nahmen meine Eltern gelassen hin, aber wenn sie von meiner Reiseabsicht erfahren hätten, wäre ein Hausarrest unumgänglich gewesen. Die Tante hielt dicht, dafür schenkte ich ihr mein Leberwurst-Pausenbrot, das ich mir als Proviant aufgespart hatte.
Die Taxis vor dem Bahnhofsgebäude ließ ich links liegen. Nach dem Stadtplan brauchte ich nur die Brücke zu überqueren, die Trouville von Deauville trennt, und am Flüsschen Touques entlangzugehen, das hinter dem Casino in den Ärmelkanal mündet. Trouville machte auf den ersten Blick einen trägen, behäbigen, verschlafenen Eindruck auf mich. Angler standen am Kai, ältere Menschen saßen auf Bänken in der Sonne, die Hauptstraße war wenig befahren. In der Fischhalle warteten Händler auf Kundschaft. Bei der Brasserie Le Central begann die autofreie Zone der Rue des Bains, kleine Geschäfte reihten sich aneinander, Garne und Wolle, Käse, eine Buchhandlung mit handgeschriebenen Empfehlungen der Besitzerin, Haushaltsgeräte, englische Antiquitäten, Blumen und Arbeitsbekleidung und Schiffsbedarf.
Ohne die Örtlichkeiten zu kennen, hatte ich telefonisch eins von drei Zimmern eines kleinen Hotels gebucht, in der Nähe der Kirche Bon Secours, zu einem erstaunlich niedrigen Preis. Nach Hotel sah das Gebäude nicht aus, und, merkwürdig, die Eingangstür war verschlossen. Auf mein Klingeln öffnete eine ältere Dame in dunkelgrünem Leinenkostüm, mit gelockten Haaren in einem Rotton, der nur der Farbpalette eines Friseurs entstammen konnte. Ich nannte meinen Namen.
»Willkommen in meinem Schloss, Madame.«
Die Dame sagte wirklich »Schloss« und stellte sich vor. Ihren Nachnamen vergaß ich sofort, für mich blieb sie Madame Colette. Sie führte mich die Treppe hinauf in den zweiten Stock. Die trübe Deckenlampe im Flur warf spärliches Licht auf eine Kommode, geblümte Tapeten und den rot gefliesten Fußboden. Die einzige Tür öffnete sich quietschend. In dem Zimmer mit Dielenbrettern befanden sich ein einzelnes Bett aus dunklem Holz, ein Tisch, ein Stuhl, ein kleiner Schrank, der einen leichten Geruch nach Lavendel verströmte, eine Nachttischlampe aus Stoff mit herunterhängenden Fransen. Kein Fernseher, kein Radio. Das sich anschließende Badezimmer wartete immerhin mit der Errungenschaft fließenden Wassers und einer im Raum stehenden Badewanne mit Löwenfüßen auf. Ich war im 19. Jahrhundert gelandet.
Warmes Wasser brauche ein wenig bis hier oben, aber irgendwann fließe es aus dem Hahn, außerdem sei die Elektrik nicht ganz zuverlässig, warnte Madame Colette, ich solle lieber keinen Föhn benutzen. Sie gebe mir im Bedarfsfall gern die Adresse ihres Friseurs. Dann händigte sie mir einen Schlüssel aus und sagte, das Haus gehöre mir, sie erscheine morgens, um mir Frühstück zu machen. Wie? Sie wohne nicht hier? Nein, nein. Und die anderen Gäste? Keine, ich sei der einzige Gast. Wenn Probleme auftauchten, sie wohne nicht weit, nur um die Ecke. Dabei verwies sie auf ein handgeschriebenes Zettelchen auf dem Nachttisch. Das reizende Lächeln der Gastgeberin besänftigte meine leichte Unruhe nicht ganz. »Sie werden gut schlafen«, prophezeite Madame Colette und verabschiedete sich. Ob sie ein Restaurant empfehlen könne, rief ich ihr nach. »Central oder Les Mouettes«, erwiderte sie, sich auf dem Treppenabsatz umdrehend. Die roten Haare leuchteten im Halbdunkel des Flurs. Dann war die sorglose Hotelbesitzerin verschwunden.
Ich erinnerte mich an ein Foto von Marguerite Duras in der Brasserie Central. Sie ist darauf mit einer Jacke oder einem Mantel in auffälligem Rot bekleidet und trägt eine große, fast viereckige Brille. Angeblich nahm sie dort regelmäßig und an einem bestimmten Tisch ihre Mahlzeiten ein. Getrieben vom Hunger, ließ ich alles stehen und liegen und begab mich ins Central, wo die Zeit zum Mittagessen schon vorbei war und die des Abendessens noch nicht begonnen hatte. Aber man servierte mir eine normannische Fischsuppe mit Croutons und einer knoblauchhaltigen cremigen Rouille. In den folgenden Jahren sollte ich noch oft in den Genuss dieser regionalen Spezialität kommen, aber so umwerfend wie bei diesem ersten Mal empfand ich den Geschmack nie wieder. Meine Liebe zur Normandie begann mit einer Fischsuppe und mit Madame Colettes Märchenschloss. Denn als ich am späten Nachmittag, vom Essen zurückgekehrt, die Tür öffnete, hatte sich das Hotel schon in »mein« Haus verwandelt. Und als ich auf dem Bett lag und beobachtete, wie vor dem offenen Fenster kreischende Möwen und sirrende Schwalben vor dem Hintergrund eines fast dunkelblauen Himmels vorbeizogen, da spürte ich so etwas wie das Glück, am richtigen Ort zu sein.
Während ich das schreibe, wird mir die Einzigartigkeit dessen, was mir damals widerfahren ist, bewusst. Heute würden mit Sicherheit Gesetze und Verordnungen verhindern, dass ein Gast in einem Etablissement beherbergt wird, das nicht den Anforderungen zeitgemäßer sanitärer Anlagen oder moderner Stromversorgung genügt, keine Rezeption besitzt und nicht mit modernen Medien ausgestattet ist. Und dazu noch allein gelassen wird. Vielleicht galten die Gesetze auch damals schon, und Madame Colette hat sich zu meinem Glück darüber hinweggesetzt. Im Jahr darauf, als ich mich schon im Hôtel des Roches Noires einquartiert hatte, erfuhr ich, dass ich ihr letzter Gast gewesen war. Kurz nach meinem Aufenthalt hat sie das Hotel verkauft, an eine Normannin mit Tochter und Golden Retriever, die nach einer Komplettrenovierung daraus ein charmantes chambre d’hôtes, eine Pension mit zwei Gästezimmern, entstehen ließ. Und die bis heute zu meinen Freundinnen zählt. Aber das ist eine Geschichte, die an späterer Stelle erzählt wird.
Madame Colettes Prophezeiung, meinen Schlaf betreffend, erfüllte sich. In dieser Woche schlief ich jede Nacht unergründlich tief. Am Morgen erwachte ich mit dem Gefühl, geträumt zu haben, erinnerte mich aber nie an einen bestimmten Traum. Mir war, als hätte ich mich in einem Meer, einem Ozean von unendlicher Weite und Tiefe, aufgehalten, als sei ich zum Wasserwesen geworden wie Fisch oder Krake. Wenn ich morgens aus meinem nächtlichen Traummeer emporstieg, wartete Madame Colettes Frühstück auf mich. Auf ihrem Weg ins Hotel hatte sie in der viel gerühmten Pâtisserie Charlotte Croissants besorgt, dazu servierte sie gesalzene Butter, selbst gekochte Aprikosenmarmelade, Apfelgelee und einen French Breakfast Tea, der nach Malz und Schokolade schmeckte. Das und vieles andere bei diesem ersten Aufenthalt trugen zu dem Wunsch bei, in Trouville heimisch zu werden. Mich zog nicht die Aussicht auf sommerliches Badeleben an, das im Allgemeinen die Attraktivität normannischer Seebäder ausmacht. Mich lockten weder der Deauviller Boutiquen-Luxus noch Pferderennen noch Spielcasino. Nein, der Ort versetzte mich in eine traumgleiche Atmosphäre, in der sich Tradition und Geschichte, Wirklichkeit und Fantasie, Vergangenheit und Gegenwart vermischten mit etwas, was mich betraf, was ich aber noch nicht benennen konnte. Ich hatte das Gefühl, als würde ich, von einer Welle getragen, an einen Ort gelangen, den ich nicht kannte, der aber mein Leben nachhaltig verändern sollte.
Auf der Suche nach Marcel Proust
Auf der Suche nach Spuren dessen, den ich als Verursacher meiner Normandie-Reise ansah, fuhr ich in jenem Mai zum ersten Mal nach Cabourg, und zwar mit dem Bus. Die Bahnlinie von Trouville nach Cabourg, Ende des 19. Jahrhunderts für Schmalspurbahn erbaut, hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich und wurde bei den Befreiungskämpfen Ende des Zweiten Weltkriegs komplett zerstört. Die Strecke wurde nach dem Krieg zwar rekonstruiert, die Züge aber, wie überall, irgendwann durch Busse ersetzt. In jenem Jahr 2001 war die Ankündigung zu lesen, dass ab dem Sommer wieder Züge zwischen den beiden Badeorten verkehren sollten. Millionen wurden investiert, um nach und nach die kleinen Bahnhöfe zu renovieren, 2010 wurde der von Cabourg/Dives fertiggestellt. Neuerdings hört man Klagen, weil die Eisenbahngesellschaft SNCF den Zugverkehr während des ganzen Winters eingestellt hat. Eine Bahnlinie nur für Sommertouristen, nicht motorisierte Einwohner hätten das Nachsehen, hieß es in der Presse. Doch wer weiß, vielleicht macht die SNCF angesichts der aktuell diskutierten Klimamaßnahmen die getroffenen Entscheidungen wieder rückgängig.
Der Badeort Cabourg ist in den 1850er-Jahren auf dem Zeichenbrett entstanden. Strahlenförmig führen alle Straßen auf den Mittel- und Endpunkt des Ortes zu: das Grand Hôtel mit dem Casino, vom Meer nur durch eine Art Mole, einen befestigten Deich, getrennt. Verlaufen kann man sich nicht.
Der Bus hielt jenseits des Flüsschens Dives. Die Hauptstraße, von einer kräftigen Sonne beschienen, lag am späten Vormittag wie ausgestorben da. Außer einigen hübschen Stadtvillen schien der Badeort nicht viel zu bieten zu haben. In einem Papier- und Zeitschriftenladen kaufte ich alte Postkarten, Aufnahmen »aus der Zeit Marcel Prousts«. Spaziergänger mit Sonnenschirmen auf der Mole waren darauf zu sehen, die schnurgerade Hauptstraße, Automobile vor dem Grand Hôtel und das Badeleben am Strand, züchtig gewandete Herrschaften, Damen in bodenlangen Kleidern, Herren in Ganzkörper-Schwimmanzügen. Mein Herz schlug schneller, als das Ziel meiner Wünsche auftauchte. Umriss und Fassade fand ich im Vergleich zum gerade erstandenen Foto kaum verändert. Ich zögerte, das Hotel zu betreten, ein bisschen aus Scheu, weil ich mich nur umsehen und nicht nach einem Zimmer fragen wollte. Also ging ich erst einmal um das Casino herum auf die Mole. Vor mir lag das Meer, so blau wie der Himmel, mit dem es am Horizont verschmolz. Die Flut ließ vom Strand nur einen schmalen Streifen frei, auf dem sanft plätschernd die Wellen anlandeten. Die normannische Küste glich an diesem Tag der Côte d’Azur.
Fast ehrfürchtig betrat ich die Hotelhalle. Rechter Hand die Rezeption und eine in die oberen Etagen führende Treppe, im Hintergrund ein Flügel, umgeben von Sesseln und Tischen, und ein Portal, das zum Strand führte. Von Gästen keine Spur. Ich sei wegen Marcel Proust hier, sagte ich zu dem Herrn an der Rezeption. Ob ich mich umsehen dürfe, vielleicht auch in dem Zimmer, das der Verehrte hier bewohnt habe. Entgegen meiner Erwartung zeigte sich der Concierge verständnisvoll, ja, geradezu erfreut, dass ich eigens wegen dieses einzigartigen Schriftstellers den langen Weg auf mich genommen hätte. Empfangsräume und Restaurant könne ich mir gern ansehen, das Proust-Zimmer leider nicht, es sei vermietet. Die Enttäuschung hatte noch nicht ganz von mir Besitz ergriffen, da öffnete sich die Fahrstuhltür, und heraus trat zu meiner Verblüffung ein korpulenter Marcel Proust. Die schwarzen Haare exakt links gescheitelt, ein Oberlippenbart, dreiteiliger dunkler Anzug mit Weste, viel zu warm für die sonnigen Tage, statt Krawatte oder Fliege ein zu einer Schleife gebundenes Bändchen, im Knopfloch des Jacketts eine Blüte, eine Orchidee. Um zu beurteilen, ob es eine Cattleya war, reichte mein botanisches Wissen nicht aus. Am erstaunlichsten zeigte sich die Ähnlichkeit an den umschatteten Augen und halb geschlossenen Lidern. Der einzige Unterschied bestand in der Körperfülle des Doppelgängers. Ich glaube, ich starrte den aus der Zeit gefallenen, dandyhaft wirkenden Hotelgast ungebührlich lange an. Der Concierge unterbrach die peinliche Stille und wandte sich an den Herrn, der, als hätte ich ihn mit meinem Blick hypnotisiert, stehen geblieben war: »Monsieur, diese Dame sucht dasselbe wie Sie.« »Das glaube ich kaum«, erwiderte der Gast. Die Worte lösten meine Erstarrung, ich wertete sie als Zeichen der Abwehr, als Antwort auf die unzumutbare Indiskretion des Concierge, ihn angesprochen zu haben. »Entschuldigen Sie«, murmelte ich betreten.
Aber anstatt die Chance zu ergreifen, sich ohne einen Kommentar zu entfernen, machte er einen Schritt auf mich zu und lächelte. »Ich muss mich entschuldigen«, sagte er und nannte einen Namen, von dem ich nur »Igor« verstand. In sein Französisch mischte sich ein slawischer Akzent, und »Igor« erschien mir russisch. Ich erklärte mein Anliegen und stellte mich nun ebenfalls vor. Aha, auf der Suche nach der Suche. Ob ich mit ihm speisen wolle, hier im Restaurant Balbec, er habe etwas gutzumachen und würde mich gern einladen, schließlich verhindere seine Anwesenheit die Erfüllung meines Wunsches.
Im Restaurant waren zur Mittagszeit nur zwei Tische belegt. Der Kellner gab uns den gewünschten Platz am Fenster. Igor, ich nenne ihn jetzt so, bestellte Langustinen und Seezunge für uns beide, natürlich Seezunge, wie könnte es anders sein, dazu eine Flasche Sancerre. Mir gingen alle möglichen Fragen durch den Kopf, ich wagte nicht, sie zu stellen. Aber Igor fing auch ohne meine Initiative an zu reden. Er war Russe, aus Moskau, wohnte aber in Paris. Sein Vater sei reich, sehr reich – Oligarch, Gas, murmelte er – und hatte ihm, dem Sohn, eine Wohnung im 8. Arrondissement gekauft.
»Besser für meinen Vater und besser für mich, wenn ich nicht in Moskau bin.«
Er machte eine Pause. Mein fragender Blick nötigte ihn zu einer Erklärung. Seine Neigung sei in Russland unerwünscht. Es könnte dem Vater schaden. Ich begann zu verstehen. Igor war homosexuell, daher seine Bemerkung an der Rezeption, daher seine Flucht aus Russland, daher seine Beschäftigung mit Proust. Ich nickte zum Zeichen, dass ich begriffen hatte. Ja, sagte er, an Marcel – er gebrauchte den Namen, als spreche er von einem Freund – interessiere ihn die Kunst des Kaschierens, wie der dieses anbetungswürdige Werk habe erschaffen können, in dem es eigentlich nur um seine Neigungen gehe, ohne sie jemals direkt zu erwähnen. Zwei Stunden lang waren wir im Gespräch vertieft. Das Wort »Homosexualität« fiel nicht ein einziges Mal. Igor sprach von disposition oder préférence, und ich schloss mich ihm an. Leider sei heute der Sinn für Extravaganz verloren gegangen, beklagte er, selbst in Paris, der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten, sei es schwierig, Gleichgesinnte zu finden, die eine Kultur der Salons und der geistreichen Unterhaltung pflegten. Er hätte lieber im 19. Jahrhundert gelebt als in diesem nüchternen, leidenschaftslosen späten 20., das sich im 21. ebenso fortsetze, wenn nicht gar eine zunehmende Verrohung zu befürchten sei.
»Aber so viele Kriege, so viel Zerstörung«, wandte ich ein, »die Napoleonischen, der Deutsch-Französische …« »Das war Ihrer«, konterte er. »Ja, und Sie waren, soweit ich weiß, mit dem Osmanischen Reich und der Krim beschäftigt, dann der Erste Weltkrieg, der noch verheerendere Zweite Weltkrieg. Hätten Sie das alles erleben wollen?«
»Wahrscheinlich nicht«, gab er zu, »trotzdem erlaube ich mir, dem Verschwinden der Eleganz und der Poesie nachzuweinen.«
»Die immer ein Privileg der Begüterten waren.«
»Selbstverständlich, Madame, so ist die Welt. Wer hungert, kann kaum Sinn für Schönheit entwickeln.«
Während der Unterhaltung hatten wir gebratene Langustinen an Kräuterbutter, gegrillte Seezunge, Sauce Béarnaise und Pommes Dauphine verspeist. Nach Dessert und Kaffee – Igor gestand eine Schwäche für Süßes und orderte zum Espresso einen Teller mit Pralinés und Trüffeln aus dem Maison du Chocolat in Paris, seinem Lieblingschocolatier – wusste ich von ihm viel, er von mir wenig.
Ich dankte ihm und streckte ihm die Hand zum Abschied hin. Statt sie zu ergreifen, fragte er: »Haben Sie sich schon die kleine romanische Kirche in Dives-sur-Mer angesehen, Sie wissen, die …« Ich wusste, welche er meinte, Proust erwähnt sie in der Recherche.
»Nein.«
»Die müssen Sie sehen.«
Er bat den Concierge, ein Taxi zu rufen. Und zehn Minuten später rollte der Wagen mit dem ungleichen Paar im Fond die Hauptstraße von Cabourg entlang stadtauswärts. Kaum zehn Minuten dauerte die Fahrt nach Dives, das, obwohl »sur mer« genannt, gar nicht am Meer liegt, sondern an einem kleinen geschützten Binnenhafen, der sich zu dem in den Ärmelkanal mündenden Flüsschen Dives öffnet. Hier brach 1066 Wilhelm der Eroberer zu seiner bedeutenden Schlacht nach England auf, die er mit Glanz und Gloria gewann und die ihn zum König von England machte. Davon wird später zu berichten sein.





























