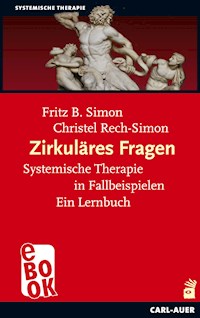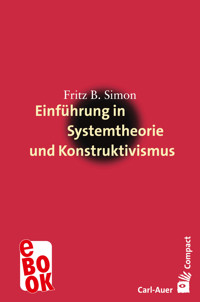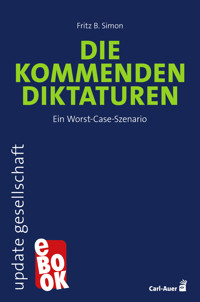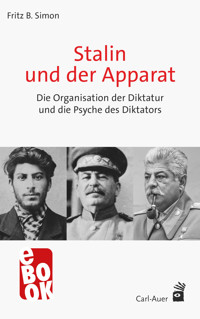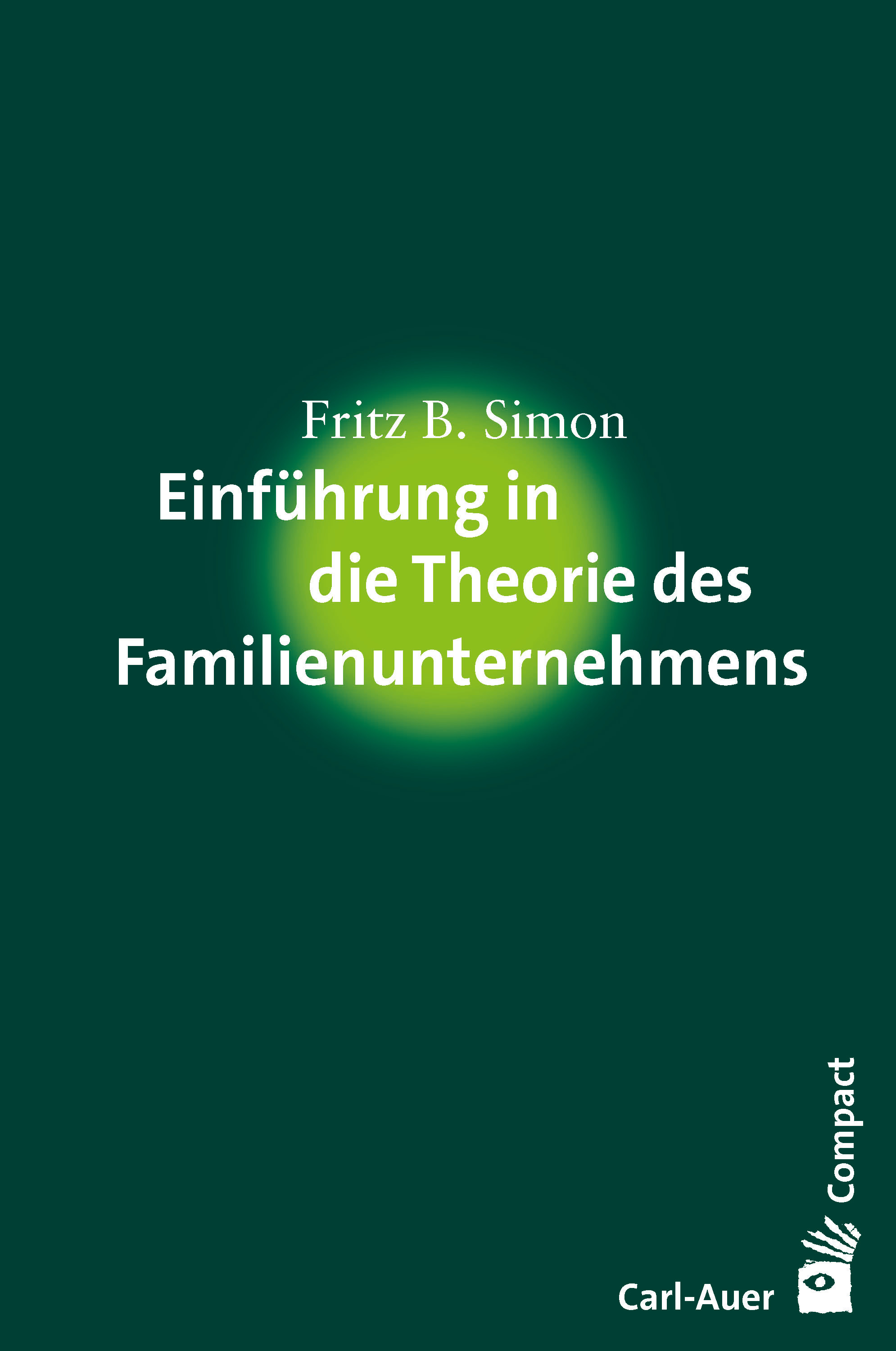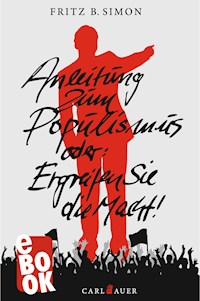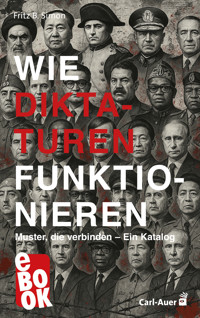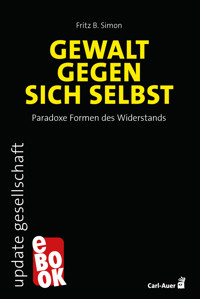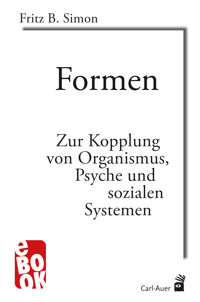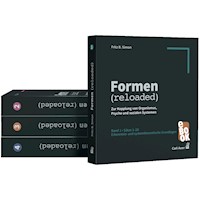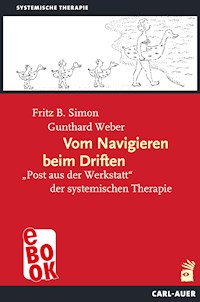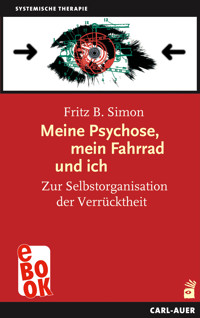
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Systemische Therapie
- Sprache: Deutsch
"Dieses Buch, das über die Merkmale eines Bestsellers hinaus auch die eines Klassikers hat, ist von einem Mann geschrieben, der eben nicht den in unserem Fache traditionellen Fehler begeht, die Speisekarte statt der auf ihr aufgeführten Speisen zu essen, sich über den schlechten Geschmack zu beschweren und Verdacht zu schöpfen, dass man ihn vergiften will." - Paul Watzlawick Der grundlegende Einführungs- und Lehrtext in die neuere Systemtheorie und den Radikalen Konstruktivismus Ein Buch über die Beziehung von Geist und Körper, Wahn und Wirklichkeit. Es handelt von Paradoxien und den Tricks, sie zum Verschwinden zu bringen, der Entstehung von Zeit, Ordnung und Chaos, den merkwürdigen Verstrickungen des Fühlens im Denken, von Milch, freien Gedanken, Miss Elli, der Evolution der Hinkelkästen, von Segeln und Fussball, ganz vielen Autos, persönlicher Verantwortung, der Unwissenschaftlichkeit des Suchens nach Ursache und Schuld, von Selbstorganisation, Hemden mit Krokodilen, Zen sowie Psychiatern und anderen Verrückten. Es zeigt den Unterschied zwischen Logik und Leben, der dazu führt, dass Weltbilder gelegentlich nicht zur Welt passen, und es singt ein Loblied auf unsere Ambivalenzen. Die Entstehung von Verrückheit wird so schließlich ganz vernünftig als ein Ergebnis der Politik des Familienlebens, der tragischen und absurden Dramen der Kämpfe um Autonomie und Abhängigkeit des Wechselspiels von Liebe und Hass erklärbar und berechenbar. Vor allem aber ist dies ein einzigartiges Lehr- und Übungsbuch systemischen Denkens. Der Autor: Fritz B. Simon, Dr. med., Professor für Führung und Organisation am Institut für Familienunternehmen der Universität Witten/Herdecke; Systemischer Organisationsberater, Psychiater, Psychoanalytiker und systemischer Familientherapeut; Mitbegründer der Simon, Weber & Friends Systemische Organisationsberatung GmbH. Autor bzw. Herausgeber von ca. 300 wissenschaftlichen Fachartikeln und 34 Büchern, die in 15 Sprachen übersetzt sind, u. a.: Der Prozeß der Individuation (1984), Die Sprache der Familientherapie (1984, mit Helm Stierlin und Ulrich Clement), Lebende Systeme (1988), Unterschiede, die Unterschiede machen (1988), Meine Psychose, mein Fahrrad und ich (1990), Radikale Marktwirtschaft (1992, mit CONECTA), Die andere Seite der Gesundheit (1995), Die Kunst, nicht zu lernen (1997), Zirkuläres Fragen (1999, mit Christel Rech-Simon), Tödliche Konflikte (2001), Die Familie des Familienunternehmens (2002), Gemeinsam sind wir blöd!? (2004), Mehr-Generationen-Familienunternehmen (2005, mit Rudi Wimmer und Torsten Groth), Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus (2006), Einführung in die systemische Organisationstheorie (2007), Einführung in die systemische Wirtschaftstheorie (2009), Vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Systemische Aspekte des Fußballs (2009), Einführung in die Systemtheorie des Konflikts (2010), "Zhong De Ban" oder: Wie die Psychotherapie nach China kam (2011, mit Margarete Haas-Wiesegart und Zhao Xudong), Einführung in die Theorie des Familienunternehmens (2012), Wenn rechts links ist und links rechts (2013), Einführung in die (System-)Theorie der Beratung (2014), Formen. Zur Kopplung von Organismus, Psyche und sozialen Systemen (2018), Anleitung zum Populismus oder: Ergreifen Sie die Macht! (2019), Der Streit ums Nadelöhr. Körper, Psyche, Soziales, Kultur. Wohin schauen systemische Berater? (2019, mit Jürgen Kriz), Lockdown: Das Anhalten der Welt (2020, mit Heiko Kleve und Steffen Roth), Formen (reloaded). Zur Kopplung von Organismus, Psyche und sozialen Systemen (2022), Stalin und der Apparat. Die Organisation der Diktatur und die Psyche des Diktators (2023), Die kommenden Diktaturen (2024).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carl-Auer
»Statt zu sagen ›Ich denke‹, sollten wir sagen ›Es denkt‹, wobei das ›Es‹ genau so verwendet werde wie in ›Es blitzet‹.«
G. Ch. Lichtenberg1
Fritz B. Simon
Meine Psychose,mein Fahrrad und ich
Zur Selbstorganisation der Verrücktheit
Fünfzehnte Auflage, 2025
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Dr. h. c. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Dresden)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer † (Heidelberg)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin † (Heidelberg)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Karsten Trebesch (Dallgow-Döberitz)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Tom Levold (Köln)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Burkhard Peter (München)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Reihengestaltung: Uwe Göbel
Umschlagbild: WSP Design Werbeagentur, Heidelberg
Satz: Drißner-Design u. DTP, Meßstetten
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Fünfzehnte Auflage, 2025
ISBN 978-3-8497-0193-2 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8543-7 (ePub)
© 1990, 2025 Carl-Auer-Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/
Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 . 6911 5 Heidelberg
Tel. +4962216438-0 . Fax +4962216438-22
1 Einführung
Ein diagnostischer Test
Lassen Sie uns mit einer einfachen Prüfung beginnen: Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Buch mit dem Titel »Meine Psychose, mein Fahrrad und ich. Zur Selbstorganisation der Verrücktheit« aufgeschlagen und beginnen gerade, das erste Kapitel zu lesen.
Stellen Sie sich vor, Sie lesen in diesem Moment (jetzt gerade) die erste Zeile (?) des zweiten Absatzes. Sehen Sie, das war zu befürchten: Sie lassen Ihrer Fantasie die Zügel schießen, und sie geht mit Ihnen durch. Sie sind offensichtlich ein Mensch mit einer viel zu plastischen Vorstellungsfähigkeit. Gestehen Sie es sich ruhig ein, Sie haben den Eindruck, wirklich in solch einem Buch zu lesen. Ja, Sie glauben sogar, gerade solch ein Buch in der Hand zu halten und sinnlich wahrzunehmen.
Es ist sehr bedenklich, dass jemand wie Sie, der sich für aufgeklärt, kritisch und vernünftig hält, derart leicht zu beeinflussen und so suggestibel ist. Um ihre unabhängige Urteilskraft und Autonomie scheint es nicht sehr gut bestellt. Sie gehorchen nicht nur blind den Einflüsterungen eines Fremden, sich irgendwelchen Hirngespinsten hinzugeben – nein, schlimmer noch: Sie vertiefen sich derart in diese Tagtraumwelt, dass Sie meinen, wirklich in ihr zu leben. Oder wollen Sie etwa leugnen, dass Sie im Moment das Gefühl haben, in diesem fiktiven Buch zu lesen?
Das Symptom ist für jeden Psychiater ganz klar: Sie können Ihre Vorstellung nicht von Ihrer Wahrnehmung unterscheiden. Passiert Ihnen das häufiger? Gehorchen Sie immer den Anweisungen all Ihrer Mitmenschen? Seit wann können Sie sich anderen gegenüber so schlecht abgrenzen?
Sie glauben, dieses Buch wirklich in der Hand zu halten. Das ist nach allgemeiner psychiatrischer Erfahrung ein Zeichen dafür, dass Sie den Bezug zur Realität verloren haben: schließlich folgen Sie nur der Anweisung, sich etwas vorzustellen.
Wenn Sie jetzt ärgerlich mit dem Gedanken spielen sollten, das Buch zuzuschlagen, so wäre dies ein Indiz dafür, dass Sie mit Fluchttendenzen reagieren, wenn Sie etwas nicht sofort in seinem Sinn verstehen. Wahrscheinlich neigen Sie dann auch sonst zu Beziehungsabbrüchen in für Sie undurchschaubaren Situationen.
Sollte Sie hingegen das, was Ihnen gerade widerfährt, vollkommen kalt und unberührt lassen, so ist auch dies ein bedenkliches Zeichen: Sie wehren alle Gefühle ab, die Sie in Ihrer Selbst- und Weltgewissheit verunsichern und Ihnen Angst einflößen könnten. Sie lassen sich daher gar nicht richtig auf Beziehungen ein (nicht einmal auf eine objektiv so ungefährliche wie die zu einem fantasierten Buch).
Sie überlegen, was das alles soll, und sind etwas verwirrt? Fragen Sie sich nicht sogar, ob Sie manipuliert werden und ein Spiel mit Ihnen gespielt wird? Sie sind wirklich leicht zu durchschauen ...
Aber wahrscheinlich glauben Sie ja, Sie wüssten, dass Sie jetzt gerade in diesem Buch lesen. Wie können Sie sich selbst und den Diagnostiker, der behauptet, Sie seien das Opfer einer optischen Halluzination und in ein Wahnsystem verstrickt, davon überzeugen, dass es dieses Buch vor Ihnen wirklich gibt?
Ehrlich gesagt, mein Eindruck ist, dass Sie (entschuldigen Sie bitte die krasse Formulierung – es ist nicht persönlich oder gar abwertend gemeint) im Moment nicht ganz bei Trost sind. Aber gibt es mich denn überhaupt? Bin ich nicht auch nur ein Produkt Ihrer egozentrischen, kranken Fantasie, die sich überall von Irrenärzten und anderen Verfolgern umstellt sieht und jedes Buch, die Fernsehnachrichten und Schlagertexte auf sich selbst bezieht?
Die Antwort auf die Frage, ob es das Buch in Ihrer Hand wirklich gibt, hat weitreichende Folgen. Sie sagt mehr über Sie und Ihren Geisteszustand als über das Buch aus. Ist es halluziniert, so sind Sie wahrscheinlich im Moment verrückt. Um einen medizinischen Fachausdruck dafür zu verwenden: Sie sind dann wahrscheinlich psychotisch – warum auch immer. Aller psychiatrischer Erfahrung nach werden Sie dann in nächster Zeit in Konflikte mit Ihren Mitmenschen geraten, weil Ihre Wahrnehmungen, Ihr Bild der Welt, Ihre Verhaltens-, Denk- und Gefühlsmuster von denen Ihrer Mitmenschen abweichen. Und da die Mehrheit dann nicht auf Ihrer Seite stehen wird, dürfte es Ihr Schicksal sein, aus dem Verkehr gezogen und in eine Klinik oder Anstalt gebracht zu werden, in der man Ihnen irgendeine Form der Therapie angedeihen lässt.
Wie kommen Sie und andere dazu, irgendwelche Ansichten und Aussagen über die Welt für wahr oder für falsch zu halten? Wie können Sie Ihre Wahrnehmung überprüfen und Illusion, Halluzination, Täuschung, Einbildung, Traum und all die anderen Ausgeburten Ihrer Fantasie von Wirklichkeit unterscheiden? Was trennt verrücktes Denken, Fühlen und Handeln von normalem Denken, Fühlen und Handeln? Vor allem aber: Wie lässt sich die Entstehung des einen und/oder anderen erklären?
Sollten Sie durch das, was Sie bislang gelesen haben, oder durch das, was Sie gerade nicht gelesen haben (weiß der Himmel, was Sie erwartet haben!), etwas verwirrt sein, so haben Sie ein wenig von der Konfusion kosten können, in die derjenige gestürzt wird, der sich intensiv mit Verrücktheit und Verrücktheiten beschäftigt. Natürlich kann die Ratlosigkeit, die durch einen geschriebenen Text ausgelöst wird, nur eine blasse Ahnung von dem vermitteln, was sich im Zusammenleben von Menschen abspielt, die sich gegenseitig wichtig sind. Wenn hier dennoch der schüchterne Versuch unternommen wurde, Ihnen eine leise und harmlose Ahnung von einigen der interaktionellen und logischen Aspekte der Verrücktheit zu verschaffen, so aus einem einfachen Grund: Über Verrücktheit zu reden, zu schreiben oder zu lesen, ist etwas ganz anderes, als sie zu produzieren und zu erleben. Es ist die Art Unterschied, wie sie zwischen einer Speisekarte, der Zubereitung des Essens und dem Essen besteht.
Wer Kochbücher verzehrt, ist verrückt.
»Psychose« oder »Verrücktheit«? – Von der Schwierigkeit, die passenden Begriffe zu finden
Um das Thema einzugrenzen und eventuellen Missverständnissen vorzubeugen: Mit dem Begriff »Verrücktheit« sollen hier Verhaltens-, Denk- und Fühlweisen bezeichnet werden, die in der psychiatrischen Fachliteratur als Ausdruck von »Geistes- und Gemütskrankheiten«, als psychopathologische Symptome der sogenannten endogenen Psychosen beschrieben werden. Menschen, die sich so verhalten, dass sie schließlich mit einer der Diagnosen dieses Spektrums versehen werden, scheinen die für uns alle selbstverständliche Wirklichkeit verloren oder verlassen zu haben. Ihr Erleben weicht in charakteristischer Weise von dem ihrer Mitmenschen ab. Sie scheinen in einer für andere nur schwer oder gar nicht nachvollziehbaren Weise zu denken und zu fühlen, und ihr Verhalten ist weniger als das anderer Menschen berechen- und vorhersehbar. Ihr Denken, Fühlen und Verhalten erscheint nicht einfach vom Zufall bestimmt zu sein, sondern anders – unnormal – geordnet. Beobachtet man die verschiedenen, äußerlich wahrnehmbaren Aspekte des Verhaltens solcher Patienten und bezieht man ihre Berichte über ihre Selbstbeobachtungen und ihr Erleben mit ein, so lassen sich typische, von der Norm abweichende Muster und Regeln innerseelischer Prozesse unterscheiden. Die traditionelle Psychiatrie der letzten hundert Jahre ging (und geht) davon aus, dass diese psychopathologischen Symptomkomplexe gegeneinander abgegrenzt und diagnostisch verschiedenen zugrunde liegenden Krankheiten zugeordnet und mit unterschiedlichen Namen versehen werden können.
Wenn hier im folgenden diese diagnostizierenden Etiketten (z. B. »Schizophrenie« oder »manisch-depressive Psychose«) verwendet werden, so sollen dadurch im Gegensatz zu den stillschweigenden Vorannahmen des Krankheitskonzeptes lediglich charakteristische Phänomene – Verhaltens-, Fühl- und Denkmuster – beschrieben werden. Irgendwelche Erklärungen im Sinne eines organmedizinischen Krankheitsmodells sollen damit nicht vorausgesetzt werden. Diese abgrenzende Vorbemerkung ist deswegen nötig, weil bei der Verwendung solch medizinischer Fachausdrücke nur allzu leicht und fatalerweise die Beschreibung von Phänomenen mit ihrer Erklärung gleichgesetzt und verwechselt wird.
Die Frage, wie diese Phänomene entstehen, führt über den beschränkten Rahmen der Medizin hinaus in den Bereich elementarer erkenntnistheoretischer, ethischer und politischer Probleme. Es geht um die Frage, was in einer Gesellschaft für wahr, schön und gut erachtet wird. Man kann nicht über Verrücktheit reden, ohne über Normalität zu sprechen, und nicht über Normalität, ohne etwas über Verrücktheit zu sagen. Erst durch ihre gegenseitige Abgrenzung gewinnen beide Kontur und Inhalt. Die Frage nach der Entwicklung der Verrücktheit ist daher die Frage nach der Entstehung der Normalität.
Jeder Versuch, eine allumfassende und vollständige Antwort auf diese Fragen zu geben, wäre größenwahnsinnig, das heißt: ziemlich verrückt. Die Komplexität, mit der man dabei konfrontiert wird, ist zu groß. Was jedoch versucht werden kann und hier versucht werden soll, ist die Entwicklung eines Modells, das diese Komplexität weit genug vereinfacht, um Sinnzusammenhänge und Erklärungen konstruieren zu können, die für die alltägliche Lebenspraxis nutzbar sind. Es soll all denen, die mit Verrücktheit(en) aktiv oder passiv beschäftigt sind (und wer wäre das nicht?), einen Orientierungsrahmen für das eigene Verhalten in ihr und im Umgang mit ihr zur Verfügung stellen.
Solch ein Modell lässt sich leider nicht wie das eines Hauses mit der Laubsäge aus Sperrholz zusammenbasteln und dadurch anschaulich und begreifbar machen. Es muss mit sprachlichen Mitteln hergestellt werden. Wie bei der Konstruktion aller derartiger Modelle ergibt sich die Frage nach der Wahl der angemessenen Baumaterialien, d. h. der passenden Begriffe. Dass der Bezeichnung »Verrücktheit« hier im Allgemeinen der Vorzug vor »Geisteskrankheit« oder »Psychose« gegeben wird, liegt an der magischen Wirkung von Worten: Sie verändern das, was sie benennen; manchmal erzeugen sie es sogar erst.
Sagt man zum Beispiel »Herr Maier hat eine Psychose« oder »Er hat eine Geisteskrankheit«, dann erweckt man den Eindruck, »Herr Maier« und »seine Geisteskrankheit« seien zwei getrennte Dinge. So, wie Herr Maier ein Fahrrad oder ein Eigenheim besitzen kann, kann er dann eben auch eine Psychose sein eigen nennen. Es scheint dann nur logisch, dass man zu dem Schluss kommt, man könne ihn von seiner Psychose in derselben Weise befreien, wie man ihm sein Fahrrad stehlen oder das Haus pfänden kann. Seltsamerweise scheint die Verwendung des Psychose- oder Krankheitsbegriffs nur selten die eigentlich ebenso plausible Idee nahezulegen, Herr Maier könne seine Geisteskrankheit einmal wie sein Fahrrad aus Versehen irgendwo stehen lassen, wie einen Regenschirm in der Straßenbahn vergessen oder wie sein Haus verkaufen. Er wird durch den Begriff »Krankheit«, diese scheinbar alles erklärende Zauberformel, zur passiven Nebenfigur der Geschichte.
Da wir meist denken, dass es das, was einen Namen hat, auch gibt, bestimmt die Wahl der Worte, was wir für einen unabhängig zu betrachtenden oder zu untersuchenden Gegenstand halten. Trennen wir Herrn Maier von seiner Psychose oder seiner Geisteskrankheit, so begeben wir uns in Alices Wunderland, wo die unaufhörlich lächelnde Cheshire-Katze plötzlich verschwindet und nur ihr Lächeln zurückbleibt.2 Wir lassen Herrn Maier einfach verschwinden, während uns seine Psychose erhalten bleibt. Wir können Sie dann unabhängig von Herrn Maier, seiner Lebensgeschichte und seinen Lebensumständen studieren, in kleine Stücke zerteilen und, wenn wir dann endlich glauben, ihren Mechanismus verstanden zu haben, versuchen, sie wieder zusammenzusetzen.
Es ist aber schwierig, eine bessere Formulierung oder einen angemesseneren Begriff zu finden. Wenn wir das »Haben« durch das »Sein« ersetzen, so ändern sich die stillschweigend in der Bedeutung unserer Worte enthaltene Vorannahmen und die damit verbundenen indirekten Suggestionen (»Hast du was, dann bist du was!«). Die Situation wird dadurch nicht unbedingt besser: »Hast du eine Psychose oder Geisteskrankheit, so bist du psychotisch oder geisteskrank – ein Psychotiker, ein Geisteskranker«. Sage mir, was du bist, und ich sage dir, wer du bist – so lautet die Regel, nach der in unserer Alltagssprache und der in ihr enthaltenen Logik einer Person eine bestimmte Identität zugesprochen wird. Die gerade beklagte Trennung zwischen der Person und der Psychose ist in solcher Wortwahl zwar aufgehoben, stattdessen wird nun aber eine nicht minder zu beklagende, dauerhafte Identifizierung eines Menschen mit seiner meist nur zeitweiligen Art, zu denken, fühlen und sich zu verhalten, vollzogen.
Während wir es zuvor mit einer Zweierbeziehung zu tun hatten, in welcher einer der beiden Partner (der oder die Patientin) unter dem anderen (der oder dem Geisteskrankheit) litt, sind beide nun nicht mehr zu unterscheiden, ein Herz und eine Seele. Im ersten Fall blieb wenigstens, wie bei anderen Partnerschaften auch, die Möglichkeit offen, dass beide sich trennen und in Frieden ihrer Wege gehen oder auch der eine den anderen gut- oder böswillig verlässt. Nun aber besteht die Gefahr, dass die »krank« benannten Phänomene zum identitätsstiftenden Merkmal einer Person werden, zum unveränderlichen Kennzeichen, das in den Pass eingetragen wird. Beide werden dadurch zu einer untrennbaren Einheit verschmolzen (bis dass der Tod sie scheidet).
Mit der Verwendung der Begriffe »Geisteskrankheit« oder »endogene Psychose« ist aber noch ein weiteres Risiko verbunden. Es könnte damit der Eindruck erweckt werden, irgendjemand wüsste genau, wie Verrücktheit entsteht. Betrachtet man sich genauer, was durch den Begriff »Psychose« eigentlich gesagt wird, so wird dies schnell als Vorspiegelung falscher Tatsachen erkennbar. In der Geheimsprache der Ärzte deutet die Schlusssilbe »-ose« stets darauf hin, dass man es mit einem Geschehen zu tun hat, das so aus dem Rahmen der Normalität fällt, dass ihm Krankheitswert beigemessen wird; »endogen«3 verhüllt aber lediglich wohlklingend, dass niemand wirklich genau weiß, wie dieses Geschehen zu erklären ist. Wenn also ein Arzt feststellt, ein Patient habe eine endogene Psychose, so sagt er damit nur in einer für ihn und seine Zunft möglichst wenig kränkenden und dem Prestige bekömmlichen Weise, dass er genauso wenig wie seine Kollegen weiß, warum sich der Patient so verhält, wie er sich verhält.
»Krankheit« ist in diesem Fall aber nicht nur eine Metapher von fraglichem Wert, sondern ein Programm für die Zukunft, eine (Be-)Handlungsanweisung. Sucht man nach Erklärungen für sie, so wendet man naturgemäß die Methoden an, die sich zur Erklärung anderer Krankheiten als nützlich erwiesen haben. Man versucht wie bei der Syphilis den Erreger des öffentlichen Ärgernisses Psychose zu entlarven und dingfest zu machen. Die Jagd nach dem Täter (dem berüchtigten Schizococcus) geht dann erneut von einer Trennung in mindestens zwei unterscheidbare Einheiten aus: der Psychose und ihrer Ursache.
Der Vorzug des Begriffs »Verrücktheit« besteht zunächst einmal darin, dass er nur wenig durch medizinische Vorannahmen belastet ist. Der Bedeutungshof, der die Verrücktheit umgibt, stammt aus viel alltäglicheren Bereichen: Verrückt werden außer Menschen nämlich meist nur Möbel (Stühle, Tische, Sessel, manchmal auch Klaviere oder Schränke) und Uhrzeiger.4 In gleicher Weise wie die Tassen, die nicht alle im Schrank sind, Zeichen einer gestörten Ordnung sind, sagt auch Verrücktheit, dass Unordnung entstanden ist – und zwar plötzlich, ohne sanften Übergang, ruck, zuck. Verrücktheit bedeutet dann, dass der Standpunkt eines Menschen verändert ist, die räumliche oder zeitliche Ordnung, in der er sich orientiert und lebt.
Die Aufgeräumtheit kleinbürgerlicher Küchenschränke und Wohnzimmer ist zwar (auch) ein Ausdruck, aber sicher kein Maßstab für die Ordnung des menschlichen Geistes. Auch sind die in dem Bild der fehlenden Tassen enthaltenen Erklärungs- und Lösungsmodelle ein wenig schlicht: »Wer hat die Tassen aus dem Schrank genommen?« und »Wer tut sie wieder rein?« sind die Fragen, die sich sofort ergeben. Wo solch eine statische Form der Unordnung herrscht, können nur allzu leicht die Ordner und Ordnungshüter mit ihren schrecklich vereinfachenden Patentrezepten ihre Stunde gekommen sehen. dass deren (Be-)Handlungsmethoden den ärztlichen vorzuziehen seien, darf mit gutem Grund bezweifelt werden.
Wenden wir uns also (hin- und hergerissen) wieder dem Krankheitsbegriff zu, um zu sehen, ob die Gefahren, die mit seiner Verwendung verbunden sind, nicht durch Vorteile ausgeglichen werden. Sein erster Vorzug ist, dass die durch ihn beschriebene Unordnung dynamisch ist. Gesundheit (Ordnung) und Krankheit (Unordnung) sind beide an den Prozess des Lebens gebunden, er ist Voraussetzung für beide. Ein Mensch kann todkrank sein, aber ist er erst einmal tot, so ist er nicht mehr krank (natürlich auch nicht gesund). Krankheit und Gesundheit sind also nicht nur ein Gegensatz, sondern sie haben eine gemeinsame Grundlage: die Lebendigkeit des Organismus.
Die Unordnung von Krankheiten ist darüber hinaus nicht beliebig oder zufällig zusammengewürfelt wie die Zusammensetzung einer Müllkippe, sondern eine geordnete Unordnung. Sieht ein Beobachter bei verschiedenen Menschen dieselben körperlichen Veränderungen (Symptome) und ihr Entstehen, ihre Blüte und ihr Vergehen, so kann er sie als unterscheidbare Einheiten betrachten und ihnen eine unabhängige, bestimmten Gesetzmäßigkeiten folgende Existenz zuschreiben. Wie Lebewesen oder Personen scheinen sie einen unverwechselbaren Charakter zu besitzen, nach Rassen und Klassen unterscheidbar, mit mehr oder weniger gut- oder bösartigen Eigenschaften ausgestattet. So werden schließlich Masern und Mumps, Windpocken und Akne als unterscheidbare Einheiten identifiziert und auf ihren unverwechselbaren Namen getauft. Dadurch sind aber keine Dinge, sondern spezifische Unterschiede im Funktionieren des Körpers benannt.
Man könnte natürlich genauso auf die Idee kommen, die unterschiedlichen Weisen, in denen Tassen nicht im Schrank sind, zu klassifizieren (Tassen zerbrochen, verborgt, auf dem Frühstückstisch stehen gelassen, Schrank zusammengebrochen usw.), nur fällt es erheblich schwerer, diesen unterschiedlichen Formen der Unordnung eine von der willkürlichen Entscheidung des Beobachters unabhängige Eigengesetzlichkeit, charakteristische und immer wie der kehrende Merkmale und eine unterscheidbare Identität zuzusprechen.
Der Bedeutungsgehalt des Krankheitsbegriffs, der die Aufmerksamkeit auf dynamische Prozessmuster lenkt, könnte ein Argument dafür sein, auch Verrücktheit als Krankheit zu betrachten. Aber sind es dieselben Prozessmuster, um die es dabei geht? Sind es wirklich körperliche Prozesse, deren Ordnung durcheinandergeraten ist? Kann, soll, darf oder muss die gesellschaftliche und ärztliche Bewertung und Behandlung körperlicher Krankheiten einfach auf die Verrücktheit übertragen werden?
Für die roten Flecken, die ein an Masern leidender Patient auf seiner Haut zeigt, wird ihm von den Menschen in seiner Umgebung im Allgemeinen nicht die Verantwortung (Schuld, Ursache) zugeschrieben. Ganz anders sieht es bei den Verhaltensweisen aus, die er zeigt. Die Symptome der sogenannten endogenen Psychosen sind aber zunächst und vor allem abweichende Verhaltensweisen. Ist abweichendes Verhalten stets das Symptom einer Krankheit? Würde man bei den Mitgliedern der berühmten Panzerknackerbande immer dann, wenn sie damit beschäftigt sind, den Haupttresor einer Bank aufzuschweißen, den Blutdruck, den Spiegel der Nebennierenrindenhormone und ähnliche physiologische Werte messen, so würde man auch bei ihnen spezifische körperliche Veränderungen registrieren können. Aber heißt das, dass sie irgendeine Ose haben oder gar an ihr leiden? Denn es gibt ja zweifellos Bereiche und Fälle, in denen menschliches Verhalten durch die Wirkung körperlicher Prozesse erklärbar ist. Was unterscheidet Kriminalität von Krankheit? Sollte man die Gefängnisse schließen und stattdessen psychiatrische Krankenhäuser errichten?
Hier die angemessenen Unterscheidungen zu treffen, hat weitreichende Konsequenzen. Es ist eine ethische, politische und juristische Frage, die große Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens berührt. Wie viel Verantwortung kann, darf oder muss einem Menschen für sein Denken, Fühlen und Handeln zugesprochen werden?
Die Beantwortung dieser Frage stellt ein philosophisches Grundproblem dar, das über Jahrhunderte nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat. Bereits Kant wies darauf hin, dass sie weder in den Kompetenzbereich der Ärzte, noch der Juristen fällt:
»Das Irrereden (delirium) des Wachenden im fieberhaften Zustande ist eine körperliche Krankheit und bedarf medizinischer Vorkehrungen. Nur der Irreredende, bei welchem der Arzt keine solchen krankhaften Zufälle wahrnimmt, heißt verrückt; wofür das Wort gestört nur ein mildernder Ausdruck ist. Wenn also jemand vorsätzlich ein Unglück angerichtet hat, und nun, ob und welche Schuld deswegen auf ihm hafte, die Frage ist, mithin zuvor ausgemacht werden muss, ob er damals verrückt gewesen sei oder nicht, so kann das Gericht ihn nicht an die medizinische, sondern müsste (der Inkompetenz des Gerichtshofes halber) ihn an die philosophische Fakultät verweisen. Denn die Frage: ob der Angeklagte bei seiner Tat im Besitz seines natürlichen Verstandes- und Beurteilungsvermögens gewesen sei, ist gänzlich psychologisch und, obgleich körperliche Verschrobenheit der Seelen vielleicht wohl bisweilen die Ursache einer unnatürlichen Übertretung des (jedem Menschen beiwohnenden) Pflichtgesetzes sein möchte, so sind die Ärzte und Physiologen überhaupt doch nicht so weit, das Maschinenwesen im Menschen so tief einzusehen, dass sie die Anwandlung zu einer solchen Gräueltat daraus erklären oder (ohne Anatomie des Körpers) sie vorhersehen könnten …«5
Wer sich mit der Frage nach der Entstehung von Verrücktheit und Normalität, d. h. der vermeintlichen Natürlichkeit des Verstandes bzw. des jedem Menschen beiwohnenden Pflichtgesetzes und der vermeintlichen Unnatürlichkeit des Verstandes und des Übertretens von Pflichtgesetzen beschäftigt, gerät ganz schnell in eine Grauzone, in der die Grenzen zwischen den Territorien und Kompetenzbereichen unterschiedlicher Wissenschaften und gesellschaftlicher Institutionen aufgehoben sind oder sich überschneiden. Die Repräsentanten solcher Fachgebiete legen ihre zwangsläufig beschränkte Perspektive zugrunde und gelangen so zu ihren fachspezifischen Erklärungs- und Handlungsmodellen. Die Fach-Wahrheiten und -Idiotien der Physiologen geraten so in Konkurrenz zu denen der Psychologen, die der Soziologen zu denen der Theologen, die der Psychiater zu denen der Juristen. Jeder verwendet seine eigene Geheimsprache, welche dem Nichteingeweihten das Mitreden unmöglich macht.
In den letzten 40–50 Jahren wurde jedoch ein wissenschaftliches Modell entwickelt, das die Chance eröffnet, all die betroffenen Bereiche miteinander zu verbinden, die Fachgrenzen zu überschreiten und die Entwicklung einer gemeinsamen, übergeordneten Perspektive und Sprache zu ermöglichen: das Modell der Systemtheorie und Kybernetik, speziell das der Selbstorganisation. Sein Interesse gilt ganz allgemein der Entstehung und Aufrechterhaltung, der Störung, Veränderung und Auflösung von Ordnung. Gegenwärtig ist wohl kein anderer wissenschaftlicher Ansatz in gleicher Weise geeignet, der Vielschichtigkeit und Komplexität des Phänomens der Verrücktheit gerecht zu werden. Er lässt sich in der Biologie ebenso anwenden wie in Psychologie und Soziologie, in der Physik wie in der Philosophie.
Sein wesentlicher Vorzug besteht darin, dass er nicht nur neue Antworten auf alte Fragen liefern kann, sondern – weit wichtiger – neue Fragen zu alten Antworten: bis dahin Selbstverständliches wird unverständlich. Dass etwas selbstverständlich ist, heißt ja nicht, dass wir es verstehen, sondern nur, dass wir es nicht infrage stellen. Plötzlich bedarf nicht nur die Ausnahme von der Regel der Erklärung, sondern auch die Regel. Es ergibt sich unausweichlich die Frage, wie sich normale Strukturen entwickeln, wie sie hergestellt und aufrechterhalten werden.
Einer der Vorzüge dieses theoretischen Ansatzes besteht darin, dass er den Blickwinkel des Beobachters auf bis dahin Selbstverständliches verschiebt. Oft lassen sich dadurch Probleme auf ungewohnte Weise beschreiben und ungeahnte neue Auswege aus alten Sackgassen eröffnen. Gerade für die Behandlung von Verrücktheiten erscheint der Angehörigen, der Ärzte, der Therapeuten und der Helfer aller Art groß ist.
Doch auch für den nicht direkt Betroffenen kann die Beschäftigung mit der Verrücktheit von Nutzen sein, da der prinzipielle Unterschied zwischen den Verrücktheiten unserer privaten, gesellschaftlichen und politischen Lebensformen und denen, die in Irrenhäusern zu beobachten sind, gar nicht so groß ist.6
2 Das Modell der Selbstorganisation
Geist und Körper – Die Teilung des Individuums
Ob nun der Geist als willig und das Fleisch als schwach oder aber das Fleisch als willig und der Geist als schwach betrachtet wird, stets wird zwischen Körper und Geist unterschieden. Dies scheint eine der vielen Selbstverständlichkeiten unseres Sprachgebrauchs zu sein. Die Trennung zwischen beidem ist ja auch jedem unmittelbar einleuchtend, der sich geistig schon einmal aus einer langweiligen Gesellschaft entfernt hat, obwohl er körperlich anwesend blieb. Doch auch – oder gerade – wenn es unserer alltäglichen Erfahrung entspricht, stellt sich die Frage nach der Beziehung von Geist und Körper, von Leib und Seele, von Idee und Materie. Ganz besonders stellt sie sich natürlich, wenn die Rolle körperlicher und geistiger, ideeller wie materieller Prozesse bei der Entstehung der Verrücktheit untersucht werden soll.
Die Geist-Körper-Frage hat eine lange philosophisch-wissenschaftliche Tradition. Von alters her beschäftigen sich Philosophen (das waren früher einmal auch die Naturwissenschaftler) mit dem Problem, in welchem Verhältnis das Sein der Welt und die Erkenntnis von dieser Welt stehen. Als einer der wichtigsten Denker, der für die Entwicklung unseres heutigen, weitgehend naturwissenschaftlich geprägten Weltbildes wichtig geworden ist, muss Descartes genannt werden. Er hat eine klare Abgrenzung zwischen dem geistigen und dem materiellen Bereich vorgenommen, die bis heute nicht nur die Trennung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften mitbestimmt, sondern auch unsere Alltagsvorstellungen über die Beziehung von Leib und Seele, von den Dingen da draußen in der Welt und unserer Sicht von ihnen.
Descartes teilt die Welt in »res cogitans« und »res extensa«, was so viel heißt wie die denkende und die ausgedehnte Sache oder das denkende und das ausgedehnte Ding7: Geist und Körper. Beides sind für ihn unabhängig voneinander existierende Substanzen, die sich durch ihre Attribute, d. h. ihre Eigenschaften, ihr Wesen, ihre Natur, ausdrücken und aus sich selbst, ohne die Voraussetzung anderer Eigenschaften, begreifbar sind. Als Attribut des Geistes sieht er das Denken bzw. seine Modi des Fühlens, Wollens, Begehrens, Vorstellens, Urteilens (des Bejahens und Verneinens); als Attribut der Körper die Ausdehnung bzw. ihre verschiedenen Erscheinungsweisen wie beispielsweise die Lage, die Gestalt, die Bewegung, die Größe.
Die Grundlage, auf der Descartes’ System ruht, ist die Annahme eingeborener Begriffe (idea innatae). Mit ihrer Hilfe lässt sich die Wirklichkeit beschreiben und erklären. Da sie eingeboren sind, brauchen sie nicht hinterfragt zu werden – sie können es auch nicht. Einer dieser Begriffe ist Gott. Andere sind die logischen Grundprinzipien, die Ursache, die Ausdehnung, die Zahl, vor allem aber der Begriff der Substanz (des Dings). Es ist wichtig, diese Idee der eingeborenen Ideen in Erinnerung zu behalten, da sie bei den mit der Verrücktheit verbundenen Abläufen und Phänomenen von entscheidender Bedeutung sind (dies ist auch der Grund, warum hier Descartes so viel Raum gewidmet wird).
Von diesen Voraussetzungen, diesem Ist-Zustand, ausgehend entwirft Descartes sein Modell der menschlichen Erkenntnis. Seine Methode ist der Zweifel. Als wahr erkennt er nur an, was klar und deutlich als Wesen eines Gegenstandes einsichtig ist. Sein Zweifel gilt vor allem den Sinnen. Was sie vorspiegeln, darf nicht als wirklich akzeptiert werden. Lediglich an mir selbst kann ich als zweifelndes Subjekt nicht zweifeln, denn, um zweifeln zu können, muss ich sein. Die Selbstbezüglichkeit meines Denkens gibt mir die Gewissheit zu sein: »Cogito ergo sum«, ich denke, also bin ich.
Ganz nebenbei und unausgesprochen bedeutet dies, dass ich mich als von meinem Sein schließlich doch überzeugter Zweifler mit der res cogitans identifiziere. Mein Körper ist damit als Teil der res extensa von mir getrennt und zu einem außerhalb meiner selbst liegenden Objekt geworden.
Der Substanz des Denkens, in der durch die Selbstgewissheit des Denkenden ein fester Punkt gefunden wurde, stellt Descartes die Substanz der ausgedehnten Dinge gegenüber. Um beide Substanzen miteinander in Verbindung zu bringen und die Gesamtheit der Welt wieder herzustellen, benutzt er Gott. Der hat die Welt als Ganzes geschaffen (das ist für Descartes eine in der Idee Gottes gegebene Wahrheit), deshalb kann an der physikalischen Realität als Tatsache nicht gezweifelt werden. Gott ist vollkommen (wiederum ist dies eine für Descartes mit der Idee Gottes verbundene Selbstverständlichkeit), deshalb kann er nicht böse sein und nicht täuschen. Da er dem Menschen die Vernunft gegeben hat, kann der sich auf die Resultate seines rationalen Denkens auch verlassen. Insofern kann eine schlüssige Beziehung zwischen der gegenständlichen Wirklichkeit und den Ergebnissen rationalen Denkens hergestellt werden.8
Die Argumentation wirkt heute nicht mehr ganz so zwingend, wie sie zu Descartes Zeiten gewirkt haben mag. Besonders die Begründung dafür, dass der Mensch sich auf die Ergebnisse seines rationalen Denkens verlassen kann, nicht aber auf die seiner sinnlichen Wahrnehmung, wo doch beides von Gott gegeben wurde, lässt viele Fragen offen.
Es hat weitreichende Folgen, wenn der Rationalität ein besonderer Rang bei der Erkenntnis der Welt zugebilligt wird. Ihr Wahrheits- und Machtanspruch wurde ursprünglich wie der weltlicher Herrschaft mit ihrem Gottesgnadentum legitimiert. Auch wenn diese Begründung für die Wahrheit rationaler Erkenntnis nicht mehr verwendet wird, so ist doch der Anspruch, die Wahrheit zu erfassen, geblieben. Besonders wichtig ist dabei, dass auch die Außenperspektive der Beobachtung, wie sie Gott als Schöpfer aller Dinge zugebilligt wird, als Grundlage des vernünftigen Denkens vorausgesetzt wird. Das erkennende Subjekt ist nicht von dieser Welt: Es steht außerhalb der Dinge, aus denen die Welt zusammengesetzt ist, es ist von ihnen getrennt und schaut von draußen auf ihre Oberfläche.
Diese Subjekt-Objekt-Spaltung des Descartes’schen Erkenntnismodells geht durch die körperlich-geistige Ganzheit Mensch hindurch. Er kann und muss daher einem von ihm selbst zu unterscheidenden Objekt, genannt Körper, gegenüber und mit ihm in Interaktion treten. Es ist eine Spaltung, in der es durchaus einen Sinn ergibt, gegen die vom Körper ausgehenden Regungen und Wünsche zu kämpfen, ihn zu disziplinieren, zu unterwerfen und zu beherrschen; der Mensch braucht sich bei der täglichen Toilette nicht zu waschen, sondern nur seinen Körper. Diese Trennung zwischen Leib und Seele hat Descartes nicht erfunden; schließlich gibt und gab es die Idee der Seelenwanderung, des Wechsels der Seele von einem Körper in einen anderen, ihres Weiterlebens nach dem Tode und ähnliche Vorstellungen seit Jahrtausenden. Sie bilden die Grundlage vieler großer Weltreligionen. Auch im Christentum, dessen Gott für Descartes’ Verbindung zwischen res cogitans und res extensa solch eine wichtige Rolle einnimmt, ist diese Trennung ein wichtiger Bestandteil.
Will man das kartesianische Erkenntnismodell und Weltbild zusammenfassen, so muss zunächst festgestellt werden, dass er von einer Welt ausgeht, die so ist, wie sie ist. Sie ist von Gott geschaffen, wie eine Maschine von einem Ingenieur konstruiert und zusammengebaut. Ihre Bestandteile sind einzelne Dinge, die in ihren Eigenschaften nicht aufeinander zurückzuführen sind. Diese Maschine bewegt sich zwar, ihre Mechanismen sind jedoch statisch und unveränderlich. Die Wechselbeziehungen dieser in ihrem Wesen unabhängig voneinander existierenden Objekte sind durch mechanische Gesetze bestimmt. Ursache und Wirkung sind so miteinander verknüpft, dass die Ursache die Wirkung bestimmt. Der Geist, der nach Erkenntnis strebt, steht dieser Maschine gegenüber. Seine Beobachtungen haben im Prinzip keinen Einfluss auf die beobachteten materiellen Prozesse. Den Regeln der Mechanik in der Welt draußen entsprechen die Regeln der Vernunft drinnen. Die Wahrheit kann nur durch das Befolgen dieser Regeln gefunden werden. Erkenntnis ist, wenn sie gelingt, ein Abbild der Wirklichkeit. Angestrebt wird die Berechenbarkeit und Vorhersagbarkeit dieser Uhrwerk-Welt.
Mit seiner Trennung von res cogitans und res extensa, von Beobachter und beobachtetem Objekt, hat Descartes einen geschickten Schachzug vollzogen. Er hat verhindert, dass irgendwann einmal die res cogitans selbst zum Gegenstand der Erkenntnis gemacht werden könnte. Wenn die Begriffe eingeboren sind und Gott dafür sorgt, dass die Beziehung zwischen ihnen und ihrer Bedeutung angemessen ist, so braucht man sich mit der Frage nach dem Verhältnis von Körper und Geist nicht mehr zu beschäftigen. Das Problem der Selbstbezüglichkeit der Erkenntnis, der Erkenntnis, die sich selbst zu erkennen sucht und schon manchem Philosophen zu den standesgemäßen grauen Haaren verholfen hat, taucht nicht auf.
Die Trennung zwischen Subjekt und Objekt der Erkenntnis bricht zwangsläufig zusammen, wenn ein Mensch sich selbst beobachtet. Das Unteilbare (Individuum) wird geteilt, wenn nach kartesianischem Muster mit dem eigenen Körper, dem eigenen Erleben, Denken, Fühlen, Verhalten verfahren wird. Stellt man die Frage nach der Beziehung zwischen Körper und Seele, zwischen Geist und Materie, Idee und Leib, so kann man die Teilung des Individuums in zwei gegeneinander abgegrenzte und unvermittelbar nebeneinander stehende Wirklichkeitsbereiche nicht als gottgegeben und selbstverständlich hinnehmen. Man braucht ein theoretisches Modell, das diese Spaltung überwindet und nicht allein die Eigenschaften irgendwelcher isoliert nebeneinander stehender Substanzen, sondern die Eigenschaft dieser Eigenschaften, miteinander in Beziehungen zu stehen, erfasst.
Der Teil, das Ganze und die Umwelt
In nahezu allen traditionellen Wissenschaftsbereichen – den naturwie auch den geisteswissenschaftlichen – haben in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die Modelle der Kybernetik9 und Systemtheorie eine große Verbreitung und Anwendung gefunden. Sie können nicht nur als neue Wissenschaften angesehen werden, die neben die bereits bestehenden Fachgebiete getreten sind, sondern als eine neue Sichtweise, welche die herkömmlichen Grenzen der Einzeldisziplinen überschreitet (ohne sie zu missachten). Sie entwickelten sich zunächst ganz in der Tradition des kartesianischen Weltbildes. Vorausgesetzt wurde, dass der Beobachter das untersuchte Objekt (genannt System) aus der Außenperspektive wahrnimmt (die bekannte und ja auch vielfach bewährte Subjekt-Objekt-Spaltung der Erkenntnis). Da dieses Modell zunächst von Ingenieuren entwickelt wurde, die sich mit der Konstruktion und Steuerung von Maschinen beschäftigten, war diese Außenperspektive naheliegend und sinnvoll. Man konstruierte oder untersuchte Systeme, d. h. irgendwelche aus mehreren Teilen zusammengesetzte Gegenstände, deren Verhalten auf das Zusammenwirken aller seiner Teile zurückzuführen war. Das Interesse richtete sich nicht auf die materiellen Eigenschaften dieser Ganzheiten und ihrer Teile, sondern auf ihr Verhalten, seine Regelung und Kontrolle.
Als diese Ingenieure dann Automaten wie beispielsweise den Thermostaten bauten, die wundervoll funktionierten, stellte sich heraus, dass man bei der Erklärung ihrer Arbeitsweise mit einigen lieb gewonnenen Vorstellungen über die Beziehung von Ursache und Wirkung in Konflikt geriet. Es ist eine der Grundlagen unseres naturwissenschaftlich-technischen Weltbildes, dass ein Ereignis, das als Ursache für ein anderes Ereignis angesehen werden will, gefälligst zeitlich vor dieser Wirkung stattzufinden hat. Derartige Automaten sind aber in der Lage, bestimmte Verhaltensweisen zu kontrollieren – zum Beispiel das Anspringen der Heizung bei Abkühlung des Raumes –, weil das Zusammenspiel ihrer Teile so organisiert ist, dass eine klare Unterscheidung zwischen Wirkung und Ursache unmöglich ist. Eine Verhaltensweise entfaltet Wirkungen auf ihren weiteren Verlauf. Sie ist in der Lage, sich gewissermaßen selbst zu korrigieren, indem Störungen und Abweichungen von einem angestrebten Sollwert ausgeglichen werden.
Biologen, welche herauszufinden suchten, wie bestimmte körperliche Strukturen und Gleichgewichtsformen in Organismen aufrechterhalten werden, fanden überall dort, wo es um die Stabilität von Lebensprozessen geht, derartige Rückkopplungsschleifen. Die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur von ca. 37°C kann als Beispiel für ein solches Regelungsprinzip angesehen werden.
Will ein Beobachter die Dynamik solcher Abläufe analysieren, so ist es ihm unmöglich, guten Gewissens eine geradlinige Ursache-Wirkungs-Beziehung zu beschreiben. Er kann weder der hohen Raumtemperatur die Schuld dafür geben, dass die Heizung nicht anspringt (schließlich hat die Heizung selbst dafür gesorgt, dass sie nichts mehr zu tun hat), noch kann er der Heizung vorwerfen, sie habe den Raum so sehr erwärmt (schließlich hat die abgekühlte Raumtemperatur selbst den Schalter der Heizung betätigt).
Wo die Verknüpfung zwischen einem bestimmten Zustand oder Ereignis E und anderen Ereignissen oder Zuständen (E1, …, Em) so ist, dass sich ein Zirkel bildet, sind diese anderen Ereignisse (E1, …, Em) nicht nur die hinreichenden (eventuell auch notwendigen) Bedingungen für E, sondern E ist auch eine Bedingung für E1, …, Em. Die stattfindenden Ereignisse oder Zustände lassen sich durch ein Gesetz beschreiben, durch das ursächliche und bewirkte Ereignisse rekursiv, d. h. im Kreise zurücklaufend, miteinander verknüpft sind. Ihre Interaktion ist so organisiert, dass beide sich gegenseitig stabilisieren. Jede Wirkung kann als Ursache einer Wirkung betrachtet werden, die selbst wieder Ursache dieser Wirkung ist. Häufig ist solch ein Kreis natürlich erheblich weiter gezogen, es sind eine ganze Menge solcher Ursachen und Wirkungen beteiligt, sodass schließlich meist der Überblick verloren geht. Dennoch kann auch bei sehr viel komplizierteren dynamischen Systemen solch eine zirkuläre Organisationsform beschrieben werden, in der die es bildenden Ereignisse und Zustände eine selbstbezügliche Wirkung entfalten.
Wenn Kybernetik und Systemtheorie es auch nicht erlauben, Ursache-Wirkungs-Beziehungen im herkömmlichen Sinne festzustellen, so ermöglichen sie es doch, logische Verknüpfungen und Gesetzmäßigkeiten (Wenn …, dann …) zu beschreiben. Im Unterschied zur kausalen Erklärung wird dabei nicht einem Ereignis oder Zustand oder auch dem Verhalten eines Elements des untersuchten Systems als Ursache die Verantwortung oder Schuld für andere Ereignisse und Zustände oder die Verhaltensweisen der anderen Elemente eines Systems zugeschrieben. Es wird eine Ganzheit betrachtet, deren Elemente in einem Netzwerk von Wechselbeziehungen miteinander verbunden sind, in dem jedes die Bedingungen aller anderen bestimmt. Untersuchungsgegenstand sind dementsprechend Strukturen und Funktionen, die Beziehungen von Elementen innerhalb eines Gesamtgefüges, die Regeln der Interaktion, die Umwandlungen und Veränderungen von Systemzuständen und -strukturen.
Die Frage nach der Beziehung der Teile zum Ganzen bildet aber nur einen Aspekt von Kybernetik und Systemtheorie. Den zweiten und in den letzten Jahren mehr in den Vordergrund tretenden Schwerpunkt bildet die Untersuchung der System-Umwelt-Unterscheidung10. Welchen Einfluss haben Veränderungen in der Umwelt eines Systems auf innersystemische Prozesse? Wie entsteht ein System als eine abgegrenzte und unterscheidbare Einheit, d. h., wie entsteht der Unterschied zwischen System und Umwelt, wie wird er in der Interaktion des Systems mit seiner Umwelt erhalten, wie entwickelt und bewahrt das System seine Struktur und Gestalt?
Die Tatsache, dass systemische Konzepte so abstrakt und nicht an bestimmte materielle Inhalte gebunden sind, ermöglicht ihre Anwendung in nahezu allen Wissenschaftsbereichen. Sie sind der Mathematik zu vergleichen, die auch nicht festlegt, dass beim Zusammenzählen von drei und vier stets Äpfel oder Birnen gemeint sein müssen. Die Prinzipien des Zählens und der Grundrechenarten lassen sich auch auf alle anderen konkreten Gegenstände anwenden, ohne dass man ein Spezialwissen über sie braucht. In derselben Weise kann man den »System«-Begriff und kybernetische Konzepte in Fachgebieten anwenden, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. So wie die drei Äpfel und vier Birnen zusammengezählt etwas Neues ergeben (sieben: eine andere Zahl von Früchten), lassen sich dann bei der Frage nach dem Verhältnis von Geist und Körper Wechselbeziehungen zwischen körperlichen und geistigen Prozessen, Umformungen des einen in das andere, Abgrenzungen gegeneinander und gegenüber einer gemeinsamen Umwelt, die Entstehung und Aufrechterhaltung spezifischer Strukturen, die Bildung und Auflösung von Einheiten und ähnliches studieren. Es wird dabei nicht mehr nach der Beziehung zweier unterschiedlicher Substanzen gefragt, sondern nach der Beziehung von Regelungsmechanismen, nach der Entwicklung und Erhaltung von Ordnung, ihrer Veränderung und Zerstörung. Unter diesem Blickwinkel gehören Geist und Körper zu einem einheitlichen Gegenstandsbereich.
Lebende Systeme
Was für Descartes keiner Erklärung bedurfte, ist aus kybernetischer Perspektive höchst rätselhaft: die Tatsache, dass etwas so bleibt, wie es ist, oder zumindest uns als Beobachtern so erscheint.
Descartes beschreibt eine Welt, die (gott)gegeben ist, wie sie nun einmal ist. Der Mensch ist in diese Welt der Dinge und Sachen hineingesetzt und muss sich Gedanken über deren Sein (den Ist-Zustand) machen. Dies wie auch sein Umgang mit diesen Dingen gehört zu den Merkmalen der res cogitans, des Geistes. Er versucht herauszufinden, nach welchem Bauplan diese Welt von Gott, diesem großen Konstrukteur und Skulpteur, geschaffen worden ist. Die mechanischen Gesetze bilden das Musterbeispiel dieses Bauplans. Wenn man sie erkannt hat, so kann man mit den Dingen besser umgehen und sie sich untertan machen. Die Statik der Ordnung dieser Welt ist eine ihrer Selbstverständlichkeiten. Erklärungsbedürftig sind stets die Veränderungen, die Bewegung, die Dynamik. Die stillschweigende Vorannahme dieses Weltbilds lautet: Alles bleibt wie es ist, es sei denn, irgendjemand sorgt dafür, dass es verändert wird.
Aus kybernetisch-systemischer Sicht ist dagegen die Bewegung all dessen, was existiert, und seine ständige Veränderung selbstverständlich. Wo Dynamik und Veränderung vorausgesetzt sind, wird Beständigkeit und Statik zum Rätsel: Wie lässt sich erklären, dass wir als Beobachter den Eindruck gewinnen, in einer Welt von Dingen und Objekten zu leben? Schließlich scheinen viele der Gegenstände, mit denen unsere Umwelt möbliert ist, ihre Formen und ihre Eigenschaften recht zuverlässig zu bewahren.
Zweifellos hat sich das traditionelle, stillschweigend Statik voraussetzende, Modell in vielen Bereichen unseres Alltags wie auch der Naturwissenschaften sehr bewährt. Dort, wo es um Lebensprozesse geht, ist sein Nutzen jedoch begrenzt. Es ist mit der Gefahr verbunden, dass gerade von dem abstrahiert wird, was Lebensprozesse charakterisiert: ihrer Dynamik und Prozesshaftigkeit.
Ein Beispiel soll den Unterschied zwischen statischen Systemen, zu deren kunstgerechter Behandlung die Gesetze der Mechanik erfolgreich angewendet werden können, und lebenden Systemen und deren Behandlung ein wenig verdeutlichen.
Betrachten wir ein Auto als Beispiel solch eines statischen Systems. Ein Konstrukteur hat es sich ausgedacht, einen Bauplan erstellt, Arbeiter und Maschinen haben dann seine Bestandteile hergestellt (Motor, Getriebe, Karosserie, Sitze, Scheiben, Räder und Aschenbecher). Es ist aus einer Menge solcher Einzelteile zusammengesetzt. Wenn dieses Wunderwerk menschlicher Schöpfung erst einmal fertiggestellt ist, dann bleibt es so, wie es ist, es sei denn irgendwelche von außen kommenden Kräfte wirken auf dieses System ein. Der Kotflügel behält die wunderbar runde Gestalt, die den stolzen Autobesitzer in stille Andacht versetzt, bis sie dem lieben Nachbarn nicht gefällt, und er mit seiner nur Hohn und Mitleid erntenden alten Schrottkiste eine Beule in sie fährt. Der Lack bewahrt seinen Glanz, bis Wind und Wetter ihn ermatten. Und das Auto als Ganzheit löst sich in seine Bestandteile auf (die meist auch noch ihre Form verändern), wenn die Interaktion mit einem Baum zu heftig und mit zu großer Geschwindigkeit erfolgt. Auch wenn es bis zu diesem Totalschaden bewegungsfähig blieb, so konnte das Auto vom Beobachter mit gutem Grund als ein statisches System betrachtet werden. Die Beziehung seiner Teile zueinander blieb ganz unbewegt so, wie sie von ihren Schöpfern vorgegeben wurde. Jede Veränderung bedurfte einer äußeren Kraft, die auf dieses System einwirkte. So ließ sich auch die Beule aus dem Kotflügel nur durch die von außen einwirkende Aktivität eines Gummihammers wieder beseitigen. Ohne sein segensreiches Wirken wäre die Beule geblieben, wo sie die traumatische und somit eindrucksvolle Begegnung mit dem Nachbarn geschaffen hatte. Das System Auto blieb bei seiner Reparatur ebenso passiv, wie es auch schon seine eigene Schöpfung ohne aktiven Widerstand über sich hatte ergehen lassen.
Ganz anders ist die Situation bei einem lebenden System. Wenn sich ein Mensch beispielsweise beim Zusammenstoß mit einer Schranktüre eine Beule an der Stirn zuzieht, so verschwindet diese Beule nach einigen Tagen von allein. Das lebende System Mensch bedarf also keines von außen kommenden Gummihammers, keines Mechanikers, der irgendwelche Schäden aktiv beseitigt, während das beschädigte System passiv bleibt. Es repariert sich selbst. Falls nun aber dennoch jemand über längere Zeit mit einer Beule am Kopf herumläuft, so ergibt sich ganz anders als beim Auto die Frage: Wie schafft er das? Die Antwort lautet dann wahrscheinlich, dass er jeden Tag einmal mit dem Kopf gegen den Schrank rennt. In diesem Fall bedarf also die Aufrechterhaltung einer bestimmten Struktur (der Beule) der Erklärung, da sie normalerweise ganz selbstverständlich verschwindet. Dasselbe gilt für die Kratzer im Lack eines lebenden Wesens.
Der Unterschied zwischen den beiden Beulen und ihrer Geschichte dürfte deutlich sein. Er wird praktisch immer dort wichtig, wo es um die therapeutische Kunst, den Umgang mit Menschen und menschlichen Systemen geht, um Pädagogik, Psychotherapie oder Organisationsberatung, um den Unterschied zwischen Mechaniker und Arzt, aber auch um die Erklärung chronifizierter Störungen, d. h. über längere Zeiten andauernde Abweichungen von einer biologischen oder Verhaltensnorm.
Unausweichlich ergibt sich die Frage, wie denn eigentlich die normalen Strukturen hergestellt und aufrechterhalten werden. Um es mit den Worten Lichtenbergs zu sagen:
»Es ist doch verwunderlich, dass der Katze gerade dort zwei Löcher ins Fell geschnitten sind, wo die Augen sitzen.«11
Der auffallendste Unterschied zwischen einem statischen und einem lebenden System besteht darin, dass lebende Strukturen aktiv aufrechterhalten werden müssen. Beständigkeit und Mangel an Veränderung bedürfen der Aktivität: Alles verändert sich, es sei denn, irgendwer oder -was sorgt dafür, dass es bleibt, wie es ist.
Ein gutrasierter Mann bleibt nur so lange ein gutrasierter Mann, wie irgendwer dafür sorgt, dass er es bleibt (heutzutage sind es meist er selbst und sein Rasierapparat). Die allmorgendliche Rasur ist in diesem Fall die Aktivität, die nötig ist, um den Status quo – die Eigenschaft »gut rasiert« – zu bewahren. Eine nie endende, in regelmäßigen Abständen auftauchende Notwendigkeit, die den Vergleich mit den Mühen des Sisyphus verdient.
Ein lebender Organismus bedarf bestimmter Aktivitäten, damit er ein lebender Organismus bleibt. Es sind zum einen Prozesse, die in ihm ablaufen (z. B. der Kreislauf, der Stoffwechsel), zum anderen eng damit zusammenhängende Verhaltensweisen, die er vollziehen muss (z. B. Essen, Trinken, Ausscheiden). Es ist das Funktionieren der körperlichen Strukturen, das diese Strukturen bewahrt. Die Biologen Humberto Maturana und Francisco Varela geben diesem Prozess der Selbsterschaffung und -erhaltung des Organismus den Namen »Autopoiese«12. Sie beschreiben damit Leben als einen Prozess, bei dem sich lebende Systeme als Einheiten selbst produzieren. Auch wenn der Begriff es suggeriert, meint Autopoiese also nicht die oben beschriebene Herstellung eines Autos durch den Konstrukteur und die Mechaniker mit ihren Maschinen, sondern einen Prozess, bei dem der Unterschied zwischen demjenigen, der konstruiert, und dem, was konstruiert wird, zwischen dem Werkzeug und dem Werkstück, zwischen Fabrik und Fabrikat aufgehoben ist.
Auch hier lässt sich wie beim Thermostat aus der Perspektive des außenstehenden Beobachters eine Rückkopplungsschleife, die Selbstbezüglichkeit der Wirkung von Prozessen, beschreiben. Nur wird hier nicht solch ein banaler Wert wie die Raumtemperatur konstant gehalten, sondern eine physische Struktur. Es findet eine Schöpfung statt, bei der zwischen ihrem Subjekt und Objekt, zwischen der geschaffenen Kreatur und ihrem Kreateur nicht mehr unterschieden werden kann.
Die Entwicklung und Autonomie der Dinge
Die Beziehungen zwischen den Dingen, Sachen, Gegenständen, Objekten und ihren Eigenschaften, Verhaltensweisen und Wirkungen sind den Annahmen des kartesianisches Weltbildes gemäß unabhängig vom Beobachter. Die Objekte werden als isolierte Einheiten betrachtet und auf ihre Merkmale und Charakteristika hin untersucht. In Abbildung 1 ist der Zusammenhang zwischen der Struktur und Funktion eines Objekts, wie er in diesem Konzept angenommen wird, skizziert.
Der Beobachter kann hier zwar über »das Ding an sich« nichts sagen, aber über seine äußerlich wahrnehmbare Form, seine Eigenschaften und seine Struktur (wobei diese Begriffe meist nicht klar gegeneinander abgegrenzt verwendet werden). Auch über das Verhalten dieses Dings kann er etwas sagen, seine Wirkung auf irgendwelche anderen
Abb. 1
Dinge, sein Funktionieren und seine Funktion. Er kann zwischen Struktur und Funktion, d. h. der Bau- und Wirkungsweise eines betrachteten Gegenstands, trennen. Meist geschieht dies so, dass die Besonderheiten der Bauweise die Erklärung für die spezielle Funktionsweise liefern. Eine Waschmaschine ist eben so gebaut, dass sie Wäsche waschen kann. Die Wirkungsweise solch eines Gegenstandes verbindet ihn mit den Gegenständen seiner Umwelt, denen er sie angedeihen lässt (die Waschmaschine mit der Wäsche).
Der Unterschied, der durch die Selbstbezüglichkeit der Funktionsweise lebender Systeme entsteht, wird durch Abbildung 2 illustriert.
Abb. 2
Sie arbeiten so wie eine (von Menschenhand bislang noch nicht geschaffene) Waschmaschine, die in der Lage ist, sich selbst zu waschen. Struktur und Funktion befinden sich in einer Wechselbeziehung, sodass der Beobachter die Wahl hat, die Funktion durch die Struktur oder die Struktur durch die Funktion zu erklären. Die Unterscheidung zwischen beidem erscheint recht willkürlich und daher fragwürdig. Beides ist lediglich ein unterschiedlicher Aspekt des identischen Prozesses, der schließlich dazu führt, dass der außenstehende Beobachter eine stabile, gegenüber der Umwelt abgegrenzte Einheit wahrnehmen kann: die Katze mit stets denselben Löchern an der Stelle, wo die Augen sitzen.
So kann beispielsweise die Entstehung einer Zellmembran als Ergebnis des Zellstoffwechsels angesehen werden. Der ist jedoch nur möglich, weil die Zellmembran als Grenze gegenüber der Umwelt wirkt und so den Binnenraum für den Stoffwechsel schafft.13Die System-Umwelt-Unterscheidung, die Einheit Zelle, wird durch diesen zirkulären Prozess hervorgebracht und aufrechterhalten.
Der Prozess, durch den lebende Strukturen ihre Gestalt erhalten, ist also noch angemessener durch Abbildung 3 dargestellt:
Abb. 3
Die Tätigkeiten und Wirkungsweisen des Organismus, seine Operationen, wirken auf ihn selbst zurück. Sie sind selbstbezüglich. Nicht die Umwelt oder irgendwelche Ursachen in dieser Umwelt sorgen dafür, dass ein Lebewesen seine Form erhält, sondern das System selbst. Dieser Vorgang wird als »operationale Schließung« bezeichnet; er kann als das entscheidende Merkmal der Autonomie lebender Systeme angesehen werden.14
In seinen Arbeiten zur Ökologie des Geistes interpretiert Gregory Bateson diese Art der Entstehung von Ordnung durch selbstbezügliche, sich selbst aufrechterhaltende Prozesse als Geist.15 Und er sieht nicht nur Lebensprozesse nach diesem Muster organisiert, sondern alle stabilen Strukturen. Auch unser oben als Beispiels einer statischen Struktur verwendetes Auto kann als Ergebnis solch eines selbstbezüglichen, operational geschlossenen Prozesses betrachtet werden. Nur spielen sich diese Prozesse, welche die unbelebten Objekte ihre Form und Struktur bewahren lassen, in einem anderen Wahrnehmungs- und Phänomenbereich, in einer anderen Größenordnung ab: auf der molekularen Ebene. Um ihrer gewahr zu werden, müssen andere Methoden der Beobachtung und Untersuchung angewendet werden. Mit diesem umfassenden Verständnis von Geist als Selbstbezüglichkeit kann Bateson Geist und Natur als eine untrennbare Einheit betrachten. Das ganze Universum kann dann nicht nur als ein einziger, fortdauernder Prozess der Selbstorganisation verstanden werden, sondern als ein geistiger Prozess.16 Die Geist-Materie-Unterscheidung wird überflüssig, da die materiellen Dinge Ergebnis geistiger Prozesse sind.
Man kann sich darüber streiten, ob ein so weitreichendes Verständnis von Geist sinnvoll und nützlich ist. Auf jeden Fall erscheinen auch die Merkmale geistiger Tätigkeit, des Denkens, Fühlens und Handelns, die Entwicklung und Stabilisierung seelischer Strukturen in einem neuen Licht, wenn man sie – wie alle anderen Lebensprozesse auch – als Ergebnis solch selbstbezüglicher, sich selbst ordnender und stabilisierender Abläufe sieht. Das verrückte Verhalten eines Patienten kann dann nicht allein auf eine irgendwann früher einmal gestörte Struktur, das psychische Trauma, die Beule aus der frühen Kindheit oder eine gegenwärtig gestörte biologische Funktion zurückgeführt werden. Stattdessen muss der Prozess der Selbstorganisation der Verrücktheit als Teil der Selbstorganisation aller geistiger Prozesse (im engeren, herkömmlichen Sinne) untersucht werden.
Die Kybernetik der Kybernetik
Der Glaube an die Möglichkeit objektiver, von den Bedingungen des Beobachters unabhängiger, menschlicher Erkenntnis schwand dahin, als Kybernetiker begannen, ihre Theorien über die selbstbezügliche Organisation lebender Systeme auch auf sich selbst zu beziehen. Bei all ihren Aussagen über Systeme hatten sie stillschweigend vorausgesetzt, dass sie außerhalb dieser Systeme stehen und von draußen auf etwas schauen, das unabhängig von ihnen und ihrer Beobachtung abläuft. Nunmehr mussten sie diese Selbstgewissheit infrage stellen. Betrachtet man das größere, übergeordnete System »Beobachter plus von ihm beobachtetes System«, so kann man nicht länger von der Außenperspektive der Beobachtung ausgehen. Der (angeblich) unbeteiligte Beobachter sieht sich plötzlich als teilnehmenden Beobachter, der sich selbst verdächtigen muss, die Verhaltensmuster eines von ihm »erkannten« Systems nicht nur zu beschreiben, sondern zu stabilisieren oder, schlimmer noch, erst auszulösen. Aus dem neutralen und harmlosen, objektiven Chronisten wird der Agent provocateur.
Mit der Beobachtung der Beobachtung wird der konsequente Schritt von der Kybernetik zur Kybernetik der Kybernetik, d. h. der Anwendung kybernetischer Konzepte auf die Kybernetik selbst, vollzogen.17 Die Kybernetik der Kybernetik, auch Kybernetik 2. Ordnung genannt, untersucht die Wechselwirkung zwischen dem erkennenden Subjekt und dem Gegenstand seiner Erkenntnis. Wenn der Beobachter durch die Beobachtung in die selbstbezüglichen, das beobachtete System in seiner Struktur und Funktion erschaffenden und erhaltenden Prozesse eingreift, könnte es durchaus sein, dass er das, was er beobachtet, verändert, erhält oder erschafft. Die Aussagen über das Objekt sind deshalb stets Aussagen über den Beobachter, seine Strukturen und Verhaltensweisen (Abb. 4).
Abb. 4
Dass menschliche Erkenntnis Rückwirkungen auf das hat, was erkannt wird, scheint auf den ersten Blick unserem alltäglichen Verständnis von Erkennen und Wissen zuwiderzulaufen. Wenn jemand weiß, dass er einige hundert Meter geradeaus fahren und dann rechts abbiegen muss, um zum Bahnhof zu kommen, so verändert dieses Wissen nicht die Lage des Bahnhofs. Anders stellt sich die Situation dar, wenn er weiß, welchen Weg er zu nehmen hat, um zu einem einsamen Strand zu gelangen. Wissen erst genügend Leute von diesem einsamen Strand, dann bleibt seine Lage zwar dadurch auch unberührt, aber einen einsamen Strand wird es dort nach einiger Zeit nicht mehr geben.