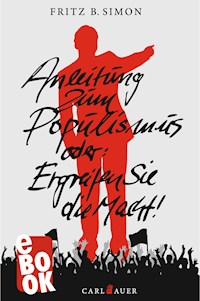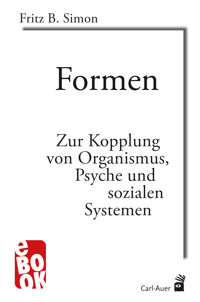Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Systemische Horizonte
- Sprache: Deutsch
Es vergeht kein Tag, ohne dass uns Nachrichten von Konflikten in unserer näheren oder weiteren Umgebung erreichen, die sich zutreffend nur als Krieg bezeichnen lassen. Krieg kann als ein Konflikt verstanden werden, bei dem die beteiligten Parteien ihr Überleben riskieren. Das gilt nicht nur für Konflikte zwischen Nationen, sondern auch für andere soziale Einheiten wie Firmen, Organisationen, Stämme, Banden usw., ja, auch für Individuen. Beispiele sind das Duell oder die manchmal in Mord und Totschlag endenden Konflikte zwischen Ehepartnern. In diesem Buch werden die Entstehungsbedingungen von Kriegen aus systemtheoretischer Perspektive analysiert. Der Autor bezieht dabei sowohl biologische und psychoanalytische Modelle als auch soziologische Erkenntnisse ein. Ergebnis ist, dass solche Kämpfe im allgemeinen nicht um irgendwelcher wirtschaftlicher oder triebhafter Interessen willen ausgefochten werden, sondern dass es um scheinbar so antiquierte Werte wie Ehre, Stolz und Status geht. Kriege sind nach Auffassung des Autors deshalb als Fortsetzung des Sports mit anderen Mitteln zu verstehen und, nicht zu vernachlässigen, als ultimative Form des Entertainments – zumindest für die nicht direkt beteiligten Beobachter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tödliche Konflikte
Fritz B. Simon
Zur Selbstorganisation privater und öffentlicher Kriege
Dritte Auflage, 2022
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Tom Levold (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin † (Heidelberg)
Karsten Trebesch (Berlin)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Umschlaggestaltung: Uwe Göbel, München
Satz und Diagramme: Paul Richardson
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI Druckdienstleistungen GmbH, Erfurt
Dritte Auflage, 2022
ISBN 978-3-89670-427-3 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8367-9 (ePub)
© 2001, 2022 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/.
Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 • Fax +49 6221 6438-22
Inhalt
Danksagung
Einführung
Der Krieg zum Buch – Einige persönliche Vorbemerkungen zum 11. September 2001 und seinen Folgen
I. Theoretische und methodische Grundlagen
1. Vorbemerkung
2. Merkmale der Unterscheidung von „Krieg“
3. Analyseinstrumentarium
II. Krieg und Frieden als Dauerzustand
1. Krieg ohne Ende – Fidschi als idealtypisches Modell
2. Hundert Jahre Frieden – Die Xingu-Indianer als idealtypisches Modell
3. Oszillation zwischen Krieg und Frieden bei den Tsembaga
4. Fidschi, Xingu, Tsembaga – Einige Unterschiede und Gemeinsamkeiten
III. Krieg als Ausnahmezustand mit eindeutigem Anfang und Ende
1. Der trinitarische Krieg
2. Der Erste Weltkrieg
3. Kriegsursache: Inkompetenz der Führer oder machtpolitische Konstellation?
IV. Krieg mit schleichendem Beginn
1. Rebellen, Guerillas und Freiheitskämpfer – Der Low Intensity Conflict
2. Der Vietnamkrieg
3. Muster der Entscheidungsprozesse – Die Innenperspektive eines Beteiligten
V. Der ritualisierte, zeitlich und örtlich verabredete Zweikampf
1. Das Duell als Zweipersonenkrieg
2. Ehrenhändel
3. Die Ritualisierung des Duells
4. Die Funktion des Duells
5. Nichtkriegerische „Duelle“
VI. Krieg ohne Ende
1. Blutrache
2. Blutrache als Entwicklungsstufe des Rechtssystems
3. Gruppensolidarität in der Beziehung zu Außenfeinden
4. Regularien der Blutrache
VII. Augenblickskriege – Totschlag im Affekt
1. Fallbeispiel
2. Ehekrieg
3. Das Paradox der Selbstkontrolle
VIII. Biologische und psychologische Bedingungen des Krieges
1. Körper und Psyche als Umwelten sozialer Systeme
2. Die Kopplung von Körper und Psyche
3. Verhaltensforschung (Ethologie)
4. Psychoanalyse
5. Affektlogik
IX. Die expressive Ordnung
1. Störungen des Gleichgewichts und Ausgleichshandlungen
2. Stolz und Ehre
3. Kontenausgleich
4. Schismogenese
X. Soziale Funktionen des Krieges
1. Funktion versus Intention
2. Soziale Konflikte
3. Krieg als autopoietisches System
4. Durch Krieg bewirkte Veränderungen
5. Krieg als Mittel zum Zweck
6. Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln?
7. Bedingungen der Entstehung von Kriegen
XI. Die Lust am Kämpfen
1. Krieg als quasireligiöse Erfahrung
2. Krieg als Entertainment – Die Suche nach dem „Kick“
3. Kriegsgeschichten – Die Reise des Helden
XII. Die Logik des Krieges
Nachtrag
Ein Angriff auf die USA?
Nicht gewinnbare Kriege
Der Versuch, aus einem Low Intensity War einen traditionellen Krieg zu machen
Die Zivilisierung der Konfliktlösung und die mögliche Rolle der UNO
Literaturverweise
Literaturverzeichnis
Register
Über den Autor
Danksagung
Für wertvolle Anregungen, Kritik und Hinweise danke ich Bernhard Blanke, Helm Stierlin, Paul Watzlawick und Rudi Wimmer. Trotzdem sind natürlich alle Unrichtigkeiten, Fehleinschätzungen usw. allein mir zuzurechnen.
Einführung
„Uranos zeugte mit Mutter Erde die Titanen, nachdem er seine aufständischen Söhne, die Kyklopen, in den Tartaros geworfen hatte. Dies ist ein finsterer Ort in der Unterwelt, der so weit von der Erde liegt wie die Erde vom Himmel … Auf Rache sinnend, verleitete Mutter Erde die Titanen, den Vater anzugreifen. Geführt von Kronos, dem jüngsten der sieben, den die Mutter mit einer Sichel aus Feuerstein bewaffnet hatte, überraschten sie Uranos im Schlafe. Und mit der steinernen Sichel entmannte der erbarmungslose Kronos den Uranos … Die Titanen befreiten dann die Kyklopen aus dem Tartaros und sprachen die Oberherrschaft über die Erde dem Kronos zu. Kaum befand sich Kronos im Besitze der Macht, verbannte er die Kyklopen zusammen mit den Hundertarmigen wieder in den Tartaros und regierte, nachdem er seine Schwester Rhea zur Frau genommen hatte, in Elis … Doch wurde ihm von der Mutter Erde und von seinem Vater Uranos vorausgesagt, daß einer seiner eigenen Söhne ihn entthronen würde. Daher verschlang er alljährlich die Kinder, die ihm Rhea gebar … Rhea war voll Zornes. Sie gebar Zeus, ihren dritten Sohn, in finsterer Nacht auf dem Berge Lykaion in Arkadien, wo kein Wesen Schatten wirft … Die goldene Wiege des Kindes Zeus hing hoch in einem Baume, daß ihn Kronos nicht finden sollte, weder im Himmel noch auf Erden, noch im Meere … Rhea hatte einen Stein in Windeln gewickelt und ihn Kronos auf dem Berge Thaumasion in Arkadien gegeben. Er verschluckte den Stein und dachte, er verschlucke das Kind Zeus. Aber Kronos erfuhr, was geschehen war, und verfolgte Zeus … Der Krieg dauerte schon zehn Jahre, da prophezeite Mutter Erde ihrem Enkel Zeus den Sieg, wenn er sich mit denen verbündete, die Kronos in den Tartaros verbannt hatte. So schlich er sich denn an Kampe heran, die alte Gefängniswärterin des Tartaros, tötete sie, nahm ihre Schlüssel an sich und befreite die Kyklopen und die Hundertarmigen und stärkte sie mit göttlicher Nahrung und göttlichem Trunk. Da gaben die Kyklopen Zeus den Blitz als Waffe des Angriffs, Hades gaben sie die Tarnkappe und Poseidon den Dreizack. Nachdem die drei Brüder Kriegsrat gehalten hatten, schlich sich Hades ungesehen an Kronos heran und stahl dessen Waffen. Während Poseidon den Kronos mit seinem Dreizack bedrohte und so dessen Aufmerksamkeit ablenkte, schlug ihn Zeus mit dem Blitze nieder … Kronos und die besiegten Titanen, mit Ausnahme des Atlas, wurden auf eine britische Insel im weitesten Westen (oder, wie manche sagen, in den Tartaros) verbannt und dort von den Hundertarmigen bewacht.“1
Der Krieg zum Buch – Einige persönliche Vorbemerkungen zum 11. September 2001 und zum Krieg im Irak
Wer ein Buch über Krieg schreibt, braucht sich um dessen Aktualität keine Sorgen zu machen. Krieg ist ein Phänomen, das es gibt, solange die menschliche Erinnerung zurück reicht, und es ist anzunehmen, dass es auch in Zukunft nicht verschwinden wird. Das vorliegende Buch habe ich ohne aktuellen politischen Anlass geschrieben, und ich wollte aus der nüchtern-neutralen Perspektive des außen stehenden Beobachters, der keiner der jeweiligen Kriegsparteien angehört, moralfrei und ohne erhobenen Zeigefinger, Regelhaftigkeiten von Kriegen und ihren sozialen, psychischen und biologischen Bedingungen analysieren. Es sollte kein Antikriegsbuch werden, und es wurde auch keines. Es führte aber zu Schlussfolgerungen, die zeigen, wann Kriege nützlich sind und wann nicht (eine Bewertung, die natürlich von den Kriterien des Beobachters abhängt).
Diese emotionale Distanz konnte ich als Autor einhalten, weil ich Kriege untersuchte, die sich entweder in fernen Ländern oder aber in fernen Zeiten abspielten. Der räumliche, zeitliche oder kulturelle Abstand ermöglichte es mir, ohne Rücksicht auf political correctness meine Folgerungen zu publizieren. Sie waren teils bekannt, teils unerwartet, manche für den Leser offenbar auch provokativ. Die erste Auflage des Buches erschien wenige Wochen vor dem 11. September 2001 und den Selbstmordattentaten auf die Twin Towers des World Trade Centers in New York und das Pentagon in Washington.
Seit diesem Ereignis ist die Distanz dahin, niemand kann mehr über Krieg schreiben oder sprechen, ohne dass die Bilder der brennenden und einstürzenden Türme in Erinnerung gerufen werden, und zurzeit (April 2004) können jeden Tag in den Fernsehnachrichten Bilder von Kämpfen zwischen den US-Besatzungstruppen und aufständischen Schiiten und/oder Sunniten im Irak verfolgt werden. Seit der Verkündung des offiziellen Kriegsendes sind inzwischen weit mehr amerikanische Soldaten und Soldaten der mit den USA verbündeten „Koalition der Willigen“ ums Leben gekommen als während der offiziellen Kriegshandlungen, und täglich sind neue Opfer zu beklagen. Für mich als Autor, der sich lange Zeit bemüht hat, das Phänomen Krieg in all seinen Eigenartigkeiten zu verstehen und zu erklären, war und ist dies mit ambivalenten Gefühlen, wenn auch überwiegend Unwohlsein, verbunden. Zum einen bin ich über die Ereignisse entsetzt, wie die meisten Menschen in meiner Umgebung, zum anderen aber bin ich verblüfft, dass die Ereignisse tatsächlich zu bestätigen scheinen, was nach den theoretischen Erwägungen zu erwarten war. Was ich beobachten kann, ist die Probe aufs Exempel: der Krieg zum Buch.
Die Analyse früherer Kriege, wie sie in der vorliegenden Untersuchung dargelegt ist, zeigt, dass der Verlauf von Kriegen nicht naturgesetzlich vorbestimmt ist. Es gibt immer Weichenstellungen, die bestimmen, wie die Entwicklung weiter geht. Es sind Politiker mit ihren persönlichen Stärken und Schwächen, ihrer Weisheit oder Torheit, die hier eine entscheidende Rolle spielen. Sie sind zwar auch den gruppen- und massenpsychologischen Mechanismen ausgesetzt, die dazu führen, dass Kriege zu sozialen Systemen werden, die sich aus sich selbst nähren, aber sie können diese Dynamik in weit stärkerem Maße beeinflussen als der Durchschnittsbürger. Daher stellte und stellt sich auch heute die prinzipielle Frage, die unter anderen im vorliegenden Buch untersucht wird: Welche Wirklichkeitskonstruktionen der Politiker bestimmen ihre Entscheidungen? Wie kommunizieren sie mit ihren Gegnern und der Öffentlichkeit? Welche Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen wecken sie bei ihren wirklichen oder vermeintlichen Kontrahenten? Und welche Unterscheidungen werden handlungswirksam und ordnen die Gemengelage im Verlaufe des Konfliktes, d. h., welche Parteien entstehen und bekämpfen sich schließlich?
Seit der Publikation der ersten Auflage dieses Buches kam es zu einem „heißen Krieg“, die US-Luftwaffe bombardierte Bagdad, der Irak wurde ohne allzu große Gegenwehr der irakischen Truppen besetzt. Während der Kampfhandlungen gingen in aller Welt Hunderttausende von Menschen auf die Straße und demonstrierten gegen einen Krieg, für dessen Charakterisierung es unterschiedliche Lesarten gab: Die USA legitimierten ihn offiziell als „preemptive strike“ gegen die Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen (von denen sich bis heute im Irak allerdings keine Spuren finden ließen) und mit der angeblichen Verbindung Saddam Husseins mit den Terroristen des Al-Qaida-Netzwerkes (wofür sich allerdings auch keine stichhaltigen Belege finden ließen). Aus der Außenperspektive stellt sich die Frage, ob dies ein Krieg gegen ein Regime oder gegen ein Land war, gegen Saddam Hussein oder den Irak. Oder war all dies nur der Vorwand für wirtschaftliche Interessen oder hegemoniale Konzepte von Schreibtischtätern konservativer amerikanischer Think-Tanks? Dem Kampf auf den Schlachtfeldern entspricht der Streit der Deutungen. Wie zu Zeiten des Vietnam-Krieges brannten und brennen wieder amerikanische Flaggen. Nur wenige Wochen nach der Verkündung des „Siegs“ über das Regime von Saddam Hussein wurden die USA erneut in eine Art Guerilla-Krieg verwickelt, jeden Tag kommt es zu gewalttätigen Widerstandsaktionen gegen die Besatzung. Während ich diese Zeilen verfasse, gibt es Straßenkämpfe in Nadschaf und Falludscha, ungeachtet der Tatsache, dass der amerikanische Präsident George W. Bush vor einem Jahr das Ende der Kampfhandlungen verkündet hat. In der amerikanischen Öffentlichkeit wird die Erinnerung an Vietnam beschworen, die Geschichte scheint sich zu wiederholen.
Was seit dem 11. September 2001 geschah, der Krieg gegen das Taliban-Regime in Afghanistan, die (vergebliche) Suche nach Usama bin Laden, die gequälten Diskussionen im UN-Sicherheitsrat, der Krieg gegen den Irak als vermeintliche Fortsetzung des „Krieges gegen den Terror“ …, all dies bestätigt die in diesem Buch vorliegenden Analysen in einer Weise, die leider nur intellektuell befriedigen kann: Denn so war es ja nicht gemeint! Als Autor formuliert man, nur den historischen Daten und der Logik der Argumentation verpflichtet, seine Theorien, ohne daraus konkret Entscheidungen ableiten zu müssen. Derartige Studien erscheinen aufgrund ihrer Abstraktheit immer etwas surreal. Doch was als kühle Analyse von Ereignissen und Prozessen aus fernen Zeiten und von fernen Orten geplant war, erweist sich nun als Drehbuch für die Gegenwart, zeitlich und räumlich näher als irgendjemandem lieb sein kann.
Diese Logik durchsichtig zu machen, war und ist Ziel dieses Buches. Es muss nach den jüngsten Ereignissen nicht umgeschrieben werden. Aber sie lassen einige Aspekte zeitgenössischer Kriegführung und ihrer Begrenzungen deutlicher werden, als dies die historische Analyse ermöglichte. Das betrifft vor allem die Idee des „Krieges gegen den Terror“ wie auch die von einigen Mitgliedern der Bush-Administration vertretene Idee einer pax americana, d. h. der unilateralen Hegemonie eines einzelnen Staates. Aus Sicht der hier verwendeten systemtheoretischen Modelle erweisen sich solche Vorstellungen weder als realisierbar noch als rational. Ganz im Gegenteil: Es bedurfte kaum seherischer Fähigkeiten, um vorauszusagen, dass sie paradoxe Wirkungen erzielen würden. Würden sie nämlich konsequent verfolgt, so könnten sie das Ende des amerikanischen Zeitalters einläuten. Was dagegen sprach, war ebenfalls absehbar: Die hegemonialen Ideen, wie sie von George W. Bush und seinen Mitstreitern propagiert wurden, sind langfristig im eigenen Lande nicht mehrheitsfähig, schon weil sie finanziell nicht zu bewältigen sind. Alle Versuche, langfristig die Kontrolle über irgendwelche sozialen Systeme zu erhalten, sind in der Geschichte immer an der Kostenfrage gescheitert.
Amerika und seine demokratischen Werte werden also wohl auch die Bush-Regierung und den Irak-Krieg überleben. Diese Hoffnung ergibt sich aus den Analysen, die in einem Kapitel am Ende des Buches nachgetragen sind. Ihre Aufmerksamkeit richtet sich auf den „Krieg gegen den Terror“ und den Krieg gegen den Irak.
Eine von manchen Kritikern als provokativ empfundene These des Buches bedarf angesichts der Anschläge auf das World Trade Center, der Kämpfe in Afghanistan, vor allem aber auch wegen des Krieges im Irak, der vorauseilenden Kommentierung. Eine meiner Antworten auf die Frage, worin die Faszination des Krieges liegt, lautet, dass Kriege Ähnlichkeiten mit verschiedenen Formen des Entertainments (z. B. den Heldenmythen aus Hollywoodfilmen, dem Sport usw.) haben. Die Ansicht, dass der Sinn des Kämpfens das Kämpfen ist, wird auch von anderen Autoren vertreten. Dass der Krieg als ultimative Form des Entertainments betrachtet werden kann, ist m. E. nur die konsequente Folgerung. Heute, nach dem 11. September, angesichts der vielen Toten und der täglich im Fernsehen gezeigten Leichen aus dem Irak, hätte ich wahrscheinlich Angst, des Zynismus beschuldigt zu werden, wenn ich solch eine These erstmals publizieren würde. Da sie mir aber immer noch sachlich begründet erscheint, habe ich das Kapitel nicht umgeschrieben. Ich will aber noch einmal ausdrücklich unterstreichen, dass es mir nicht darum geht, reißerisch den Opfern kriegerischer Auseinandersetzungen den Respekt zu verweigern. Doch es gehört zum Verständnis des Krieges, sich klar zu machen, dass es kaum eine bessere Form der „Unterhaltung“ gibt als Krieg. Kämpfen, vor allem aber das „Gewinnen“, ist mit Lust verbunden. Das erklärt die Begeisterung, mit der Menschen in den Krieg ziehen, und die Faszination, die uns zuschauen lässt. Als die beiden Türme des World Trade Centers in Flammen standen, hat die Welt nicht nur den Atem angehalten, sie hat auch gebannt vor dem Fernsehschirm gesessen. Die Einschaltquoten waren so hoch wie selten zuvor. Jetzt, nachdem auf unterschiedlichen Kanälen von Reportern, die „embedded“ in die kämpfenden Truppen im Irak waren, erstmals in der Geschichte der Menschheit direkt von Kriegsschauplätzen berichtet wurde, ist die Tarnung des Entertainments als Infotainment offensichtlich.
Der Wechsel von Spannung und Entspannung ist es, was den Kampf von Gut und Böse unterhaltsam macht. Wer ins Kino geht, kann darauf vertrauen, dass ein Drehbuchautor oder Regisseur die Verantwortung für diesen Wechsel übernommen hat. Deshalb kann er sich immer noch innerlich distanzieren und auf das Happy End warten. Wer Bungee springt, verlässt sich darauf, dass das Seil hält, doch was er oder sie erlebt, ist „the real thing“, der Adrenalinausstoß, der nicht nur durch Identifikation mit irgendwelchen fiktiven Helden erfolgt. Die Trennung zwischen Fakt und Fiktion ist aufgehoben. In makabrer Weise wurde dieses Re-Entry des Beobachters ins Bild in den Twin Towers vollzogen, wo einige Leute in den oberen Stockwerken im Fernsehen sahen – zwangsläufig mehr oder weniger distanziert – wie ein Flugzeug in den Turm flog, in dem sie gerade saßen. Die Unterscheidung zwischen Beobachter und Akteur war aufgehoben, die Grenze zwischen innen und außen aufgelöst. Der Albtraum des Zuschauers wurde wahr …
Dass die Produktion von Action- und Katastrophenfilmen in Hollywood in der Folge vorübergehend eingestellt oder aufgeschoben wurde, zeigt, dass zwischen dem tatsächlichen Krieg und seiner Inszenierung zu Unterhaltungszwecken ein Konkurrenzverhältnis besteht. Auch im klassischen Altertum wurden die Olympischen Spiele zu Kriegszeiten ausgesetzt. Wenn real ums Überleben gekämpft wird, braucht man nicht den Ersatz durch simulierte Formen des Krieges im Sport oder im Film. So kann man wohl mit Fug und Recht die These aufstellen, dass Sport (zumindest der Kampfsport) und die Formen des Entertainments, die dem Muster von Heldenmythen folgen, die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln sind (manchmal auch umgekehrt).
Doch durch sie allein wird der Krieg vielleicht im Erleben des Einzelnen überflüssig gemacht, nicht jedoch im Leben sozialer Einheiten. Hier muss das Diktum von Clausewitz, der Krieg sei die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, auf den Kopf gestellt werden, damit es Boden unter die Füße bekommt: Die Politik ist die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Krieg kann als eine Art der Regression in eine vorzivilisierte Form der Konfliktlösung betrachtet werden, in eine Phase der gesellschaftlichen Entwicklung, in der die Lösung von Konflikten noch keine Verrechtlichung erfahren hatte. Wo das Recht des Stärkeren die Anwendung sachlich begründbarer, rechtlicher Prinzipien der Entscheidungsfindung überflüssig macht, herrschen Zustände, die historisch im Prozess der Zivilisation überwunden wurden. In diesem Zusammenhang gewinnt die Frage, ob ein Krieg mit oder ohne die rechtliche Legitimation durch ein Mandat der UN erfolgt, ihre Bedeutung. So könnte es durchaus sein, dass wir zurzeit nicht Zeuge eines „Clash Of Civilizations“ werden, sondern eines Krieges gegen die Zivilisation. Dabei stellt sich die Frage, wer es ist, der sie angreift und bedroht.
April 2004
F. B. Simon
I. Theoretische und methodische Grundlagen
1. VORBEMERKUNG
„In Wahrheit beginnt der Krieg nicht dann, wenn einige Menschen andere umbringen. Vielmehr beginnt er an dem Punkt, da erstere das Risiko eingehen, selbst getötet zu werden.“
Martin van Creveld1
Folgt man der bewährten Tradition, die Bedeutung eines Begriffs in seinem Gebrauch zu suchen, so zeigt sich, dass mit Krieg ein Typus von Konflikt bezeichnet wird, der sich vor allem dadurch von anderen Konflikten unterscheidet, dass ihn viele der daran beteiligten Akteure nicht überleben oder zumindest in ihm ihr Überleben riskieren. Auch wenn nach dem Zweiten Weltkrieg für über 50 Jahre ein „Kalter Krieg“ herrschte, in dessen Verlauf es nicht zu größeren tätlichen Auseinandersetzungen zwischen den Konfliktparteien kam, ist Krieg („heißer Krieg“) in der Regel mit der Anwendung von Gewalt verbunden.
Die folgende Untersuchung geht von der These aus, dass Krieg ein charakteristisches Kommunikationsmuster ist, d. h. ein soziales System, bei dem die beteiligten Parteien ihre Existenz riskieren. Unabhängig davon, ob es sich um den Kampf Nation gegen Nation, Kolonialtruppen gegen Freiheitskämpfer, Firma gegen Firma, Held versus Bösewicht oder Ehepartner gegen Ehepartner handelt, es wird immer das gleiche Spiel gespielt, und die Variation der Muster ist begrenzt und berechenbar. Die entscheidende Frage ist, wie es in all diesen so verschieden erscheinenden Bereichen zum Ausbruch von Kriegen kommen kann. Welcher Logik folgt die Kommunikation, die aus zunächst gewaltfreien Konflikten Kriege werden lässt? Wenn es gelingt, sie zu erfassen, so sollte es möglich sein, den Verlauf von Konflikten ein wenig berechenbarer zu machen, sodass sich den Beteiligten die Option eröffnet, Alternativen zu wählen – oder sich eben auch bewusst und „sehenden Auges“ für den Krieg entscheiden zu können.
Eine der Merkwürdigkeiten, mit der man bei der Beschäftigung mit dem Phänomen Krieg immer wieder konfrontiert wird, besteht darin, dass Menschen oder auch soziale Systeme scheinbar ohne Not ihre Existenz riskieren. Es muss für sie also Werte und Ziele geben, die wichtiger sind als das Überleben. Lassen sich solche Werte identifizieren und benennen? Und sind sie, bei näherer Betrachtung und Abwägung, wirklich wert, dafür zu sterben? Beantworten lassen sich diese Fragen erst, wenn sie bewusst gemacht werden. Denn bewusst sind sie im Allgemeinen nicht, auch wenn sie die Entscheidungen von Einzelnen und Nationen, Organisationen und Gruppen leiten.
Wenn hier von der Logik des Krieges die Rede ist, sollen neben der Analyse des sozialen Systems und seiner Spielregeln noch zwei andere Bereiche ins Blickfeld gerückt werden: die psychischen und biologischen Umwelten von Kriegen. Es geht also auch um die Logik seelischer und körperlicher Prozesse, die mit Krieg gekoppelt sind. Das führt zu der Frage, ob es z. B. angebracht und nützlich ist, dem Menschen einen Aggressionstrieb oder etwas Ähnliches zuzuschreiben oder frühkindliche Traumatisierungen für die Bereitschaft, sich in kriegerische Auseinandersetzungen zu verwickeln, verantwortlich zu machen.
Im Blick auf individuelle wie kollektive Wirklichkeitskonstruktionen ergibt sich die Frage, welche Unterscheidungen zu welchen eher kriegerischen oder friedensfördernden Konsequenzen führen. Welche Logik des Fühlens und Denkens, welche Art der Selbst- und Fremdbeschreibung macht Krieg wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher?
Um der Beantwortung dieser Fragen näher zu kommen, sollen unterschiedliche Muster kriegerischer Verwicklungen analysiert werden. Dabei werden der oben genannten Definition entsprechend solche Interaktions- und Kommunikationsformen, bei denen die Beteiligten bereit sind, ihre eigene Existenz aufs Spiel zu setzen, als Kriege betrachtet. Das Spektrum erstreckt sich dementsprechend von den im vorigen Jahrhundert auf Fidschi geführten Dauerkriegen zwischen kannibalistischen Dorfgemeinschaften bzw. Chiefdoms über den Ersten Weltkrieg und den Vietnamkrieg bis hin zu den berüchtigten Duellen europäischer „Ehrenmänner“ im 18. und 19. Jahrhundert und den oft tragischen zeitgenössischen Ehekriegen, die in Mord und Totschlag enden. Dem entgegengesetzt werden einige zugegebenermaßen selten anzutreffende Beispiele friedlicher Gesellschaftsformen. Sie können verdeutlichen, dass Frieden wie Krieg ihren Preis haben. Ob das, was man für den jeweiligen Preis erhält, das Risiko wert ist, soll dabei nicht bewertet werden. Ziel war nicht, ein weiteres Antikriegsbuch zu schreiben, sondern dem Verständnis des Phänomens Krieg ein wenig näher zu kommen.
Die theoretischen Grundlagen der vorliegenden Analyse liefert die neuere Systemtheorie. Sie stellt einen konzeptuellen Rahmen zur Verfügung, der abstrakt genug ist, um auf ganz unterschiedliche Praxisfelder angewandt zu werden. Sie ist transdisziplinär, da sie Muster der Kommunikation und die Prinzipien ihrer Organisation beschreibt und analysiert. Vor diesem Theoriehintergrund lassen sich Befunde der Verhaltensforschung, der Psychoanalyse, der Soziologie, ja, in Ansätzen auch der Biologie in ein integrierendes Modell einordnen.
Der praktische Wert solch einer Analyse dürfte für diejenigen am größten sein, die in ihrer täglichen Arbeit aktiv an der Herstellung, Erhaltung oder Beseitigung von – potenziell tödlichen – Konflikten beteiligt oder mit deren Management beschäftigt sind. Das dürften Politiker, Diplomaten, Manager, Mediatoren, Priester, Organisationsberater, Therapeuten und andere Personen sein, die ihr Leben mit Konflikten fristen – sei es zu ihrer Lösung, sei es zu ihrer Herstellung. Die Kenntnis der generellen Logik kriegerischer Konflikte sollte ihnen im Einzelfall helfen, Ideen zu deren Bewältigung zu entwickeln. Dennoch wird hier nicht versucht, einen Leitfaden für das Management tödlicher Konflikte zu entwerfen. Welche praktischen Konsequenzen aus ihrer Analyse zu ziehen sind, bleibt dem Leser überlassen. Er muss sich auch die Frage beantworten, ob die Analogien, die zwischen der politischen und der interpersonalen Ebene beschrieben werden können, also z. B. zwischen internationalen Kriegen und denen von Ehepartnern („Rosenkrieg“), nur von metaphorischem Wert sind oder ob sich daraus konkrete Interventionen ableiten lassen. Denn, das sei ausdrücklich betont, der Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung ist bewusst auf Kriege im traditionellen Sinn gelegt.*
2. MERKMALE DER UNTERSCHEIDUNG VON „KRIEG“
a) Das Überleben bedrohen und riskieren
Will man Krieg im Unterschied zu anderen Formen sozialer (oder, allgemeiner: menschlicher) Konflikte definieren, so tritt als Erstes die Anwendung von Gewalt ins Blickfeld. Doch wenn wir die Rede vom Kalten Krieg, vom Wirtschaftskrieg, vom Propagandakrieg usw. ernst nehmen, so stellt der mit Gewaltanwendung verbundene Krieg nur eine Möglichkeit unter anderen dar. Das definierende Merkmal des Krieges, so kann hier im Anschluss an die Definition des Militärhistorikers Martin van Creveld2 postuliert werden, ist ein Kampf, bei dem das Überleben der beteiligten Parteien auf dem Spiel steht. Es wird in der Auseinandersetzung bedroht und/oder riskiert.
Nicht jeder Überlebenskampf ist aber ein Krieg. Wer sich daranmacht, die Eigernordwand oder den Mount Everest zu besteigen, im Paddelboot über den Atlantik zu rudern oder in Sandalen durch die Sahara zu wandern, riskiert zweifellos auch sein Leben. Und wer das Unglück hat, in einem Erdbebengebiet zu leben, dessen rein physische Existenz ist sogar ständig bedroht. Betrachtet man nicht nur Organismen als Überlebenseinheiten, sondern auch Organisationen, Firmen, Nationen und andere soziale Systeme, so gewinnt der Begriff des Überlebens eine die Grenzen der Biologie überschreitende Bedeutung. Es geht dann beispielsweise darum, als Firma in einem bestimmten Marktsegment die autonome Existenz zu bewahren. Und das Bemühen darum kann durchaus den Charakter eines Kampfes annehmen. Doch auch solch ein Überlebenskampf sollte nach der hier vorgeschlagenen Definition nicht als Krieg bezeichnet werden. Denn weder der Mount Everest noch der Markt sind als Kriegsparteien zu betrachten. Sie sind nicht Teilnehmer an einem Kommunikationssystem. Man kann zwar mit dem Berg „ringen“, er ringt aber nicht zurück. Man kann ganz allgemein mit der „Tücke des Objekts“ kämpfen, dem Objekt ist dies aber – falls es sich darüber überhaupt Gedanken machen sollte – vollkommen egal. Um es auf eine Formel zu bringen: Zum Krieg gehören (mindestens) zwei Teilnehmer, die in der Lage sind, Sinn zu prozessieren und miteinander zu kommunizieren. Der Berg mag vom erfahrenen Bergsteiger zwar „gelesen“ werden, die Zeichen für Gefahren mögen gedeutet und interpretiert werden, der Berg „liest“ aber nicht den Bergsteiger. Die Interaktion zwischen beiden ist kein Prozess, bei dem zwei voneinander unterscheidbare kognitive Systeme miteinander ums Überleben kämpfen. Der Atlantik existiert weiter, unabhängig davon, wie viele Paddler mit ihm kämpfen. Doch dieser Fortbestand kann nicht als Überleben bezeichnet werden, da ihm die Merkmale von Lebensprozessen fehlen. Vor allem aber: Seinen Aktivitäten können keine dahinter liegende Absichten zugeschrieben werden, er kann daher nicht als handelnde oder sich aktiv an der Kommunikation beteiligende Überlebenseinheit betrachtet werden (es sei denn, man würde es sich erlauben, „magisch“ zu denken und auch der unbelebten Natur quasimenschliche Eigenschaften zuschreiben).
Die hier vorgeschlagene Definition ist natürlich nicht ohne vielfältige Voraussetzungen. Die wichtigste ist die Annahme von Überlebenseinheiten. Wenn in der Interaktion zwischen Berg und Bergsteiger dem Bergsteiger ein anderer Status als dem Berg zugeschrieben wird, so deswegen, weil der Organismus des Bergsteigers als Überlebenseinheit aktiver Prozesse zur Herstellung und Erhaltung seiner Grenzen gegenüber seinen Umwelten bedarf. Das ist bei Einheiten, die in der unbelebten Natur unterschieden werden können (der Berg, der Atlantik), nicht der Fall.
Unter dem Begriff Überlebenseinheit soll im Rahmen des hier verwendeten Theorieansatzes aber nicht allein der Organismus verstanden werden, sondern er soll als Oberbegriff für autopoietische Systeme* verwendet werden. Dies können neben Organismen psychische und soziale Systeme sein. Beim Krieg handelt es sich um eine Form der Interaktion und Kommunikation von mindestens zwei solcher Überlebenseinheiten, bei der ihr Erhalt als abgegrenzte, autonome Einheiten wechselseitig infrage gestellt wird. Der Tod solch einer Überlebenseinheit ist daher nur für Organismen biologisch zu verstehen. Für alle anderen ist er synonym mit der Beendigung der Existenz als autonome, innengesteuerte Einheit.
Mit den Worten des Militärtheoretikers von Clausewitz: „Der Krieg ist nichts als ein erweiterter Zweikampf. Wollen wir uns die Unzahl der einzelnen Zweikämpfe, aus denen er besteht, als Einheit denken, so tun wir besser, uns zwei Ringende vorzustellen. Jeder sucht den andern durch physische Gewalt zur Erfüllung seines Willens zu zwingen; sein nächster Zweck ist, den Gegner niederzuwerfen und dadurch zu jedem Widerstand unfähig zu machen.“3
Im Krieg ist daher nicht nur „erlaubt“ (wer sollte es auch verbieten oder solch ein Verbot durchsetzen?), sondern explizites Ziel, die Autonomie des Gegners zu beenden, seine Grenzen neu zu definieren oder gar aufzulösen und damit seiner Existenz ein Ende zu setzen. Wer dabei gewinnt, ist offen, das unterscheidet Krieg von kaltblütigem Mord oder Holocaust.
b) Krieg vs. Konkurrenz – Aktive vs. passive Negation
In diesem Zusammenhang scheint eine weitere Unterscheidung nützlich: die zwischen Konkurrenz und Krieg. Konkurrenz ist nicht Krieg im hier verstandenen Sinn. Was beides unterscheidet, ist, „dass die Regeln der Konkurrenz es den beiden Seiten nicht erlauben, zur Verwirklichung ihrer Ziele einander direkt anzugehen, sich gegenseitig zu behindern oder wechselseitig zu zerstören. Im Gegenteil, der Gedanke des ‚fairen‘ Wettbewerbs beruht eben auf dem Verzicht auf solche Mittel … Ohne diese Unterscheidung wäre ein ‚zivilisiertes‘ Leben nicht möglich gewesen.“4
Die Marktwirtschaft ist ein gutes Beispiel dafür, dass Firmen, die ähnliche Produkte herstellen, miteinander um Käufer konkurrieren. Es gibt dabei ebenfalls Gewinner und Verlierer. Und das Ergebnis kann auch sein, dass einer der Anbieter schließlich Bankrott geht, von einem Mitbewerber „feindlich übernommen“ wird und nicht als autonome Einheit überlebt. Zwar ist es – und das ist ein wichtiger logischer Unterschied zwischen Krieg und Konkurrenz – den am Wettbewerb Beteiligten erlaubt, alles dafür zu tun, um die eigene Position zu verbessern, es ist aber verboten, dabei dem Mitbewerber direkt zu schaden. Es gibt Regeln des „lauteren Wettbewerbs“ oder, besser gesagt: Verbote des „unlauteren Wettbewerbs“, die von staatlichen oder von überstaatlichen Institutionen (z. B. der EU-Komission) durchgesetzt und überwacht werden. Sie sind mit sportlichen Regeln vergleichbar: Bei einem 10 000-m-Lauf etwa darf jeder das Rennen so schnell oder langsam angehen, wie er will, und Zwischenspurts einlegen, um seine Gegner zu demoralisieren usw. Aber er darf ihnen nicht das Bein stellen, sie schubsen, sie niederschlagen, erschießen usw. Tut er das, so wird er nicht nur disqualifiziert, sondern muss gegebenenfalls auch noch mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.
Der Unterschied zwischen Krieg und Konkurrenz lässt sich in Bezug auf die Logik der Spielregeln als Unterschied zwischen „aktiver“ und „passiver Negation“ des Gegners bzw. seines Erfolges erfassen.5
Unter passiver Negation ist dabei zu verstehen, dass alle Handlungen unterlassen werden, die dem Gegner nutzen könnten. Unter aktiver Negation hingegen werden Aktionen verstanden, durch die versucht wird, dem Gegner aktiv zu schaden. Wer Handlungen vollzieht, die ihm selbst nutzen, und es unterlässt, dem Gegner zu helfen, bewegt sich also im Bereich der passiven Negation des Gegners oder seiner Ziele und Interessen. Unterlassene Hilfeleistung für den Mitbewerber ist in Konkurrenzbeziehungen nicht nur nicht strafbar, sie ist im Einklang mit der Logik des Wettbewerbs. Wer aber seine Vorteile dadurch zu erlangen sucht, dass er dem Gegner aktiv schadet, der hat die Grenze zur Kriegführung überschritten. Im Extremfall geht es dabei um die aktive Negation des Gegners als Überlebenseinheit, d. h. um seine Vernichtung (ein Begriff, der genau dies auch umgangssprachlich zum Ausdruck bringt).
Nimmt man die Unterscheidung zwischen aktiv und passiv negierenden Aktionen als Kriterium der Unterscheidung zwischen Konkurrenz und Krieg, so erweist sich auch die Rede vom „Wirtschaftskrieg“ als durchaus angemessen. Wenn die USA den Mitgliedern der EU beispielsweise für irgendwelche Produkte Strafzölle auferlegen, um sie zu Zugeständnissen bei der Einfuhr hormonbehandelten Rindfleisches zu bewegen, so wird zwar keine Gewalt angewandt, aber es werden Maßnahmen ergriffen, die dem „Gegner“ aktiv schaden.
c) Symmetrie der Beziehung
Obwohl Krieg weitgehend mit der Anwendung von Gewalt als Mittel zur Schädigung des Gegners gleichgesetzt wird, ist nicht jede gewalttätige Schädigung eines Kontrahenten als Krieg zu bewerten. Martin van Creveld, auf dessen Überlegungen sich die hier gewählten Definitionen stützen, weist darauf hin, dass es historisch betrachtet in jeder Gesellschaftsform Regeln dafür gab, wann das Töten eines Mitmenschen als Mord oder als Heldentat zu bewerten ist. In diesem Zusammenhang kommt der Ehre der Kämpfer eine wichtige Bedeutung zu. Sie ist direkt an die Symmetrie der kämpfenden Parteien gekoppelt. Wer nicht das Risiko eingeht, selbst getötet zu werden, während er andere tötet, wird im Allgemeinen Mörder oder Schlächter genannt. Solche Leute stehen sozial in keinem hohen Ansehen, sodass Berufe, deren Aufgabe darin besteht, wehrlose Menschen vom Leben zum Tode zu befördern (z. B. Henker), als „unrein“ angesehen und verachtet werden.
„Zum Kampf gehören zwei. Er beginnt nicht dann, wenn einige Menschen andern das Leben nehmen, sondern dort, wo sie ihr eigenes riskieren.“6 Diese Gleichwertigkeit der Gegner ist eine der „heimlichen“ Regeln des Krieges, der ihn vom anarchischen Abschlachten Wehrloser unterscheidet.
Wer gegen Schwache kämpft, verliert in jedem Fall. Wenn er gegen sie gewinnt, ist es ein ehrloser Sieg. Wenn er verliert, hat er doppelt verloren. Außerdem gilt, dass der Schwache im Prinzip jedes noch so unfaire Mittel verwenden kann, ohne sich und sein Anliegen zu entwerten. Der Beobachter, d. h. die Öffentlichkeit, wird auf seiner Seite stehen (als Beispiel dafür sei an Gandhis Kampf gegen die Briten erinnert)7. Was der Starke hingegen tut, ist fast immer unangemessen. Truppen, die gegen schwächere kämpfen müssen, erleben sich selbst als würdelos, und sie verlieren ihre Selbstachtung und Moral. Sie können die Sinnfrage nicht mehr positiv beantworten, einige nehmen Drogen, manche desertieren usw. Die professionellen Werte des Soldatentums verlieren ihre Bedeutung, die Selbstkontrolle geht verloren, es kommt zu den immer wieder beklagten Gräueltaten. Verlieren sie gar gegen die Schwachen, ist ihre Moral und sind damit sie selbst endgültig gebrochen.8
Die mit Ehre verknüpfte Symmetrieanforderung legt den Vergleich mit anderen Interaktionsformen wie dem Duell nahe, bei dem die Akteure gegenseitig ebenfalls ihr Überleben mit Waffengewalt bedrohen. Sie rückt den Krieg aber auch in die Nähe des Sportes und des Entertainments, die bereits im klassischen Altertum die Form des Kampfes genutzt haben (z. B. Gladiatorenkämpfe, die „Spiele“ des berühmten „Brot und Spiele“).
Durch diese Faktoren – die Symmetrie der Beziehung zwischen den kämpfenden Parteien, die Bereitschaft, der anderen Partei zu schaden, und schließlich, seine eigene Existenz zu riskieren – mag Krieg als spezifisches Muster der Kommunikation und Interaktion noch nicht vollständig und umfassend definiert sein. Sie sind aber als Ausgangspunkt für die weitere Analyse ausreichend. Es wird dabei immer um die Frage gehen, welches die betroffenen Überlebenseinheiten sind und wie sich die Beziehungsmuster im Verlaufe der Auseinandersetzungen verändern (oder auch nicht).
3. ANALYSEINSTRUMENTARIUM
a) Die Logik der Beobachtung
Wie bereits angedeutet, soll im Folgenden ein Analyseinstrumentarium verwendet werden, das sich in der neueren Systemtheorie bewährt hat.9
Von zentraler Bedeutung ist dabei die Frage nach den verwendeten Unterscheidungen. Durch sie konstruiert der Beobachter irgendwelche Einheiten (z. B. Systeme) als von ihren Umwelten abgegrenzt. Vergleichbar ist dies mit dem Zeichnen eines Kreises auf einem Blatt Papier oder der Herstellung eines Objektes in einem dreidimensionalen Raum. Er hat nun die Möglichkeit, das Augenmerk auf die Innenseite oder die Außenseite der Unterscheidung zu richten. Er kann die internen Differenzierungen (z. B. die Bildung von Subsystemen) solcher Einheiten beobachten (etwa die Mitgliedsstaaten einer Allianz, die unterschiedlichen Parteien innerhalb eines Staates, die Fraktionen innerhalb einer Partei usw.), oder er kann die Außenbeziehung interagierender und miteinander kommunizierender Einheiten (Systeme) betrachten.
Wenn solche Einheiten eine gemeinsame Interaktionsgeschichte durchlaufen, so können sie als relativ fest miteinander gekoppelt betrachtet werden. Sie stellen dann füreinander Umwelten dar und müssen aufeinander reagieren. Wie sie das tun, hängt aber weniger davon ab, was sie als Interaktions- und Kommunikationspartner tun, sondern von den jeweils eigenen internen Strukturen. Sie funktionieren innengesteuert („strukturdeterminiert“) und sind daher als autonom zu betrachten (wie beispielweise zwei voneinander unabhängige Staaten, zwei oppositionelle Parteien usw.). Sie können sich in der Interaktion miteinander gegenseitig stören („perturbieren“, „irritieren“) und anregen, es gibt aber keine geradlinige Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen den Aktionen des einen und denen des anderen Systems (keine „instruktive Interaktion“).
Bezogen auf die Kriegsproblematik, lassen sich folgende grundlegende Fragen aus der Perspektive des außen stehenden Beobachters formulieren:
1)
Welches sind die miteinander Krieg führenden Überlebenseinheiten?
2)
Durch welche Prozesse unterschieden sie sich als abgegrenzte Einheiten voneinander, und wie sind sie intern strukturiert?
3)
In welcher Beziehung stehen die Kontrahenten in der Ausgangssituation, d. h. der unmittelbaren Vorkriegszeit, zueinander?
4)
Wie lässt sich das Ausbrechen des „heißen“ Krieges, d. h. der Beginn der Kampfhandlungen, erklären?
5)
Wie hört er auf, d. h., unter welchen Bedingungen enden Kriege?
6)
Welches sind die durch den Krieg herbeigeführten Veränderungen, d. h., wie ist die Vorher-nachher-Unterscheidung, sei es in den Außenbeziehungen, sei es in den Innenbeziehungen?
b) Tetralemma
Bei der Analyse derartiger Muster und ihrer Veränderungen soll versucht werden, die Beobachtung, um der Vergleichbarkeit willen, zu systematisieren. Dazu wird der Fokus der Aufmerksamkeit auf die Aktionen der Konfliktparteien bzw. deren Wirkungen aufeinander gerichtet. Sie lassen sich dann als entweder nützlich für die eine Partei, die andere Partei, keine Partei oder beide Parteien bewerten.
Abb. 1
Ein solches Beobachtungsschema kann verdeutlichen, dass es im Prinzip immer mehr als nur zwei Möglichkeiten gibt, sich in einem Konfliktfeld zu positionieren. Man braucht nicht Partei zu ergreifen, man kann sich auch neutral verhalten oder widersprüchlich, unentscheidbar, paradox usw. Ein didaktischer Vorteil dieser Betrachtungsweise ist, dass sich diese Positionen und Zuordnungen grafisch (Abb. 1) darstellen lassen. Die Symbolisierung der Gemengelage in einem zweidimensionalen Raum (auf dem Papier) eröffnet den Zugang zum Musteraspekt von Interaktion und Kommunikation. Die Wirkung unterschiedlicher (freundlicher/feindlicher) Aktionen wird gleichzeitig und nebeneinander dargestellt. Dadurch werden sie zueinander in Beziehung gesetzt, was in unserem Alltagsdenken nur selten passiert. Wir sind es gewohnt, Handlungen, die hier und jetzt vollzogen werden, irgendwelchen Akteuren (Personen, Parteien usw.) zuzuschreiben; damit isolieren wir sie von ihrem interaktionellen Kontext. Mithilfe der hier vorgeschlagenen Beobachtungs- und Beschreibungsmethode wird die Wechselbeziehung zwischen den Aktionen der beteiligten Akteure visualisiert und ins Blickfeld gerückt.
Da Angriff und Verteidigung, um ein Beispiel zu nennen, nacheinander erfolgen, ist es im Allgemeinen sehr wahrscheinlich, dass jeder der Beteiligten seinem eigenen Erleben entsprechend diesen Zeitfluss unterschiedlich interpunktiert. Er definiert sein Handeln als Reaktion auf die Handlungen des anderen. Er „verteidigt“ sich nur gegen einen Angriff der anderen Partei und sieht sich als „Opfer“, seinen Kontrahenten als „Täter“, der „angegriffen“ hat. Wenn das beide Parteien machen, entsteht ein charakteristisches Interaktions- und Kommunikationsmuster. Schon bei den Streitigkeiten kleiner Kinder im Sandkasten geht es nachher meist darum, wer „angefangen“ hat. Von außen betrachtet, lässt sich dies als Spiel beschreiben, in dem charakteristische Spielzüge beider Parteien miteinander kombiniert sind: „Nimmst du mir das Schäufelchen, nehm ich dir das Schäufelchen, nehm ich dir das Eimerchen, nimmst du mir das Eimerchen …“ Wann und wie das Ganze angefangen hat, ist zwar interessant, um die oft harmlos erscheinenden Anfänge diagnostizieren und ihnen wehren zu können, für die Beschreibung des Musters, d. h. der Spielregel, braucht man es nicht zu wissen. Als Muster wird die Interaktion und Kommunikation erst erkennbar, wenn man die Frage des Anfangs ausklammert und stattdessen die Aufmerksamkeit auf Regelmäßigkeiten und Wiederholungen richtet.
In dem hier verwendeten Vierfelderschema soll „Pro“ für Mitteilungen oder Aktionen einzelner Kommunikationsteilnehmer stehen, deren Wirkung vom Beobachter (wer immer das sein mag – also auch der Selbstbeobachter) beispielsweise als freundschaftlich bewertet wird. „Kontra“ steht dann für die konflikthaften feindlichen Aktionen oder Mitteilungen. In diesem formalen Schema sind die Inhalte, je nachdem, worum im konkretem Konflikt gestritten wird („Geld oder Leben“), austauschbar. In jedem Fall ergibt sich ein Schema aus vier möglichen Positionen (daher „Tetralemma“10 genannt), die man in diesem konkreten Konflikt einnehmen oder zuschreiben kann. Die (in unserem Beispiel freundlichen vs. feindlichen) Funktionen des Verhaltens eines jeden Kommunikationsteilnehmers können nunmehr vom Beobachter einer der folgenden vier Positionen zugeordnet werden: entweder (1) Pro (freundschaftlich) oder (2) Kontra (feindlich), sowohl (3) Pro als auch Kontra (sowohl freundschaftlich als auch feindlich), (4) weder Pro noch Kontra (weder freundschaftlich noch feindlich).
Die Anwendung eines solchen Beobachtungsschemas ermöglicht es, Ambivalenzen und Konflikte innerhalb sozialer Systeme zu beschreiben und die aufeinander bezogenen Elemente von Interaktions- und Kommunikationsmustern (einzelne Verhaltensweisen bzw. die Verhaltensweisen einzelner Akteure) in ihrer Wirkung im Kontext der Kommunikation zu beschreiben. Es soll daher dazu benutzt werden, um Allianzen und Parteiungen bzw. deren Veränderungen zu analysieren und zu illustrieren.
c) Starke und schwache Konflikte
Jeder Beobachter, der gezwungen ist zu handeln, steht nicht nur vor der Notwendigkeit, Unterscheidungen zu treffen, er muss Entscheidungen treffen. Er muss – im einfachsten Fall – zwischen den beiden Seiten einer Unterscheidung wählen: etwas tun oder nicht tun. Und er muss bewerten, ob es besser ist, sich für die eine Seite oder die andere Seite zu entscheiden. Der Maßstab für diese Bewertung sind erstrebte Zustände, Wünsche, Begehren, politische, militärische oder wirtschaftliche Ziele (positive Ziele), aber auch die Vermeidung oder Verhinderung von etwas Befürchtetem (negative Ziele).
Legt man diese Definition von Konflikt zugrunde, so ist das individuelle menschliche Leben wie auch das von sozialen Systemen (Organisationen, Nationen, Firmen, Banden, Gruppen usw.) eine Sequenz durchlebter Konflikte. Jede Aktion eines Akteurs (womit hier agierende Einheiten gemeint sind, und das können sowohl menschliche Individuen als auch soziale Systeme sein) setzt Entscheidungen und damit Bewertungsprozesse voraus. Er ist daher Ambivalenzen ausgesetzt und muss Kosten-Nutzen-Erwägungen anstellen. Sie führen aber nicht immer zu eindeutigen Ergebnissen, zumal dann, wenn unterschiedliche handelnde Einheiten unterschiedliche Zielvorstellungen verfolgen.
In sozialen Systemen und in der Kommunikation sozialer Systeme ist dies die Regel. Wo immer mehrere soziale Einheiten aufeinander stoßen, kann davon ausgegangen werden, dass sie mehr oder weniger unterschiedliche Ziele verfolgen. Schon allein die Unterschiedlichkeit ihrer Wirklichkeitskonstruktionen, Kulturen, politischen Systeme und Werte sorgt für diesen Antagonismus. Übereinstimmung ist die Ausnahme. Im Allgemeinen kommt es zu einem selbst organisierten Prozess der Balancierung solch gegenläufiger Tendenzen („systemischer Antagonismus“)11. Die Erklärung dafür ist leicht einzusehen: Die Teilnehmer an der Kommunikation beobachten und bewerten die Aktionen der anderen Beteiligten, und sie ergreifen gegensteuernde Maßnahmen, wenn sie befürchten, dass sich das Gesamtsystem in eine Richtung bewegt, welche die von ihnen vertretenen Interessen und Werte gefährdet.
Zur Analyse der Organisation solcher Konflikt- und Entscheidungsprozesse erscheint es nützlich, zwischen „starken“ und „schwachen Konflikten“ zu unterscheiden (s. Abb. 2).12
Ein Beispiel mag diesen Unterschied verdeutlichen: Kommt man als Wanderer an eine Wegkreuzung, so soll der Konflikt „Rechts- vs. Linksabbiegen“ als „starker Konflikt“ bezeichnet werden. Das Linksabbiegen ist die aktive Negation des Rechtsabbiegens, das Rechtsabbiegen die aktive Negation des Linksabbiegens.13 Der starke Konflikt ist also dadurch gekennzeichnet, dass die Gegenpole sich gegenseitig aktiv negieren. Die beiden Seiten der Unterscheidung weisen Merkmale auf, die sich im Sinne der zweiwertigen Logik gegenseitig ausschließen, d. h., sie können nicht gleichzeitig wahr sein. Bei einem starken Konflikt werden also zwei sich gegenseitig logisch ausschließende Ziele angestrebt und mit Gegenbegriffen (z. B. „Linksabbiegen“ vs. „Rechtsabbiegen“) benannt. Wer in einem bestimmten Moment nach rechts abbiegt, kann in der physischen Realität nicht gleichzeitig nach links abbiegen.
Der Konflikt zwischen „Rechtsabbiegen und Nichtrechtsabbiegen“ soll „schwacher Konflikt“ genannt werden. Beim schwachen Konflikt wird nur der einen Seite der Unterscheidung ein Merkmal zugeschrieben (Rechtsabbiegen). Es wird durch die andere Seite der Unterscheidung nur schwach negiert, d. h., die andere Seite ist lediglich durch das Fehlen dieses Merkmals definiert (Nichtrechtsabbiegen). Dadurch bleiben viele alternative Optionen offen (Geradeausgehen, Linksabbiegen, Stehenbleiben, Zurückgehen etc.).
Abb. 2
Allgemein gesagt: Im starken Konflikt geht es um die Unterscheidung zwischen „Pro“ und „Kontra“, die beide durch Merkmale definiert sind, die sich im Sinne der zweiwertigen Logik gegenseitig ausschließen. Im schwachen Konflikt geht es dagegen um eine Unterscheidung zwischen „Pro“ und „Nichtpro“ bzw. „Kontra“ und „Nichtkontra“, die sich nicht gegenseitig ausschließen (vgl. „Rechtsabbiegen“ vs. „Einen-Apfel-Essen“).
Mithilfe dieser Typisierung lässt sich die Logik des Verhaltens von Interaktionsteilnehmern wie auch des Musters ihrer Interaktion im Konflikt- wie im Nichtkonfliktfall beschreiben.
Im Konfliktfall zwischen Pro (z. B. Kapitalismus/Westen) und Kontra (Kommunismus/Osten) hatte jeder politische Akteur prinzipiell vier Möglichkeiten, sich zu positionieren und damit einen unterschiedlich starken Konflikt zu wagen: Er konnte aktiv als Pro-Parteigänger werden und damit in einen starken Konflikt mit der Kontra-Partei geraten; dasselbe galt für den Parteigänger von Kontra, der sich in einen starken Konflikt mit dem oder den Vertretern der Pro-Partei begab. Er wurde in beiden Fällen de facto Mitglied eines der beiden gegnerischen Blöcke. Er konnte aber auch eine Position einnehmen, in der er weder für die Pro- noch für die Kontra-Partei aktiv war. Dann war er neutral, d. h. in jedem Fall höchstens in einem schwachen Konflikt mit der Pro- wie auch der Kontra-Partei. Und als vierte Möglichkeit stand ihm offen, sich widersprüchlich und logisch inkonsistent zu zeigen, indem er sich entweder vieldeutig, logisch widersprüchlich, paradox oder oszillierend (d. h. mal für die Pro-, mal für die Kontra-Partei) verhielt.
Kriege sind in diesem Sinne immer starke Konflikte; die beiden Seiten des Konfliktes versuchen, sich gegenseitig aktiv zu negieren, d. h. im Extremfall: zu vernichten.
Polarisierungen führen im Allgemeinen zu einer brisanten, explosiven Situation. Als Beispiel dafür mag die weltpolitische Lage nach dem Zweiten Weltkrieg dienen, die zur Ost-West-Spaltung und zum Kalten Krieg führte. Allein die gegenseitige atomare Drohung dürfte das Heißwerden dieses Krieges verhindert haben (Abb. 3).
Was die Kontrahenten in diesem Fall vereinte, war die grundsätzliche Unterscheidung entsprechend dem Ost-West-Schema. Es war eine Klassifizierung, die wenig Differenzierung und keinen dritten Weg, der etwa „westliche“ und „östliche“ Merkmale miteinander kombinierte, zugelassen hätte.
Im Folgenden werden den hier skizzierten Beobachtungsrichtlinien entsprechend Beispiele historischer Kriege untersucht. Durch die Betrachtung ferner Kulturen (vortechnische Stammeskriege), ferner Zeiten (Erster Weltkrieg, Vietnamkrieg) oder auch ritualisierter Kampfhandlungen (Duell) usw. kann man eine relativ distanzierte Außenperspektive einnehmen, die es erlaubt, Beschreibungen von Kommunikations- und Beziehungsmustern vorzunehmen, die mit Kriegsgefahr verbunden sind, um anschließend zu versuchen, das tatsächliche Ausbrechen von Kriegen zu rekonstruieren und zu erklären.
Abb. 3 Die Leitunterscheidung, die nach dem Zweiten Weltkrieg die weltpolitische Lage organisierte, war die Ost-West-Unterscheidung bzw. die Unterscheidung zwischen den politischen Systemen „Kommunismus“ und „Westliche Demokratie“. Gegenüber dieser Innen-außen-Unterscheidung verloren alle internen Differenzierungen an Bedeutung. Neben den beiden Blöcken gab es eine Reihe blockfreier Staaten und einige Staaten, die sich von beiden Seiten umwerben ließen und wechselnde Koalitionen eingingen
.
Dabei besteht der erste Schritt darin, Kriege in ihrer Regelhaftigkeit zu erfassen. In einem zweiten Schritt sollen dann unterschiedliche Kriegstypen miteinander verglichen werden. Die Art, wie in vortechnischen Gesellschaften gekämpft wurde und wird, unterscheidet sich elementar vom High-Tech-Krieg, wie er etwa im Golfkrieg einen ersten Höhepunkt fand.
Die Komplexität moderner Kriege dürfte sich dabei zwar als größer erweisen als die von Stammeskriegen, dennoch ermöglicht es gerade deren Analyse aufgrund ihrer besseren Überschaubarkeit, charakteristische Organisationsformen des Krieges, idealtypische Kommunikations- und Interaktionsmuster und ihre Veränderung zu erfassen. Deshalb soll zunächst die Aufmerksamkeit auf Kriegsund (des Kontrastes wegen) Friedensmuster in vom Rest der Welt isolierten vortechnischen Gesellschaftsformen gerichtet werden.
* Es sollte an dieser Stelle, um Missverständnissen vorzubeugen, darauf hingewiesen werden, dass angesichts der vollkommen unüberschaubaren Flut von Veröffentlichungen zum Thema Krieg nicht der Versuch unternommen wird, den Stand der Wissenschaft zu referieren. Stattdessen wird eine sehr auf die Analyse von Beziehungsmustern fokussierte Literaturauswertung vorgenommen, und zitiert werden ausschließlich Studien, die im Rahmen der gewählten Argumentationslinie auch tatsächlich relevant erscheinen. Allerdings heißt das wiederum nicht, dass irgendwelche dieser Linie widersprechende Literatur (bewusst) ausgeklammert wird.
* Der Begriff des autopoietischen Systems wurde von dem chilenischen Biologen Humberto Maturana geprägt. Er sieht Leben durch eine spezifische zirkuläre Form der Organisation von Prozessen gekennzeichnet, durch die ein lebender Organismus sich von seiner Umwelt abgrenzt und unterscheidet. Es handelt sich dabei um Selbstorganisationsprozesse, bei denen die Elemente des Netzwerks der Prozesse, die das System konstituieren, durch das Netzwerk der Elemente des Prozesses selbst hergestellt werden. So werden beispielsweise die Elemente, die den Körper als abgegrenzte Einheit erhalten (biochemische Prozesse), von den Elementen des Körpers selbst produziert. Die Wand einer Zelle ermöglicht, dass die Stoffwechselprozesse, die zur Bildung der Zellwand nötig sind, stattfinden; die Zellwand ihrerseits wird von den Stoffwechselprozessen, die ohne sie nicht möglich wären, erzeugt. Es ist ein kreisförmiger, selbstbezüglicher Prozess. Dieser Typus selbst organisierter Systeme, die nicht von außen erschaffen werden, sondern sich in ihrer Struktur durch ihr eigenes Prozessieren herausbilden und als Einheit abgrenzen, sind von Humberto Maturana (1975) als „autopoietische Systeme“ bezeichnet worden. Von Niklas Luhmann (1984) wurde dieses Konzept auf soziale Systeme übertragen. Auch sie erhalten sich als abgegrenzte Einheiten durch ihre eigenen, selbstbezüglichen Aktivitäten. Ihre Elemente sind aber nicht biochemische Prozesse, sondern Kommunikationen.
II. Krieg und Frieden als Dauerzustand
1. KRIEG OHNE ENDE – FIDSCHI ALS IDEALTYPISCHES MODELL
Wohl keine Gegend der Welt und keine historische Epoche dürfte besser geeignet sein, die Logik des Krieges idealtypisch zu studieren, als die Gesellschaft der Fidschi-Inseln des 19. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit gab es genügend Beobachter aus Europa, die mit hinreichendem emotionalem und intellektuellem Abstand die Vorkommnisse und Abläufe beschreiben konnten, aber der europäische Einfluss war in seiner kolonialisierenden und missionierenden Wirkung noch nicht so groß, dass sich die Verhältnisse darunter grundlegend verändert hätten.
Fidschi scheint als Modell der Entstehung von Kriegen aus mehreren Gründen besonders günstig: Zum Ersten sorgt die Insellage dafür, dass die Komplexität der Situation aufgrund der Begrenztheit des zu beobachtenden Raums und der kämpfenden Parteien überschaubar bleibt. Zum anderen war Krieg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewissermaßen der Dauerzustand auf Fidschi,1 sodass sich den (europäischen) Beobachtern die Gelegenheit bot, die wiederholte Abfolge von (nur kurzfristigen) Friedenszeiten, Kriegsausbruch, Sieg, Niederlage usw. zu beschreiben.
Ein weiterer Grund, warum Fidschi so etwas wie eine Exposition zum Thema Krieg in seinen unterschiedlichen Facetten liefern kann, ist der damals praktizierte Kannibalismus. In ihm werden die drei beteiligten Systemtypen – soziales System, Psyche und Körper – symbolisch zusammengeführt: das Auffressen des Feindes als seine ultimative und nicht umkehrbare Unterwerfung und Demütigung. Dieses „Verspeisen des Feindes“, eine Vorstellung, die heute nur noch metaphorisch im Rahmen feindlicher Beziehungen auftaucht, verweist auf eine weitere Besonderheit von Stammeskriegen: Man sieht dem Feind ins Auge, Krieg findet als direkte Interaktion, als Face-to-face-Kommunikation statt; man schlägt dem Feind persönlich und unter Aufbietung eigener körperlicher Kräfte den Schädel ein – ein Aspekt, der mit der Entwicklung von Fernwaffen in Europa immer mehr an Bedeutung verloren hat. Man riskiert wenig, wenn man aus der Ferne schießt.
a) Die kämpfenden Einheiten
In früheren Zeiten, bevor die Weißen kamen, war das Sozialleben auf Fidschi von tief verwurzelten Mustern der Höflichkeit und des Protokolls und gleichzeitig einer nach europäischen Maßstäben „barbarischen Grausamkeit“ bestimmt.2
Hierarchie war das wesentliche Charakteristikum der sozialen Struktur. Man wurde in Kasten geboren, und an der Spitze eines jeden Dorfes stand ein Häuptling, der „Chief“. Die Dörfer gehörten zu größeren Einheiten, den so genannten Chiefdoms. Leben und Tod der Untertanen hingen von der Willkür des Häuptlings ab. Er hielt die Bewohner seines eigenen Dorfes mit Gewalt in Schach und ebenso die Chiefs tributpflichtiger, unterworfener Dörfer.3
Die Krieg führenden Parteien bestanden aus solchen Chiefdoms, d. h. größeren Mehr-Dorf-Einheiten. Die einzelnen Dörfer waren nicht mehr autonom, sie unterstanden einem gemeinsamen Oberhaupt. Zur Bildung dieser größeren Einheiten war es als Folge von Eroberungskriegen gekommen, der Unterwerfung der Verlierer folgte die Eingliederung ihrer Territorien in die der Sieger. Es kam zur Verschmelzung von zuvor unabhängigen Einheiten zu größeren, hierarchisch organisierten Einheiten. Aus einer segmentären Ordnung unabhängiger Dörfer entstand durch Kriege und die damit verbundene Entwicklung von Machtstrukturen eine stratifizierte Form gesellschaftlicher Differenzierung. Dieses hierarchische System wurde durch Anwendung von Gewalt stabilisiert.
Solch eine Entwicklungsdynamik kann für unterschiedliche Gegenden der Welt beschrieben werden. Die Situation auf Fidschi muss aber als besondere charakterisiert werden, weil das Stadium der Chiefdoms über sehr lange Zeit erhalten blieb. Es chronifizierte, und die Chiefdoms gerieten in eine Art Dauerkrieg miteinander. Das heißt, die Entwicklung zu immer größeren Einheiten, die in anderen Gegenden der Welt zur Staatenbildung und schließlich zum staatlichen Gewaltmonopol führte, fand nicht statt. Stattdessen, ohne übergeordnete Zentralgewalt, wurde der Krieg zwischen den formal egalitär nebeneinander existierenden Chiefdoms zum Dauerzustand.
Thomas Williams, ein sorgfältiger Beobachter in dieser Zeit, schreibt dazu im Jahre 1870: „Fidschi ist selten frei von Krieg … Die Häuptlinge stehen seit jeher im Krieg miteinander.“4 Er sieht in der Tatsache, dass es so viele unabhängige Regierungen gibt, die versuchen, ihren Einflussbereich jeweils auf Kosten der anderen zu vergrößern, den wichtigsten Grund für die andauernden Kriege.
Dies ist eine Hypothese, für die schon allein mathematische Überlegungen sprechen: Wenn es mehr Parteien gibt, so gibt es auch rein quantitativ mehr potenzielle Konflikte. Hinzu kommt, dass ein auffallender Kontrast zwischen internen und externen Beziehungen herrschte. Intern waren die Beziehungen zwischen den Dorf- bzw. Chiefdom-Bewohnern in extremer Weise hierarchisch, d. h. asymmetrisch geordnet; extern waren sie zwischen den Chiefdoms bzw. den Häuptlingen symmetrisch gestaltet. Während intern die Machtverhältnisse eindeutig waren, waren sie in den Außenbeziehungen vollkommen ungeklärt und offen. Was liegt näher, als das Mittel, das intern klare Machtbeziehungen gewährleistet, auch in den Außenbeziehungen anzuwenden: Gewalt?
Dass schon die Bereitschaft einer Partei zur Gewaltanwendung tatsächlich zum Krieg führte, ergab sich aus der Insellage. Eine Konfliktvermeidung durch Flucht, durch Räumen des Feldes, war nicht möglich. Aus demselben Grund kam es auch zu keiner Staatenbildung. Es gab keinen gemeinsamen Außenfeind, der als Repräsentant des fremden und gefährlichen Außen für die Entwicklung des Bewusstseins eines gemeinsamen Innen hätte sorgen und die Integration beschleunigen können. Die soziale Identitätsbildung durch Freund-Feind-Unterscheidungen musste intern, d. h. innerhalb der Bevölkerung der Inselgruppe, vollzogen werden. Es entstanden, dem entsprechend, kleine, autonome und miteinander um Vorherrschaft und Ressourcen kämpfende Einheiten.
Zur Vorbereitung von Kriegen wurden Allianzen geknüpft, bzw. es wurde versucht, Allianzen der Gegner zu verhindern. Allerdings waren diese Allianzen nicht sehr zuverlässig. Es gab ständig wechselnde Koalitionen, sodass die Verbündeten von heute damit rechnen mussten, von einem Tag auf den anderen von den vermeintlichen Freunden erschlagen zu werden.
Die Chiefs gaben Befehl, dass ihre Untertanen sich in Kriegsbereitschaft versetzten sollten. Wer sich verweigerte, wurde mit Gewalt sanktioniert. Die Armee war gleichbedeutend mit der gesamten gesunden männlichen Bevölkerung. Es herrschte also faktisch eine Art allgemeiner Wehrpflicht. Als Belohnung wurden denen, die sich im Kampf auszeichneten, junge Frauen und Frauen von Rang versprochen.5
Die Zahl der auf Fidschi kämpfenden Krieger jeder Partei lag in den hunderten, manchmal waren es tausend Kämpfer, in einzelnen Fällen umfassten Armeen sogar 4000–5000 Personen.6
Angesichts der Größe der Armeen konnten Kriege nicht mehr in Form nächtlicher Überfälle erfolgen, der Kriegsbeginn wurde formalisiert und zeremonialisiert, d. h., es wurden formelle und informelle Warnungen und Kriegserklärungen ausgesandt.
Unter den Waffen wurde auf Fidschi der Totschläger bevorzugt. Der Kampf erfolgte Mann gegen Mann, Angriffe wurden von der Drohung, das Gehirn des gegnerischen Häuptlings aufzuessen, begleitet.7
Während Kriege auf der Ebene autonomer Dörfer meist mit nur geringen Verlusten verbunden waren, nahm die Zahl der Toten beträchtliche Ausmaße an, wenn Chiefdoms miteinander kämpften. In den meisten Schlachten gab es 20 bis 200 Gefallene. Die größte Zahl von Toten, von denen Williams berichtet, ist 400. Die meisten davon waren Frauen und Kinder. In den 60er-Jahren des 19. Jahrhunderts betrug die Gesamtzahl der jährlichen Toten etwa 1500 bis 2000.8
Die Kriege waren blutig, ohne Rücksicht auf Geschlecht und Alter der Beteiligten. Der Kampf war ein solch wichtiger Bestandteil des Lebens auf Fidschi, dass derjenige, der einen Gegner totgeschlagen hatte, mit dem Ehrennamen Koroi bezeichnet wurde. Er gewann an Status. Gemeine Bürger konnten so einen gewaltigen Aufstieg vollziehen. Auch die Chiefs konnten ihre Position durch Kriegserfolge verbessern. Ihr Status, ihre Macht und ihr Territorium wuchsen gleichzeitig mit der Zahl ihrer Untertanen, die ihnen Tribut zollten.9
b) Kannibalismus – Der Körper als Kriegsschauplatz
Ein Charakteristikum des Lebens auf Fidschi war der Kannibalismus, der in alle Aspekte der Kultur verwoben war. Es ist zu vermuten, dass er als Form der Rache entstanden ist. Kannibalismus war ein elementarer Bestandteil der Kriegführung. Wer im Kampf umkam, wurde aufgegessen.
Einer der Effekte des Verspeisens des Gegners war die Einschüchterung der Feinde. Aber darüber hinaus hatte es auch noch einen symbolischen Wert: Wen man verspeist, dem zeigt man seine Verachtung.10
Das Aufessen des Feindes ist der konkrete Vollzug dessen, worum es auf einer abstrakteren Ebene beim Krieg fast immer geht: die Auflösung des Gegners als separate und autonome Überlebenseinheit. Wer in kleine Stücke geschnitten, gekocht, gekaut, geschluckt und verdaut wird, ist am Ende zum integralen Bestandteil des Siegers bzw. seines Organismus geworden. Seiner autonomen Existenz ist ein Ende gesetzt, die Autopoiese, der Lebensprozess, ist beendet. Das bis dahin abgegrenzte System Körper wird im buchstäblichen, konkreten Sinne internalisiert und zum unbelebten Rohstofflieferanten für die Lebensprozesse des Siegers. Der Kannibalismus kann insofern als Metapher für das verstanden werden, worum es auch bei den Kriegen größerer sozialer Einheiten geht oder zumindest gehen kann: um Schlucken und Geschlucktwerden als Form der Bemächtigung. Nur dass diese Metapher auf Fidschi eben in erstaunlichem Konkretismus realisiert und gelebt wurde. Der Machtkampf wurde, wenn er entschieden war, auf körperlicher Ebene wiederholt, der Sieg biologisch ratifiziert.
Dabei wurde besonders prominenten oder verachteten Feinden gegenüber vor keinerlei Grausamkeit zurückgeschreckt. Sie wurden einer speziellen Behandlung unterzogen. Ihnen wurden Körperteile (Finger, Nase, Zunge, ganze Glieder) abgetrennt, die vor ihren Augen gekocht und ihnen anschließend zu essen angeboten wurden. Gefangene wurden so gefoltert, dass ein Schlag mit dem Totschläger auf den Schädel stets als glücklicheres Schicksal vorzuziehen war. In den Häusern der großen Chiefs gab es fast jede Woche Menschenfleisch zu essen. Für Frauen war es in der Regel tabu. Nur wenn es ganz besonders erfolgreiche Expeditionen gab, wurden sie eingeladen, sich an dem Festmahl zu beteiligen.11
Insgesamt kann man wohl sagen, dass die Sieger sich eine vergnügliche Zeit mit und bei dem Verspeisen ihrer Feinde gönnten, zumal Menschenfleisch als Delikatesse galt.
Aber der Kannibalismus ist nur ein besonders signifikantes Beispiel für die Nutzung des Körpers als Machtmittel. Denn auch in nerhalb des Chiefdom wurde der Körper in ganz elementarer Weise als Ort, Machtverhältnisse zu exerzieren, genutzt. Mangelnder Respekt dem Chief gegenüber wurde durch Abhacken eines Fingers oder eines Ohrs oder einer anderen Gliedmaße bestraft oder auch durch den Tod.12
Wer krank oder alt war, wurde verachtet. Wer nicht mehr in der Lage war, irgendwelche nützlichen Tätigkeiten zu vollziehen, wurde – oft auf eigene Anforderung – von den Kindern stranguliert. Kranke wurden gelegentlich lebend begraben, die Tötung von Neugeborenen und Säuglingen war üblich.
Das Töten von Feinden wurde als ein Wert an sich betrachtet, unabhängig davon, wie dies geschah. Es war also durchaus nicht unehrenhaft, alten, gebrechlichen Frauen oder kleinen, hilflosen Kindern aufzulauern und ihnen mit einer Keule über den Kopf zu hauen. Wer ein Mitglied einer feindlichen Gruppe umgebracht hatte, erhielt seinen Ehrentitel unabhängig von den Qualitäten des Opfers oder der Methode, mit der er es zur Strecke gebracht hatte.13
Man wurde nicht sehr alt auf Fidschi, Misstrauen beherrschte den Alltag, keiner verließ ohne Totschläger das Haus.
Die internen Stammesbeziehungen in ihrer streng hierarchischen, durch Gewalt stabilisierten Form führten auch innerhalb von Familien zu Gewalttätigkeiten. Man kannte buchstäblich keine Verwandten, zumindest keine Rücksicht auf sie: Es kam zu mörderischem Hass zwischen Brüdern von gleichem Rang, was häufig dazu führte, dass einer von ihnen sein Leben verlor. Da nur einer die Rolle des Chief einnehmen konnte, tötete der Bruder den Bruder und der Vater den Sohn, um die Macht für sich zu gewinnen oder zu behalten.
Hier zeigt sich, dass Kriege auf der interpersonellen Ebene und der Ebene zwischen sozialen Systemen denselben Mustern folgen. Asymmetrie und Eindeutigkeit der Hierarchie wird durch Gewalt erreicht und/oder stabilisiert. Symmetrie und Uneindeutigkeit der Machtverhältnisse führt zu Gewalttätigkeit, um Asymmetrie herzustellen, falls (mindestens) eine der beteiligten Parteien die Macht anstrebt. Wo dies nicht gelingt, chronifiziert die Symmetrie und damit die Wahrscheinlichkeit des nächsten Krieges, d. h. des nächsten Versuchs, Asymmetrie herzustellen. Dies schon allein deswegen, weil durch die praktizierte Grausamkeit und den Kannibalismus ein hohes Maß an Rachebedürfnis geweckt wird, was zwangsläufig zur Eskalation des Hasses und zur Fortsetzung des Krieges führt. Nach dem Krieg war daher auf Fidschi, angesichts der offenen Rechnungen und der ungeklärten Machtverhältnisse, immer vor dem Krieg.
c) Kommunikationsmuster
Will man die Organisationsprinzipien der skizzierten Dynamik darstellen, so kann man – fern aller Erklärungsversuche – idealtypische Muster des Kriegsgeschehens auf Fidschi beschreiben.
Kriegführende Überlebenseinheiten
Handelnde Einheiten sind die voneinander abgegrenzten Chiefdoms. Sie sind autonom und voneinander unabhängig, d. h., sie stehen in keiner formalisierten Organisationsbeziehung zueinander. Manchmal kommt es zu Koalitionen zwischen mehreren Chiefdoms. Da sie sehr unzuverlässig sind (lose gekoppelt), kommt es nicht zur dauerhaften Bildung größerer organisierter Einheiten. Es sind stets einzelne Chiefdoms, die als handelnde Einheiten in Erscheinung treten, auch wenn manche eine beträchtliche Größe entwickeln können.
Mechanismen der Abgrenzung
Innerhalb der Chiefdoms gibt es klare hierarchische Strukturen, in denen jeder aufgrund seiner Geburt seinen ihm zustehenden Platz kennt. Fidschi-Dörfer und Chiefdoms können als hoch integriert charakterisiert werden. Die Entscheidungsgewalt in allen Leben und Tod betreffenden Fragen liegt beim Häuptling. Er ist der absolute Herrscher und Befehlshaber, dem sich seine Untertanen demütig unterzuordnen haben. Wer dies nicht tut, signalisiert damit, dass er entweder nicht zum Dorf/Chiefdom gehört oder aber dass er bereit ist, den Kampf um die Führungsrolle mit dem Häuptling aufzunehmen.
Beziehung der Kontrahenten bei Kriegsbeginn
Aufgrund der begrenzten räumlichen Möglichkeiten lässt sich der Kontakt zwischen diesen autonomen Überlebenseinheiten nicht vermeiden. Es gibt keine überlieferten und etablierten Über- oder Unterordnungsverhältnisse zwischen ihnen, sodass die Beziehung entweder als undefiniert oder aber als symmetrisch bezeichnet werden kann.