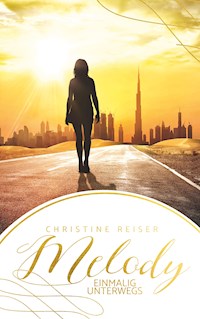
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Stell dir vor, du könntest dich mit nur einem Gedanken von Stadt zu Stadt beamen. Jedes Fleckchen Erde wäre für dich erreichbar. Welche Möglichkeiten würden sich für dich auftun? Melody liebt ihre Familie und würde alles für diese tun. Aber nicht nur das macht sie zu etwas ganz Besonderem. Sie und ihre Familie umhüllt ein Geheimnis, das kein Mensch erfahren darf. Als ihr Vater nicht geplant zum verabredeten Zeitpunkt erscheint, überschlagen sich die Ereignisse und sie findet heraus, dass nicht alles so ist, wie man oft zu glauben meint.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stell dir vor, du könntest dich mit nur einem Gedanken von Stadt zu Stadt beamen. Jedes Fleckchen Erde wäre für dich erreichbar. Welche Möglichkeiten würden sich für dich auftun?
Melody liebt ihre Familie und würde alles für diese tun. Aber nicht nur das macht sie zu etwas ganz Besonderem. Sie und ihre Familie umhüllt ein Geheimnis, das kein Mensch erfahren darf. Als ihr Vater nicht geplant zum verabredeten Zeitpunkt erscheint, überschlagen sich die Ereignisse und sie findet heraus, dass nicht alles so ist, wie man oft zu glauben meint.
Fantasie ist ein Ort, in den ich mich flüchte. In eine Welt eintauche, die die Realität verlässt. Da ist Vergessen, da ist Freisein. Ich und doch nicht ich sein. Eine Bereicherung, ein Traum, in dem ich stehen bleibe, verweile, ATME, um dann wieder aufzutauchen.
Julia Scharton
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Tag 1
Tag 2
Tag 3
Tag 4
Kapitel 23
Tag 5
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 1
Es war ein sehr schöner Sommertag im August. Die Sonne brannte heiß auf mich herunter, ein kühler Wind wehte und brachte meine Haare durcheinander. Ich saß vor unserem Haus, auf meinem großen Koffer und wartete auf meinen Vater. Die Straßen waren wie leer gefegt. Die meisten unserer Nachbarn waren im Urlaub oder vergnügten sich im Freibad. Das war typisch für die Sommerferien. Langsam begann ich, mich zu langweilen. Von meinem Vater war noch immer nichts zu sehen. Er war schon seit einer halben Stunde überfällig, was ganz normal für ihn war. Dieser Umstand ging mir heute aber extrem auf die Nerven. Denn heute war es endlich so weit: Wir würden zu unserem gemeinsamen Urlaub aufbrechen. Nicht dass der Urlaub für mich was Besonderes war. Nein! Denn das konnte ich zu jeder Zeit und zu jeder Stunde problemlos machen. Ich war ständig in anderen Ländern unterwegs und hatte auch schon viel von der Welt gesehen. Das Besondere heute war, dass wir die Familie meines Vaters auf Hawaii trafen, um ein paar schöne Wochen miteinander zu verbringen. Ich konnte es nicht erwarten, meine Cousinen und Cousins alle wiederzusehen. Denn ich war ein typisches Einzelkind, das nach Geschwistern lechzte. Besonders auf meine Cousine Bella freute ich mich. In der letzten Zeit hatten wir uns sehr selten gesehen, weil ihre Eltern ihr das Reisen verboten hatten. Aber das war eine ganz andere Gesichte. Genervt schaute ich auf meine Armbanduhr, der Zeiger drehte seine Runden. Aber mein Dad war immer noch nicht aufgetaucht. Ich saß mutterseelenalleine hier und fühlte mich wie bestellt und nicht abgeholt. Langsam fing ich an, mir Sorgen zu machen. Dass er zu spät kam, war seine zweite Natur. Aber nicht heute, da er wusste, wie wichtig es war, dass wir uns zusammen dahin begaben. Und ich, seine einzige, zickige Tochter, ihm eine Riesenszene machen würde, falls er es vermasseln sollte. Ich gab ihm noch zehn Minuten. Genervt holte ich mein Handy aus meiner Shorts heraus. Keine Nachricht. Wie es aussah, vermisste man uns noch nicht. Wo blieb er nur? Heute Morgen hatte er mir versichert, dass er nur ganz kurz seine jetzige Freundin in London besuchen wollte. Mein Dad war, wie er halt war. Ein ewiger Junggeselle mit einer Frau an jedem Finger. Und das Komische daran war, dass diese Frauen ihn nie dabei erwischen konnten, wie er sie gegenseitig betrog. Denn sie befanden sich alle verstreut auf der ganzen Erde! So, meine Geduld war am Ende. Ich schaute auf meinen Ring, der leuchtete nicht. In unserer Familie besaß jeder einen Ring mit einem Stein. Meiner war so braun wie meine Augenfarbe. Wenn wir in Schwierigkeiten waren, leuchtete er hell auf. Dann musste ich nur meine Hand drauf legen und sah innerlich, wer in Schwierigkeiten steckte. Mit dem Ring konnte ich auch jede Person in meiner Familie aufspüren. Ja, wir waren alle etwas ganz Besonderes. Wir sahen zwar wie Menschen aus, aber wir waren keine, weil wir besondere Fähigkeiten hatten. Besser gesagt, eine besondere Fähigkeit. Ich für meinen Teil fand, dass wir Menschen waren, nur hatten wir zusätzlich ein anderes Gen dazubekommen. Ein Lächeln spielte sich um meine Lippen. Ich würde ohne meinen Dad gehen. Sollte sich doch meine Oma mit ihm auseinandersetzen. Ich war es satt, immer die Erwachsene zu sein. Mit meinen fast achtzehn Jahren galt ich ja schon als beinahe erwachsen, aber manchmal dachte ich, Dad wäre viel jünger als ich. Zufrieden schloss ich die Augen und stellte mir Hawaii innerlich vor. Den Strand, die Sonne und den Sand. Es reichte eigentlich schon, den Namen leise vor sich hin zu sagen. Aber ich machte gerne beides, denn das bereitete mich besser darauf vor, was auf mich zukam. Fast zeitgleich mit meinem Bild im Kopf spürte ich das bekannte, warme Kribbeln auf meiner Haut, das sich schnell auf meinem Körper verbreitete. Erst wurde mir kalt, dann heiß und das Kribbeln verschwand schlussendlich so schnell, wie es gekommen war. Ich öffnete meine Augen – und war auf Hawaii. Mein Herz schlug gleich schneller. Mit schnellen Atemzügen sog ich die Meeresluft in mich hinein. Die heißen Sonnenstrahlen auf meinem Gesicht genoss ich zufrieden. Ich liebte die Hitze. Wenn es nach mir gehen würde, wäre es rund ums Jahr vierzig Grad heiß. Aber wie sagte mein Dad immer: „Zum Glück geht es nicht immer nach deinem Kopf.“ Desto glücklicher war ich jetzt, die Hitze in mich aufzunehmen.
„Melody, Melody“, rief mich eine mir wohl bekannte Stimme. Ich war richtig gelandet, da wo unser Familienhaus stand, weit weg von jeglichen Touristen oder Einheimischen. Wir mochten keine Zeugen, wenn wir uns irgendwohin beamten! Denn dieses Geheimnis durfte kein normaler Mensch je erfahren. Was ich sehr bedauerte.
„Melody!“, rief die Stimme wieder. Genervt blickte ich mich in diese Richtung um. Meine Oma stand auf der Terrasse und brüllte aus Leibeskräften. Soviel dazu, dass wir noch nicht erwartet wurden. Ich winkte ihr und setzte mein freundliches Lächeln auf. Sie durfte ich nicht verärgern. Sie hatte mich sowieso zurzeit auf dem Kieker. Mit langsamen Schritten ging ich auf das Haus zu und rollte meinen Koffer hinter mir her, so gut es halt im tiefen Sand möglich war. Hochkonzentriert versuchte ich, mich nicht über Dads Abwesenheit zu ärgern. Denn eigentlich war es seine Aufgabe, die Koffer über den Sand zu schleppen und nicht meine. Ich kam zwar sehr gut auch ohne seine Hilfe zurecht, aber in bestimmten Dingen war ich einfach Papas kleine Prinzessin und Koffer über den Sand ziehen war eine dieser Dinge. So bemerkte ich nicht die näher kommenden Schritte. Ruckartig wurde ich in die Luft gehoben.
„Ahhhhhh“, schrie ich aus Leibeskräften. Aber die starken Hände trugen mich weiter, ohne meinen Widerstand für voll zu nehmen. In der nächsten Sekunde flog ich in die Luft und landete im salzigen Meerwasser. Prustend kam ich hoch. Die Stelle war nicht tief und ich konnte ohne Problem stehen. Wenn man bedachte, dass ich mit meinen eins dreiundsechzig nicht gerade groß war. Tiefes, dunkles Lachen drang zu mir herüber. Ich rieb mir die brennenden Augen und endlich konnte ich wieder sehen. Ein junger Mann mit dunklen Haaren, hellen Augen und einer stattlichen Figur stand am Ufer und lachte laut über seinen gelungenen Streich. Sehr attraktiv wirkte er in seinen kurzen Badehosen. Ein Lächeln bildete sich auf meinem Mund. Eins zu null für ihn. Ich liebte dieses Lachen. Denn vor mir stand mein großer Cousin, der wie der Bruder, den ich nie gehabt hatte, für mich war.
„Dir auch ein schönes Hallo, Nick“, rief ich ihm zu und ging langsam aus dem Wasser. Zum Glück hatte ich ein schwarzes Top und dunkle, blaue Shorts angezogen. So konnte er keine Porno ähnlichen Bilder mit seinem Smartphone machen. Denn er liebte es, vor seinen Freunden mit uns, seinen Cousinen, anzugeben. An seinem Gesichtsausdruck sah ich, dass er es jetzt erst merkte. Eins zu eins. Es stand wieder unentschieden. Ach, wie ich diese Wettkämpfe in meiner Familie liebte. Langsam ging ich auf ihn zu. Wir grinsten uns an. Dann umarmten wir uns herzlich.
„Hallo, Nickilein!“
„Melody! Endlich bist du da! Es wurde fast schon langweilig!“, zog er mich auf.
„Nick!“, schimpfte ich.
„Wo ist Tom?“ Oh nein. Jetzt waren wir schon wieder bei meinem Problem angekommen.
„Dad kam wieder zu spät!“, rechtfertigte ich mich.
„Haha“, lachte er laut.
„Oma wird sich freuen! Du weißt, dass sie das nicht mag, wenn du ohne ihn alleine unterwegs bist!“
„Ja.“ Ich stöhnte laut auf.
„Ich bin nicht mehr klein!“
„Das wissen du und ich. Aber sie nicht!“ Jetzt musste ich laut auflachen. Wo er recht hatte, hatte er recht!
„Wo ist Bella?“, wechselte ich das Thema
„Bella? Muss ich sie kennen?“ Gespielt verdrehte er die Augen. Ich lachte wieder.
„Nick. Sind alle schon da?“
„Ja, Süße!“
„Oh nein!“ Ich stöhnte laut. Das würde mir eine lange Rede von meinem Opa einbringen. Er hasste es, wenn man sich nur eine Minute verspätete. Manchmal fragte ich mich, wie er so einen Sohn hatte zeugen können.
„Hör ihm einfach nicht zu!“, versuchte Nick, mich aufzumuntern. Langsam näherten wir uns dem Haus.
„Melody, da bist du ja endlich!“, wurden wir von unserer Oma begrüßt. Mit ihren eins sechzig war sie klein, rundlich und ein regelrechter Wirbelwind.
„Hallo, Oma!“, begrüßte ich sie mit gemischten Gefühlen, denn ich wusste nicht, wie sie darauf regieren würde, dass ihr Lieblingssohn nicht dabei war. Schon wurde ich an ihre weiche Brust gedrückt.
„Wo ist Tom?“ Sie schaute hinter uns. Ich sah zu Nick und verdrehte die Augen. Er grinste mich breit an. Bei meiner Oma drehte sich alles um Tom. Er war nämlich das jüngste von ihren fünf Kindern.
„Mein Vater ist noch nicht da!“, antwortete ich trocken.
„Nicht da? Hat er es vergessen?“ Ihre Augen glitzerten empört.
„Heute Morgen wusste er es noch!“, rechtfertigte ich mich.
„An welchen Ort ist er gereist?“ Sie wusste ganz genau, dass er bei irgendeiner seiner Frauen war. Auch wenn sie ihn abgöttisch liebte, hasste sie sein Verhalten desto mehr.
„London!“
„Melody! Erzähl doch bitte alles. Oder muss man dir immer alles aus der Nase ziehen!“, verlor meine Oma die Geduld.
„Melody!“, rief mein Opa aus und kam aus dem Haus auf mich zugeschritten, schon wurde ich an seine starke Brust gedrückt. Mein Opa war ein Berg von Mann, groß und schlank wie ein Baum. Aber muskulös. Sofort fühlte ich mich in seinen Armen geborgen. So sollte ein richtiger Vater auf mich wirken. Aber mein Dad war das krasse Gegenteil davon.
„Lisa, was machst du für ein Lärm hier draußen?“, fragte er Oma. Dabei hielt er mich immer noch im Arm.
„Tom ist verschwunden!“, stellte sie panisch fest. Opa hob seine Augenbrauen.
„Jetzt gehen wir alle rein und du erzählst uns alles in Ruhe, Melody!“, befahl er mit ruhiger Stimme. Mir drehte sich der Magen um. Ich war zwar nicht auf den Mund gefallen, aber ich hasste es, vor allen Verwandten zu sprechen. Die waren nämlich nicht immer alle nett. Oma rannte fast ins Haus hinein. Nick schlenderte hinter mir und Opa her.
„War dein Beamen angenehm?“, versuchte Opa, freundlich zu sein. Ich nickte wortlos. Dann betraten wir das Wohnzimmer. Die ganze Mannschaft war versammelt und alle Augen richteten sich sofort auf mich. Immer wieder fragte ich mich, wie Oma es in der kurzen Zeit stets schaffte, alle so schnell zu versammeln.
„Hallo, Melody!“, wurde ich von allen freundlich begrüßt.
„Hallo“, rief ich in die große Runde. Bella trat auf mich zu und umarmte mich. Ich grinste.
„Was hat dein Dad jetzt wohl ausgefressen?“, flüsterte sie mir ins Ohr.
„Das Übliche“, raunte ich ihr zu. Sie stellte sich zu mir.
„Wo ist Tom?“, fragte Onkel Frederik mich direkt. Er war der älteste der fünf Geschwister und genauso Single wie mein Dad. Frederik hatte auch nicht vor, sich festzulegen. Er sah Dad sehr ähnlich. Mit seinen blonden, welligen Haaren, grünen Augen und seiner muskulösen Figur.
„Mein Vater kam nicht geplant von London zurück! Ungefähr eine Stunde hab ich auf ihn gewartet. Was, wie ihr alle wisst, nichts Ungewöhnliches für ihn ist!“, brachte ich es hinter mich. Opa atmete erleichtert auf. Frederik grinste mich breit an.
„Hast du schon mit dem Ring nach ihm gesucht?“ Omas Stimme klang schrill.
„Mama, er wird schon noch kommen!“, mischte sich Tante Bianca ein. Sie war die zweitjüngste. Ihr Haar schimmerte von schwarzer Farbe. Sie war sehr schlank und ihre grüne Augen glitzerten beruhigend. Im Gegensatz zu ihren Brüdern war sie glücklich verheiratet mit einem ganz normalen Menschen – Kasimir. Er wusste auch über uns Bescheid. Wie jede Regel hatte auch unsere seine Schlupflöcher. Sie hatte mit Kasimir vier Kinder, die zu ihrem Glück alle das Gen mit vererbt bekommen hatten.
„Genau, Mama, du machst dir viel zu viele Sorgen um ihn. Er ist schon lange erwachsen und kann ganz gut selber auf sich aufpassen“, unterstützte sie die zweitälteste Tochter Tante Claudia. Sie hatte auch schwarze Haare und grüne Augen und war genauso schlank wie die anderen vier Geschwister. Ich fand es schon immer interessant, dass die drei Söhne blonde Haare hatten und die zwei Töchter schwarze. Nur die grünen Augen hatten sie alle gemeinsam. Auch sie hatte zwei Kinder und war verwitwet. Ihr verstorbener Mann hieß Leo und war im vierten Grad mit uns verwandt gewesen, sodass die Kinder keine Mischlinge waren. Früher gab es nämlich den Brauch, dass man sich nur unter unseresgleichen vermehren durfte. In der heutigen Zeit war man etwas offener geworden, sodass man sich hin und wieder mit einem Menschen vermischen durfte. Ekel kam in mir hoch. Wie konnte man mit einem Verwandten Kinder haben?
„Ich bin nur vorsichtig, Claudia, und du weißt am besten, warum“, reagierte Oma noch immer aufgebracht. Sie spielte auf den Tod von Onkel Leo an. Von uns Kindern wusste keiner genau, wie er gestorben war. Da blieben die Erwachsen stur und erzählten uns nichts.
„Melody, Kleines, könntest du bitte kurz schauen, ob es deinem Vater gut geht und wo er sich gerade aufhält? Dann können wir uns nämlich wieder in die Sonne legen und die Zeit genießen!“, äußerte sich Tante Susanne. Sie saß auf Onkel Karstens Schoß. Er war der mittlere Sohn von Oma und Opa. Susanne war genauso ein Mensch wie Onkel Kasimir. Sie hatte rote Haare und freundliche braune Augen. Onkel Karsten war der gemütlichste der fünf Geschwister. Auch er hatte die wunderschönen grünen Augen und blonden Haare von Opa geerbt, aber glich vom Wesen eher seiner Mutter. Natürlich hatten die beiden auch Kinder, insgesamt drei. Und zwei davon waren meine besten Freunde – Nick und Bella. Obwohl ich mich mit Olivia, der älteren der drei, auch sehr gut verstand. Sie war nur einige Jahre älter als wir. Sie war ebenfalls mit einem Menschen, Marcel, seit einem Jahr verheiratet. Wie man sah, vermischten wir unser Blut immer mehr und mehr mit Menschen. Was meiner Oma überhaupt nicht gefiel. Deswegen hatte sie sich geschworen, Bella und mich mit unseresgleichen, also sprich Verwandten, zu vermischen. Weit war sie damit zum Glück noch nicht gekommen. Alle schauten mich erwartungsvoll an.
Kapitel 2
Ich schloss meine Augen und blendete alle Anwesenden aus. Dann drückte ich mit der anderen Hand meinen Ring. Innerlich stellte ich mir die Frage: „Geht es Dad gut?“ Ich konzertierte mich nur alleine auf diese eine Frage. Sofort spürte ich die Wärme des Ringes. Ein Bild erschien in meinem Kopf. Wie er gefesselt in einem dunklen Raum saß. Seine Augen waren geschlossen. Mehr konnte ich nicht erkennen. Erschrocken riss ich meine Augen auf und unterbrach die Verbindung.
„Was ist?“, fragte Oma ängstlich, als ob sie etwas ahnen würde. Ich antwortete nicht. Ich war immer noch geschockt von dem Bild, was ich hatte erblicken müssen. Schnell schloss ich wieder die Augen und drückte auf den Ring. Diesmal stellte ich mir die Frage: „Wo ist Dad?“ Die Wärme entfaltete sich erneut und es erschien ein Bild in meinem Kopf. Das konnte doch nicht sein! Ängstlich riss ich wieder die Augen auf.
„Melody!“, ermahnte mich Opa ungeduldig.
„Er ist in China in einem dunklen Raum eingesperrt und gefesselt!“ Die Anwesenden schnappten nach Luft und jegliches Lächeln verlor sich. Oma setzte sich geschockt auf ihren Sessel.
„Ich wusste es“, murmelte sie leise.
„Bist du dir sicher?“, brummte Frederik, der aufgesprungen war. Ich nickte. So langsam begriff ich, dass es alles kein Spiel war, sondern dass mein Dad in richtigen Schwierigkeiten steckte. Nur verstand ich nicht, weshalb. Er war mein Dad, den jeder liebte und schätzte. Ich hatte nämlich noch nie mitbekommen, dass er je mit irgendjemandem mal Streit gehabt hätte.
„Ist China nicht für euch seit ein paar Jahren tabu?“, fragte nun Tante Susanne.
„Ja! Was macht er nur da?“, wollte Onkel Karsten wissen. Er war mittlerweile ebenfalls aufgestanden. Die Erwachsenen schlossen fast alle ihre Augen und bedienten ihren Ring.
„Ich sehe es auch!“, bestätigte Oma meine Vision.
„Ich sehe gar nichts!“
„Ich auch nicht!“ Wie es aussah, konnten nur ich und Oma mit ihm eine Verbindung aufbauen.
„Sie müssen ihn gefangen halten!“, stellte Tante Bianca fest.
„Sie?“, fragte ich
„Bianca, nicht vor den Kindern!“, ermahnte Opa.
„Sie sind doch fast alle keine Kinder mehr“, warf Tante Claudia ungeduldig ein.
„Nicht jetzt!“, donnerte Frederik. „Kinder, verschwindet alle nach oben.“ Ich schaute von einem zum anderen und verstand nur Bahnhof. Bella und Nick schauten genauso ratlos drein wie ich.
„Habt ihr euren Onkel nicht gehört!“, sagte Opa ernst.
„Opa, es geht hier um meinen Papa. Ich gehe nirgendwo hin“, stellte ich mich stur. Ich wollte wissen, über wen die Erwachsenen sprachen und was eigentlich los war. Und vor allem, wie mein Dad wieder heil daraus kommen würde!
„Melody, jetzt nicht! Geht sofort alle hoch!“ Opa war mittlerweile zornig. Und das bedeutete nichts Gutes. Wie auf Kommando standen alle auf und begaben sich die Treppen nach oben ins frühere Spielzimmer.
„Olivia, du bist die älteste hier, um was geht es da unten genau?“, wandte ich mich sofort an sie.
„Ich weiß genauso viel wie ihr!“, antwortete sie schnell. Mit ihren roten Haaren, die sie von ihrer menschlichen Mutter geerbt hatte, stach sie total heraus. Ihr Mann besaß schwarze Haare und ehrliche braune Augen. Sie waren sehr verliebt. Neidisch beobachtete ich die beiden, wie sie sich aufs Sofa nebeneinander kuschelten und leise miteinander flüsterten. Nicht, dass sich gerade wenig Jungs für mich interessieren würden. Aber das Problem war, dass ich mich nicht mit jedem abgeben wollte. Ich wollte nur die wahre Liebe an mich ranlassen. Das, was meine Großeltern hatten, das wollte ich auch und nicht das, was mein Vater so toll fand. Vielleicht ließ er mich deswegen so oft allein, weil er wusste, wie ich dachte? Es war nicht einfach, nur von einem männlichen Teil erzogen zu werden. Meine Mutter kannte ich leider nicht. Ich wusste nicht mal, wie sie hieß oder wer sie genau war. Niemand sprach über sie. Als Teenie hatte ich mal versucht, was über sie rauszubekommen. Ich wusste nicht einmal, ob sie menschlich war oder eine von uns, denn ich stieß nur auf Ablehnung und Stillschweigen. Irgendwann gab ich auf und fand, sie war die Mühe nicht wert.
„Melody, es wird schon alles gut werden!“, sprach mich Bella an. Ich schaute entgeistert in ihre wunderschönen grünen Augen. Bella war eine Augenweite. Mit ihren blonden Haaren und ihrer kurvenreichen Figur zog sie sehr viele Männerblicke auf sich.
„Meinst du?“ Ich war mir da nicht so sicher.
„Die werden bestimmt Tom suchen gehen“, mischte sich Clarissa ein.
„Warum tun die dann so geheimnisvoll?“, fragte ihr Bruder Bastian. Clarissa verdrehte ihre hübschen blauen Augen. Clarissa, Bastian, Felix und Ariel waren die Kinder von Tante Bianca und Kasimir.
„Ich glaube, das weiß keiner so genau. Das Einzige, was klar ist, ist, dass sie Geheimnisse vor uns haben“, mischte sich nun auch Nick sachlich in die Unterhaltung ein.
„Haben wir eigentlich auch Feinde?“, fragte Ariel neugierig. Erstaunt schaute ich die Vierzehnjährige an. Sie war die jüngste in unserer Familie. Ihre Geschwister waren alle je ein Jahr älter.
„Das ist eine interessante Frage!“, stellte ich laut fest.
„Nein, die haben wir nicht“, beteiligte sich Maxim an der Unterhaltung.
„Du weißt es von?“, meldete sich auch seine Schwester Sabrina zu Wort. Ich betrachtete beide Geschwister genau. Sie waren so unterschiedlich. Maxim war sehr groß und schlank, hatte schwarze Haare und braune Augen. Sabrina dagegen war klein, dunkelblond und hatte natürlich grüne Augen, so wie fast jeder in unserer Familie.
„Ich hab unsere Mutter gefragt!“, rechtfertigte er sich.
„Du denkst, Tante Claudia sagt die Wahrheit?“ Bella runzelte die Stirn.
„Bella, willst du gerade meine Mutter als Lügnerin darstellen?“ Sabrina hörte sich wütend an. Na ja, wir verstanden uns nicht alle richtig gut. Aber bei so einer Menge Cousins und Cousinen war es auch nicht leicht.
„Hey, Leute, wir streiten uns nicht. Aber ich denke, Bella hat recht. Denk daran, Sabrina, Opa hätte es ihr verbieten können!“, warf ich ein. Wütend starrte sie mich an.
„Sie könnte recht haben, Schwesterherz!“
„Wie wäre es, wenn wir die Erwachsenen zur Rede stellen, alle gemeinsam!“, schlug Felix vor. Wir schauten ihn an. Für seine fünfzehn Jahre war er schon sehr klug, zu klug.
„Du meinst, wenn wir sie als Einheit an die Wand drücken, dann lügen sie uns nicht an?“, überlegte Nick.
„Ja, denn gemeinsam sind wir stark!“
„Die Predigt unseres Opas!“ Bastian schmunzelte milde.
„Und wann?“, fragte ich ungeduldig. Olivia stand auf.
„Jetzt sofort!“ Alle nickten zustimmend. Gemeinsam machten wir uns wieder auf den Weg nach unten. Aber unten war keiner.
„Die Frauen sind am Strand!“, rief April aufgeregt.
„Und die Männer?“, wollte Marcel interessiert wissen.
„Nirgends zu sehen!“, rief Felix.
„Dann ab zu den Frauen!“, rief ich und ging voran. Die anderen folgen mir. Unsere Tanten, Mütter und Oma sahen uns mit verwunderten Gesichtern entgegen. Bei ihnen angekommen, schauten wir uns erst unsicher an.
„Wo sind die Männer?“, ergriff Bastian das Wort.
„Tom holen!“, antwortete Tante Bianca.
„Ohne mich!“, begehrte ich auf.
„Ja, ohne dich, Melody, du weißt gar nicht, was da vorgeht!“, konterte Oma.
„Und du schon?“, griff ich sie an. Meine Gruppe holte tief Luft. Bis jetzt hatte es noch keiner gewagt, ein Wort gegen unsere Großeltern zu sprechen. So viel Respekt wurde uns von Kindesbeinen an beigebracht. Ich wusste, dass ich mich auf dünnes Eis begab. Aber das war mir egal. Ich wollte nur die Wahrheit wissen. Denn das Bild meines gefangenen Vaters ließ mich nicht los.
„Melody, du musst noch vieles lernen!“, ermahnte sie mich sanft.
„Wir wollen die Wahrheit wissen. Und zwar die ganze Wahrheit über uns!“, mischte sich plötzlich Bella ein.
„Keine Lügen mehr!“, rief Maxim und fixierte dabei seine Mutter. Die Frauen schauten uns mit großen Augen an.
„Ich bin eurer Meinung“, bestätigte Tante Claudia uns.
„Claudia …“
„Ich denke genauso!“, unterbrach Tante Bianca ihre Mutter.
Plötzlich wurde es ein paar Schritte von uns entfernt unnatürlich hell. Auf der Bildfläche erschienen Onkel Frederik, Karsten, Kasimir, der die Hand von Opa hielt, und Tom.
„Papa“, rief ich erfreut auf und eilte auf ihn zu. Er sah bleich aus, aber sonst unversehrt, soweit ich das beurteilen konnte.
„Hallo, mein Mäuschen“, rief er mit angenehm rauer Stimme. Dann schloss er mich in seine Arme. Ein Stein fiel von meinem Herzen. Er lebte und er war bei mir!
Kapitel 3
Wir saßen alle wieder im Wohnzimmer und Opa stand in der Mitte und betrachtete uns alle mit seinen ausdruckvollen grünen Augen. Nachdem die stürmische Begrüßung vorbei war, trugen wir unser Anliegen vor. Viele Erwachsene waren damit einverstanden. Einige aber nicht, wie Frederik und mein Vater. Aber Opa beschloss, ohne auf die beiden zu achten, dass die heutige Situation gezeigt hätte, dass es Zeit war, dass wir alles über uns erfahren mussten. Und zwar nicht irgendwann, sondern sofort. So saßen wir alle beisammen und warteten aufgeregt auf das, was er uns erzählen wollte.
„Wie ihr alle wisst, stammt unser Volk nicht von der Erde ab. Deswegen zählen die Ältesten uns nicht zu den Menschen dazu. Was für euch wahrscheinlich unbegreiflich ist, denn wir sind schon seit Jahrzehnten auf der Erde heimisch geworden.“ Er machte eine Pause und holte tief Luft. Wir sahen ihn alle mit großen Augen an. Diese Tatsache hatte uns noch keiner erzählt. Wir hatten uns zwar mit Bella immer darüber lustig gemacht, dass die Erwachsenen sagten, wir wären keine Menschen, aber dass es wahr sein könnte, wäre keinem von uns in den Sinn gekommen.
„Woher kommen unsere Vorfahren?“, wollte April leise wissen.
„Von einem Planeten namens Beamen!“, erzählte Opa traurig weiter. Keiner sagte ein Wort.
„Uns nennt man die Beamer. Alle, die auf diesem Planeten wohnten, hatten das gleiche Gen wie wir!“ Wieder machte er eine Pause, um uns die Möglichkeit zu geben, das zu verstehen, was er gesagt hatte.
„Also haben noch andere Lebewesen, die nicht mit uns verwandt sind, unser Gen“, stellte Nick nüchtern fest. Ich riss die Augen auf, so weit hatte ich noch gar nicht gedacht.
„Opa, warst du auf diesem Planeten?“, fragte Maxim leise.
„Wie weit unterscheiden wir uns wirklich von den Menschen?“, flüsterte Bastian. Opa hielt seinen Arm hoch.
„Langsam, langsam. Hört mir jetzt einfach zu. Ja, Nick, es gibt viele Beamer, die nicht mit uns verwandt sind. Und nein, Maxim, ich bin auch hier auf der Erde geboren worden wie du. Ich erzähle euch nur die Gesichte, die mir von meinem Opa erzählt worden ist und ihm von seinem Opa. Unseren Planeten gibt es schon sehr lange nicht mehr. Wir sind genauso wie die Menschen, nur dass wir uns überall hin beamen können und nie krank werden. Ansonsten unterscheiden wir uns nicht von ihnen.“ Er holte tief Luft.
„Deswegen haben unsere Vorfahren die Erde als ihre zukünftige Heimat gewählt, als unser Planet ausgelöscht wurde“, erzählte Oma weiter. Das war fast zu viel für mich. Es gab noch mehr von uns und die waren alle nicht mit mir verwandt. Ein Lächeln umspielte meine Lippen. Also gab es noch Hoffnung, sich mit einem nicht verwandten Beamer fortzupflanzen. Denn das Beamergen wurde am besten weitervererbt, wenn beide Eltern das Gen in sich trugen. Bei den Mischlingskindern war das Gen oft nicht stark genug ausgeprägt oder wurde gar nicht mehr weitervererbt. Deswegen war es mir so wichtig, Kinder mit einem Beamer zu haben, um das Gen weiterzuvererben. Ich schaute zu Bella, sie lächelte auch ganz verträumt vor sich hin.
„Warum wurde unser Planet zerstört?“, meldete sich Sabrina zu Wort.
„Viele Völker von anderen Planeten waren sehr eifersüchtig auf unser Können. Wir brauchten keine Technik, um uns fortzubewegen. Wir konnten nur mithilfe unserer Gedanken dahin, wo wir hinwollten. Kein Schloss oder Tür konnte uns den Weg versperren. Wir hatten Freiheiten, die sich viele wünschen würden. So kam es, dass ein bestimmtes Volk Namens Jupfalter anfing, uns zu entführen und Experimente an uns durchzuführen. Bis sie einen Apparat erfunden hatten, der uns unser Gen abzapfen und ihnen selber gleichzeitig verabreicht werden konnte, sodass sie sich wie wir beamen konnten. Aber die Wirkung dauerte bei ihnen nicht lange an. Sie beschlossen, uns gefangen zu halten, um immer das Gen zu Verfügung zu haben. Dieses Abzapfen wirkte sich nicht gut auf uns aus. Es verringerte unsere Lebensdauer. Viele vertrugen es gar nicht und starben sehr jung. Was aber die Jups nicht abschreckte, es weiter zu praktizieren.“ Es war mucksmäuschenstill geworden. Alle schauten ihn an. Also hatten wir doch Feinde. Gänsehaut machte sich breit, hoffentlich würde ich nie so einem Jup begegnen.
„Natürlich fingen wir Beamer an, uns zu verteidigen. So entstand Krieg zwischen unseren beiden Völkern“, erzählte Oma weiter.
„Und beide Planeten wurden zerstört und jetzt jagen die Jups uns hier auf der Erde?“, überlegte Nick laut. Die Männer grinsten ihn an.
„Schön wäre es, Nick. Aber nein! Nur unser Planet wurde zerstört. Jupfalter gibt es immer noch!“, beteiligte sich Onkel Frederik an der Unterhaltung.
„Wie anders als wir sind die?“, fragte ich laut. So langsam bekam ich ein Gefühl, dass da noch mehr war, als dass sie unser Gen anzapften.
„Sie sind so wie wir und die Menschen von der Anatomie her. Nur …“ Opa schwieg.
„Die Jups sind schneller, stärker und flinker als wir alle zusammen“, sprach Tante Bianca leise.
„Für was brauchten sie dann das Beamen, wenn sie so schnell sind?“, fragte Felix.
„Sie können nicht fliegen, so wie wir!“, sprach Karsten verträumt.
„Er meint, sie brauchen trotzdem viel länger von einem Ort zum anderen als ihr“, erklärte Onkel Kasimir.
„Wie haben sich die Beamer gegen die Jups überhaupt verteidigt?“, sprach ich leise aus, was alle dachten.
„Durch Waffen natürlich. Jeglicher Art. Aber wir hatten nie wirklich eine Chance. Deswegen flohen so viele wie möglich“, beantwortete Oma meine Frage.
„Und jetzt sind die Jups auf der Erde und suchen nach uns?“, stellte Bella fest.
„Die Jups waren schon immer mal wieder auf der Erde, um uns zu suchen. Das Problem für sie hier ist, uns zu finden. Da wir den Menschen sehr ähnlich sind, ist es sehr schwierig, uns ausfindig zu machen. Mithilfe eines Gerätes suchen sie nach höherer Energie, die wir beim Beamen ausscheiden. So ist es für sie nur möglich, uns unter den Menschen auszumachen. In unsere Familie gab es allerdings schon seit vielen Jahren keine Übergriffe mehr.“
„Dad, wie haben sie dich gefunden?“ Ich sah ihn intensiv an. Es war an der Zeit, dass er uns seine Geschichte erzählte. Er lachte laut auf.
„Ach, Mäuschen, das war für die nicht schwierig. Ich war nämlich mit einer von ihnen zusammen!“ Man hörte, wie alle tief Luft holten. Andere wie Onkel Frederik lachten auf.
„Wie ist das möglich?“, stellte Olivia fest.
„Ganz einfach, wir können sie genauso schlecht von den Menschen unterscheiden wie sie uns“, erklärte Opa.
„Auf jeden Fall ist es ihr aufgefallen, dass ich anders bin und so ist sie mir auf die Schliche gekommen. Und als ich heute Morgen bei ihr in London ankam, nahm sie mich mit ein paar Jup-Freunden gefangen.“
„Sie haben sich an deinem Gen bedient?“, fragte ich ängstlich.
„Ja, um nach China zu gelangen. Wie es aussieht, wissen die nichts von unseren Ringen und den Verbindungen.“
„Das ist mal ein Vorteil, wir haben dich da wirklich schnell rausbekommen!“ Frederik lachte.
„Ja, ihre Gesichter hätte ich auch gerne gesehen, als sie die leere Zelle gefunden haben“, meinte Karsten.
„Konntest du dich nicht einfach wieder zurückbeamen, Dad?“
„Nein, dafür war ich zu schwach und das wussten sie. Deswegen gab es auch keine Wachen!“
„Werden sie dich jetzt verfolgen?“, meldete Oma sich zu Wort.
„Wir denken nicht! Mein Gen wird bei ihnen nicht lange wirken und sie wissen nicht, wo ich wohne.“
„Dann sind für uns London und China in den nächsten Jahren tabu!“, bestimmte Opa.
„Warum kennen wir eigentlich nicht andere Beamer, die nicht mit uns verwandt sind?“, wechselte Carmen das Thema.
„Wir schon, ihr nicht!“, lachte Opa.
„Nicht alle Beamer sind von Natur aus friedlebend wie wir!“ Oma lächelte.
„Erklärung!“, rief Felix.
„Es gibt überall Beamer auf der ganzen Erde verteilt. Wir können uns auch nicht einfach so finden. Man begegnet immer wieder welchen. Aber die meisten nutzen die Menschen aus und plündern ihre Reichtümer“, erklärte Opa wieder.
„Das heißt, die meisten sind Kriminelle. Und mit so was wollen wir nichts zu tun haben!“, ergänzte Oma.
„Wie bemerkt man einen anderen Beamer?“ April schaute neugierig in die Runde.
„Wie merkst du, dass wir in der Nähe sind?“ Ihre Mutter schaute sie ernst an.
„Durch ein Kitzeln an Füßen und Beinen!“
„Genau, das Kitzeln ist bei einem Blutsverwandten sehr stark und bei anderen ganz schwach. Deswegen ist es schwer, zu merken, dass er zur gleichen Gattung gehört“, erklärte Bianca sachlich.
„Oft bemerken wir uns Beamer gegenseitig gar nicht!“, meinte Tante Claudia. Das war sehr viel Information. Ich schluckte schwer.
„So, das reicht jetzt. Jetzt wird noch gegessen und dann ist Nachtruhe! Ab morgen wollen wir endlich unsere Gemeinschaft genießen. Kein Wort mehr von den Jupfaltern!“, rief Oma laut. Es entstand ein begeistertes Murmeln überall und die ersten machten sich auf den Weg in die Küche. Ich wusste gar nicht mehr, was richtig und was falsch war. Nur eins war mir klar geworden: Wir wurden wegen unseres Gens gejagt und es gab andere meiner Art. Langsam stand ich auf und folgte meinen Verwandten.
Kapitel 4
Drei Wochen waren eine sehr lange Zeit, musste man meinen. Aber für mich erschien es im Nachhinein sehr kurz. Ich lag endlich in meinem eigenen Bett und konnte nicht einschlafen. Vor einer Stunde waren Dad und ich wieder in unserem vertrauten Heim angekommen und morgen begann die Schule, worauf ich mich überhaupt nicht freute. Zwar freute ich mich, endlich all meine Freunde wiederzusehen, aber es gab viele Gestalten, die ich nicht unbedingt antreffen wollte. Mein Dad war wieder ganz der alte. Vergessen war der Vorfall in London. Er ließ mich mal wieder allein. Er war, glaubte ich, gerade in Amerika, um eine seiner Freundinnen zu treffen, die hoffentlich kein verkappter Jup war. Ich grinste vor mich hin. Die erste Woche über war er wirklich fürsorglich gewesen. Es hatte mir gutgetan, dass er mehr Zeit mit mir verbracht hatte. Aber auf Dauer wäre es einfach zu nervig geworden. Deswegen hatte ich erst mal aufgeatmet, als er eine halbe Stunde nach unserer Ankunft wieder verschwunden war. Das Einzige, was mich daran störte, war, dass ich ganz allein in unserem Haus war. Nach der Horrorgeschichte unserer Großeltern fühlte ich mich nicht mehr sicher. Es wurde langsam Zeit, dass ich endlich einen Hund bekam. Dann würde ich mich sicherer fühlen, auch wenn mir bewusst war, dass er mich, wenn es darauf ankam, nicht vor einem Jup beschützen konnte. Allerdings würde ich mich dann nicht mehr so alleine fühlen. Morgen gleich würde ich mit Dad darüber reden. So langsam wurde ich immer müder und müder. Wohlig kuschelte ich mich enger in mein Bett hinein. Ich spürte immer noch die warme Sonne von Hawaii auf mir. Die letzten drei Wochen waren sehr schön gewesen. Wir hatten viel gelacht, Streiche gespielt und nicht mit den Erwachsenen über die Jupfalter gesprochen, aber unter uns sehr viel. Vor allem mit Bella über die nicht verwandten Beamer. Im Großen und Ganzen war es der schönste Familienurlaub aller Zeiten gewesen. Ich vermisste schon jetzt alle. Ich liebte die Gesellschaft und die Fürsorge der anderen. Hier in meinem Heimartort Nagold war ich recht einsam. Mein Dad arbeitete sehr viel in einem Maklerbüro oder war auf Reisen bei seinen Frauen. Meistens sah ich ihn nur morgens oder abends. So war ich meist auf mich selbst gestellt. Ich war es gewohnt, alleine zu sein und es machte mir eigentlich nicht viel aus. Nur nach den Familienurlauben war es schwer, sich wieder an die Einsamkeit zu gewöhnen. Es lag eine sehr harte Woche vor mir, aber die würde ich auch irgendwie meistern.
Irgendetwas klingelte schrill und laut. Was war das? Ich konnte es nicht zuordnen und es wollte partout nicht aufhören. Langsam machte ich die Augen auf. Ich war in meinem Zimmer und mein Wecker machte unmögliche Geräusche. Schnell schlug ich nach ihm. Endlich war es wieder ruhig. Ich schloss die Augen. Mein Gewissen meldete sich: Schule. Ich stöhnte laut auf und verließ widerwillig mein Bett. Ein Blick auf die Uhr sagte mir, dass ich mich beeilen musste. Ich rannte ins Bad, vollzog mein Morgenritual und rannte wieder zurück zum Kleiderschrank. Ein Blick aus dem Fenster sagte mir, dass es ein regnerischer, kalter Tag werden würde. Was für Deutschland ganz normal war. Wieder fragte ich mich, warum Dad hier unbedingt leben wollte. Im Gegensatz zu mir liebte er den Schwarzwald und die vielen Bäume. Sand und Wüste waren mir lieber. Aber nach so vielen Jahren Gemotze hatte ich ihn immer noch nicht dazu bewogen, umzuziehen. Ohne lange zu überlegen, holte ich mir eine blaue Jeans heraus und dazu ein schwarze Bluse. Ich liebte es, mich sportlich elegant anzuziehen. Ein paar passende schwarze Pumps und mein Outfit war fertig. Meine langen, blonden Haare bürstete ich kurz durch, sodass sie mir gerade den Rücken runterfielen. Im Gegensatz zu meinem Dad hatte ich glatte Haare von meiner unbekannten Mutter vererbt bekommen. Ich legte die Bürste weg und eilte wieder ins Bad, um meine Kriegsbemalung anzulegen. Drei Wochen ohne, ich war leicht aus der Übung. Aber heute musste Make-up und Mascara reichen, für mehr war keine Zeit, nicht mal für mich als Beamer. Dann nahm ich meine Umhängetasche, die ich schon gestern gepackt hatte, und eilte nach unten. Ich kochte mir schnell einen Kaffee und nahm eine Scheibe Marmeladenbrot dazu. Ich aß nicht wirklich, ich würgte es hinunter.
„Dad!“, rief ich laut. Kein Laut war zu vernehmen. Entweder schlief er noch oder er war schon auf der Arbeit. Was merkwürdig für ihn wäre. Denn sonst legte er viel wert darauf, mit mir noch ein paar Worte zu wechseln, bevor er den Tag begann. Nach dem schnellen Frühstück rannte ich noch mal hoch und schaute in sein Zimmer rein. Das Bett sah genauso aus wie gestern. Er war gar nicht nach Hause gekommen. Angst beschlich mich, ob ihm etwas zugestoßen war. Schnell schloss ich die Augen und berührte meinen Ring. In meinem Kopf bildete ich die Frage: „Geht’s meinem Dad gut?“ Sofort erschien in meinem Kopf ein Bild. Wie er schlafend in einem Bett neben einer Rothaarigen lag. Augenblicklich unterbrach ich die Verbindung. Röte stieg mir in die Wangen. Wie peinlich war das jetzt. Oje, er war noch nicht im Alltag angekommen. Wieder schloss ich die Augen, aber diesmal beamte ich mich auf eine Mädchentoilette in der Berufsschule Centrum von Nagold in der Hoffnung, dass keiner dort war. Denn sonst würde ich mich gleich am ersten Tag verspäten. Was für mich ein Weltuntergang wäre, denn ich hasste es, zu spät zu kommen. Fast zugleich spürte ich das bekannte warme Kribbeln auf meiner Haut, das sich schnell auf meinem Körper ausbreitete. Dann wurde es mir kalt, danach heiß und das Kribbeln verschwand so schnell, wie es gekommen war. Ich öffnete meine Augen und fand mich in der Mädchentoilette wieder. Zum Glück war keiner da. Ein kurzer Blick in den Spiegel und ich ging hinaus in die Richtung meines Klassenzimmers. Ich hatte noch ein ganzes Jahr vor mir und dann hatte ich das Berufskolleg Stufe zwei abgeschlossen. Aber ich wusste immer noch nicht, was ich werden wollte. Schnell holte ich mein Smartphone raus und tippte Dad eine Nachricht in WhatsApp:
Du kommst zu spät zur Arbeit!
Ein selbstgefälliges Lächeln breitete sich auf meinen Lippen aus. Er würde bestimm erbost sein, dass ich ihm nachspioniert hatte. Aber das hatte er sich selber zuzuschreiben, wenn er nicht fähig war, eine Nachricht zu hinterlassen.
„Melody! Melody!“, rief mich da eine altbekannte Stimme. Schnell drehte ich mich um. Daemon rannte mit einem breiten Grinsen auf mich zu. Er war genauso so spät dran wie ich. Diesen Typen kannte ich schon mein ganzes Leben lang. Unsere Väter waren die dicksten Kumpels. Kurz vor mir blieb er stehen und umarmte mich stürmisch, was mir ein lautes Lachen entlockte.
„Hallo, hübscher Mann!“, begrüßte ich ihn. Er war braun gebrannt von der Sonne, was gut zu seinen kurzen braunen Haaren passte. Seine haselnussbraunen Augen strahlten mich freundlich an.
„Du siehst noch hübscher aus!“, schleimte er. Ich verdrehte die Augen.
„Danke! Wie waren deine Sommerferien?“, erkundigte ich mich.
„Gut! Sehr gut! Hat echt Spaß gemacht, mit Dad und der Jacht unterwegs zu sein!“ Ich lächelte ihm freundlich zu. Tja, sein Dad war ebenfalls Single wie meiner und genauso in dieser Richtung durchgeknallt. Daemons Mama war leider gestorben, als er noch sehr klein gewesen war. Vielleicht war es diese Tatsache, dass wir zwei nur von einem Vater erzogen worden waren, die uns beide so dick miteinander verband. Endlich hatten wir das Klassenzimmer erreicht.





























