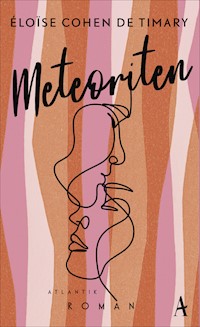
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ein Liebesroman von größter Intensität." Le Monde In einer abgelegenen Pariser Bar treffen Marianne, eine junge Kulturredakteurin und der Landschaftsarchitekt Virgile, der eigentlich auf Männer steht, zusammen. Es ist gegen alle Wahrscheinlichkeit Liebe auf den ersten Blick, eine jener Lieben, wie man sie wohl nur einmal im Leben erfährt. Sie fühlt sich an wie der Sand unter den Füßen am Strand der Bretagne, schmeckt wie die Zitrone eines Margheritas, klingt wie 80er-Pop, wie Patti Smith und Janis Joplin. Marianne und Virgile schmieden wilde Zukunftspläne, sogar der Wunsch nach einem Kind kommt auf. Doch dann nimmt ihr gemeinsames Leben plötzlich eine tragische Wendung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Éloïse Cohen de Timary
Meteoriten
Roman
Aus dem Französischen von Maja Ueberle-Pfaff
Atlantik
Prolog
Wie eine Sportlerin vor dem Wettkampf geht sie im Geist den Ablauf durch. Sicher, sie hätte das lieber in der Klinik erledigt, mit dem gleichmäßigen Piepen der Geräte und dem Rattern des Servierwagens im Ohr und dem vertrauten Geruch der Desinfektionslösungen und Anästhetika in der Nase, aber die Umstände erfordern es nun einmal, dass sie es irgendwo in der Bretagne tun muss, in einem alten Haus mit feuchten Wänden und ausgetretenen, stellenweise abgesplitterten Steinfliesen. Es ist kurz vor Tagesanbruch, draußen herrscht eisige Kälte. Weißer Raureif überzieht die Fensterscheiben, die Temperatur im Haus beträgt höchstens zehn Grad.
Sie stöbert in dem großen Kirschholzschrank neben dem Eingang nach einer Wolldecke oder einem Plaid, aber sie findet nur Öljacken und Gummistiefel in allen Größen, Eimer, farbige Spaten, einen Tennisschläger mit gerissener Bespannung, und alles verströmt den Geruch von Ferien und Salzwasser. Unverdrossen geht sie zum offenen Kamin und legt ein paar Holzscheite nach. Es fällt ihr nicht schwer, sich die Kinder vorzustellen, die johlend, mit salzverkrustetem Haar, vom Strand zurückgerannt kommen, die Badeanzüge, die tropfend über der Wanne hängen, sie kann sich auch den fortwährenden Trubel in diesem Haus gut vorstellen, die Erwachsenen, die Witze reißen oder sich zoffen, die geselligen Tischrunden mit gut und gerne fünfzehn Personen, die Würstchen, die aufgereiht auf dem Grill brutzeln, die randvollen Salatschüsseln, die Flaschen, die geleert werden, eine nach der anderen, die Mahlzeiten, die sich ewig hinziehen, das letzte Glas, das man mit Blick auf den Sternenhimmel trinkt, und auf einmal drücken die Erinnerungsbilder, die nicht die ihren sind, ein wenig auf ihre Stimmung. Sie schüttelt den Kopf, um die düsteren Gedanken zu vertreiben, und kehrt in die Küche zurück, wo sie den Kaffee aufsetzt. Marianne müsste bald nach unten kommen.
Im Stockwerk über ihr liegt Marianne schon lange wach. Das heißt, sie hat so gut wie gar nicht geschlafen. Aber sie möchte noch ein Weilchen für sich sein. Sie stellt sich ans Fenster, wischt die beschlagene Scheibe mit dem Ärmel ab und betrachtet den alten Pflaumenbaum am hinteren Ende des Gartens, der völlig kahl ist. Seine schlanken, windschiefen Äste heben sich wie ein Scherenschnitt vom Morgenhimmel ab. Marianne steht allein vor dem sanft heraufdämmernden Tag und fröstelt. Sie bläst ein paarmal ihren warmen Atem in die Hände und klemmt die Finger unter die Achseln. Der Morgennebel hat sich wie eine dünne weiße Decke auf die Landschaft gelegt. Aus den Schornsteinen der Nachbarhäuser quillt der erste Rauch. Die Zeit scheint langsamer zu verstreichen. Es ist vollkommen still, nichts regt sich, kein Laut dringt an ihr Ohr. Nur zwei Vögel trippeln zum Vogelhäuschen im Garten, um ein paar Sonnenblumenkörner aufzupicken, und im angrenzenden Bauernhof bereitet sich ein Kälbchen darauf vor, geboren zu werden.
Kurze Zeit später liegt Marianne lang ausgestreckt auf dem Sofa im Wohnzimmer. Von der Taille abwärts ist sie mit einer Wolldecke zugedeckt, darunter ist sie nackt. Sie schließt die Augen und kneift die Lider so fest zusammen, dass aus dem Dunkel psychedelische Farbwirbel auftauchen. Sie würde gern ein Gedicht aufsagen oder womöglich gar ein Gebet sprechen, aber ihr fällt nichts ein. Ganz präsent sind nur Virgiles Gesicht und die wenigen flüchtigen Bilder, die sie gern für immer unversehrt im Gedächtnis bewahren würde – den Abend ihrer ersten Begegnung und den Moment, in dem sie nach der Zigarette greift, die er gerade angezündet hat, als Ersatz für seine Lippen, die sie so gern berührt hätte; ihren ersten gemeinsamen Ausflug ans Meer, an einen Küstenort nicht weit von hier; das erste Mal, dass sie ihre Kleider in denselben Schrank eingeräumt und ihre Unterwäsche in dieselbe Waschmaschine gesteckt haben; das erste Mal, dass sie sich überlegt haben, wie es wäre, gemeinsam alt zu werden, und welchen Geruch ihrer beider Haut dann wohl hätte.
Marianne nimmt einen tiefen Atemzug und öffnet die Augen weit. Sie spürt, dass Virgile ganz nahe bei ihr ist. Sie kann ihn wahrnehmen, seinen warmen Atem, sein sonniges Lachen, den Zitrusduft von frischer Bergamotte in seiner Halsbeuge, und sie flüstert im Stillen allen Druiden und Zauberkundigen dieser Erde zu: Bitte macht, dass es gut geht. Macht, dass es funktioniert, ihr alle.
Die Frau neben ihr sagt etwas Ermutigendes – es klappt bestimmt, keine Sorge – und legt ihr beruhigend die Hand auf den Bauch. Dann führt sie behutsam den Katheter ein und injiziert mit sicherer, ruhiger Hand den Inhalt des kleinen Röhrchens – in diesem Moment für Marianne der Mittelpunkt des Universums.
Der Chefredakteur thronte hinter seinem Schreibtisch, das Hemd bis zum gelockten Brusthaar aufgeknöpft, die Kippe zwischen den Zähnen, und wühlte nervös in seinem Papierstapel.
»Was für ein Chaos«, stöhnte er und legte die brennende Zigarette auf dem Rand des Schreibtischs ab. Er schob die Unterlagen hin und her, bis er gefunden hatte, was er suchte. »Ach, hier ist es. Ein Artikel über Paul Wiazowski, der letzte Woche in den USA erschienen ist.«
Marianne nahm die Zeitschrift entgegen, und der Chefredakteur klaubte seine Zigarette vom Tisch. Er ließ sich in den Sessel zurücksinken und nahm einen tiefen Zug, dann strich er mit der Hand über seinen Dreitagebart.
»Aber merkwürdig ist es schon«, sagte er. »Der Typ gibt nie Interviews. Und du ergatterst ein Gespräch mit ihm, einfach so, knall, peng. Wo noch mal?«
Marianne murmelte die Adresse, während sie mit der Spitze des Zeigefingers die Seiten umblätterte, und als sie den fraglichen Artikel fand (»Paul Wiazowski or the Revival of French Literature«), legte sie die Zeitschrift auf die Knie und strich den Rand glatt. Der Artikel war eine Ansammlung von Plattitüden, er zeichnete das Porträt des »Salinger der Ardennen« – Wiazowski stammte ursprünglich aus Charleville-Mézières, Geburtsdatum unbekannt – anhand seiner Lieblingsthemen und seiner Arbeitsweise. Oberflächliches Zeug, das man schon tausendmal gelesen hatte.
»Danke, Vincent«, sagte Marianne und legte die Zeitschrift auf den Schreibtisch zurück. »Aber ich glaube, das kriege ich hin. Damit komme ich klar.«
Sie wollte Paul Wiazowski schon so lange interviewen. Manchmal hatte sie fast den Eindruck, ihn bereits zu kennen, so stark fühlte sie sich von seinen Werken angesprochen, einen solchen Widerhall fand das, was er schrieb, in ihrem Herzen. Selten hatte sie etwas gelesen, das die menschliche Seele mit einer solchen Präzision und Schärfe abbildete, und noch immer war er offenbar nicht an die Grenzen seines Talents gestoßen. Wiazowski fing wie kein anderer die winzigsten Alltagsdetails ein und konnte die verborgensten Gefühle so zutreffend beschreiben, als schliche er sich auf Zehenspitzen, nein, auf Samtsohlen ins Herz der Menschen, aber er konnte seine Leser auch mit Passagen voller Gewalt und schier unerträglichem Schmerz bis ins Mark treffen. Bei der Lektüre seiner Bücher kam man nie ungeschoren davon. Immer war man aufgewühlt, bewegt, erschüttert. Und zuweilen stieß man unerwartet auf einen Satz, in dem unvermittelt eine Lebensweisheit aufblitzte, und es war, als würde sich im Dunkeln ein Vorhang heben, sodass mit einem Mal reines, helles, strahlendes Licht einströmen konnte.
Marianne wusste natürlich, dass Wiazowski keine Interviews gab, aber sie hatte trotzdem eine Anfrage an seinen Verlag geschickt. Sie hatte keine großen Reden geschwungen, sondern möglichst genau die Wirkung beschrieben, die seine Bücher auf sie ausübten: Sie fühlte sich wie eine Frau, die in einem klapprigen Eisenbahnwaggon mit Höchstgeschwindigkeit durch ein russisches Gebirge rast. Und dann hatte sie abgewartet. Mehrere Monate waren vergangen, sie hatte schon kaum noch mit einer Antwort gerechnet, und dann hatte sie eines Tages wundersamerweise einen Brief erhalten, in dem ihr ein Gespräch mit Paul Wiazowski angeboten wurde.
Marianne musste länger nach dem vereinbarten Treffpunkt suchen, da sie vom Verlag nur eine sehr vage Wegbeschreibung bekommen hatte. Sie fragte sich durch, musste immer wieder umkehren und fand schließlich die enge Sackgasse, die auf keinem Stadtplan verzeichnet war. Die Mauern waren mit Graffiti besprüht, es stank nach Pisse, auf dem Pflaster lagen Zigarettenstummel und gebrauchte Präservative herum, und eine struppige Katze flitzte ihr gegen die Waden. Du lieber Himmel, das fängt ja gut an, dachte sie. Das totale Klischee. Aber was für einen Aufmacher ihr diese Szenerie für ihr Interview liefern würde!
Der Rest sah entsprechend aus: ein schäbiger Hinterhof, ein abbruchreifes Gebäude und weit geöffnete Fenster, aus denen das Klappern von Geschirr, laute Stimmen und Fernsehgeräusche drangen. Das konnte doch nicht der richtige Treffpunkt sein? Marianne wollte gerade umkehren, als sie zu ihrer Linken eine unscheinbare Tür bemerkte. Sie stieß sie auf, ohne anzuklopfen, und ihr schlug eine Wolke aus Tabakrauch, Knoblauch, Gewürzen und fröhlichem Stimmengewirr entgegen. Sie fand sich in einer winzigen Bar wieder, die nicht mehr als drei mal vier Meter messen konnte. Vor der Theke standen fünf oder sechs Barhocker, dahinter waren auf einem mehrstöckigen Flaschenregal diverse Spirituosen aufgereiht. An den Wänden hingen alte Schwarz-Weiß-Fotos von Tanger, Rabat und Essaouira, daneben Spiegel unterschiedlicher Größe und Form, vergilbte Botanikposter vom Flohmarkt, aus Kautschukholz geschnitzte afrikanische Masken, aufgespießte Schmetterlinge und Käfer in Bilderrahmen und mehrere Kupferstiche, die eindeutig aus dem neunzehnten Jahrhundert stammten – lasziv posierende Frauen mit schneeweißen Brüsten und ausladenden Hüften. Vor der Theke stapelten sich Bücher auf dem Fußboden.
Die Bar, die von einem Paar namens Kamel und Olive geführt wurde, war immer gut besucht. Man fand selten einen freien Barhocker, und dieser Abend bildete keine Ausnahme. Zwei junge Männer, die an der Theke saßen, unterhielten sich laut und lachten hemmungslos. Der erste trug eine senfgelbe Hose, ein kariertes Hemd, eine farblich passende Fliege und einen sehr dünnen Schnurrbart, der aussah wie mit chinesischer Tusche gepinselt. Der andere steckte in einem weit geschnittenen Ringelshirt, hatte ein kantiges braunes Gesicht, schöne graue Augen und roch intensiv nach einem Duftwasser, in dem sich Süßgras, Seifenflocken und Patschuli mischten. Neben ihnen becherte ein Bärtiger still vor sich hin und hing seinen Gedanken nach, während auf dem Hocker neben ihm ein junger Mann mit Engelsgesicht, blonden Locken und einem durchscheinend zarten Teint die Nase in sein Buch steckte. Von Zeit zu Zeit unterbrach der junge Mann seine Lektüre, wenn auf seinem Handy eine SMS aufleuchtete; dann warf er einen zerstreuten Blick auf sein Display, tippte eine Antwort und vertiefte sich gleich wieder in sein Buch.
Und dann saß da noch Paul Wiazowski. Mit rasiertem Schädel, einer dunklen Brille und einem Tattoo auf dem Ohrläppchen. Vor ihm stand ein großes Bier, und er stocherte in einem Keramikschälchen mit Schnecken à la marocaine.
»Hier, probier das mal«, sagte er und hielt Marianne die Schüssel hin, bevor sie noch Zeit gehabt hatte, sich vorzustellen. »Orangenschale, Anis, Piment, ein paar Tropfen Absinth … Ich kenne keinen, der Schnecken kochen kann wie Kamel!«
Kamel, der hinter der Theke gerade ein Weinglas abtrocknete, errötete bis zu den Haarwurzeln.
»Das war meine Großmutter«, nuschelte er verlegen. »Sie hat mir alles beigebracht.«
»He, he«, mischte sich Olive ein, die mit dem Cocktailshaker in der Hand mitten in der Bewegung innehielt. »Freu dich über das Kompliment und zieh Leine, Chéri.«
Sie deutete einen sanften Tritt an, Kamel setzte eine empörte Miene auf, hör auf damit, du, stellte das Glas ins Regal und fuhr geistesabwesend mit dem Spültuch über den Rand des Spülbeckens. Dabei murmelte er voller Rührung noch ein paar gefühlvolle Worte über seine Großmutter. Olive lächelte. Sie goss den Inhalt des Shakers in zwei Gläser, die mit dem Rand in farbigen Zucker getaucht waren, und schob sie über die Theke, eines für die senfgelbe Hose, das andere für den parfümierten Ringelpulli. Dann drehte sie sich zu Kamel um, verstrubbelte ihm die Haareund wischte mit dem angefeuchteten Daumen die Lippenstiftspuren weg, die an seiner Wange klebten.
»Ich hätte deine Großmutter so gerne kennengelernt«, sagte sie. »Wir hätten uns bestimmt fabelhaft verstanden.«
Sie lachte leise, ja, ganz bestimmt, wir hätten jede Menge Blödsinn angestellt, doch dann stiegen ihr aus heiterem Himmel Tränen in die Augen. Sie griff nach dem Küchentuch, das Kamel liegen gelassen hatte, wischte hektisch über die saubere Theke, rückte mechanisch die Flaschen zurecht. O ja, sie hätte Kamels Großmutter nur allzu gern kennengelernt. Sie hätte sie liebend gern besucht, einen Tee mit ihr getrunken und stundenlang mit ihr geplaudert, sie hätte ihr das schüttere Haar gekämmt, staubtrockenes Gebäck geknabbert, sich eine langweilige Anekdote nach der anderen angehört – wenn Kamel nur wüsste, wie gern! Denn seitdem sie darauf verzichtet hatte, Luis zu sein, um Olive zu werden, hatte sie ihre eigene Großmutter nicht mehr wiedergesehen. Ebenso wenig wie ihre Mutter. Oder alle anderen Mitglieder ihrer Familie.
Marianne holte ihr Notizheft hervor und legte das Diktiergerät auf den Tresen.
»Was trinkst du?«, fragte Wiazowski. »Ich bestell mir noch was.«
Er langte nach einer Papierserviette, wischte sich nervös die Stirn und goss das restliche Bier in einem Zug hinunter.
»Ich gehöre an meinen Schreibtisch. Zu meinen Stiften, meinen Papierstapeln und meinen gelben Zetteln. Ich brauche den Geruch von trocknender Tinte in der Nase. Ich muss an jedem Satz schrauben, ihn immer wieder umstellen und polieren. Was anderes brauche ich nicht.«
Er schwenkte die Keramikschüssel im Kreis, sodass die Muschelschalen gegeneinanderklackten, dann griff er nach einem kurzen Zögern in seine Jackentasche und zog Mariannes Brief hervor. Er faltete ihn sorgfältig auseinander und legte die flache Hand darauf. Aber jetzt sind wir hier, wir zwei, schien er damit sagen zu wollen. Er blickte Marianne durch seine dunkle Brille hindurch aufmerksam an.
»Was genau willst du wissen?«
Sie hatte lange überlegt, wie sie dieses Interview am besten anpacken sollte. Sie hatte sich entschieden, gleich zum Kern der Sache vorzustoßen und ihn zu seiner Schreibpraxis zu befragen. Sie schaltete das Diktiergerät ein, schob es sachte auf ihn zu und räusperte sich.
»Ich stelle mir vor, dass ein Schriftsteller mit jedem seiner Bücher ein Stück Weg zurücklegt«, begann sie. »Dass er immer neuen Schwierigkeiten begegnet, etwas ausprobiert, Irrtümer begeht, neu ansetzt und schließlich die Hindernisse überwindet. Was haben Sie beim Schreiben des jüngsten Romans, Ihres elften, gelernt?«
Marianne sah, wie Wiazowski hinter seiner dunklen Brille die Stirn runzelte und Kamel per Handzeichen aufforderte, ihm sein Bier zu bringen. Er nahm einen tiefen Zug und stellte das Glas auf eine Ecke des Briefs. Dann stürzte er sich kopfüber in seine Erläuterungen und spulte sie ab, ohne den Blick auch nur einmal vom Tresen zu lösen.
»Angefangen hat alles mit dieser Frau, die bei mir zu Hause im Waschkeller saß, vor einer der Maschinen. Sie war sehr dünn und sehr verloren, sie gab ihrem Baby die Brust und starrte dabei auf die Trommel, die sich vor ihr drehte. Sie saß auf einem Plastikstuhl, mit dem Baby an ihrem kümmerlichen Busen, und fixierte die Kleider, die träge in der Trommel vor sich hin wirbelten. Sie hatte einen krummen Rücken und einen stumpfen Blick, verfilztes, mausgraues Haar bis zu den Schultern und eine herabhängende Unterlippe. Sie drückte den Säugling fest an sich, aber der quiekte wie ein kleines Ferkel und strampelte wie wild. Ich sah, wie sein winziges Köpfchen gegen die magere Brust stieß, als wollte er sich befreien, und er schob sich mit seinen kleinen geballten Fäusten mit aller Kraft von der Frau weg.«
Paul Wiazowski trank noch einen Schluck, zündete sich eine Zigarette an und rauchte schweigend.
»Als ich die Szene sah, war ich wie gebannt. Ich konnte mich nicht losreißen, sie machte mich regelrecht fertig. Ich war mir sicher, dass da etwas nicht stimmte. Aber die Frau musste meine Anwesenheit gespürt haben, denn irgendwann drehte sie sich um, und als sich unsere Blicke kreuzten, verstand ich auf einmal. Alles. Ich hatte einen trockenen Mund, und mein Herz schlug mir bis zum Hals. Ich ging in meine Wohnung hoch und fing an, die Geschichte dieser gottverlassenen Frau aufzuschreiben, die auf einer Grünanlage mitten in der Stadt ein Neugeborenes stiehlt. Das Baby war ganz offensichtlich nicht ihr eigenes. Ich habe selbst keine Kinder, und ich weiß, dass man zu so einer Verrücktheit imstande ist, wenn der Abend kommt und zu viel Einsamkeit und zu viel Leere um einen sind. Ich habe mehrere Fassungen geschrieben, jede wie aus einem Guss, aber es gab immer ein Element, das sich mir entzog. Es gelang mir nicht, die Person selbst zu erfassen, sie zum Leben zu erwecken. Sie blieb blass wie ein Schemen. Und manchmal verfolgte mich die Frau nachts bis in meine Träume – sie pflanzte sich vor mir auf, mitsamt ihrem Baby, aus dem ein großer bedrohlicher Muskelprotz geworden war, der mir anscheinend ans Leder wollte. Woher wollte ich überhaupt wissen, dass er nicht ihr Kind war? Was verstand ich denn schon davon? Monatelang habe ich mich mit meinen Zweifeln herumgeplagt, ich habe mehr als einmal alles hingeworfen und dann zum Schluss doch durch Zufall eine Möglichkeit gefunden.«
Er nagte an seiner Unterlippe, als hätte er sich verplappert, und schüttelte den Kopf.
»Du siehst, dass ich über meine Arbeit nicht gescheit daherlabern kann.« Er schob das Diktiergerät mit der flachen Hand von sich weg. »Genau deshalb lehne ich Interviews normalerweise ab. Auch bei Werbetouren lese ich nur in Kirchen, weil ich dann nicht reden muss.«
Marianne hatte sich einmal mit eigenen Augen davon überzeugen können. Die Leute hatten im Kirchenschiff Schlange gestanden, vor dem Tischchen neben dem Beichtstuhl, an dem der Autor saß. Er signierte ein Buch nach dem anderen, nahm Komplimente entgegen, schüttelte Hände und machte den Mund nicht auf. Dennoch beteuerten zahllose Leserinnen, dass ihnen seine Bücher geradezu das Leben gerettet hatten – ja, allen Ernstes, das Leben gerettet! –, weil sie endlich ihre eigene Psyche durchschauten, ihren Horizont erweiterten, für ein paar Stunden ihrem Alltag entkamen und freier, gestärkt und selbstbewusster als bisher in ihr Leben zurückkehrten. Sie wollten mit Wiazowski darüber sprechen, sie wollten verstehen, wieso er sie in- und auswendig kannte, wie er es anstellte, welches Geheimnis er hütete. Manche schlugen sogar vor, nach der Signierstunde irgendwo ein Glas zu trinken, andere wollten eine Korrespondenz beginnen. Auch einige Männer überwanden ihre Scheu und offenbarten vor ihm ihre empfindsame Seite. »Seitdem ich Sie lese, sehe ich die Dinge mit anderen Augen«, hatte ihm einer gestanden. »Ich habe endlich meinen nervenaufreibenden Job gekündigt und meine untreue Frau verlassen«, ein anderer. »Und alles nur Ihretwegen, dank Ihrer Bücher. Können Sie sich das vorstellen?« Paul Wiazowski hörte zu, signierte, was man ihm hinhielt, lächelte zuweilen vage und beantwortete nie auch nur eine einzige Frage. Kein Wort, nichts, nada. Wirklich ein komischer Heiliger.
Marianne versuchte ihn zu ermutigen, doch, doch, das ist interessant, sprechen Sie weiter, aber Wiazowski ging nicht darauf ein, sondern schüttelte nur den Kopf und wurde auf einmal noch nervöser. Auf seiner Oberlippe hatten sich kleine Schweißperlen gebildet. Marianne versuchte es mit einer neuen Fragetechnik, wollte ihn auf ein einfacheres, weniger intimes Terrain führen. Doch es war vergebliche Liebesmüh. Wiazowski stand auf, zog sich sein Jackett über und legte einen Geldschein auf die Theke.
Niedergeschlagen überflog Marianne ihre Notizen. Drei magere Sätze, wie mit dem Schmetterlingsnetz aus der Luft gefischt. Nie und nimmer ausreichend für einen Artikel. Sie sah im Geiste schon den Chefredakteur, wie er mit der Kaffeetasse in der Hand die Augen zum Himmel verdrehte und ihr mit einer Spur Verachtung in der Stimme hinwarf: »Hätte mich ja auch gewundert. Paul Wiazowski redet nie mit Journalisten. Sogar den Amerikanern hat er alles abgeschlagen. Kein Radio, kein Fernsehen, nichts.«
Kamel stellte ein Glas vor Marianne und entkorkte eine Flasche.
»Das dürfen Sie nicht persönlich nehmen«, sagte er, während er ihr einen gut gekühlten Weißwein einschenkte. »So ist Wiazowski eben. Völlig unberechenbar.«
Marianne drehte den Stiel zwischen Daumen und Zeigefinger und blickte ins Leere. Kondenswasserrinnsale liefen wie kleine Tränenbäche über das Glas. Hatte sie sich womöglich auf eine Karriere versteift, die ihr nicht lag? Geisteswissenschaften, die Journalistenschule … War sie wirklich dafür geschaffen? Woher sollte man wissen, wann man sich hartnäckig in etwas verbeißen und wann man aufgeben musste? Immer häufiger kam es vor, dass sie von einer handwerklichen Tätigkeit träumte, etwas mit Holz, oder Erde zwischen den Fingern, Teig kneten in einer Backstube. Etwas mit den eigenen Händen herstellen, in Kontakt sein mit Rohmaterial, mit der Realität. Zu etwas nutze sein. Stattdessen schuftete sie für ein mageres Zeilenhonorar, führte bescheuerte Interviews und war obendrein ziemlich einsam.
Sie trank ihr Glas in einem Zug aus, stellte es auf die Theke zurück und versuchte tapfer, Kamel anzulächeln, aber am liebsten hätte sie einfach nur losgeheult. Nein, lieber schnell noch etwas bestellen, eine Margarita zum Beispiel, jetzt erst recht!
»Eine Margarita, very good idea!«, lobte der Mann, der in diesem Moment die Bar betrat. »Mach mir auch eine. Das wird mich an die alten Zeiten erinnern, als wir noch süße Backfische waren«, fügte er feixend hinzu.
Olive zwinkerte ihm zu, hallo, mein Herzblatt, geht’s dir gut?, während Kamel zwei Gläser auf die Theke stellte und den Korken einer Tequilaflasche ploppen ließ.
Der Mann wandte sich Marianne zu. »Was soll denn diese Grabesmiene? Hat man Ihnen nicht gesagt, dass das hier verboten ist?«
»Hör auf«, griff Kamel ein. »Das geht auf Wiazowskis Konto. Sie war mit ihm verabredet, aber er ist mitten im Gespräch abgehauen.«
Der Neuankömmling hob die Arme gen Himmel und ließ sie schwer herabfallen.
»Dieser Idiot!«, rief er theatralisch. Er machte eine kurze Pause, dann fuhr er fort: »Aber mal ehrlich, ich habe nie so recht verstanden, was alle an diesem Typen finden. Hast du eins seiner Bücher gelesen?« Kamel schüttelte den Kopf. »Viel weniger durchgeknallt, als allgemein behauptet wird, das kannst du mir glauben.«
Der Mann ging weiter zu Benoît (dem jungen Mann mit dem Ringelpulli) und William (dem mit der senfgelben Hose) und drückte beiden einen schmatzenden Kuss auf die Lippen. Danach nahm er die beiden Margaritas entgegen, die Kamel ihm über die Theke reichte, und setzte sich neben Marianne.
»Okay, und worauf stoßen wir an?«, fragte er. Er gab ihr das Glas in die Hand, und ihre Finger streiften sich für einen Moment. »Auf die echte Literatur?«
Marianne war so überrascht, dass sie kein Wort herausbekam. Wie gebannt starrte sie ihn an, seine sehr blauen Augen, sein Lächeln, das einen leicht schiefen Schneidezahn freilegte, die Bewegung, mit der er sein Glas hob, um mit ihr anzustoßen, und die plötzlich einfror, als er auf den Song aufmerksam wurde, der gerade im Radio lief.
»Oh, hören Sie!«, rief er mit erhobenem Zeigefinger und leuchtenden Augen.
Gestikulierend bat er Kamel, den Ton hochzudrehen, und fing an auf seinem Hocker mitzuwippen. Er schaukelte unbefangen im Takt von links nach rechts und sang die ersten Worte wie ein Echo nach: Felicità / è tenersi per mano / andare lontano / la felicità … Il tuo sguardo innocente / in mezzo alla gente / la felicità … È restare vicini / come bambini / la felicità … felicità …
Marianne betrachtete seine beweglichen Lippen, seine lachenden Augen, seine gepflegten Fingernägel. Er kannte die Worte offensichtlich auswendig und warf sich in die Pose der koketten Diva, wenn die weibliche Stimme sang. Sobald der Mann an der Reihe war, markierte er den schmachtenden Latin Lover. Er wechselte mit kindlicher Begeisterung von einer Rolle zur anderen, und Marianne entspannte sich zusehends und lachte mit. Der Wein tat allmählich seine Wirkung.
Ihr neuer Bekannter brach vor dem Ende des Songs ab, um sein Margaritaglas zum Mund zu führen, und wandte sich wieder Marianne zu.
»Als sie das 82 beim Festival von Sanremo gesungen haben, waren Al Bano und Romina Power im echten Leben ein Paar … Glück ist, sich an der Hand zu halten und weit zu gehen. Besser kann man es nicht ausdrücken, oder?« Er prostete Marianne zu.
Ihre Blicke begegneten sich, flackerten leicht. Sie stießen fast geräuschlos mit ihren Gläsern an, und der junge Mann sagte:
»Ich heiße Virgile. Und Sie?«
Virgile Lifar redete schnell, und so konnte sich Marianne aus den vielen Einzelheiten, die er erzählte, sehr bald ein Bild von seiner Persönlichkeit basteln.
»Mein Onkel hat mich mit dem Virus angesteckt«, erklärte er. »Der Garten, die Jahreszeiten, die Ernte zum richtigen Zeitpunkt – das alles hat er mir beigebracht, als ich ein Junge war. Unübertroffen, als Mensch und Pflanzenkenner. Er hat preisgekrönte Rosen gezüchtet, nicht weit von Varengeville-sur-Mer, kennen Sie das?« Marianne schüttelte den Kopf. Virgile fegte ihre Unkenntnis mit der Hand weg. »Egal. Von ihm habe ich gelernt, wie man Unkraut jätet, umgräbt, anpflanzt und beschneidet, von ihm habe ich auch gelernt, in den Sternen zu lesen, dem Wind zu lauschen, die Wolken zu deuten. Er hat erreicht, dass ich Geschmack daran fand. Und so fängt es doch immer an, oder?«
Nach seiner Ausbildung hatte Virgile eine Zeit lang bei einer renommierten Gartenbaufirma als Landschaftsgärtner gearbeitet, aber in diesem Betrieb konnte er weder seine Vorstellungen verwirklichen noch mit eigenen Gestaltungsideen punkten, also machte er sich nach kurzer Zeit selbstständig. Und da er tausend Ideen in der Sekunde produzierte und hart arbeiten konnte, dauerte es nicht lange, bis sich der Erfolg einstellte. Mit dem Garten eines Freundes seines Onkels fing es an, sein Talent und seine Kreativität fanden Anklang, die Sache hatte sich herumgesprochen. Andere Projekte folgten, zunächst in der näheren Umgebung, dann immer weiter entfernt, und nach und nach hatte er sich als Landschaftsarchitekt einen Namen gemacht.
»Wenn ich einen Garten anlege, interessiere ich mich in erster Linie für die Menschen«, erklärte er Marianne. »Für ihre Art zu sprechen, dafür, wie sie ihre Wohnräume einrichten. Was sie gern essen, welche Düfte sie mögen, welche Farben sie bevorzugen.«
Virgile interessierte sich für Menschen, das war unübersehbar, und generell für alles Neue. Er konnte sich mit derselben Begeisterung über eine jüngst in Mexiko entdeckte Orchideenart wie über die zweite Staffel seiner Lieblingsserie oder das Ingwerhähnchen vom Vorabend auslassen. Marianne verlor beim Zuhören immer mehr den Bezug zu ihrer Umgebung. Virgile absorbierte alles – die Moleküle, die Lichtpartikel, ihren eigenen Herzschlag –, und während sie den säuerlich-herben Geschmack ihrer Margarita genoss, spürte sie, wie die Stimmen im Hintergrund verschwammen, die Wände auseinanderrückten, die Luft sich verflüssigte. Und eine Frage immer drängender in den Vordergrund trat: Warum nur, warum hatte sie diese unausrottbare vertrackte Schwäche für Komplikationen?
Als Virgile seinen zweiten Cocktail ausgetrunken hatte, erwähnte er den Vornamen Andy.
»Ein megatalentierter Fotograf.« Er schwenkte den Rest seiner Margarita im Glas. »Eine Art Fusion aus Nan Goldin, Darcy Pardilla und Antoine d’Agata.« Randgruppen, Nachtszenen, Huren, die vom Leben Vergessenen, solche Sachen. Trash und Poesie in einem. Ich bin mir sicher, dass er in ein paar Jahren berühmt sein wird.«
»Andy …« Virgile legte den Kopf in den Nacken und schlürfte den letzten Schluck. »Ein bemerkenswerter Typ … Bemerkenswert, aber total unerträglich.«
Er bestellte bei Olive noch zwei Margaritas.
»Und Sie? Sie sind Schriftstellerin, richtig?«
Marianne tat verlegen, nein, nein, ganz und gar nicht, griff fahrig nach ihrem Cocktail, trank einen Schluck, leckte das Salz ab, das an ihren Lippen klebte, und stellte das Glas wieder ab.
»Aber es stimmt schon, ich schreibe manchmal Sachen nur so für mich. Woher wissen Sie das?«
»Ich weiß gar nichts«, antwortete Virgile. »Außer dass Wiazowski nie mit Journalisten redet, sondern nur mit Freunden. Und mit Schriftstellern.«
»Ah.«
»Und Ihre Sachen, kann man die vielleicht irgendwo lesen?«
»Nein, nein, abgesehen von meinen Artikeln für die Presse habe ich nichts veröffentlicht. Und ich weiß nicht mal, ob ich damit weitermachen will …«
»Das ist komisch«, fiel ihr Virgile ins Wort, »ich dachte immer, dass Gärtner genau das mit Schriftstellern gemeinsam haben.« Er kniff die Augen zusammen und sah sie durchdringend an. »Dass sie etwas pflanzen, es ruhen lassen, während es wächst, dann abschneiden, was überflüssig ist, damit es eine Form bekommt. Und so weiter. Stimmt das nicht?«
Marianne nickte ohne rechte Überzeugung.
»Doch, doch, glaub mir!«, versicherte er voller Überschwang. »Es dreht sich alles nur darum: Arbeit, Geduld und noch mehr Arbeit.«
Er beugte sich vor, legte seine Hand auf ihre und fixierte sie mit seinen sehr blauen Augen.
»Schreib, als hättest du nur diese eine Chance. Ich bin mir sicher: Wenn du dein ganzes Herzblut hineinlegst und all deine Kraft und wenn du dir genügend Zeit nimmst, dann wird es dir gelingen.«
Er ließ seine Hand auf ihrer liegen und drückte sie leicht.
»Überleg doch mal. Wenn Deppen wie Wiazowski es schaffen …«
In diesem Moment schlängelte sich Benoît Ringelpulli hinter ihnen vorbei und tippte Virgile auf die Schulter.
»Wir gehen ins Tango, Darling. Sollen wir auf dich warten, oder kommst du später nach?«
Benoît hatte hinreißende, vermutlich mit Mascara verlängerte Wimpern, und sein Süßgras-Patschuli-Parfüm stieg Marianne so in die Nase, dass sie niesen musste.
»Ich komme gleich mit«, antwortete Virgile. »Aber ich bleibe nicht lange. Ich hatte einen Wahnsinnstag und bin völlig fertig.«
Er sagte noch mehr, aber Marianne hörte nicht mehr zu. Sie sah nur noch Lippen, die Worte artikulierten, ciao, allerseits, danke für den Abend, meine Süßen, es war superschön, einen Mund, dem ganze Wolken von Kirschblüten entströmten, Aberhunderte von Blütenblättern, die wie Konfetti um die Anwesenden herumtanzten, und als Virgile hinter sich die Tür schloss, trudelten die zartrosa Blüten noch eine Weile müde weiter, bis sie entkräftet in die leeren Gläser sanken.
Marianne besaß nicht einmal seine Telefonnummer. Beim Abschied hatte er ihr lediglich ein Küsschen auf jede Wange gedrückt, war schön, mit dir zu reden, hoffentlich sehen wir uns mal wieder, und sie war wie angewurzelt sitzen geblieben und hatte die Schwarz-Weiß-Fotos an der Wand angegafft, Bilder von den Festungsanlagen in Essaouira, der Medina von Rabat, den Hügeln von Tanger. Bei den Fotos von Tanger verweilte sie länger, weil sie an William Burroughs denken musste, der dort aus seinen Koffern lebte; sie stellte sich vor, wie er nonstop über seinem Manuskript brütete, das eines Tages Naked Lunch heißen würde, Tausende loser Blätter, über den Fußboden verteilt, dazu der scharfe Geruch von Drogen und Schweiß und in den Zimmerecken Affenkot. Und dann die sternenlose Nacht, das gespenstische Gekreische der Möwen in der Ferne und überall zwielichtige Geschäftemacher.
Marianne bat um ein Glas kaltes Wasser und hielt es sich an die Stirn. Sie fühlte sich wie von innen aufgeheizt.
Kurz darauf servierte Olive dem gelockten Engel eine dampfende Tortilla, die herrlich nach gebackenen Kartoffeln und gebratenen Zwiebeln duftete. Der junge Mann legte sein Buch zur Seite, beugte sich weit vor, bis sein Gesicht über dem Teller hing, und stürzte sich wie ein Verhungernder auf sein Essen. Er reagierte nicht einmal mehr auf das Handy, das mehrfach brummte. Olive betrachtete ihn voller Entzücken mit gerötetem Gesicht und leuchtenden Augen.
Die Tür ging auf. »Ich hoffe, du hast mir ein Stück von deiner Tortilla aufgehoben, Chérie?« Virgiles Stimme.
Olive wedelte mit dem Zeigefinger, du träumst wohl, mein Schatz, du hättest nur dableiben müssen, und Virgile warf ihr grinsend eine Kusshand zu, vielen Dank, Chérie, du bist wunderbar. Er setzte sich neben Marianne und neigte sich seitlich zu ihr hinüber, bis sich ihre Schultern fast berührten.
»Ich konnte dich doch nicht so sitzenlassen, oder? Das Viertel, die dunkle Nacht und dazu noch dieses«, er deutete mit einer Kopfbewegung auf Kamel und Olive, »lichtscheue Gesindel … Nein, ehrlich, das ging gar nicht.« Er widmete sich seiner Tortilla und verschlang ein großes Stück. Dann spießte er ein zweites mit der Gabel auf und hielt es Marianne hin. Sie spürte, wie ihr die heiße Kartoffel die Kehle verbrannte und direkt in den leeren Magen rutschte. Die Wände fingen an, sich in einem anmutigen Reigen um sie herum zu drehen.
Als sie später die Bar verließen, war die ganze Stadt im Tiefschlaf versunken. Als einzige Geräusche hörte man das Brummen der Autos in der Ferne, das Gelächter einer Gruppe von Studenten auf dem Heimweg von einer Party und die Schimpfkanonade eines einsamen Obdachlosen. Marianne und Virgile gingen schweigend durch die enge, nach Urin stinkende Gasse. Ihre leicht schwankenden Schritte hallten auf dem Straßenpflaster, und gelegentlich stießen ihre Schultern aneinander. Es war eine milde Nacht. Virgile ließ die Arme baumeln, und seine Hände streiften immer wieder Mariannes Handrücken. Beide zogen die Arme fast augenblicklich zurück.
Virgile winkte mehreren Taxis, aber keines hielt an. Er blieb halbherzig schimpfend am Straßenrand stehen und schnipste gegen den Boden seiner Zigarettenschachtel. Mit den Zähnen zog er eine heraus, zerbrach beim Versuch, sie anzuzünden, zwei Streichhölzer und pustete schließlich den Rauch gegen den Himmel.
»Sag mal, kennst du eine andere Stadt, in der es so schwer ist, ein Taxi zu kriegen?«
Marianne lächelte. Es war ihr sehr recht, dass sich die Taxisuche so kompliziert gestaltete. Dass weder ein Taxi noch sonst jemand vorbeikam, um dem Abend ein Ende zu setzen. Von ihr aus konnte diese Nacht so lange dauern, wie sie wollte, bis in alle Ewigkeit und weiter, wenn es nach ihr ging, musste der kommende Tag nie anbrechen, ja, sie wünschte es sich sogar, und deshalb deutete sie statt einer Antwort mit dem Zeigefinger auf die Zigarette.
»Kann ich mal?«
»Natürlich«, erwiderte Virgile, »ich hätte nicht gedacht, dass du rauchst. Rauchen ist so total out«, fügte er lachend hinzu.
Marianne zog einmal kurz, so kurz wie möglich, denn sie rauchte nicht, o nein, aber wenn sie schon seine Lippen nicht berühren konnte …
Sie setzte sich ohne jede Furcht oder Anspannung zu Virgile ins Taxi. Was hatte sie denn auch zu fürchten? Virgile hatte sich gerade von Andy getrennt. Virgile liebte Blumen und italienische Schlager aus den achtziger Jahren. Virgile war nicht wie die anderen. Sie empfand einen Anflug von Scham, weil ihr so viele Klischees durch den Kopf schwirrten, aber wirklich nur einen Anflug, denn im Grunde wurde ein anderes Gefühl immer stärker, ein Gefühl von unverdientem Glück, von Rausch und Unbedingtheit: Man muss dazu bemerken, dass gerade in ihrem Inselkortex, auch Insula genannt, die stärkste Aktivität zu verzeichnen war, dem Ort im Gehirn also, in dem Gefühle entstehen und sterben – eine geheime, windumtoste Insel, die die Qualen und Freuden der menschlichen Seele beherbergt.
Sie schliefen wie zwei Schiffbrüchige unter einem Himmel voller Sterne. Zwei vollständig bekleidete Körper, jeder gestrandet auf einer Seite des großen Doppelbetts. Virgile wohnte im Quartier des Halles in einer kleinen Dreizimmerwohnung in der Rue Saint-Denis, deren Fenster auf die Fußgängerzone mit ihren Dönerbuden, Secondhandläden und kunterbunten schillernden Gestalten gingen. Sobald es dunkel wurde, flackerte die Neonleuchtschrift der Sexshops auch an den Wänden der Wohnung, mal hellrosa, mal mattviolett.
Als Marianne erwachte, schlief Virgile noch. Auf dem Rücken, friedlich, die Hände auf der Brust übereinandergelegt. Er schnarchte nicht. Sie beugte sich vorsichtig, mit angehaltenem Atem, über ihn und verspürte den Wunsch, seine Lider, seine Lippen, seine glatten Wangen zu berühren. Trotz des Alkohols und der Zigaretten vom Vorabend hatte seine Haut den angenehm frischen Duft seines Rasierwassers bewahrt, den Hauch von Bergamotte und Orangenblüten. Sie wunderte sich darüber, dass es ihr nicht im Mindesten unangenehm war, an einem fremden Ort aufzuwachen, neben einem schlafenden Mann, den sie erst seit wenigen Stunden kannte.
Sie tappte in die Küche. Der Raum war winzig, aber sehr ordentlich. Auf den Regalen standen Gewürzdosen aller Art, Weckgläser mit Reis, Nudeln und Linsen und eine beeindruckende Kollektion von Tees. Marianne öffnete mehrere Dosen und schnupperte an den verschiedenen Aromen, bis sie sich schließlich für Darjeeling Himalaya entschied. Während sie darauf wartete, dass ihr Tee abkühlte, blätterte sie in dem Skizzenbuch, das neben dem Kühlschrank lag. Sie sah Bleistiftskizzen und Aquarelle von Gärten, mehrere Fotografien – Luftaufnahmen von Heckenlandschaften, mediterrane Ansichten – und dazwischen eingestreut Dutzende von Zitaten. Eine wilde Mischung: Françoise Sagan, Emmanuel Carrère, Raymond Carver, Carson McCullers, Virginie Despentes. Daneben fanden sich minutiös beschriebene Filmszenen, Kommentare zu Kunstausstellungen und TV-Serien, kurz, alles, was Virgile als Inspirationsquelle dienen konnte. Marianne klappte das Skizzenbuch zu und legte es, im vollen Bewusstsein seines Werts, an den Platz zurück, an dem sie es gefunden hatte.
Als Virgile in der Küchentür auftauchte, lehnte Marianne mit dem Rücken an der Spüle und nippte vorsichtig an ihrem immer noch heißen Tee. Sie hielt die Tasse in den Fingern wie ein aus dem Nest gefallenes Vogeljunges. Virgile sagte guten Morgen, Marianne, mit einer fast unmerklichen Pause zwischen den Worten, und Marianne blies schweigend und lächelnd auf ihren Tee. Er trug Boxershorts und ein blassrosa T-Shirt mit einer großen gebogenen Palme auf der Brust. Außerdem hatte er eine Sonnenbrille aufgesetzt.
»Willst du zum Strand?«, fragte Marianne amüsiert.
»Mach dich nur lustig«, antwortete er leicht gekränkt. »Ich bin morgens beim Aufstehen extrem lichtempfindlich.«
Marianne hob fragend die Augenbrauen, und Virgile ergänzte:
»Das ist kein Witz, weißt du, ich bin photophob. Aber nur am Morgen. Das heißt, ich muss die hier tragen, es führt kein Weg dran vorbei.« Er tippte auf die Brille.
Marianne konnte ein Glucksen nicht unterdrücken, und Virgile machte einen Schmollmund. »Ich weiß wirklich nicht, was daran so komisch ist.« Er nahm eine der Teedosen in die Hand, hielt sie sich ans Ohr und schüttelte die Blättchen sachte.
»Ich liebe dieses Geräusch, du auch?«
Virgile toastete Brot, presste Orangen aus, holte Butter und Marmelade aus dem Kühlschrank und legte alles auf ein hübsches japanisches Lacktablett.
»Setzt du dich nicht hin?«, fragte er mit einer Kopfbewegung zum Küchentisch.
»Doch, doch«, antwortete Marianne und zog scharrend einen Stuhl über die Fliesen zum Tisch.
Virgile beobachtete sie durch seine Sonnenbrille hindurch, als sie sich Butter aufs Brot strich. Er verweilte bei den zarten Sommersprossen, die vor allem die Wangen und den Nasenrücken sprenkelten, bei ihren johannisbeerroten Lippen und den feinen Haarsträhnen, die ihr ins Gesicht wehten.
Marianne hob den Blick. »Was ist?«, fragte sie, das Messer in der Luft.
»Nichts«, antwortete Virgile, der sich ertappt fühlte. Er griff nach einem Stück Brot, strich einen großen Löffel Marmelade darauf und biss hinein. »Mit einer Sonnenbrille sieht man immer extrem seriös aus, viel seriöser, als man in Wirklichkeit ist. Ist dir das noch nie aufgefallen?«
Er trank einen Schluck Tee und verbrannte sich prompt die Zunge. Andy kam ihm in den Sinn, Andy mit den porzellanweißen, glatten Zähnen. Andy, mit dem er noch vor einem Monat sein Leben geteilt hatte. Andy, der auf einmal so weit weggerückt war.
Marianne erschien mit über einer Stunde Verspätung zu ihrem Termin in der Redaktion. Unterwegs begegnete sie ihrer Freundin Lucie, der sie kurz zunickte, bevor sie eilig das Großraumbüro durchquerte. Sie klopfte zweimal kurz an die Tür des Chefredakteurs und trat ein, ohne auf ein Herein zu warten.
»Wurde auch langsam Zeit«, begrüßte sie ihr Chef, ohne den Blick vom Bildschirm zu heben. Er klickte unbeirrt weiter auf die Maus (löschen, löschen, löschen, löschen). »Ich mache das noch schnell fertig.« Klick, klick, klick. »Also, dann erzähl mal. Wie ist es gestern Abend mit Paul Wiazowski gelaufen?«





























