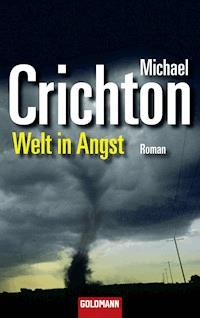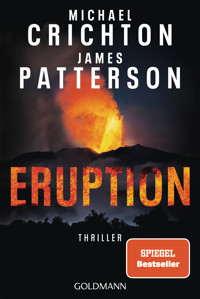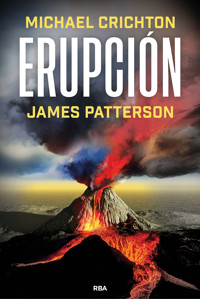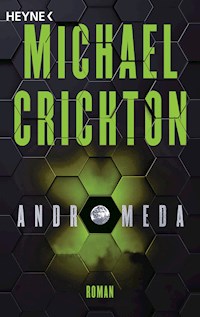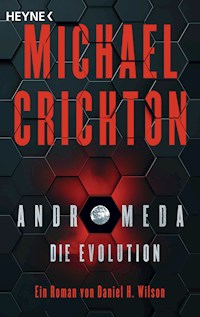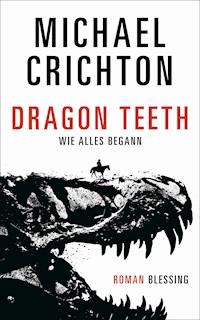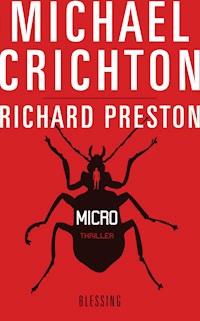
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Handvoll Studenten, ausgesetzt im Regenwald, auf der Flucht vor technisch veränderten Organismen: ein hintergründiges und hochaktuelles Actionszenario
Honolulu, Hawaii. Drei Männer liegen tot auf dem Fußboden eines verschlossenen Büros – keine Anzeichen eines Kampfes, keine Einbruchsspuren, keine Tatwaffe. Nur die extrem feinen, rasiermesserscharfen Schnitte, die die Leichen überziehen, liefern einen ebenso grausigen wie rätselhaften Hinweis auf die Todesursache. In Cambridge, Massachusetts, wird eine Handvoll Studenten, die sich durch besondere Fähigkeiten hervortun, von einem Unternehmen für den Einsatz an der Front der Mikrobiologie rekrutiert. Die streng geheime, höchst profitable Arbeit von Nanigen Micro Technologies führt die Forschungstalente nach Hawaii. Doch hier, weit entfernt von der Sicherheit ihrer Labors, plötzlich sich selbst überlassen im Dschungel, sehen sich die Studenten nicht nur einer erbarmungslosen Natur, sondern auch einer radikalen neuen Technik gegenüber, die die Gruppe schnell beherrschen lernen muss, will sie nicht für immer in den undurchdringlichen Wäldern Oahus verschwinden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
MICHAEL
CRICHTON
RICHARD PRESTON
MICRO
Roman
Aus dem Englischen
von Michael Bayer
Karl Blessing Verlag
Für Jr.
Um uns herum wimmelt es von winzigen Lebewesen. Sie sind Objekte potenziell unendlicher Erforschung und Bewunderung, wenn wir bereit sind, unseren Blick statt geradeaus in die Ferne nach unten zu richten, um die Welt einzubeziehen, die nur eine Armeslänge entfernt ist. Man kann ein ganzes Leben auf einer Magellanschen Entdeckungsreise um den Stamm eines einzigen Baumes verbringen.
E. O. Wilson
Vorwort
In was für einer Welt leben wir?
Der berühmte Tierfilmer David Attenborough äußerte sich kürzlich besorgt darüber, dass die Schulkinder von heute nicht einmal mehr die Namen häufig vorkommender Pflanzen und Insekten kennen, während frühere Generationen damit keine Probleme hatten. Offenbar ist es Kindern heute nicht mehr möglich, Natur direkt zu erleben und in freier Natur zu spielen. Dafür werden verschiedene Gründe angeführt: Die Kinder wachsen in der Stadt auf, es gibt kaum noch naturbelassene Gebiete, die Kinder verbringen zu viel Zeit am Computer und im Internet und haben einen vollen Terminplan. Alles läuft jedenfalls darauf hinaus, dass Kinder nicht mehr mit der Natur in Berührung kommen und keine unmittelbaren Erfahrungen in der Natur machen. Und das ironischerweise in einer Zeit, in der im Westen das Umweltbewusstsein wächst und immer ehrgeizigere Maßnahmen zum Umweltschutz erlassen werden.
Kinder im Sinne des Umweltschutzes zu erziehen ist ein Kerngedanke der Umweltschutzbewegung, entsprechend wird Kindern nun beigebracht, etwas zu schützen, von dem sie keine Ahnung haben. Dieser Ansatz ist zwar gut gemeint, hat der Umwelt bisher jedoch mehr geschadet als genützt – als wichtige Beispiele sind die Vernachlässigung der amerikanischen Nationalparks oder die Maßnahmen zur Verhinderung von Waldbränden in den USA zu nennen. Eine derartige Politik hätte sich nie umsetzen lassen, wenn die Menschen die Natur, die sie zu schützen versuchen, wirklich kennen würden.
Dabei dachte der Mensch tatsächlich, er wüsste Bescheid. Und man kann annehmen, dass die neue Generation Schulkinder noch überzeugter von sich sein wird. Heute wird in den Schulen gelehrt, dass es eine Antwort auf jede Frage gibt; erst im wahren Leben erkennen die Jugendlichen, dass vieles im Leben ungewiss und geheimnisvoll ist und der Mensch manches einfach nicht weiß. Wenn man Gelegenheit hatte, in der freien Natur zu spielen, wenn man von einem Käfer mit stinkendem Sekret bespritzt wurde, wenn man erlebt hat, wie die Farbe eines Schmetterlingsflügels an den Fingern haften bleibt, wenn man gesehen hat, wie eine Raupe ihren Kokon spinnt, bekommt man ein Gefühl für das Geheimnisvolle und Ungewisse. Je mehr man beobachtet, desto geheimnisvoller wirkt die Natur und desto mehr erkennt man, wie wenig man eigentlich weiß. Neben der Schönheit lernt man, dass es in der Natur auch Fruchtbarkeit gibt, Verschwendung, Aggressivität, Rücksichtslosigkeit, Schmarotzertum und Gewalttätigkeit – Eigenschaften, die in den Lehrbüchern vernachlässigt werden.
Die wichtigste Lehre, die man aus der direkten Erfahrung zieht, ist vermutlich die, dass die Natur mit all ihren Elementen und Verbindungen ein komplexes System darstellt, das man nicht verstehen, geschweige denn vorhersehen kann. Man macht sich etwas vor, wenn man sich so benimmt, als ob man es könnte, so wie jemand, der glaubt, er könnte die Entwicklung am Aktienmarkt vorhersehen, der ein ähnlich komplexes System darstellt. Wenn jemand behauptet, er könne den Kurs einer Aktie vorhersagen, wissen wir, dass er entweder ein Betrüger oder ein Scharlatan ist. Wenn ein Umweltschützer ähnliche Behauptungen über die Natur oder ein Ökosystem aufstellt, haben wir noch nicht gelernt, in ihm einen falschen Propheten oder einen Dummkopf zu sehen.
Der Mensch interagiert sehr erfolgreich mit komplexen Systemen. Das tun wir ständig. Aber wir interagieren mit ihnen, ohne zu behaupten, dass wir sie verstehen. Manager interagieren mit dem System: Sie tun etwas, warten die Reaktion ab und tun dann etwas anderes, um das gewünschte Resultat zu erzielen. Ein sich ständig wiederholender Prozess, bei dem man zugibt, dass man nicht sicher wissen kann, wie das System reagieren wird – man muss abwarten und schauen, was kommt. Wir haben vielleicht eine Ahnung. Vielleicht haben wir sogar meistens recht. Aber wir können uns nie sicher sein. Im Umgang mit der Natur ist uns Gewissheit verwehrt. Und das wird auch immer so bleiben.
Wie können junge Menschen nun Erfahrungen in der freien Natur sammeln? Idealerweise bei einem Aufenthalt im tropischen Regenwald – diesem enormen, unwirtlichen, beunruhigenden und faszinierenden Gebiet, das uns schnell eines Besseren belehrt, was unsere vorgefassten Meinungen betrifft.
Unvollendeter Text
Michael Crichton, 28. September 2008
Die sieben Forschungsstudenten
RICK HUTTER Ethnobotaniker, der von Eingeborenenvölkern verwendete Arzneimittel untersucht.
KAREN KING Arachnologin (Expertin für Spinnen, Skorpione und Milben). Erfahrene Kampfsportlerin.
PETER JANSEN Experte für Gifte und Vergiftungen.
ERIKA MOLL Entomologin und Koleopterologin (Käferforscherin).
AMAR SINGH Botaniker mit dem Spezialgebiet Pflanzenhormone.
JENNY LINN Biochemikerin, Expertin für Pheromone, den von Tieren und Pflanzen benutzten Botenstoffen.
DANNY MINOT Doktorand, der gerade eine Doktorarbeit über »wissenschaftliche linguistische Codes und Paradigmenwechsel« schreibt.
Teil 1 Tensor
Prolog
NANIGEN9. OKTOBER, 23:55 UHR
Westlich von Pearl Harbor fuhr er durch die im Mondlicht dunkelgrün schimmernden Zuckerrohrfelder den Farrington Highway hinunter. Das hier war zwar seit Langem die Ackerbaugegend der Insel Oahu, in letzter Zeit jedoch hatte sich einiges geändert. Auf der linken Seite hoben sich die silbern glänzenden flachen Stahldächer des neuen Kalikimaki Industrial Park von ihrer grünen Umgebung ab. Marcos Rodriguez wusste jedoch, dass es mit der Industrie in diesem Gewerbegebiet nicht weit her war. Die meisten Gebäude waren billig zu mietende Lagerhäuser. Außerdem gab es dort noch ein Schiffsbedarfsgeschäft, einen Mann, der maßgefertigte Surfbretter herstellte, ein paar Maschinenwerkstätten und eine Schlosserei. Das war so ziemlich alles.
Und dann war da noch das, weswegen er heute Nacht hier war: Nanigen MicroTechnologies, ein neues Unternehmen, das gerade erst vom Festland hierhergezogen war und seinen Sitz jetzt in einem großen Gebäude am äußersten Ende des Gewerbegebiets hatte.
Rodriguez bog von der Hauptstraße ab und fuhr die dunkel und still daliegenden Geschäftsbauten entlang. Es war fast Mitternacht. Das Industriegelände war menschenleer. Er parkte vor Nanigen.
Von außen sah das Nanigen-Gebäude wie alle anderen aus: eine einstöckige Stahlfassade und ein flaches Wellblechdach. Im Grunde war es nur ein riesiger, billig und schnell errichteter Kasten. Rodriguez wusste jedoch, dass dies beileibe nicht alles war. Vor dem Bau hatte das Unternehmen ein tiefes Loch in das Lavagestein graben lassen und dieses mit einer Menge elektronischer Geräte gefüllt. Erst danach hatte man diese unscheinbare Fassade errichtet, die jetzt von dem feinen roten Staub bedeckt war, der von den benachbarten Äckern herüberwehte.
Rodriguez zog seine Gummihandschuhe an und steckte seine Digitalkamera mit ihrem Infrarotfilter in die Tasche. Dann stieg er aus. Er trug die Uniform eines Sicherheitsunternehmens. Er zog sich die Mütze tief ins Gesicht, falls irgendwelche Kameras die Straße überwachen sollten. Er holte den Schlüssel heraus, den er einige Wochen zuvor dieser Nanigen-Empfangsdame stibitzt hatte, nachdem sie von ihrem dritten Blue-Hawaii-Cocktail außer Gefecht gesetzt worden war. Er hatte ihn nachmachen lassen und ihr danach wieder in die Handtasche gesteckt, bevor sie aufgewacht war.
Von ihr hatte er auch erfahren, dass das Nanigen-Gebäude voller Laboratorien und Hightech-Einrichtungen steckte, die insgesamt eine Fläche von 3700 Quadratmetern einnahmen. Sie meinte, sie würden dort Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Robotik durchführen. Was genau sie erforschten, konnte sie jedoch nicht sagen, außer dass die Roboter extrem klein waren. »Die untersuchen da Chemikalien und Pflanzen«, sagte sie etwas vage.
»Dafür braucht man Roboter?«
»Anscheinend.« Sie zuckte die Achseln.
Sie hatte ihm jedoch auch erzählt, dass das Gebäude selbst keine Sicherheitseinrichtungen hatte. Keine Alarmanlage, keine Bewegungsmelder, keine Wachleute, Kameras oder Laserstrahlen. »Und was benutzen sie stattdessen?«, fragte er nach. »Hunde?«
Die Empfangsdame schüttelte den Kopf. »Nichts«, sagte sie. »Nur ein Schloss an der Vordertür. Sie sagen, sie kämen ohne Sicherheitsmaßnahmen aus.«
Rodriguez begann zu vermuten, dass Nanigen ein Schwindelunternehmen oder irgendein Steuerbetrug war. Keine Hightech-Firma würde sich in einem staubigen Lagerhaus niederlassen, das dermaßen weit von der Stadtmitte und der Universität von Honolulu entfernt lag, von der alle Hightech-Unternehmen ihre Forschungskräfte bezogen. Wenn Nanigen also einen solch abgelegenen Flecken gewählt hatte, musste es etwas zu verbergen haben.
Diese Meinung teilte im Übrigen auch sein Kunde. Deswegen hatte man Rodriguez überhaupt erst diesen Auftrag erteilt. Eigentlich war die Untersuchung von Hightech-Unternehmen nicht gerade sein gewöhnliches Betätigungsfeld. Meist riefen ihn Anwälte an und ließen ihn irgendwelche Ehemänner fotografieren, die in Waikiki ihre Frauen betrogen. Auch in diesem Fall hatte ihn ein örtlicher Anwalt angeheuert: Willy Fong. Aber Fong war nicht sein eigentlicher Auftraggeber. Er wollte ihm auch nicht sagen, wer es war.
Rodriguez hatte allerdings seine Vermutungen. Nanigen hatte sich angeblich aus Schanghai und Osaka Elektronik im Wert von vielen Millionen Dollar kommen lassen. Einige dieser Lieferanten wollten jetzt wohl wissen, was man mit ihren Erzeugnissen hier so anstellte. »Sind das die, Willy? Die Chinesen oder die Japaner?«
Willy Fong zuckte die Achseln. »Sie wissen doch, dass ich Ihnen das nicht erzählen kann, Marcos.«
»Aber das Ganze ergibt doch keinen Sinn«, hatte Rodriguez gemeint. »Der Laden hat keine Sicherheitseinrichtungen. Ihre Auftraggeber könnten also einfach in der Nacht das Schloss knacken, da reingehen und selbst nachschauen. Dazu brauchen die mich doch nicht.«
»Sie wollen den Job also nicht?«
»Ich will nur wissen, worum ’s hier eigentlich geht.«
»Die wollen, dass Sie in dieses Gebäude gehen und ein paar Fotos für sie machen. Das ist alles.«
»Mir gefällt das Ganze nicht. Ich glaub, das ist irgendein Beschiss.«
»Wahrscheinlich haben Sie recht.«
Willy schaute ihn müde an, als wolle er sagen: Das kann Ihnen doch egal sein. »Wenigstens wird niemand vom Esstisch aufstehen und Ihnen aufs Maul hauen.«
»Stimmt.«
Willy schob seinen Stuhl zurück und verschränkte die Arme vor seinem ausladenden Bauch. »Also, was ist jetzt, Marcos? Nehmen Sie den Auftrag an oder nicht?«
Als Rodriguez jetzt genau um Mitternacht auf die Eingangstür zuging, wurde er plötzlich nervös. Sie kommen ohne Sicherheitsmaßnahmen aus. Was zum Teufel bedeutete das? Heutzutage hatte doch jeder Sicherheitseinrichtungen – eine Menge Sicherheitseinrichtungen. Vor allem hier in der Umgebung von Honolulu. Es blieb einem ja gar nichts anderes übrig.
Das Gebäude hatte keine Fenster, nur eine einzige Metalltür. Neben ihr hing ein Schild: NANIGEN MICROTECHNOLOGIES, INC. Und darunter: NUR NACH VEREINBARUNG.
Er steckte den Schlüssel ins Schloss und drehte ihn um. Die Tür öffnete sich.
Viel zu einfach, dachte er, während er auf die völlig leere Straße zurückschaute. Dann schlüpfte er in das Gebäude.
Nachtlampen beleuchteten einen von Glaswänden umgebenen Eingangsbereich, eine Empfangstheke und einen Warteraum mit Sofas, Zeitschriften und Informationsmaterial über das Unternehmen. Rodriguez schaltete seine Taschenlampe ein und ging den dahinterliegenden Gang hinunter. An dessen Ende befanden sich zwei Türen. Als er durch die erste trat, gelangte er in einen weiteren von Glaswänden eingefassten Gang. Auf beiden Seiten lagen Labore mit langen schwarzen Arbeitstischen, auf denen eine Menge Forschungsutensilien zu sehen waren. In den Wandregalen waren unzählige Flaschen und Fläschchen nebeneinander aufgereiht. Etwa alle zehn Meter summte ein Edelstahlkühlschrank und stand etwas, das wie eine Waschmaschine aussah.
Von Nachrichtenzetteln übersäte Anschlagtafeln, Post-its auf den Kühlschränken und mit Formeln vollgekritzelte Weißwandtafeln – alles ziemlich chaotisch, für Rodriguez jedoch ein deutliches Zeichen dafür, dass es sich hier um eine echte Firma handelte und dass Nanigen hier wirklich wissenschaftliche Arbeiten verrichtete. Wofür sollten die Roboter benötigen?
Und dann sah er sie endlich. Diese Roboter sahen jedoch äußerst seltsam aus: kastenförmige, silbern glänzende Metallapparaturen mit mechanischen Armen, Antriebssystemen und wie Gliedmaßen aussehenden Anhängseln. Sie erinnerten am ehesten an die Rover, die man zum Mars geschickt hatte. Es gab sie in den unterschiedlichsten Formen und Größen. Einige waren gerade einmal so groß wie eine Schuhschachtel, andere jedoch weit größer. Dann bemerkte er, dass neben jedem Roboter eine kleinere Version seiner selbst stand. Und daneben eine noch kleinere. Schließlich waren sie nur noch so groß wie ein Zehennagel, schienen jedoch bis in die kleinste Kleinigkeit eine exakte, winzige Kopie des jeweils größten Geräts zu sein. Auf den Arbeitstischen waren riesige Vergrößerungsgläser installiert, die den Laborarbeitern offensichtlich eine genaue Betrachtung der Roboter ermöglichen sollten. Rodriguez wunderte sich, wie man so etwas Winziges überhaupt bauen konnte.
Am Ende des Gangs traf er auf eine Tür, auf deren kleinem Schild TENSORKERN stand. Als er sie aufstieß, wehte ihm ein kühler Luftzug entgegen. Der Raum dahinter war groß und dunkel. An der rechten Wand hing an starken Haken eine ganze Reihe von Rucksäcken, als ob sie auf einen längeren Campingausflug warteten. Sonst war der Raum völlig leer. Als einziges Geräusch war ein lautes Wechselstrombrummen zu hören. Er bemerkte, dass in den Boden tiefe Rillen eingeritzt waren, die jeweils ein Sechseck ergaben. Oder handelte es sich dabei vielleicht um sechseckige Bodenplatten? Bei diesem schwachen Licht konnte er das nicht genau erkennen.
Aber dann wurde ihm plötzlich bewusst, dass es unter diesem Boden noch etwas gab. Eine riesige, komplexe Anlage aus sechseckigen Röhren und Kupferdrähten, kaum zu erkennen. Der Boden bestand aus Kunststoff, durch den man die in den Erdboden eingesenkten elektronischen Installationen wahrnehmen konnte.
Rodriguez kniete sich hin, um das Ganze besser betrachten zu können. Als er auf die unter ihm liegenden Sechsecke starrte, sah er plötzlich, wie ein Blutspritzer auf den Plastikboden tropfte. Und dann noch einer. Er starrte sie an, bevor er sich schließlich mit der Hand an die Stirn griff. Er blutete direkt über seiner rechten Augenbraue.
»Was zum Teufel –« Irgendwo musste er sich geschnitten haben. Er hatte überhaupt nichts gespürt, aber da war Blut auf seinem Handschuh, und aus seiner Augenbraue tropfte immer noch Blut herunter. Einige Sekunden lang stand er ganz ruhig da. Das Blut lief ihm über die Wange, das Kinn und dann hinunter auf seine Uniform. Er hielt sich die Hand an die Stirn und rannte in das nächstliegende Labor zurück, um dort nach einem Kleenex oder einem Stofftuch zu suchen. Er fand eine Schachtel mit Papiertaschentüchern und ging zu einem Waschbecken hinüber, über dem ein kleiner Spiegel angebracht war. Er tupfte sein Gesicht ab. Die Wunde hatte bereits aufgehört zu bluten. Der Schnitt war klein, aber rasiermesserscharf. Er wusste nicht, wie das passiert war. Am ehesten erinnerte ihn die Verletzung an eine Papierschnittwunde.
Er schaute auf die Uhr. Zwanzig nach zwölf. Zeit, sich wieder an die Arbeit zu machen. Einen Augenblick später sah er, wie sich längs seines Handrückens vom Handgelenk bis zu den Fingerknöcheln ein tiefer roter Riss auftat. Die Haut öffnete sich und begann zu bluten. Rodriguez schrie entsetzt auf. Er schnappte sich noch ein paar Kleenex und dazu noch ein neben dem Waschbecken hängendes Handtuch.
Er riss ein Stück davon ab und wickelte es sich um die Hand. Plötzlich fühlte er einen scharfen Schmerz an seinem Bein. Als er hinunterschaute, sah er, dass seine Hosen bis auf halbe Schenkelhöhe aufgeschnitten waren. Gleichzeitig spürte er, wie das Blut jetzt auch seine Beine hinunterfloss.
Rodriguez hatte genug. Er drehte sich um und machte sich davon.
So schnell es ihm sein verletztes Bein erlaubte, humpelte er durch den Gang zur Eingangstür zurück. Es war ihm wohl bewusst, dass man ihn anhand der Blutspuren, die er hier hinterließ, später leicht identifizieren könnte, aber das war ihm völlig egal. Er wollte nur noch weg von hier.
Kurz vor 1 Uhr morgens stellte er sein Auto vor Fongs Büro ab. Im ersten Stock brannte immer noch Licht. Rodriguez wankte die Hintertreppe hoch. Der Blutverlust hatte ihn geschwächt, aber sonst war er noch einigermaßen in Ordnung. Er trat ein, ohne zu klopfen.
Außer Fong befand sich noch ein weiterer Mann im Büro, den Rodriguez noch nie zuvor gesehen hatte, ein Chinese um die Zwanzig, der einen schwarzen Anzug trug und eine Zigarette rauchte. Fong drehte sich um. »Was zum Teufel ist denn mit Ihnen passiert? Sie sehen ja schrecklich aus.« Fong stand auf, verschloss die Tür und kam zurück. »Haben Sie sich geprügelt?«
Rodriguez lehnte sich an den Schreibtisch. Seine Wunden bluteten immer noch. Der schwarz gekleidete Chinese wich ein Stück zurück, sagte aber kein Wort. »Nein, ich habe mich nicht geprügelt.«
»Was zum Teufel ist denn dann passiert?«
»Weiß ich nicht. Ist eben einfach passiert.«
»Was reden Sie denn da?«, sagte Fong ärgerlich. »Erzählen Sie keinen Quatsch, Mann. Ich will wissen, was passiert ist.«
Der junge Chinese hustete. Als Rodriguez zu ihm hinübersah, bemerkte er unter dessen Kinn einen roten halbkreisförmigen Schnitt. Blut floss auf sein bisher so blütenweißes Hemd hinunter. Der Junge schien vollkommen schockiert zu sein. Er presste seine Hand an den Hals. Zwischen deren Fingern quoll Blut hervor. Er fiel rückwärts zu Boden.
»Heilige Scheiße«, rief Willy Fong. Er sprang zu dem jungen Mann und schaute auf ihn hinunter. Dessen Absätze trommelten im Krampf auf den Boden. »Waren Sie das?«
»Nein«, rief Rodriguez. »Das sag ich doch die ganze Zeit.«
»Was für eine Riesensauerei«, sagte Fong. »Mussten Sie das in mein Büro bringen? Haben Sie sich überhaupt was dabei gedacht? Das alles hier zu reinigen ist –«
Plötzlich spritzte Blut auf die linke Seite von Fongs Gesicht. Seine durchschnittene Halsschlagader pumpte es stoßweise aus seinem Körper. Er presste seine Hand auf die Wunde, doch das Blut floss weiter.
»Heilige Scheiße«, japste er und sackte in seinen Schreibtischstuhl. Er starrte Rodriguez an. »Wie …?«
»Ich habe nicht die geringste Ahnung«, antwortete Rodriguez. Er wusste jedoch, was als Nächstes kommen würde. Nur eine Frage der Zeit. Zwar fühlte er kaum den Schnitt in seinem Genick, aber kurz darauf wurde ihm schwindlig, und er fiel zu Boden. Dort lag er auf der Seite in einer stetig größer werdenden Blutlache und starrte auf Fongs Schreibtisch. Auf Fongs Schuhe. Dann fiel ihm ein, dass ihn der Bastard noch nicht bezahlt hatte. Und dann wurde es dunkel um ihn.
Die fette Schlagzeile der Titelseite des Honolulu Star-Advertisers lautete: DREI TOTE IN BIZARREM SELBSTMORDPAKT. Lieutenant Dan Watanabe, der hinter seinem Schreibtisch saß, stieß die Zeitung beiseite. Er schaute zu seinem Chef Marty Kalama hoch. »Anrufe ohne Ende«, sagte Kalama. Er trug eine Drahtgestellbrille, hinter der er ständig blinzelte. Er sah eher wie ein Lehrer aus, nicht wie ein Cop. Aber er war ein Akamai-Junge, wie die Hawaiianer einen klugen Menschen nannten, und wusste genau, was er tat. »Ich habe gehört, dass es hier Probleme gibt, Dan.«
»Wegen der Selbstmorde?« Watanabe nickte. »Das ist wirklich ein Riesenproblem. Ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn Sie mich fragen.«
»Woher haben es die Zeitungen dann?«
»Da her, wo sie alles herhaben«, antwortete Watanabe. »Sie haben es einfach erfunden.«
»Setzen Sie mich ins Bild«, forderte ihn Kalama auf.
Watanabe musste dazu nicht einmal in seine Aufzeichnungen schauen. Noch Tage später war ihm die grausige Szene gut in Erinnerung. »Willy Fong hatte ein Büro im ersten Stock eines dieser kleinen Gebäude in der Puuhui Lane, die nördlich der Autobahn von der Lillihi Street abzweigt. Ein ziemlich schäbiges Holzgebäude mit vier Büros. Willy war so um die sechzig, Sie kannten ihn wahrscheinlich, hat Einheimische bei Trunkenheit am Steuer vertreten, Kleinigkeiten eben, hat sich nie was zuschulden kommen lassen. Ein paar Leute in diesem Haus beklagten sich dann über den Gestank, der aus Willys Büro kam. Als wir dort nachsahen, fanden wir drei männliche Leichen vor. Der Gerichtsmediziner sagt, sie seien etwa zwei bis drei Tage tot gewesen, genauer kann er’s nicht eingrenzen. Die Klimaanlage war abgestellt, also wurde es in diesem Zimmer ziemlich heiß. Alle drei starben an Schnittverletzungen, wohl von einem Messer. Willy hat man die Halsschlagader durchgeschnitten, er ist in seinem Schreibtischsessel verblutet. Auf der anderen Seite des Raums lag ein junger Chinese, den wir noch nicht identifizieren konnten, vielleicht chinesischer Staatsbürger. Kehle samt beiden Schlagadern durchgeschnitten, er muss schnell verblutet sein. Das dritte Opfer ist dieser Portugiese mit der Kamera, Rodriguez.«
»Der immer die Kerle fotografiert, die ihre Frauen mit ihren Sekretärinnen betrügen?«
»Genau der. Das hat ihm immer wieder Schläge eingebracht. Wie auch immer, er lag da und hatte am ganzen Körper Stich- und Schnittwunden – im Gesicht, auf der Stirn, auf der Hand, den Beinen und im Genick. So was habe ich noch nie gesehen.«
»Selbst zugefügt?«
Watanabe schüttelte den Kopf. »Nein. Sagt auch der Gerichtsmediziner. Diese Verletzungen hat ihm ein anderer zugefügt, und zwar im Verlauf einer gewissen Zeit, vielleicht einer Stunde. Wir haben seine blutigen Fußspuren auf der Hintertreppe gefunden. Sein Auto, das er neben dem Gebäude abgestellt hatte, war auch voller Blut. Er muss also bereits geblutet haben, als er das Büro betrat.«
»Was ist also Ihrer Meinung nach geschehen?«
»Keine Ahnung«, sagte Watanabe. »Wenn es sich hier um Selbstmorde handeln sollte, dann hat keiner der drei einen Abschiedsbrief hinterlassen. So was hat es allerdings noch nie gegeben. Außerdem haben wir kein Messer gefunden, obwohl wir den Laden wirklich auf den Kopf gestellt haben, das können Sie mir glauben. Und das Büro war von innen abgeschlossen, also hätte keiner rausgekonnt. Die Fenster waren geschlossen und verriegelt. Wir haben trotzdem auf den Fensterrahmen nach Fingerabdrücken geschaut, um ganz sicherzugehen, dass niemand durch ein Fenster eingedrungen ist. Aber in der Umgebung der Fenster haben wir keine frischen Abdrücke gefunden, nur einen Haufen Schmutz.«
»Könnte jemand eine Klinge das Klo hinuntergespült haben?«, fragte Kalama.
»Nein«, antwortete Dan Watanabe. »In der Toilette war kein Blut. Das bedeutet, dass sich niemand nach Beginn der Messerstecherei dort aufgehalten haben kann. Wir haben es hier also mit drei toten Männern zu tun, die in einem verschlossenen Raum aufgeschlitzt worden sind. Kein Motiv, keine Waffen, überhaupt nichts.«
»Und was machen wir jetzt?«
»Dieser portugiesische Privatdetektiv muss von irgendwoher gekommen sein. Er muss irgendwo anders aufgeschlitzt worden sein. Schätze, wir sollten also rausfinden, wo das passiert ist, wo alles angefangen hat.« Watanabe zuckte die Achseln. »Wir haben bei ihm eine Benzinquittung von Kelo’s Mobil-Tankstelle in Kalepa gefunden. Er hat dort um 22 Uhr vollgetankt. Wir wissen, wie viel Benzin er danach verbraucht hat. Also können wir einen Entfernungsradius festlegen, innerhalb dessen er von dieser Tankstelle zu seinem Bestimmungsort und dann zurück zu Willys Büro gefahren ist.«
»Das wird ein großer Radius werden. Wohl fast die ganze Insel.«
»Wir tasten uns ran. In seinen Reifenprofilen haben wir frische Schottersplitter gefunden. Zermahlener Kalkstein. Kann gut sein, dass er zu einer neuen Baustelle oder so was gefahren ist. Das werden wir jedenfalls schon noch rauskriegen. Wird vielleicht eine Weile dauern, aber wir finden diesen Ort ganz bestimmt.« Watanabe schob die Zeitung quer über seinen Schreibtisch. »Und bis dahin … würde ich sagen, dass die Zeitungen recht haben. Dreifacher Selbstmordpakt, das ist alles. Zumindest für den Moment.«
Kapitel 1
DIVINITY AVENUE, CAMBRIDGE18. OKTOBER, 13 UHR
Im Biologielabor im ersten Stock senkte der 23-jährige Peter Jansen die Metallzange ganz langsam in den Glaskäfig hinein. Plötzlich fixierte er die Kobra mit einem kurzen Stoß direkt hinter ihrer Haube. Die Schlange zischte wütend, während Jansen in den Käfig griff, sie fest hinter dem Kopf packte und diesen zum »Melkbehälter« hob. Er tränkte die Behältermembran mit Alkohol, durchstieß sie dann mit den Giftzähnen und schaute aufmerksam zu, wie die gelbliche Giftflüssigkeit in das Glas hinunterfloss.
Allerdings betrug die Ausbeute nur ein paar enttäuschende Milliliter. Jansen hätte für seine Studienzwecke eigentlich ein halbes Dutzend Kobras gebraucht, um die Mengen an Gift zu sammeln, die er für seine Untersuchungen benötigte. In diesem Labor war nur leider kein Platz für weitere Tiere. Es gab zwar eine Reptilienzuchtstation drüben in Allston, aber die Tiere dort waren ausgesprochen krankheitsanfällig. Außerdem wollte Peter seine Schlangen immer in der Nähe haben, damit er ihren Zustand ständig überwachen konnte.
Schlangengift wurde ganz leicht von Bakterien verseucht. Daher auch das Tränken der Membran mit Alkohol und das Eisbett, auf dem der Melkbehälter aufsaß. Peter erforschte die Bioaktivität ganz bestimmter Polypeptide im Kobragift. Diese Arbeiten waren Teil seines riesigen Forschungsinteresses, das unter anderem Schlangen, Frösche und Spinnen umfasste, die alle neuroaktive Giftstoffe herstellten. Seine Erfahrung mit diesen Reptilien hatte ihn zu einem »Entgiftungsspezialisten« gemacht, der gelegentlich sogar von großen Krankenhäusern gerufen wurde, um sie bei exotischen Schlangenbissen zu beraten. Was einige andere Forschungsstudenten in diesem Labor ziemlich neidisch machte. Zwischen ihnen herrschte große Konkurrenz, deshalb bekamen sie auch sofort mit, wenn jemand aus ihrer Gruppe das Interesse der Außenwelt erregte. Sie versuchten, Peter auszubremsen, indem sie klagten, es sei viel zu gefährlich, eine solche Kobra im Labor zu halten. Eigentlich dürfte sie gar nicht hier sein. Sie qualifizierten Peters Forschungen als »Arbeit mit fiesen, widerlichen Kriechtieren« ab.
Peter machte das nichts aus. Er hatte einen fröhlichen und ausgeglichenen Charakter. Er kam aus einer Akademikerfamilie, weswegen er die Lästereien auch nicht allzu ernst nahm. Seine Eltern lebten nicht mehr. Sie waren beim Absturz eines Kleinflugzeugs in den Bergen Nordkaliforniens ums Leben gekommen. Sein Vater war Geologieprofessor an der University of California in Davis gewesen, während seine Mutter in der medizinischen Fakultät in San Francisco gelehrt hatte. Sein älterer Bruder war Physiker, und seine jüngere Schwester studierte Medizin.
Peter hatte die Kobra gerade in das gläserne Terrarium zurückgelegt, als Rick Hutter herüberkam. Hutter war 24 Jahre alt und Ethnobotaniker. Seit einiger Zeit untersuchte er Analgetika, Schmerzmittel, die man in der Rinde von Urwaldbäumen fand. Wie gewöhnlich trug Rick ausgewaschene Jeans, ein Jeanshemd und schwere Stiefel. Er hatte einen gut getrimmten Bart und schaute ständig düster drein. »Mir fällt auf, dass du deine Handschuhe nicht angezogen hast«, sagte er zur Begrüßung.
»Stimmt«, sagte Peter. »Ich bin inzwischen im Umgang mit Schlangen recht geübt –«
»Bei meinen Feldstudien mussten wir immer Handschuhe tragen«, fiel ihm Rick Hutter ins Wort. Er ließ grundsätzlich keine Gelegenheit aus, die anderen in diesem Labor daran zu erinnern, dass er tatsächlich vor Ort Feldforschung betrieben hatte. Dabei klang er so, als habe er lange Jahre in den abgelegensten Winkeln des Amazonasgebiets verbracht. Tatsächlich hatte er jedoch nur vier Monate lang in einem Nationalpark in Costa Rica geforscht. »Ein Träger in unserem Team trug einmal keine Handschuhe und griff dann nach unten, um einen Stein zu entfernen. Bamm! Schon hatte eine Terciopelo ihre Giftzähne in ihn geschlagen, eine zwei Meter lange Lanzenotter. Sein Arm musste danach amputiert werden. Er hatte großes Glück, dass er überhaupt überlebte.«
»Mhm«, brummte Peter und hoffte, Rick würde wieder verschwinden. Eigentlich mochte er Rick ganz gern, aber der Junge hatte die unangenehme Angewohnheit, ständig alle anderen zu schulmeistern.
Wer Rick in diesem Labor jedoch von Herzen verabscheute, war Karen King, eine fortgeschrittene Forschungsstudentin. Karen, eine groß gewachsene junge Frau mit dunklen Haaren und eckigen Schultern, untersuchte Spinnengifte und die verschiedenen Spinnwebformen. Als sie hörte, wie Rick Peter über Schlangenbisse im Dschungel »aufklärte«, hielt sie es nicht länger aus. Von ihrem Arbeitstisch aus blaffte sie über die Schulter: »Rick, du hast damals in Costa Rica in einer Touristenlodge gewohnt. Erinnerst du dich?«
»Unsinn. Wir haben im Regenwald gezeltet –«
»Zwei ganze Nächte«, unterbrach ihn Karen, »bis die Moskitos euch in die Lodge zurückgetrieben haben.«
Rick funkelte Karen wütend an. Sein Gesicht lief rot an, und er öffnete gerade den Mund, um etwas zu sagen, unterließ es dann jedoch. Er hatte dem nämlich nichts zu entgegnen. Die Moskitos waren tatsächlich höllisch gewesen. Er hatte Angst gehabt, dass sie ihm Malaria oder Denguefieber übertragen würden, deshalb war er in die Lodge zurückgekehrt.
Anstatt sich mit Karen King zu streiten, wandte er sich jetzt wieder Peter zu: »Übrigens, ich habe läuten hören, dass dein Bruder heute vorbeikommt. Hat der nicht mit einem Start-up-Unternehmen ein Vermögen gemacht?«
»Soweit ich weiß.«
»Na ja, Geld ist nicht alles. Ich selbst würde niemals in der Privatwirtschaft arbeiten. Das ist eine intellektuelle Wüste. Die klügsten Köpfe bleiben an der Uni, dort müssen sie sich nicht prostituieren.«
Peter hatte keine Lust, mit Rick eine Diskussion zu beginnen, da dieser seine Meinungen stur zu verteidigen pflegte. Aber Erika Moll, eine erst vor Kurzem aus München hierhergekommene Entomologin, meinte jetzt: »Ich glaube nicht, dass man das so stehen lassen kann. Mir würde es zum Beispiel überhaupt nichts ausmachen, für ein Privatunternehmen zu arbeiten.«
Hutter hob entsetzt die Hände. »Seht ihr? Ich hab’s doch gesagt: Prostitution.«
Erika hatte bereits mit mehreren männlichen Angehörigen der Biologiefakultät geschlafen, und es schien ihr auch nichts auszumachen, wenn andere davon erfuhren. Jetzt zeigte sie ihm den Mittelfinger und rief: »Steck ihn dir hinten rein, Rick!«
»Ich sehe, dass du dich mit amerikanischen Obszönitäten bereits gut auskennst«, erwiderte Rick. »Neben manchem anderen.«
»Über diese anderen Dinge weißt du ganz bestimmt nichts«, blaffte sie zurück. »Und du wirst sie auch nie kennenlernen.« Sie wandte sich Peter zu. »Wie dem auch sei, ich kann an einem Job in der Privatwirtschaft nichts Falsches finden.«
»Was ist das überhaupt für ein Unternehmen, um das es hier geht?«, ließ sich jetzt eine sanfte Stimme vernehmen. Peter drehte sich um und sah Amar Singh, den Laborexperten für Pflanzenhormone. Amar war für sein entschieden praktisches Denken bekannt. »Ich meine, was stellt diese Firma her, was sie so ertragsstark macht? Das ist doch ein Biologieunternehmen. Dabei ist dein Bruder doch Physiker, oder? Wie geht denn das zusammen?«
In diesem Augenblick hörte Peter, wie Jenny Linn auf der gegenüberliegenden Seite des Labors ausrief: »Wow, seht euch das an!« Sie schaute durchs Fenster auf die Straße hinunter. Sie konnten das Donnergrollen von Hochleistungsmotoren hören. Jenny meinte dann noch: »Peter, schau mal. Ist das dein Bruder?«
Alle, die sich gerade im Labor aufhielten, stürzten ans Fenster.
Peter erkannte tatsächlich seinen Bruder. Eric strahlte wie ein kleines Kind und winkte zu ihnen hinauf. Er stand neben einem kanariengelben Ferrari-Cabriolet und hielt eine wunderschöne blonde Frau im Arm. Hinter ihnen stand ein zweiter Ferrari, dessen schwarze Karosserie in der Sonne glänzte. Jemand sagte: »Zwei Ferraris! Da unten steht eine halbe Million Dollar.« Das Dröhnen der Motoren wurde von den Forschungslaboratorien rechts und links der Divinity Avenue zurückgeworfen.
Aus dem schwarzen Ferrari stieg jetzt ein Mann aus. Er war eine äußerst gepflegte Erscheinung und trug sündhaft teure Designerkleidung. Trotzdem wirkte er lässig und locker.
»Das ist Vin Drake«, sagte Karen King, die aus dem Fenster auf ihn hinunterschaute.
»Wieso kennst du den?«, fragte Rick Hutter, der neben ihr stand.
»Wer kennt den nicht?«, antwortete Karen. »Vin Drake ist wahrscheinlich der erfolgreichste Investor von ganz Boston.«
»Wenn du mich fragst, ist das eine absolute Schande«, schimpfte Rick. »Diese Autos hätte man schon vor Jahren verbieten müssen.«
Aber keiner hörte ihm mehr zu. Sie waren bereits alle auf dem Weg zur Treppe, um auf die Straße hinunterzueilen. Rick fragte: »Was soll die Aufregung?«
»Hast du’s nicht mitbekommen?«, sagte Amar, als er an Rick vorbeistürmte. »Die sind hier, um Leute anzuwerben.«
»Anwerben? Wen wollen sie denn anwerben?«
»Jeden, der auf einem Forschungsfeld gute Arbeit leistet, an dem wir interessiert sind«, teilte Vin Drake den Studenten mit, die sich eng um ihn drängten. »Mikrobiologie, Entomologie, Ethnobotanik, Phytopathologie – kurz, alle, die die natürliche Welt auf der Mikro- oder Nanoebene erforschen. Diese Leute suchen wir, und wir stellen sie auch sofort ein. Bei uns benötigen Sie keine Promotion. So etwas interessiert uns nicht. Wenn Sie talentiert sind, können Sie bei uns Ihre Doktorarbeit schreiben. Aber Sie müssen nach Hawaii umziehen, denn dort befinden sich unsere Labore.«
Ein paar Schritte von Drake entfernt umarmte Peter seinen Bruder Eric und fragte ihn dann: »Stimmt das? Du stellst schon neue Leute ein?«
Die blonde Frau antwortete: »Ja, das stimmt.« Sie stellte sich als Alyson Bender, Finanzchefin des Unternehmens, vor. Peter fielen ihr ziemlich kühler Händedruck und ihre kurz angebundene Art auf. Sie trug ein beiges Geschäftskostüm und eine Halskette aus Naturperlen.
»Bis Ende des Jahres benötigen wir mindestens hundert erstklassige Wissenschaftler«, fuhr sie fort. »Die sind aber rar, obwohl wir ihnen die wahrscheinlich beste Forschungsumgebung der gesamten Wissenschaftsgeschichte bieten können.«
»Tatsächlich? Wie denn das?«, fragte Peter erstaunt. Das war eine ziemlich großspurige Behauptung.
»Doch, das stimmt wirklich«, bestätigte sein Bruder. »Vin wird’s euch später erklären.«
Peter schaute zum Auto seines Bruders hinüber. »Hättest du was dagegen …« Er konnte einfach nicht mehr an sich halten. »Könnte ich mich einmal kurz da reinsetzen? Nur für eine Minute?«
»Sicher, kein Problem.«
Peter schlüpfte hinter das Lenkrad und schloss die Tür. Der Schalensitz schmiegte sich seinen Konturen an, das Leder roch herb, die Instrumente und Armaturen waren groß und nüchtern. Das Lenkrad war klein, und auf ihm befanden sich ungewöhnliche rote Knöpfe. Im gelben Lack der Karosserie spiegelte sich das Sonnenlicht. Alles wirkte dermaßen luxuriös, dass er sich etwas unsicher fühlte. Dabei wusste er nicht einmal, ob er dieses Gefühl mochte oder nicht. Er rückte auf dem Sitz hin und her und spürte unter seinem Schenkel etwas Hartes. Er holte einen weißen Gegenstand hervor, der wie ein einzelnes Popcorn aussah. Er war auch so leicht wie ein Popcorn. Es handelte sich jedoch eindeutig um einen Stein. Er befürchtete, dass dessen raue Kanten das kostbare Leder beschädigen könnten, und steckte ihn deshalb in die Tasche, bevor er aus dem Cabrio ausstieg.
Ein Stück weiter blickte Rick Hutter mit finsterem Gesicht auf den schwarzen Ferrari, den Jenny Linn gerade bewunderte. »Du solltest eigentlich begreifen, Jenny«, sagte er schließlich, »dass dieses Auto so viele wertvolle Ressourcen verschwendet, dass man es als einen Angriff auf Mutter Erde betrachten könnte.«
»Wirklich?«, entgegnete Jenny. »Hat sie dir das erzählt?« Sie fuhr mit dem Finger über den Kotflügel. »Ich finde diesen Wagen wunderschön.«
In einem Raum im Untergeschoss, in dem nur eine Kaffeemaschine und ein paar billige Plastikmöbel standen, hatte sich Vin Drake an einem Resopaltisch niedergelassen. Links und rechts von ihm saßen die beiden Nanigen-Chefs Eric Jansen und Alyson Bender. Die Forschungsstudenten drängten sich in einer dichten Traube um sie, einige setzten sich auf die Tischplatte, andere lehnten sich an die Wand.
»Sie alle sind junge Wissenschaftler, die gerade erst am Anfang ihrer Karriere stehen«, begann Vin Drake seinen Vortrag. »Sie müssen sich deshalb immer vor Augen halten, wie es in Ihrem Arbeitsgebiet zugeht. Warum wird in der Wissenschaft so viel Wert auf das absolute Neuland gelegt? Warum möchte jeder genau dort tätig sein? Weil alle Preise und Auszeichnungen an die neuesten Forschungsfelder gehen. Als vor dreißig Jahren die Molekularbiologie noch ganz neu war, fanden zahlreiche wichtige Entdeckungen statt, die zu etlichen Nobelpreisen führten. Später waren die Erkenntnisse dort nicht mehr ganz so fundamental und weit weniger innovativ und bahnbrechend. Die Molekularbiologie war nicht mehr neu. Inzwischen waren die besten Leute zur Genetik oder Proteomik übergewechselt, oder sie arbeiteten auf ganz bestimmten Gebieten wie der Funktionsweise des Gehirns und des Bewusstseins oder der Zelldifferenzierung, wo es noch eine Menge ungelöste Fragen und Probleme gab. War das eine gute Strategie? Eigentlich nicht, denn diese Probleme sind immer noch ungelöst. Es genügt also offensichtlich nicht, dass das Forschungsfeld neu ist. Es muss auch neue Geräte geben. Galileis Teleskop führte zu einer neuen Sicht des gesamten Universums und Leeuwenhoeks Mikroskop zu einer neuen Sicht des Lebens. Und so ging es bis zu unserer eigenen Gegenwart immer weiter, in der die Radioteleskope die astronomischen Kenntnisse explodieren ließen. Unbemannte Raumsonden schrieben unsere Kenntnisse des Sonnensystems vollkommen um. Das Elektronenmikroskop änderte die Zellbiologie, und so weiter und so fort. Neue Werkzeuge und Gerätschaften führen zu bedeutenden Forschungsfortschritten. Als junge Forscher sollten Sie sich also fragen: Wer verfügt über diese neuen Werkzeuge?«
Kurze Zeit herrschte Schweigen. Schließlich sagte jemand: »Also schön: Wer verfügt denn über diese neuartigen Werkzeuge?«
»Wir«, antwortete Vin. »Nanigen MicroTechnologies. Unser Unternehmen verfügt über Werkzeuge, die die Grenzen der Forschung in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts bestimmen werden. Ich mache keine Witze, und ich übertreibe nicht. Ich erzähle Ihnen die nackte Wahrheit.«
»Das ist eine ziemlich gewagte Behauptung«, sagte Rick Hutter. Er lehnte mit verschränkten Armen an der Wand und hielt sich an einem Pappbecher voller Kaffee fest.
Vin Drake schaute ihn ganz ruhig an. »Wir machen diese großartigen Behauptungen nicht ohne Grund.«
»Was genau sind denn dann Ihre Werkzeuge?«, fragte Rick weiter.
»Das ist ein Geschäftsgeheimnis«, entgegnete Vin. »Wenn Sie es herausfinden wollen, müssen Sie eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen und nach Hawaii kommen, um sich das Ganze dort selbst anzuschauen. Wir zahlen Ihren Flug.«
»Und wann?«
»Wann immer Sie dazu bereit sind. Schon morgen, wenn Sie wollen.«
Vin Drake hatte es eilig. Er beendete seinen Kurzvortrag, und alle Anwesenden verließen das Untergeschoss und gingen auf die Divinity Avenue hinaus, wo die beiden Ferraris parkten. Die Luft an diesem Oktobernachmittag war bereits recht frisch, und das Laub der Bäume leuchtete in einem Farbspektrum von orange bis rostrot. In diesem Augenblick schien Hawaii eine Million Kilometer von Massachusetts entfernt zu sein.
Peter bemerkte, dass Eric nicht zuhörte. Er hatte den Arm um Alyson Bender gelegt und lächelte, aber seine Gedanken waren offensichtlich ganz woanders.
Peter sagte dann zu Alyson: »Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich meinen Bruder kurz entführe?« Er fasste Eric am Arm und ging mit ihm ein Stück die Straße hinunter.
Peter war fünf Jahre jünger als Eric. Er hatte seinen großen Bruder immer bewundert. Vor allem hatte er ihn um die Leichtigkeit beneidet, mit der Eric alles auf die Reihe zu bekommen schien, ob es sich nun um Mädchen, Sport oder sein Studium handelte. Eric musste sich niemals anstrengen, er schien nie zu schwitzen oder Angst zu haben. Ob es sich nun um ein Meisterschaftsspiel seiner Lacrosse-Mannschaft oder das Rigorosum im Rahmen seiner Promotion handelte, Eric schien immer zu wissen, wie man die Dinge am besten regelte. Er war immer voller Zuversicht und völlig locker.
»Alyson scheint nett zu sein«, sagte Peter. »Wie lange seid ihr schon zusammen?«
»Ein paar Monate«, antwortete Eric. »Ja, sie ist sehr nett.« Irgendwie klang das jedoch nicht sehr begeistert.
»Höre ich da ein ›Aber‹ heraus?«
Eric zuckte die Schultern. »Nein, nur die Zwänge der Realität. Alyson hat einen Master in Betriebswirtschaft. Tatsächlich ist sie die geborene Geschäftsfrau und kann ganz schön hart auftreten. Du weißt schon: Daddy wollte eigentlich einen Jungen …«
»Für einen Jungen ist sie allerdings ziemlich hübsch.«
»Ja, das ist sie.« Wieder war da dieser eigentümliche Ton.
Wo er nun schon dabei war, fragte Peter dann noch: »Und wie kommst du mit Vin aus?« Vincent Drake hatte einen leicht anrüchigen Ruf. Schon zweimal hatte man ihn anzuklagen versucht. Beide Male hatte er jedoch die Staatsanwaltschaft daran hindern können, wobei niemand genau wusste, wie er das geschafft hatte. Drake galt als knallhart, klug und skrupellos. Vor allem war er jedoch erfolgreich. Peter war wirklich überrascht gewesen, als Eric sich mit ihm zusammengetan hatte.
»Vin kann Geld auftreiben wie kein Zweiter«, sagte Eric. »Seine Vorträge sind brillant. Und er zieht immer die dicken Fische an Land, wie man so schön sagt.« Eric zuckte die Schultern. »Deshalb akzeptiere ich auch seine weniger schönen Seiten. Vin wird immer alles sagen, was nötig ist, um einen Handel abzuschließen. In letzter Zeit war er allerdings, wie soll ich es ausdrücken … etwas vorsichtiger. Eher präsidentiell.«
»Er ist also der Chef der Firma, Alyson ist die Finanzchefin, und du bist –?«
»Technischer Leiter«, erwiderte Eric.
»Ist das okay?«
»Das ist perfekt. Ich möchte über die Technik dieser Firma bestimmen.« Er lächelte. »Und einen Ferrari fahren …«
»Was soll das mit diesen Ferraris?«, fragte Peter. »Was macht ihr mit denen?«
»Wir werden mit ihnen die ganze Ostküste runterfahren«, antwortete Eric. »Unterwegs werden wir an den Biologielaboren aller wichtigen Universitäten haltmachen und diese kleine Show veranstalten, um geeignete Kandidaten für uns zu finden. Am Schluss werden wir die Autos dann in Baltimore abliefern.«
»Sie abliefern?«
»Wir haben sie gemietet«, lachte Eric. »Nur eine Masche, um Aufmerksamkeit zu erregen.«
Peter schaute zu der Menschenansammlung zurück, die sich inzwischen um die Cabrios gebildet hatte. »Sie wirkt offenbar.«
»Ja, so haben wir uns das auch vorgestellt.«
»Also wollt ihr wirklich neue Arbeitskräfte einstellen?«
»Ja, das wollen wir wirklich.« Erneut fiel Peter die mangelnde Begeisterung in der Stimme seines Bruders auf.
»Also wo liegt das Problem?«
»Es gibt keins.«
»Sag schon, Eric.«
»Wirklich, da ist nichts. Die Firma läuft, wir machen große Fortschritte, und unsere Technik ist atemberaubend. Wo sollte da das Problem liegen?«
Peter sagte nichts. Sie gingen eine Zeit lang schweigend nebeneinanderher. Eric steckte die Hände in die Taschen. »Es ist alles in Ordnung. Wirklich.«
»Okay.«
»Glaub’s mir endlich.«
»Ich glaub’s dir ja.« Als sie am Ende der Straße angekommen waren, drehten sie um und gingen zu der Gruppe zurück, die immer noch die Luxusautos bewunderte.
»So«, brach Eric plötzlich das Schweigen, »jetzt solltest du mir erzählen, mit welchem Mädchen aus deinem Labor du gerade ausgehst.«
»Ich? Mit keinem.«
»Mit welcher denn dann?«
»Im Moment mit niemand«, sagte Peter mit leicht resignierter Stimme. Eric hatte immer eine Menge Mädchen gehabt, aber Peters Liebesleben war von jeher äußerst wechselhaft und unbefriedigend gewesen. Da hatte es eine junge Anthropologin gegeben. Sie arbeitete ein Stück die Straße hinunter im Peabody-Museum. Das Ganze hatte jedoch aufgehört, als sie mit einem Gastprofessor aus London ein Verhältnis anfing.
»Dieses asiatische Mädchen da ist echt süß«, sagte Eric.
»Jenny? Ja, sie ist wirklich süß. Aber sie steht nicht auf Männer.«
»Zu schade.« Eric nickte. »Und diese Blonde?«
»Erika Moll«, sagte Peter. »Sie kommt aus München. Sie ist nicht an einer festen Bindung interessiert.«
»Trotzdem –«
»Vergiss es, Eric.«
»Aber wenn du –«
»Habe ich schon.«
»Okay. Wer ist diese große, dunkelhaarige Frau?«
»Das ist Karen King«, erwiderte Peter. »Eine Arachnologin. Sie erforscht Spinnwebformationen. Außerdem hat sie an dem Lehrbuch Lebendige Systeme mitgewirkt. Seitdem sorgt sie dafür, dass das ja keiner vergisst.«
»Ein bisschen eingebildet?«
»Nur ein wenig.«
»Sie sieht sehr durchtrainiert aus«, bemerkte Eric, der immer noch Karen King beobachtete.
»Sie ist ein Fitnessfreak. Kampfsport, Muckibude und so.«
Sie kamen zur Gruppe zurück. Alyson winkte Eric zu. »Kann’s losgehen, Schatz?«
Eric bejahte. Er umarmte Peter und schüttelte ihm die Hand.
»Wohin geht’s jetzt?«, fragte Peter.
»Nur die Straße hinunter. Wir haben einen Termin am MIT. Am Nachmittag geht’s dann zur Boston University, danach verlassen wir die Stadt.« Er klopfte Peter auf die Schulter. »Mach dich nicht so rar und komm mich mal besuchen.«
»Das werde ich«, sagte Peter.
»Und bring deine ganze Gruppe mit. Ich verspreche euch – euch allen –, dass ihr nicht enttäuscht sein werdet.«
Kapitel 2
IM LABOR18. OKTOBER, 15 UHR
Als sie in ihr Labor zurückkehrten, erschien ihnen die vertraute Umgebung plötzlich unansehnlich und altmodisch. Und überlaufen. Die Spannungen im Labor köchelten bereits seit längerer Zeit. Rick Hutter und Karen King konnten sich von dem Tag an nicht leiden, als sie ins Labor gekommen waren. Erika Moll hatte mit ihren Bettgeschichten in der ganzen Gruppe Unruhe gestiftet. Außerdem waren sie wie so viele Forschungsstudenten überall auf der Welt Rivalen. Und sie hatten ihre Arbeit hier ziemlich satt. Anscheinend empfanden sie alle das Gleiche. Als sie an ihre Labortische zurückkehrten und ihre Arbeit wiederaufnahmen, herrschte erst einmal großes Schweigen. Peter nahm seinen Melkbehälter vom Eis, etikettierte ihn und stellte ihn in sein Kühlschrankregal. Plötzlich hörte er ein eigentümliches Klimpern in seiner Hosentasche. Etwas rieb sich an seinem Kleingeld. Er holte den Gegenstand heraus. Es war das kleine Ding, das er in dem gemieteten Ferrari seines Bruders gefunden hatte. Ohne sich etwas dabei zu denken, schnippte er es über die Oberfläche des Arbeitstisches. Es begann, sich im Kreis zu drehen.
Amar Singh, der Pflanzenvirologe, schaute zu. »Was ist das denn?«
»Oh, das ist wohl vom Ferrari meines Bruders abgebrochen. Irgendein Teil. Ich hatte Angst, es würde das Leder zerkratzen.«
»Könnte ich es mir mal anschauen?«
»Klar.« Es war etwas größer als sein Fingernagel. »Hier«, sagte Peter, ohne es näher zu betrachten.
Amar legte es in seine Handfläche und musterte es genau. »Das sieht für mich nicht wie ein Autoteil aus.«
»Nicht?«
»Nein. Ich würde sagen, es ist ein Flugzeug.«
Jetzt starrte auch Peter angestrengt auf das Objekt. Es war so klein, dass man auf den ersten Blick kaum irgendwelche Einzelheiten erkennen konnte. Als er jetzt jedoch genauer hinsah, schien es wirklich ein winziges Flugzeug zu sein. Es erinnerte ihn an die Modellbaukästen, die er als kleiner Junge so sehr geliebt hatte. Vielleicht das Modell eines Kampfflugzeugs, das man auf einen Flugzeugträger kleben konnte. Allerdings glich es keinem der Kampfflugzeuge, die er kannte. Dieses hatte eine stumpfe Nase, ein offenes Cockpit, kein Kabinendach und ein kastenförmiges Heck mit winzigen stummelartigen Ausbuchtungen. Vor allem fehlten richtige Flügel.
»Du hast doch nichts dagegen …«
Amar war bereits zu dem Vergrößerungsglas unterwegs, das auf dem Arbeitstisch angebracht war. Er legte den Gegenstand unter die Linse und drehte ihn vorsichtig um. »Das hier ist wirklich fantastisch«, rief er aus.
Jetzt brachte auch Peter den Kopf über das Glas. Unter Vergrößerung sah dieses Flugzeug – oder was auch immer es war – ausgesprochen schön und detailreich aus. Die Instrumente im Cockpit waren erstaunlich genau ausgeführt. Sie waren so winzig, dass man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, wie sie eingeritzt worden sein konnten. Amar dachte das Gleiche.
»Vielleicht mithilfe von Laserlithografie«, sagte er, »so wie sie Computerchips herstellen.«
»Aber ist das überhaupt ein Flugzeug?«
»Das bezweifle ich. Es hat überhaupt keinen Antrieb. Ich weiß es nicht. Vielleicht nur eine Art Modell.«
»Ein Modell?«
»Vielleicht solltest du deinen Bruder fragen«, sagte Amar, bevor er sich wieder seiner eigenen Arbeit widmete.
Peter erreichte Eric auf seinem Handy. Im Hintergrund waren laute Stimmen zu hören. »Wo bist du gerade?«, fragte Peter.
»Auf dem Memorial Drive. Sie lieben uns am MIT. Sie verstehen wirklich, wovon wir sprechen.«
Peter beschrieb den kleinen Gegenstand, den er gefunden hatte. »Den solltest du eigentlich gar nicht haben«, meinte Eric. »Das ist ein Betriebsgeheimnis.«
»Aber was ist es?«
»Tatsächlich ist das Ganze ein Test«, sagte sein Bruder. »Eines der ersten Probeobjekte unserer neuartigen Robotertechnik. Das ist ein Roboter.«
»Anscheinend hat es ein Cockpit mit einem kleinen Pilotensessel und Instrumenten, als ob jemand dort sitzen sollte …«
»Nein, nein, was du da siehst, ist der Schlitz, in den später die Mikrobatterie und der Steuerungsblock eingesetzt werden. Auf diese Weise können wir das Gerät mit einer Fernbedienung steuern. Ich versichere dir, Peter, es ist ein Roboter. Einer der ersten Machbarkeitsbeweise unserer Fähigkeit, Dinge so weit zu verkleinern, wie es bisher noch niemand geschafft hat. Ich würd’s dir gerne näher erklären, aber mir fehlt die Zeit – also, ich würde es vorziehen, wenn du das kleine Gerät erst einmal nicht herumzeigst, zumindest für den Moment.«
»Geht klar.« Er musste ihm ja nicht unbedingt von Amar erzählen …
»Bring es mit, wenn du uns in Hawaii besuchen kommst«, beendete Eric das Gespräch.
In diesem Moment kam der Leiter des Labors, Ray Hough, herein, um den Rest des Tages in seinem Büro Unterlagen durchzugehen und Forschungspapiere zu sichten. Es galt unter den Forschungsstudenten als schlechter Stil, über andere Jobs zu sprechen, solange Professor Hough anwesend war. Aus diesem Grund trafen sie sich alle um 16 Uhr in Lucy’s Deli in der Massachusetts Avenue. An den kleinen Tischchen begann sofort eine lebhafte Debatte. Rick Hutter bestand immer noch darauf, dass man nur an einer Universität auf ethisch korrekte Weise forschen könne. Allerdings hörte niemand mehr auf ihn. Alle anderen befassten sich nur noch mit den Behauptungen, die Vin Drake aufgestellt hatte. »Er war wirklich gut«, sagte Jenny Linn, »aber das Ganze war doch eher ein Verkaufsgespräch.«
»Ja«, stimmte Amar Singh zu, »aber wenigstens ein Teil davon war durchaus richtig. Neue Entdeckungen hängen an neuen Werkzeugen. Wenn diese Jungs so etwas wie ein neuartiges Mikroskop oder eine Technik, die mit der PCR vergleichbar wäre, entwickelt haben sollten, werden ihnen bald wichtige Entdeckungen gelingen.«
»Aber das beste Forschungsumfeld der Welt?«, fragte Jenny Linn skeptisch.
»Wir könnten es uns ja selbst ansehen«, meinte Erika Moll. »Sie wollen uns ja angeblich sogar den Flug bezahlen.«
»Wie ist denn das Wetter in Hawaii zu dieser Jahreszeit?«, fragte Jenny.
»Ich kann nicht glauben, dass ihr denen das alles abkauft«, maulte Rick.
»In Hawaii ist immer schönes Wetter«, sagte Karen King. »Ich habe einmal in Kona an einem Taekwondokurs teilgenommen. Es war herrlich.« Karen war eine begeisterte Kampfsportlerin und hatte auch schon den Sportanzug für ihr Abendtraining an.
»Ich habe die Finanzchefin sagen hören, dass sie bis Jahresende hundert Leute einstellen wollen«, sagte Erika Moll im Versuch, einer echten Auseinandersetzung zwischen Karen und Rick zuvorzukommen.
»Sollte uns das abschrecken oder ködern?«
»Oder beides?«, sagte Amar Singh.
»Wissen wir überhaupt etwas über diese neue Technik, über die sie angeblich verfügen?«, fragte Erika. »Weißt du was darüber, Peter?«
»Was die Karriereplanung angeht, wäre es äußerst unklug, nicht zuerst den Doktor zu machen«, warf Rick Hutter ein.
»Ich habe keine Ahnung«, sagte Peter. Er schaute Amar an, der jedoch nur schweigend nickte.
»Offen gesagt, würde ich mir ihre Anlage gerne einmal ansehen«, sagte Jenny.
»So geht’s mir auch«, bestätigte Amar.
»Ich habe mir mal ihre Website angeschaut«, sagte Karen King. »Nanigen MicroTech. Dort steht, dass sie spezialisierte Roboter in Mikro- und Nanogröße herstellen. Das heißt also von millimetergroßen Geräten bis zu solchen, die nur einen Tausendstelmillimeter groß sind. Sie haben die Abbildungen von Robotern ins Netz gestellt, die so aussehen, als ob sie vier oder fünf Millimeter lang wären, und dann einige, die anscheinend mit etwa zwei Millimetern nur halb so lang sind. Die Roboter sehen sehr fein ausgeführt aus. Es wird jedoch überhaupt nicht erklärt, wie sie hergestellt werden.«
Amar schaute Peter an. Der zog es vor zu schweigen.
»Also, ich weiß nicht, was die unter Roboter in Nanogröße verstehen«, fuhr Karen King fort. »Das wäre weniger als die Dicke eines Menschenhaars. Niemand kann etwas dermaßen Kleines herstellen. Man müsste fähig sein, einen Roboter Atom für Atom aufzubauen, und das kann niemand.«
»Und sie behaupten, dass sie das können?«, rief Rick. »Das ist Firmenwerbungsscheiße.«
»Die Ferraris waren jedenfalls keine Scheiße.«
»Die Ferraris waren gemietet.«
»Ich muss in meinen Kurs«, sagte Karen King und stand auf. »Aber eines muss ich euch noch erzählen. Nanigen hat sich bisher ziemlich zurückgehalten, was seine Öffentlichkeitsarbeit angeht. Aber einige Wirtschaftswebsites bringen seit etwa einem Jahr immer mal wieder einzelne Nachrichten über das Unternehmen. Sie haben finanzielle Mittel in der Höhe von fast einer Milliarde Dollar von einem Konsortium erhalten, das von Davros Venture Capital zusammengestellt wurde –«
»Eine Milliarde!«
»Genau. Und dieses Konsortium setzt sich hauptsächlich aus internationalen Arzneimittelunternehmen zusammen.«
»Arzneimittelunternehmen?« Jenny Linn runzelte die Stirn. »Warum sollten die sich für Miniroboter interessieren?«
»Jetzt kann man allmählich den Braten riechen«, sagte Rick in raunendem Ton. »Die Pharmamultis!«
»Vielleicht suchen die nach neuen Verabreichungsverfahren«, sagte Amar.
»Das glaube ich nicht. Die haben sie doch mit den Nanosphären längst gefunden. Sie würden also nicht noch einmal eine Milliarde Dollar dafür investieren. Sie müssen auf neuartige Medikamente hoffen.«
»Aber wie …« Erika schüttelte verwundert den Kopf.
»Auf den Wirtschaftswebsites habe ich noch etwas anderes gefunden«, ergänzte Karen King. »Kurz nachdem sie diese Finanzmittel erhalten hatten, machte eine andere Mikrorobotik-Firma in Palo Alto Nanigen schwere Vorwürfe. Sie behauptete, Nanigen habe falsche Angaben gemacht, um die entsprechenden Kapitalien zu bekommen. In Wirklichkeit würden sie gar nicht über die entsprechende Technik verfügen. Diese andere Firma entwickelte ebenfalls mikroskopisch kleine Roboter.«
»Und, wie ging das Ganze aus?«
»Die Anzeige wurde zurückgezogen. Das Unternehmen in Palo Alto ging in Konkurs. Das war dann das Ende der Geschichte, außer dass der Chef dieser Firma mit der Aussage zitiert wurde, dass Nanigen doch über diese Technik verfügen würde.«
»Du glaubst also, dass wirklich etwas dahintersteckt?«, fragte Rick.
»Ich glaube, dass ich zu spät in meinen Kurs komme«, sagte Karen.
»Ich glaube, dass das alles stimmt«, sagte Jenny Linn. »Und ich fliege nach Hawaii, um es mir mit eigenen Augen anzuschauen.«
»Ich auch«, sagte Amar.
»Das kann doch nicht wahr sein«, rief Rick Hutter.
Peter ging mit Karen King die Massachusetts Avenue in Richtung Central Square hinunter. Obwohl es bereits später Nachmittag war, spendete die Sonne noch eine Menge Wärme. Karen trug in der einen Hand ihren Sportbeutel, die andere Hand war frei.
»Rick regt mich wirklich auf«, sagte Karen. »Er spielt immer den Obermoralischen, dabei ist er einfach nur faul.«
»Wie meinst du das?«
»An der Uni zu bleiben ist die sicherste Lösung«, entgegnete Karen. »Das bedeutet ein nettes, bequemes und sicheres Leben. Nur will er das nicht zugeben. Tu mir einen Gefallen«, fügte sie dann noch hinzu, »und geh auf meiner anderen Seite, okay?«
Peter wechselte auf Karens linke Seite hinüber. »Warum?«
»Damit ich meine Hand frei habe.«
Peter schaute auf ihre rechte Hand hinunter. Sie hielt ihre Autoschlüssel so in der Faust, dass der Schlüsselbart zwischen ihren Knöcheln wie eine Messerklinge herausragte. Außerdem baumelte an ihrem Schlüsselanhänger ganz dicht am Handgelenk noch ein kleiner Pfefferspraybehälter.
Peter konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. »Glaubst du, wir sind hier in Gefahr?«
»Die Welt ist ein gefährlicher Ort.«
»Auf der Massachusetts Avenue? Um fünf Uhr nachmittags?« Sie gingen gerade durch die belebte Stadtmitte von Cambridge.
»Die Unis verschweigen die wirkliche Zahl der Vergewaltigungen auf ihrem Campus und unter ihren Studenten«, sagte Karen. »Das ist schlechte Werbung. Kein reicher Alumnus schickt dann noch seine Tochter hin.«
Er konnte seinen Blick nicht von ihrer geballten Faust wenden, aus der ihr Schlüssel herausragte. »Was würdest du mit diesem Schlüssel machen, wenn dich jemand angreift?«
»Ich würde den Angreifer damit in seine Luftröhre stechen. Das verursacht sofort einen entsetzlichen Schmerz, vor allem wenn ich seine Luftröhre tatsächlich durchbohre. Wenn ihn das noch nicht außer Gefecht setzt, sprühe ich ihm das Spray aus nächster Nähe direkt ins Gesicht. Außerdem könnte ich ihn noch hart an die Kniescheibe treten, möglichst brechen. Dann liegt er am Boden und bleibt auch da.«
Sie wirkte ganz ernst, fast grimmig. Peter kämpfte gegen seinen Drang zu lachen an. Die Straße vor ihnen war so ruhig und alltäglich wie gewöhnlich. Die Leute hatten gerade Feierabend gemacht und waren auf dem Weg nach Hause zum Abendessen. Sie gingen an einem gehetzt aussehenden Professor vorbei, der eine zerknitterte Cordjacke trug und krampfhaft versuchte, den Stapel blauer Klausurpapiere nicht aus den Händen gleiten zu lassen. Ihm folgte eine kleine alte Dame mit einer Gehhilfe. In der Ferne sah man gerade eine Gruppe von Joggern verschwinden.
Karen griff in ihre Sporttasche und holte ein kleines Klappmesser heraus. Sie klappte es auf, um ihm die dicke gezackte Klinge zu zeigen. »Ich habe auch mein Spyderco-Messer dabei. Ich könnte damit einen Bastard abstechen, wenn es nötig werden sollte.« Als sie aufsah, bemerkte sie seinen entgeisterten Gesichtsausdruck. »Du findest mich lächerlich, oder?«
»Nein. Aber – würdest du wirklich mit diesem Messer jemanden abstechen?«
»Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte«, sagte sie. »Meine Halbschwester ist Anwältin in Baltimore. Einmal geht sie um zwei Uhr nachmittags zu ihrem Auto in der Tiefgarage. Da wird sie von so einem Typen angegriffen. Er schlägt sie zu Boden, sie kommt mit dem Kopf auf dem harten Beton auf und verliert das Bewusstsein. Sie wird zusammengeschlagen und vergewaltigt. Als sie wieder zu sich kommt, leidet sie unter retrograder Amnesie. Sie kann sich nicht mehr an ihren Angreifer, wie er aussah und wie alles ablief, erinnern. An nichts. Sie behalten sie gerade einmal einen Tag im Krankenhaus, dann schicken sie sie heim.
In ihrer Kanzlei begegnet sie danach einem Kollegen, dessen Hals völlig zerkratzt ist. Vielleicht war er es ja, denkt sie. Ein Kerl aus ihrer eigenen Kanzlei, der ihr nach draußen gefolgt ist und sie dort vergewaltigt hat. Aber sie kann sich an nichts mehr erinnern und sich niemals sicher sein, ob er es wirklich war. Das Ganze reibt sie auf. Schließlich verlässt sie die Kanzlei, zieht nach Washington und muss dort einen schlechter bezahlten Job annehmen.« Karen hielt Peter ihre Faust vors Gesicht. »Und das alles, weil sie keinen Schlüssel wie den hier dabeihatte. Sie war zu ›nett‹ und wohlerzogen, um sich selbst zu schützen. Was für eine Scheiße.«
Peter überlegte sich, ob Karen King tatsächlich auf jemanden mit dem Schlüssel einstechen oder ihn mit dem Messer aufschlitzen würde. Er hatte das unbehagliche Gefühl, dass sie das tun würde. In einer solchen akademischen Umgebung war man es gewohnt, dass die Leute es beim Reden beließen. Sie schien dagegen zum Handeln bereit zu sein.
Sie kamen zu einem Kampfsportstudio, dessen Fenster mit Papier verklebt waren. Er konnte von drinnen kurze, gemeinsam ausgestoßene Kampfrufe hören. »So, hier findet mein Kurs statt«, sagte sie. »Wir sehen uns später. Wenn du mit deinem Bruder sprechen solltest, frag ihn doch, warum Pharmafirmen so viel Geld für Mikroroboter ausgeben, okay? Das würde mich wirklich interessieren.« Sie ging durch die Schwingtür zu ihrem Kurs.
Peter kehrte an diesem Abend noch einmal ins Labor zurück. Er musste die Kobra alle drei Tage füttern und tat dies normalerweise nach Einbruch der Dunkelheit, wenn die Kobras aktiv wurden. Es war 20 Uhr, und die Laborlichter hatten bereits auf den Nachtmodus umgeschaltet, als er eine wild zappelnde weiße Ratte in den Glaskasten setzte, den er danach wieder fest verschloss. Die Ratte rannte zum äußersten Ende des Kastens und stellte sich dann tot. Nur ihre Nase zuckte noch. Die Schlange drehte sich ganz langsam um, rollte sich auf und fixierte das Nagetier.
»Mir dreht sich der Magen um, wenn ich das sehe«, sagte Rick Hutter, der hinter Peter getreten war.
»Warum?«
»Es ist so grausam.«
»Jeder muss essen, Rick.«
Die Kobra stieß zu und senkte ihre Giftzähne tief in den Körper der Ratte. Diese zitterte, versuchte eine Zeit lang, auf den Füßen zu bleiben, und brach dann zusammen. »Deshalb bin ich Vegetarier«, sagte Rick.
»Glaubst du etwa, Pflanzen hätten keine Gefühle?«, sagte Peter.
»Fang nur nicht damit an«, entgegnete Rick. »Du und Jenny.« Jen untersuchte unter anderem die Kommunikation unter Pflanzen und Insekten mithilfe von Pheromonen und chemischen Stoffen, die von den Organismen freigesetzt wurden, um bestimmte Reaktionen hervorzurufen. Dieses Forschungsgebiet hatte in den letzten zwanzig Jahren große Fortschritte gemacht. Jenny bestand darauf, dass man Pflanzen als aktive, intelligente Lebewesen betrachten müsse, die sich kaum von den Tieren unterschieden. Außerdem machte es ihr Spaß, Rick zu ärgern. »Das ist lächerlich«, fauchte Rick Peter an. »Erbsen und Bohnen haben keine Gefühle.«
»Natürlich nicht«, entgegnete Peter mit einem Lächeln. »Und zwar, weil du die Pflanzen bereits getötet hast – sie herzlos für deine eigene egoistische Mahlzeit geopfert hast. Du willst nur nicht wahrhaben, dass die Pflanze einen Todesschrei ausgestoßen hat, als du sie getötet hast, weil du dich nicht den Konsequenzen deines kaltblütigen Pflanzenmords stellen willst.«
»Das ist absurd.«
»Nein, das ist Speziesismus«, sagte Peter. »Und du weißt es.« Er lächelte zwar, aber es war doch etwas Wahres an dem, was er sagte. Sie gingen ins Labor zurück. Peter war überrascht, dass Erika und Jenny noch da waren. Nur wenige Studenten arbeiteten noch am Abend. Was ging hier vor?
Erika Moll stand an einem Sezierbrett und schnitt gerade ganz vorsichtig einen schwarzen Käfer auf. Erika war Koleopterologin, also eine Entomologin, die sich auf Käfer spezialisiert hatte. Sie erzählte gerne, dass das schon manchen Small Talk auf Cocktailpartys abrupt beendet hatte (»Was machen Sie?« – »Ich untersuche Käfer.«). Tatsächlich waren Käfer für das Ökosystem sogar ausgesprochen wichtig. Ein Viertel aller bekannten Arten waren Käfer. Vor Jahren hatte ein Reporter den berühmten Evolutionsbiologen J. B. S. Haldane einmal gefragt, was man aus der Schöpfung über ihren Schöpfer ableiten könne. Haldane hatte geantwortet: »Er hat eine besondere Vorliebe für Käfer.«
»Was hast du denn da?«, wollte Peter von Erika wissen.
»Das ist ein Bombardierkäfer«, sagte sie. »Ein australischer Pheropsophus, dessen Sprühleistung besonders beeindruckend ist.«
Während sie das sagte, kehrte sie zu ihrer Sezierarbeit zurück. Als sie ihren Körper bewegte, berührte sie ganz leicht den seinen. Es schien ein zufälliger Kontakt zu sein – kein Anzeichen dafür, dass sie diese »Begegnung« überhaupt bemerkt hatte. Andererseits war sie berühmt für ihre Flirtkünste. »Und was ist an diesem Bombardierkäfer so besonders?«, fragte Peter.
Die Bombardierkäfer hatten ihren Namen von ihrer Fähigkeit, aus einer beweglichen Spritzdüse am Hinterleibsende ihren Angreifern ein heißes, ätzendes Gasgemisch entgegenzuschleudern. Dieses Wehrsekret war dermaßen unangenehm, dass es Kröten und Vögel davon abhielt, sie zu fressen, und es war giftig genug, um kleinere Insekten sofort zu töten. Wie die Bombardierkäfer das schafften, wurde bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts untersucht. Inzwischen wusste man genau, wie das Ganze funktionierte.