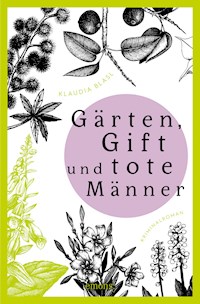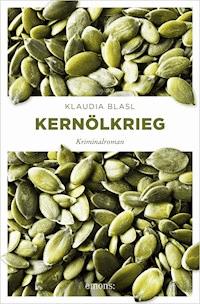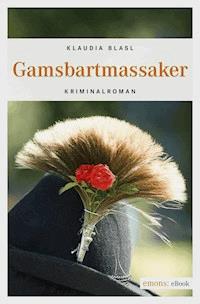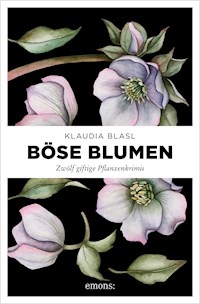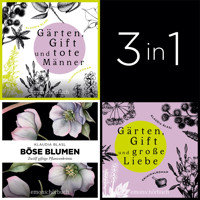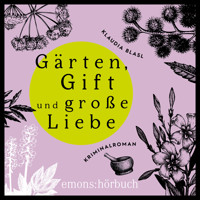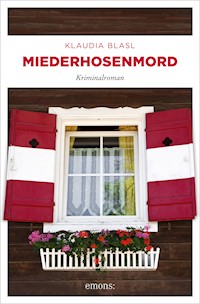
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Damischtal-Reihe
- Sprache: Deutsch
Das Leben im steirischen Damischtal verläuft friedlich, bis ein Mord die Idylle zerstört. Da die Erstbegehung des neuen Pilgerwegs durch höchste kirchliche Würdenträger naht, kommt die Leiche äußerst ungelegen. Träge beginnt Muttersöhnchen und Dorfpolizist Ferdinand Kapplhofer zu ermitteln. Dabei trifft er auf eine Menge bockiger Dörfler und mehr schmutzige Geheimnisse, als einem einzigen Tal guttut. Und dann geschehen auch noch weitere Morde. Das Schlimmste aber: Ausgerechnet der aufgeweckte Sprössling einer deutschen Urlauberfamilie bringt Licht ins frevelhafte Dunkel . . .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaudia Blasl ist süchtig nach gutem Essen. Kaum hat sie Hunger, kommt sie auf böse Gedanken. Kein Wunder also, dass die gebürtige Steirerin als Kolumnistin und Kulinarikjournalistin tätig ist. Wegen ihrer kalorischen Triebhaftigkeit hat sie bereits die halbe Welt bereist und lange Jahre in Italien verbracht, wo sie begann, die Zeit zwischen den Mahlzeiten mit »Auftragsmorden« totzuschlagen. Heute lebt die Germanistin in Graz, sofern sie nicht gerade auswärts isst oder unliebsame Zeitgenossen ins Jenseits befördert.
Alle Charaktere, Handlungen, Orte und bösen Unterstellungen sind frei erfunden und stimmen in keinem Fall mit der Wirklichkeit überein. Dort, wo Schilcher und Kernöl zu Hause sind, dort leben freundliche, friedliche und hilfsbereite Menschen, die bis heute niemandem etwas zuleide getan haben, weder gewollt noch ungewollt. Daher ist das Einzige, was der Besucher bei einem längeren Aufenthalt in dieser Gegend riskiert, seine schlanke Figur. Und dasselbe gilt für die Heimat der Lebzelterei. Ein Glossar der Austriazismen und Dialekt-Ausdrücke befindet sich im Anhang.
© 2014 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: fotolia.com/Harald Biebel Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-582-2 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.
Friedrich Schiller
Die Bewohner vom Damischtal
Balthasar Schragl
Fremdenverkehrsobmann von Plutzenberg, ambitionierter Bürgermeisteraspirant und Träger des goldenen Verdienstzeichens der heimischen Blasmusik.
Alois Feyertag
Bürgermeister von Gfrettgstätten, begabter Stimmenfänger und leidenschaftlicher Jäger.
Ferdinand Kapplhofer
Revierinspektor vom Damischtal, dessen einzige Bewegung darin besteht, jeder Bewegung aus dem Weg zu gehen – sofern er sich nicht gerade bei Muttern den Bauch vollschlägt.
Bartl Mostburger
Fleischer mit dubiosen Geschäftspraktiken und bedrohlichen Umgangsformen.
Bibiana Doppler
Feinstofflich veranlagte Schönheit, die stets auf der Suche nach potenziellen Besamern ist, um endlich in den Mutterstand zu treten.
Hermine Holzapfel
Moralischer Imperativ des Damischtals, altgediente Obfrau der katholischen Kernölkoalition und Vorsitzende des örtlichen Friedhofsblumenvereins.
Kilian Klöpfer
Walrossförmiger Schuldirektor mit entsprechend großem Resonanzvolumen und noch größerer verbaler Schlagkraft.
Sepp Böllinger
Verlustposten der Freiwilligen Feuerwehr, halbherziger Kürbiszüchter, stammtischerfahrener Kampfhahn und talentierter Rufmörder.
Hubert Ehrenhöfler
Damischtaler Umweltschutzreferent, einziger Gemeinderat der Grünen und Liebhaber von Vögeln aller Art.
Hochwürden Corolianus Hafernas
Rühriger Vertreter Gottes, der gern in weltlichen Sphären verkehrt.
Polizeihauptmann van Trott
Ergebnisorientierter Emotionsminimalist aus der Großstadt mit einer Vorliebe für Triebtätertheorien.
Familie Bartenstein
Deutsche Feriengäste, die während ihres mehr oder weniger freiwilligen Aufenthalts Kopf, Kragen und Ehekrisen riskieren. Sohn Kevin-Karl hingegen entpuppt sich als Held des ganzen Damischtals.
Prinz Rudolf
Ein zweijähriger Deutscher Drahthaar, der seine Jagdbefähigung verliert und zum Haus- und Hofhund degradiert wird.
Wallfahrts- und Pilgerwegnetzorganisationskomitee
Hohe geistliche Herren aus dem begnadeten St.Marienburg, die sich auf Gottes Spuren begeben und statt im Pilgerhimmel in der Hölle landen.
Prolog
Wir befinden uns im Jahre 2014 nach Christus. Ganz Österreich erbebt unter Steuerpaketen und Korruptionsaffären, Hypo-Rettungsversuchen und verloren gegangenen Vokalen. Nun ja, beinahe ganz Österreich. Denn in einem kleinen südweststeirischen Tal verläuft das Leben weiterhin in gewohnt gemächlichen Bahnen. Skandalös genug, dass der liederliche Bankert von der Strammelbock Xandi mit einer Zuagroastn liiert ist und der blade Bauernschädl von Bartl einen immer mit dem G’selchten bescheißt – wen soll da bitte noch die Volkswirtschaft bekümmern? Und während rundherum gewagte Tunnelbauten und gewitzte Bankenmanager bedrohliche Löcher ins Budget reißen, reißen die Menschen aus dem idyllischen Damischtal schlimmstenfalls das Maul auf, aber auch nicht immer und meist nur untereinand’. Etwa dann, wenn sie, je nach Alter und Geschlecht, am Wirtshaus- oder Küchentisch sitzen und die Lage der Nation kritisieren. Sofern es nichts Wichtigeres zu bereden gibt. Dass in Gfrettgstätten schon wieder eine Kuh in die Klärgrube gestürzt ist, ist selbst in Plutzenberg von lokaler Relevanz. Und das ernüchternde Überholverbot zwischen Buschenschank und Schrottfriedhof erscheint von nahezu weltpolitischer Brisanz. Zumindest, solange nichts Schlimmeres passiert. Aber das war bislang selten der Fall.
Zwar hauen die an Ackerland vermögenderen Plutzenberger bei den einwohnermäßig besser gestellten Gfrettgstättenern gern mal auf den Festzeltputz, und hin und wieder – vor allem in der Bärlauchzeit – fällt ein rüstiger Rentner in den Bach, aber das war’s dann schon. Allein die motorsportliche Jugend sorgt mit ungebremster Lebenslust für sporadischen Polizeieinsatz und ein Umsatzplus beim Autohaus.
Davon abgesehen gleicht das Tal einem beschaulichen Bollwerk der Gemütlichkeit. Die Damisch windet sich sanft und träge zwischen Kürbisäckern, Kukuruzfeldern und Klapotetzen dahin, die Damischtaler – etwas weniger sanft und manchmal sogar rege – wenden sich derweil ihrem mehr oder weniger rechtschaffenen Tagwerk zu. Doch der Unterschied zwischen Gut und Böse fällt kaum ins Auge. Viel auffälliger sind die vielen Rehe, Rebstöcke und Rapunzeltürmchen, die der Landschaft einen beinahe bukolischen Reiz verleihen. In Plutzenberg, auf dem Schornstein vom alten Sägewerk, campieren sogar zwei Störche. Was aber weniger die Geburtenrate als das touristische Verkehrsaufkommen hebt.
Doch gerade als Plutzenberger und Gfrettgstättener die florale Aufrüstung um die Vorherrschaft im alljährlichen Blumenschmuckwettbewerb in Angriff nehmen, befleckt ein Mord die blütenreine Botanik. Und mit der Idylle vom Fremdenverkehrsprospekt ist es für einige Zeit vorüber.
Bescherung im Gemüsebeet
»Um Gottes willen, was werden denn da die Leut’ sagen?«
Entsetzt starrte Hermine Holzapfel auf den toten Mann, der mitten in ihrem Gemüsebeet lag. Die Krachlederne stand ihm weit offen, links wie rechts von seinem Bierbauch ragten ein paar geknickte Salatsetzlinge hervor und auf dem zerdrückten Steirerhut lag der gusseiserne Wetterhahn. Über dreihundert Euro hatte sie dieses solide Werk der Damischtaler Schmiedekunst im Vorjahr gekostet. Und nun war der hübsche rote Kamm abgebrochen.
Eine himmelschreiende Sauerei war das!
Farblich abgestimmt auf dieses morgengräuliche Stillleben mit Hahn, Hut und totem Haderlump hatte auch Hermine einen leichenblassen Teint angenommen. Dieser ungeheuerliche Anblick hatte sie moralisch wie mageninhaltlich zutiefst erschüttert. Nun stand sie mit rauchendem Kopf und rumorenden Eingeweiden da und verstand die Welt nicht mehr. Dreimal griff sie nach ihrer Brille, nahm sie ab und setzte sie umständlich wieder auf, aber das Bild des Schreckens blieb. Außerdem zitterte sie, und zwar dermaßen stark, dass ihre graublauen Lockenwicklerlöckchen ganz undamenhaft auf und ab wippten, obwohl es vollkommen windstill war.
Wie gern hätte sie jetzt nach ihrem geschändeten Gockel gegriffen, um ihn zumindest anständig zu säubern. Es schien, als wäre dem armen Tier nun ein blutiger Gamsbart gewachsen. Pfui Teufel, wie das aussah! Aber die Angst vor dem nachbarschaftlichen Weitblick saß ihr dann doch zu sehr im vornüber gereckten Nacken. Es würde womöglich so aussehen, als wäre sie es gewesen, die die Hand – oder besser gesagt den Hahn – gegen diesen Idioten erhoben hatte. Was sie zwar einige Male gewollt, aber natürlich niemals getan hatte.
Der Schaden am Kopf des Mannes war unübersehbar, der am Kopfsalat leider auch. Den schlimmsten Verlust aber würde Hermine Holzapfels guter Ruf erleiden, denn der Tote hielt ganz offensichtlich ihre fleischfarbene Miederhose in der linken Hand. Was selbst für schlechte Augen gut zu erkennen war.
Nie würde die ältliche Anstandsdame der Gemeinde diesen Anblick vergessen! Und die Leute bestimmt noch viel weniger. Davon war sie (durchaus zu Recht) überzeugt. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott bekanntlich nicht zu sorgen. Schon gar nicht in einem Zweitausend-Seelen-Dorf, dessen gesellschaftliches Getriebe seit Generationen durch Klatsch, Tratsch und invasive Anteilnahme geschmiert wurde.
Beschwert von diesen zunehmend apokalyptischen Gedanken, sank das Holzapfel’sche Haupt immer weiter auf den platten Busen, während die Vögel unbeeindruckt von der ganzen Misere ihr fröhliches Morgenlob sangen. Aber an diesem denkwürdigen Tag hatte die rüstige Rentnerin natürlich kein Ohr für das vielstimmige Zwitschern, Pfeifen und Tirilieren, das sie umgab. Sie nahm nicht einmal die beharrlich brummende Hummel wahr, die sich hoffnungslos in den flauschigen Fasern ihres selbst gestrickten Trachtenjäckchens verheddert hatte. Auch dem Insekt stand ein schlimmes Ende bevor, wenngleich zumindest im Schonwaschgang.
In Hermines Kopf hingegen schleuderte es schwindelerregend.
Warum hatte dieser Pleampel ihr das antun müssen, fragte sie sich immerfort. Wo doch gerade sie sich jahrzehntelang als moralischer Imperativ des gesamten Damischtales bewährt hatte, unermüdlich bemüht, fleischlichen Lastern und anzüglichen Lästerern das Hand- beziehungsweise Mundwerk zu legen. Böse blickte sie auf den Boden, wo der Grund allen Übels reglos zwischen den Salatsetzlingen lag, doch der Beschuldigte schwieg.
An seiner statt würden sich bald Scharen an aufgeregten Anrainern das Maul über diese prickelnde Kombination von Liebestöter und getötetem Liebhaber zerreißen. Zweiteres entsprach zwar nicht der Wahrheit, aber selbst in einem Holzapfel konnte theoretisch durchaus ein Wurm drin stecken. Und genau das würden alle von ihr denken, boshaft, wie die lieben Mitmenschen halt so waren. Hätte der Mann nicht wenigstens seinen Hosenlatz zumachen können, bevor er starb? Nun stand sie da wie die sprichwörtliche Jungfrau mit Kind, allerdings ohne göttliche Fürsprache und väterliche Hilfe. Höllische Aussichten taten sich auf, bei denen es Hermine erneut die Brille beschlug.
Vor lauter imaginärer Schreckensvisionen sah die Hüterin der dörflichen Sittsamkeit ohnedies schon ebenso geknickt aus wie ihr verunstaltetes Grünzeug. Zeit ihres Lebens hatte kein Mannsbild es je gewagt, dem standhaften Fräulein ungefragt an die Wäsche zu gehen. Und nun, wo nur noch einer ganz leise danach fragte, war schlagartig die Schande über sie gekommen.
Als Vorsitzende des örtlichen Friedhofsblumenvereins und Obfrau der gemeindegrenzüberschreitenden katholischen Kernölkoalition lag Hermine sehr an ihrer sauberen Weste. Und die hatte dieser alte Depp nun aufs Schlüpfrigste beschmutzt.
So schnell würde sie sich von diesem Schandfleck nicht reinwaschen können, das war ihr mittlerweile klar geworden, weshalb sie gleich noch ein wenig tiefer in Selbstmitleid versank. Am liebsten hätte sie es ohnedies gesehen, wenn besagter Depp einfach ein Haus weiter in die biedere Botanik gebissen hätte. Bei der Doppler Bibiana etwa, die soeben lautstark und wild gestikulierend ihren Garten betrat.
»Na, da schau her! Wenn das nicht der Hummelbrunner Franz ist, dann fress ich doch glatt einen von deine verkrüppelte Krautköpf’.«
Bibiana, die zweifache Siegerin des regionalen Orchideenzuchtwettbewerbs, fühlte sich dem bodenständigen Gemüseproletariat topfhoch überlegen. Was sie durch entsprechendes Schuhwerk und aufrechte Haltung auch optisch unterstrich.
»Was hält er da eigentlich in der Hand? Ist das einer von deine Liebestöter?«
Die Orchideenmeisterin hatte ein scharfes Auge für verfängliche Details. Nur der athritische Arm des Gesetzes konnte eine zusätzliche Ausweitung der Kampfzone vermeiden.
Ferdinand Kapplhofer, der kurz nach Bibiana erschienen war, verrichtete seit über zwanzig Jahren seinen Dienst als Revierinspektor vom Damischtal. An den Anblick von stammtischgesättigten Schnapsleichen und wahlkampfbedingten Hirntoten war er ausreichend gewöhnt, aber einen Mord hatte er noch nie gesehen. Und dann ausgerechnet der Hummelbrunner Franz, der schon in jungen Jahren mehr Feindschaften gesät hatte als Hermine Selleriestauden.
Resigniert betrachtete er den mörderischen Wetterhahn, der ihm jede Hoffnung auf ein altjungfräuliches Hirngespinst geraubt hatte.
»Herr Inspektor, kommen S’ schnell, bei mir liegt ein Toter im Salat!«, hatte ihm die sonst so resolute Rentnerin vor zehn Minuten in sein wehrloses Ohr geflennt und dabei hörbar die Nase hochgezogen. Von »um’bracht habens ihn« und »kaputter Hahn« war ebenfalls die Red’ gewesen, aber vor lauter Geschluchze und Geseufze hatte er einfach nicht kapiert, was der alten Schachtel nun wirklich widerfahren war. Deshalb hatte er instinktiv an einen Wasserschaden durch altersschwache Armaturen gedacht – eine Vorstellung, die ihn doppelt deprimierte. Erstens war er kein Installateur, und zweitens konnte er wegen der halluzinierenden Hermi jetzt nicht mehr in die frischen Wuchteln beißen, die ihm seine Mutter gerade fürsorglich hatte servieren wollen. Wo doch jeder wusste, wie gut so ein ofenwarmer Germteig war.
Kapplhofer war frustriert. Sein Magen fühlte sich so leer an wie sein Kopf. Wie sollte er da auf einen gescheiten Gedanken kommen?
»An Herzverfettung oder Hirnversagen ist er jedenfalls nicht krepiert«, konstatierte er schließlich recht einfallslos und blickte erneut auf den Wetterhahn, als hätte dieser soeben gekräht.
Über dem Garten lag eindeutig ein menschliches Tiefdruckgebiet. Die Stimmung war aufgeladen, die mittlerweile eingetroffenen Schaulustigen warfen immer längere Schatten, bald würde es von allen Seiten Hypothesen hageln. Zudem trampelten die Leute nicht nur auf Hermines millimetergenau zurechtgestutzten Zierrasen herum, sondern auch auf den Nerven des Inspektors, der sich sehnlichst an seinen Frühstückstisch zurückwünschte.
Immer mehr Menschen zwängten sich durch Hermines offenes Gartentürl und stapften achtlos über deren akribisch angelegte Vorzuchtbeete, um sich einen Logenplatz mit freier Sicht auf die Unglücksstelle zu erkämpfen.
»Jetzt gehts doch bitte weg hier, das ist schließlich ein Tatort!«, brüllte er letztendlich in die Menge, doch abgesehen von einem altersschwachen Dackel, der kurz in seine Richtung sah, stieß sein Appell auf taube Ohren. Die Aufruhr war zu groß, seine Autorität zu klein.
Dabei war Kapplhofer eine durchaus stattliche Erscheinung, die bei Wirtshausraufereien einst durchschlagende Erfolge erzielt hatte. Sogar eine gewisse Bildung besaß er. Immerhin war er aufs Gymnasium gegangen und hatte drei Semester lang Jurisprudenz studiert, bevor es ihn mit vorzeitig erlahmten Energien zurück ins Damischtal gezogen hatte. Den geistigen Herausforderungen wäre er ja einigermaßen gewachsen gewesen, aber den körperlichen Anstrengungen eines großstädtischen Studentendaseins hatte er nicht standgehalten. Der strapaziöse Reigen von Waschen, Putzen, Bügeln, Kochen, Kampftrinken und geballter Geselligkeit war seinem fundierten Trägheitsmoment sehr schnell zuwider gewesen. Daheim ging es um einiges beschaulicher zu, fand er, so direkt am Busen von Mutter und Natur. Für seine naturnahen Gefühle hatten die Damischtaler auch vollstes Verständnis gezeigt, aber die Nähe zur Mutter, an deren Tischtuchzipfel er bis heute hing, die untergrub sein Ansehen mit jedem Tag mehr. Dagegen half selbst das uniformierteste Auftreten nichts. Vor allem dann nicht, wenn man von seinem Faustrecht so gar keinen Gebrauch mehr machte. Aber Kapplhofers Angst, sich durch einen schlecht gezielten Schlag um sein Fingerspitzengefühl zu bringen, hatte im Laufe der Jahrzehnte zu einer veritablen Berührungsphobie geführt. Für seine minimalistischen Modellbauaktivitäten war maximale Sensibilität bis unters Nagelbett erforderlich. Und die wollte er wegen eines dienstlich verabreichten Kinnhakens keinesfalls riskieren.
Wenig verwunderlich also, dass Kapplhofers halbherziger Ordnungsruf nicht mehr als einen müden Dackelblick zur Folge hatte. Die Zweibeiner ließen sich in ihrer angeregten Unterhaltung durch den Revierinspektor nicht im Geringsten stören und diskutierten angeregt weiter.
»Was hat so ein g’standenes Mannsbild überhaupt in deinem Garten verloren? Der ist ja bestimmt net herkommen, um zwischen die Salatstaudn zu liegn«, sprach der Böllinger Sepp nun endlich aus, was allen längst auf ihren spitzen Zungen lag. Seit er nicht mehr bei der Feuerwehr war, übte er sich erfolgreich im verbalen Zündeln.
»’pinkelt wird er halt haben, ist ja ein weiter Weg heim«, stellte der Umweltreferent lakonisch fest. »Außerdem kann er liegen, wo er will. Steht er mir wenigstens nicht mehr im Weg herum.«
Hubert Ehrenhöfler hatte sich jahrzehntelang in den dreckigen Angelegenheiten des jüngst verblichenen Hendlbarons gesuhlt. Dessen Aktenberge hatten ebenso zum Himmel gestunken wie die Jauchegrube des Ermordeten.
»Jetzt hat ihm doch glatt ein Hahn zum letzten Gericht ’kräht.«
Auch Gustl, der Wirt vom »Goldenen Kürbis«, weinte dem Toten keine Träne nach. Der Gestank und das Gegacker des nachbarschaftlichen Hühnerhofs hatten seinen gediegenen Ausflugsgasthof zu einer Einkehr für Berufsalkoholiker und Brunztouristen degradiert. Ganze Reisebusse machten oft bei ihm halt, um in geschlossener Formation aufs Klo zu stürmen, während der Fahrer gelangweilt ein Mineralwasser trank.
»G’schieht eam nur recht«, meinte er daher mitleidslos und blickte den Toten rachsüchtig an. Unter den Umstehenden erhob sich allgemein zustimmendes Gemurmel, denn fast jeder der Anwesenden wusste etwas Schlechtes über den Hummelbrunner zu sagen.
Nur Hermine schwieg. Statt wie gewohnt mit bösen Worten, warf sie allein mit giftigen Blicken um sich. Doch die blieben wirkungslos. Der Leichnam zeigte ihr die kalte Schulter, die Lästermäuler sahen über sie hinweg.
»Der hat ein echtes Morgengrauen erlebt«, meldete sich jetzt auch noch der Gfrettgstättener Doktor zu Wort, während er widerwillig zwischen den Salatpflanzen kauerte und die Leiche zaghaft befingerte. »Ist noch gar nicht richtig kalt. Länger als drei, vier Stunden liegt er vermutlich nicht da.«
Sein zerknittertes Aussehen ließ darauf schließen, dass auch der frisch vermählte Arzt ganz gern noch liegen würde, wenngleich nicht reglos und in der Öffentlichkeit.
Nach nicht einmal einer Minute war die Untersuchung bereits beendet. Vorsichtig stieg der Doktor aus dem malträtierten Anzuchtbeet, um den Schaden an seinem sommerlichen Schuhwerk so gering wie möglich zu halten. Dennoch hatte der Morgentau bereits sichtbare Spuren auf dem Leder hinterlassen. Wegen diesem verunstalteten Gockel musste er nun auch noch mit nassen Füßen herumlaufen. Der sicherste Weg, sich eine ordentliche Verkühlung einzufangen. Dr.Seidenbart war sehr um seine Gesundheit besorgt, weitaus mehr als um die seiner Patienten. Daher stapfte er nun sichtlich vergrämt Richtung Gartentor, das nach wie vor einladend offen stand.
»Den Totenschein stell ich morgen aus«, rief er dem Revierinspektor auf den letzten paar Metern zu, die ihn noch von seinem mitten auf dem Trottoir geparkten Wagen trennten, »die Todesursache steht ohnedies außer Zweifel.«
Und weg war er.
Dennoch nahm das Gedränge auf Hermines Grund und Boden spürbar zu. So einen Auflauf gab es sonst höchstens beim alkoholischen Saisonauftakt, dem Schilchersturm, doch der fand erst im Frühherbst auf der Festzeltwiese statt. Überall wurde heftig gestikuliert und wild getuschelt, die Gemüter waren erhitzt, auch wenn das Thermometer spärliche zehn Grad anzeigte. Es fehlte nur noch die Blasmusik, dann wäre das Volksfest perfekt gewesen.
Allein der unglücklichen Finderin der Leiche standen nach wie vor Tränen in den Augen. Zur Scham über ihr profaniertes Wäschestück gesellte sich nun auch noch die Wut über den Saustall, den die sensationsgierigen Dorfbewohner rund um den verblichenen Hendlbaron verursachten. Sie hatte genau gesehen, wie der kettenrauchende Böllerer einen Tschick nach dem anderen in der Regenwassertonne versenkt hatte, während die Doppler Bibiana gedankenverloren die Kapuzinerkresse kahl rupfte.
Als dann auch noch der räudige Köter von der Schober Gerli am Pfingstrosenstrauch die Pfote hob, verlor Hermine die Beherrschung.
»Raus hier! Alle miteinand! So schleichts euch doch endlich. Ihr … ihr … ihr stört’s ja die Leichenruh!«
Eigentlich hätte sie ja lieber »depperte Bagage« gesagt, aber dem stand ihr eingefleischtes Standesbewusstsein im Weg. Ihrer Ansicht nach durfte man derartige Kraftausdrücke nur Bauern, Berufskraftfahrern und betrunkenen Proleten nachsehen. Aber keinesfalls einer ehrbaren Frau. Stattdessen versuchte sie, ihren Worten mehr Nachdruck zu verleihen, indem sie mit einer glänzend gelben Rosenkugel nach den Leuten warf.
»Is ja gut, wir gehen schon.« Überraschenderweise war es ausgerechnet Bibiana, die als Erste reagierte und sich Richtung Straße begab. »Mit alten Jungfern ist nicht zu scherzen«, flüsterte sie dem mittlerweile arg transpirierenden Postenkommandanten noch leise zu, bevor sie erhobenen Hauptes von dannen schritt.
Dass das Durcheinander sich auf einmal merklich lichtete, war allerdings weder Bibianas Abgang noch den ersten Sonnenstrahlen zu verdanken, sondern der Ankunft des langjährigen Schuldirektors. Kilian Klöpfer verkörperte eine imposante Personalunion aus Berg und Prophet, verteilt auf gute hundertfünfzig Kilo Resonanzvolumen. Klöpfers korpulenter Auftritt verhinderte seit Jahren erfolgreich die von der Obrigkeit längst beschlossene Anhebung der Klassenschülerhöchstzahlen, denn allein seine Masse füllte bereits den halben Unterrichtsraum. Daher war es auch wenig ratsam, sich gegen diese wandelnde Walze aufzulehnen. Meist genügte seine bloße Anwesenheit, und jeder Protestmarsch mutierte zur Friedenskundgebung.
Auch jetzt kommandierte Klöpfer die dorfbekannten Meinungsmacher ohne große Worte zurück auf die Straße. Die Mitläufer kamen sowieso von selbst nach. »Gemma, gemma!«, war alles, was er sagte. Das allerdings in einer Lautstärke, bei der sogar den Krauthäupteln der Kopf brummte. Und weil keiner der Anwesenden einen akustischen Schlaganfall riskieren wollte, verließ die Menge unverzüglich den Garten.
Zurück blieben nur Hermine und der Gesetzeshüter. Der ließ sich die Chance nicht entgehen, endlich seines Amtes zu walten, und nahm die immer noch vor sich hin Zitternde sanft zur Seite.
»Hermine, jetzt ganz unter uns g’sagt, wo bist du denn heut’ in aller Herrgottsfrüh schon her’kommen? Es war ja nicht einmal halb sieben, als du die Leiche g’funden hast.«
Die Morgenzeitung, die sie vor Schreck über den grauslichen Fund hatte fallen lassen, lag wie ein stummer Beweis ihrer frühzeitigen Umtriebigkeit ungelesen im Gras.
Hermine wurde röter als das kommunistische Manifest, bevor sie Farbe bekannte. »Ich bin dem Herrn Pfarrer bis gegen sechs ein wenig zur Hand ’gangen.«
Wobei, das wollte Kapplhofer gar nicht genauer wissen. Was unter dem schützenden Mantel der Kirche geschah, ging ihn besser nichts an. Die Wege des Herren waren halt immer wieder unergründlich.
»Aber der Wetterhahn, und die … äh, sagen wir mal, deine …« Wie zum Teufel hieß eine Gattihosn auf Amtsdeutsch? »Also, deine Intimkleidung, wo war denn die? Ich mein, vor dem Delikt.«
»Na ja, der Wetterhahn is vorm Kohlrabibeet g’standn. Und meine …« Auch Hermine kam nicht gern auf die Großmutterstrapse zu sprechen. »Also, das mit der Wäsch’, das versteh ich selbst nicht. Die hab ich erst gestern am Nachmittag, wo ich allein war, aufg’hängt. Auf’m Balkon. Auf’m hinteren.«
Wo sie keiner sehen konnte, das verstand auch der Inspektor. Was er nicht verstand, war der weitere Verlauf der Dinge. Wie war die Miederhose zum Wetterhahn gekommen? Und was hatte der unselige Hummelbrunner überhaupt in Hermines Garten gewollt? Kapplhofer glaubte weder an fliegende Unterhosen noch an umstürzende Wetterhähne. Dennoch hatte der Täter mit diesem unaussprechlichen Ding den Hahn umwickelt, bevor er dem Opfer damit den Schädel eingeschlagen hatte. Vermutlich aus Vorsicht, um sich nicht an den scharfen Kanten des schmiedeeisernen Mordinstruments zu schneiden.
Die ganze Angelegenheit ging über Kapplhofers Verstand. Und weil sein Magen schon seit Stunden gesundheitsbedrohlich knurrte, fehlte ihm jegliche Energie, sich weiterhin den Kopf über diesen mysteriösen Vorfall zu zerbrechen. Sonst riskierte er noch einen Migräneanfall wegen Überhitzung des Denkapparats.
Ein Blick auf die Uhr gab ihm recht. Es war fünf vor zwölf, und damit höchste Zeit für eine deftige Kernöleierspeis mit viel Schnittlauch und einem guten Schluck Schilcher. Die Wuchteln waren mittlerweile eh schon zu kalt für seinen Geschmack.
»Am besten, du gehst jetzt mal ins Haus und legst dich hin. Die Kollegen aus der Stadt werden später bestimmt bei dir vorbeischaun«, trieb er die schreckensstarre Hermine zur Eile an, indem er entschlossen nach ihrem Arm griff und sie sicherheitshalber bis vor die Haustür zog, wo sie eine schier unendliche Zeit in den Tiefen ihres gehäkelten Einkaufsbeutels nach dem Schlüsselbund kramte. Seine Mutter besaß auch so ein Exemplar. Mit großen runden Holzgriffen, die stets einen roten Abdruck an den Unterarmen hinterließen. »Hey, is ja cool, Oida«, hatte Elvira, das verzogene Gör seiner Schwester, vor gar nicht langer Zeit begeistert ausgerufen, als sie dieses Relikt aus einer Zeit, in der die Frauen noch häkeln und stricken konnten, in seinem Fahrradkorb gesehen hatte. Die seien jetzt wieder ganz modern, hatte sie ihm dann besserwisserisch erklärt. Da sie im kosmopolitischen Graz wohnte, blickte sie auf die Damischtaler herab, als würden die Menschen hier noch im Lendenschurz gehen. Dabei konnte sie nicht einmal einen Knopf annähen.
Aber egal. Kapplhofer kam mittlerweile beinahe um vor Hunger. Um nicht zu sagen: Er hatte einen Mordsappetit.
Blunznfette Stammtischberichte
Als der Inspektor kurz nach zwölf den Kirchenwirt betrat, fand er halb Gfrettgstätten dicht gedrängt in der Gaststube vor. Nicht nur, weil am Samstag kein anderes Wirtshaus offen hatte, sondern vor allem, weil an diesem denkwürdigen Tag auch die Hausfrauen lieber in der Gerüchteküche statt im Bratentopf rührten. Und so musste man halt auswärts essen, denn das Mittagsmahl gehörte zum Landleben wie der Gamsbart zum Steirerhut. Da konnte sterben, wer wollte.
Die dezibellastige Leichenschmaus-Atmosphäre, die von den alten Wänden des Gewölbekellers widerhallte, war zwar gar nicht nach Kapplhofers Geschmack, der seine Eierspeis lieber in Totenstille verputzt hätte, aber bevor er kehrtmachen konnte, hatte ihn der Wirt schon erblickt und geleitete ihn mit großem Getue in Richtung Stammtisch.
Sogar die sonst so distanzierte Bibiana saß schon dort. Offenbar hatte sie ihre Berührungsängste mit der dörflichen Grobstofflichkeit zugunsten einer ungekürzten Liveberichterstattung vorübergehend überwunden. Allein das Proseccoglas, an dem ihre grell geschminkten Lippen klebten, zeugte von ihrem Standesdünkel.
»So, machts Platz für den Herrn Kommandanten«, frotzelte der Wirt unüberhörbar und schob den Ehrenhöfler mitsamt Schilcherspritzer und Breinwurst einen Meter weiter, weshalb dem Böllinger, der auf der alten Holzbank bereits rechts außen saß, sein heiß geliebtes Verhackertbrot zu Boden fiel.
»Kruzitirkn, alle miteinand! Habts ihr keine Augen im Schädl?«, polterte der empört los und fuchtelte dabei so wild mit den Armen, dass er beinahe das Hirschgeweih hinter sich von der Wand gerissen hätte. Das Verhackert, eine bodenständige Spezialität aus fettem Speck, galt bei den Damischtalern als kalorischer Verbundstoff Nummer eins. Und der wurde in Ehren beziehungsweise im Schmalztopf gehalten und nicht mit Füßen getreten.
»Reg di ab, kriegst a neues«, polterte der Wirt zurück und nahm dem Sepp zur Strafe das Weinglas weg, obwohl noch gute zwei Schluck drin waren.
Ohne Verhackertbrot und blauen Wildbacher kam sich der Böllinger auf einmal recht unterbeschäftigt vor. Zwar hatte die einst als Rabiatperle berüchtigte Schilchertraube dank moderner Kellertechnik sowohl ihren schlechten Ruf als auch ihr magenschädigendes Aggressionspotenzial eingebüßt, in ländlichen Gebieten jedoch führte ein sonntäglicher Schilcher-Entzug durchaus noch zu g’sunden Watschen und weniger g’sunden Handgreiflichkeiten. Außer, der Herr Inspektor saß mit bei Tisch. Da beließ es selbst der hitzige Böllinger bei einem verbalen Schlagabtausch.
»Das wirst mir büßen, du wamperterFetznschädl!«, fauchte er nun, um zumindest das letzte Wort zu behalten.
Doch wen sollte ein Mundraub kümmern, wenn es einen Mord zu diskutieren gab? In der gesamten Gaststube stand kein einziger Tisch, an dem nicht lautstark alle nur erdenklichen Mordszenarien durchgekaut wurden. Nur Kapplhofer nahm nicht am geschäftigen Getratsche teil. Eine frische Eierspeis durfte man wirklich nicht warten lassen. Schon gar nicht, wenn man bereits einen morgendlichen Wuchtel-Verlust erlitten hatte. Und mit vollem Munde sprach man sowieso nicht, zumindest nicht bei ihm zu Hause. Aber da hatte eh nur seine Mutter das Sagen. Daher war das einzige Geräusch, das man von polizeilicher Seite vernahm, das leise Schaben der Brotrinde auf dem Boden der gusseisernen Pfanne.
»A bissl mehr Schnittlauch hätt er schon raufgeben können, der alte Knauser.« Dem Kürbiswirt, der sein Blunzngröstl bereits verdrückt hatte, konnte es die Konkurrenz natürlich nie recht machen. Er fand in jeder fremden Suppe ein Haar.
»Apropos Grünzeug. Ob man der Hermi ihre Salatstauden jetzt noch essen kann?« Bibiana schien allen Ernstes darüber nachzudenken.
»Dort, wo der Hummelbrunner in den Salat ’bissen hat, da ist jetzt garantiert kontaminierter Boden«, befand der Umweltreferent, während er sich freizügig aus Kapplhofers Brotkorb bediente.
»Kontaminierter Boden. Wie der schon wieder g’scheit daherred«, brummte der Kirchenwirt und schob den mittlerweile geleerten Brotkorb zurück zum Inspektor.
»Was anderes kann er halt nicht, unser grüner Gemeinderat«, ätzte der Böllinger Sepp.
Als leidenschaftlicher Jäger und lahmarschiger Landwirt sah er politisch ausnahmslos schwarz. Dieses ganze neumodische Naturschutz-Blabla kam ihm vor wie ein Abszess am Allerwertesten der Parteilandschaft. Schmerzhaft und völlig fehl am Platz.
Nicht viel anders fühlte sich der Herr Inspektor. Er wusste, dass er sich nicht ewig hinter der Eierspeispfanne verschanzen und schweigen konnte, so gern er das auch getan hätte. Irgendwann musste er diesen leidigen Mord einfach zur Sprache bringen, Fakten sammeln, ein Protokoll verfassen, seinen Vorgesetzten Rede und Antwort stehen, kurz gesagt »Ermittlungsarbeit« leisten. Wovon er praktisch ebenso wenig Ahnung hatte wie der Böllinger von der Weltklimakonferenz.
Zögernd griff er nach einem Rechnungsblock, der wie in allen Landgasthäusern zwischen den schmierigen Schnapskarten steckte. Unter einer dümmlichen Brauerei-Reklame, die mehr als ein Drittel der Seite einnahm, hatte jemand 47, 16 und 31 addiert. 103 als Ergebnis kam Kapplhofer zwar etwas hoch gegriffen vor, aber er sollte ja keinem Falschspieler, sondern einem Mörder auf die Spur kommen.
»Eine wirklich schlimme Sache, das mit dem Hummelbrunner«, ergriff er endlich das Wort, während er die falsche Summe durchstrich und 96 darunterschrieb. Mit Ausrufezeichen. Er hielt viel auf Recht und Ordnung, vor allem bei Tisch. »Nicht, dass ich sein Ableben als großen Verlust für die Gemeinde betrachte, aber es war halt kein Verkehrsunfall, den man so einfach zu den Akten legen kann.«
»Na, ein Verkehrsunfall kann’s aber durchaus gewesen sein«, bemerkte der Kürbiswirt mit süffisantem Grinsen und fasste sich in den Schritt.
»Jetzt sei doch nicht immer so ottonär, Gustl!«, fiel ihm Bibiana lautstark ins Wort. »Hast doch g’sehen, wohin solche Schweinereien am Ende führen.«
»Habt’s sonst vielleicht auch noch was g’sehen?«, fragte Kapplhofer voller Hoffnung auf irgendeine verwertbare Antwort.
»Was hättn mir denn sehen sollen?« Der Böllinger war zwar schnell beim Reden, aber etwas langsam beim Denken.
»Na, irgendwas Verdächtiges, nehm ich an. Eine finstere G’stalt, die so ausschaut wie du.« Bartl, der blade Fleischhauer, gab nur selten ganze Sätze von sich, sofern es nicht um seinen beruflichen Schweinkram ging. Meist beschränkte er sich auf Grunzlaute, weil er gerade beim Essen war oder den Mund voller Wurstdarm hatte.
»Im Finstern kann man a finstere G’stalt ja gar nicht sehen«, gab Bibiana mit unerwarteter Geistesschärfe zu bedenken.
»Den Franz hättn mir auch nicht sehen müssen, den hättn mir g’hört, so b’soffen wie der gestern war.« Der Mostburger Bartl hatte offenbar seinen redseligen Tag.
»A so a Schas! Du warst ja selber so blunzenfett, dass du zum Herrn Pfarrer ›gnädiges Fräulein‹ g’sagt hast.«
Weil das der Wahrheit entsprach, beschloss Bartl, bis auf Weiteres wieder zu schweigen.
»Was war denn gestern eigentlich los?« Kapplhofer war mittlerweile etwas genervt. Irgendwas musste er schließlich zu Papier bringen, das sich annähernd wie ein Verhör las.
»Gestern war doch die Auszahlung vom Sparverein«, erklärte der Böllinger und wunderte sich einmal mehr über die Ahnungslosigkeit des Inspektors, was die fundamentalen Pflichten der Gemeindemitglieder betraf.
»Und ihr seid’s alle dabei g’wesen?«
»Ja, freilich. Bis weit nach Sperrstund samma alle z’samm im ›B’soffenen Blutzer‹ g’sessen. Also ich, der Franz, der Hubert, der Gustl, die Gerti, die Bibiana – und dann noch die Hermi, die Resi, der alte Poldl, Hochwürden und …« Da der Böllinger nur zehn Finger hatte, kam er bei seiner Aufzählung nun ins Stocken.
»… und der Pfnatschbacher Willibald.«
Dass ausgerechnet der Plutzenberger Sparkassendirektor zum Sparverein ging, fand der Inspektor etwas seltsam. Er konnte ja nicht ahnen, dass es dem professionellen Pfennigfuchser dabei allein um gewerbsmäßige Spionage und den Verkauf von Bauspar-Policen ging. Daher versah er den Namen Pfnatschbacher auf seinem Block mit einem großen Fragezeichen. »Und wann genau ist ›weit nach Sperrstund’‹?« Die Frage nach dem exakten zeitlichen Verlauf des Abends schien ihm als einzige wirklich relevant.
»Na, so zwei, drei in der Früh wird’s schon g’wesen sein«, meinte der Böllinger Sepp mit gerunzelter Stirn.
»Geh, red doch kan Topfn z’samm«, mischte sich der Kürbiswirt ein. »Des kannst ja gar nicht sagen, weil du ja als Erster abg’rissn bist. Hast wohl Angst g’habt, dass’t gach noch a Runde zahln musst.«
»Ich hab mi net vor die Bier g’fürcht, ich hab mi in Sicherheit ’bracht, weil der Franz und der Hubert sich fast die Schädl eing’schlogn habn.«
»Stimmt jo gar net.« Jetzt geriet auch der Ehrenhöfler in Erklärungsnotstand. »Ich hab überhaupt nix g’macht. A bissl g’strittn habn mir halt, der Franz und i.«
»Streitn nennst des? Du hast g’sagt, wenn der Franz no a moi seine Hendln mit dem chemischen Zeugs vollstopft, dann reißt eam die Eier aus.«
»Na. Des hat der Hubert nicht g’sagt.« Bibiana schlug sich standesgemäß auf Ehrenhöflers Seite. »Er hat nur g’sagt, dass der Franz dann ein Problem kriegt.«
»Und das hat er ja auch ’kriegt, oder?«, legte der Böllinger noch ein Schauferl nach.
»Schau, dass du kein Problem kriegst wegen übler Nachrede«, griff nun der Kürbiswirt wieder ein.
»Wer red denn schlecht? Hab i vielleicht was g’sagt, wia du gestern der Resi nachg’stiegn bist?«
»Also, jetzt haltst aber des Maul! Ich bin nirgends wohin g’stiegn, ich hab die Resi mitg’nommen, weil mir denselben Weg g’habt haben. Das is ja wohl net verboten, oder?« Dem Kürbiswirt schwoll die Zunge gefährlich an. Er mochte diese Unterstellungen nicht, vor allem dann nicht, wenn sie auf wahren Begebenheiten beruhten. Aber Angriff war ja bekanntlich die beste Verteidigung. »Also, damit das ein für alle Mal klar ist. Ich hab der Frau Oberkofler gestern das Kernöl ’bracht und wie versprochn das Siphon repariert. Und weils dann eh schon recht spät war, sind mir gleich z’samm zum Sparverein.«
»Zustelldienst, Abholservice, Haustechnik – alle Achtung«, bemerkte Bibiana und blickte herablassend in die Runde. »Ich muss mein Öl immer selbst holen. Und die kaputte Waschmaschin hat auch niemand g’schert.«
»Traut sich ja keiner heim zu dir«, grinste der Sepp.
»Zwafoche Witwe wird ma sicher net umsonst.«
»Was fallt dir eigentlich ein?« Bibianas Gesicht hatte eine tiefrote Farbe angenommen, die wenig Gutes verhieß und außerdem schlecht zu ihrer lila Bluse passte.
Über kurz oder lang wird hier eine weitere Leiche in der Landschaft liegen, dachte Kapplhofer betrübt und verging sich missmutig an einer verschrumpelten Käferbohne. Vor lauter Gezänk dröhnte ihm inzwischen der Kopf, während der Rauch die Augen tränen ließ. Er beschloss, seiner Pflicht zur Genüge nachgekommen zu sein und etwas frische und vor allem friedliche Luft zu schnappen. Im Grunde hatte er ohnedies genug gehört und ganze vier Seiten auf dem Rechnungsblock mitgeschrieben.
Fazit: Niemand hatte ein Alibi, jeder eine Gelegenheit, der Gustl und der Hubert sogar triftige Gründe. Doch Zutritt zu Hermines frisch gewaschenem Großraumslip, den hatte vermutlich nur der Herr Pfarrer gehabt, aber der verlor schon das Gleichgewicht, wenn er bei der Messe den Weihwasserkessel schwang. Für einen gusseisernen Wetterhahn, der gut und gern an die zehn Kilo wog, fehlte ihm hundertprozentig die Standfestigkeit. Und für einiges andere wahrscheinlich auch. Aber das war schlimmstenfalls Hermines Problem.
Saumäßige Zustände
Ganz im Zeichen der sonntäglichen Geruhsamkeit quälte sich der doppelstöckige Reisebus die schmale, kurvige Straße Richtung Plutzenberg hinauf, während die genervt seufzenden Einheimischen hinter ihm herzockelten. Die Damischtaler hielten nur wenig von Entschleunigung, denn für so was fehlte ihnen besonders am Wochenende die Zeit. Vieh, Felder und Weinberge mussten versorgt, Kirche, Buschenschank und Schwiegermutter besucht werden, und stets wurde man dabei von irgendwelchen Touristen ausgebremst. Wobei es keinen Unterschied machte, ob die Sonntagsinvasion aus der Landeshauptstadt, dem Salzkammergut oder gar aus Amerika kam. Die halbe Welt schien zu glauben, dass hier, am Rande der historischen Untersteiermark – nomen ist halt nicht immer omen – alles in einer Tiefebene lag, während allein die Hochsteiermark schwindelerregende Aussichten bot. Dabei reichten ihre Weinberge bis auf über sechshundert Meter. Und wenn die Ausflügler ihren Fehler dann eingesehen hatten, war es für eine Umkehr meist schon zu spät. Aus zeitlichen, aber auch verkehrstechnischen Gründen.
»Himmel Arsch noch amoi!«, fluchte der Mostburger Bartl daher los, als ihm einer dieser fahrbahnfüllenden Doppeldeckerbusse kurz vor dem Wadlpass den Weg versperrte. Gerade noch ein halber Meter lag zwischen Bartls altem Steyr-Traktor und dem Luxusliner der »K. & K.-Tours«. Auf der linken Seite fielen steile Weinterrassen in beängstigende Tiefen ab, rechter Hand versperrten ein paar riesige Pappeln die Sicht. Aber die Touristen hatten ohnedies nur Augen für den Bartl und seine borstige Fracht. Ganz aufgeregt drückten sie ihre Nasen an den getönten Scheiben platt und sahen dabei aus wie die Schweine eines Schlachttiertransports. Die vier rosaroten Sauen, die beim Fleischer auf dem Hänger standen und tatsächlich auf dem Weg ins Würstlnirwana waren, wirkten um einiges ruhiger.
Nur Bartl war ziemlich nervös. Vorwärts ging nichts, denn der »Kultur&Kulinarik«-Schlepper blockierte beide Fahrspuren, und rückwärts war lebensgefährlich, immerhin hatten die vier Schinkenlieferanten ein Lebendgewicht von fast einer halben Tonne. Blieb er allzu lange stehen, riskierte er aufgrund seiner betrügerischen Fracht gleichfalls Kopf und Kragen oder zumindest einen unerfreulichen Gefängnisaufenthalt. »So a Schas. Schleicht’s eich, ihr Wabbler, weg do, weg do!« Während er vor sich hin maulte, fuchtelte der Bartl mit den Armen herum, als würde er von einer Schar Flugsaurier bedroht.
Die Businsassen winkten begeistert zurück. Diese Mischung aus Urtümlichkeit und Ausdruckstanz war genau nach ihrem Geschmack. Und weitaus spannender als alle Vorträge ihrer bemühten Reiseleiterin.
Dem Fleischer hingegen brach zunehmend der Angstschweiß aus. Seit 1989 der Eiserne Vorhang gefallen war und die Grenzposten nach und nach abgezogen wurden, hatte Bartl einen Teil seines Rohmaterials aus Slowenien importiert und rassemäßig aufpoliert, indem er die Tiere mit falschen Papieren versah. Auf diese Art und Weise mutierten billige Mastschweine ohne großen züchterischen Aufwand zu kostbaren Mangalitzas. Die damit verbundene fleischliche Metamorphose fiel nach fachgerechter Häutung und Zerlegung aber nur noch echten Kennern ins Auge, und die drückten gegen bare Münze und ein paar Selchstelzen gern eins zu. Daher durfte er seit einigen Jahren für seine weithin bekannten und biologisch zertifizierten Klapotetzkeulen von glücklichen Freilaufferkeln sogar ein stattliches Sümmchen an Fördergeldern kassieren. Die sattsam geschmierten Kontrollinstanzen ließen ihn mitsamt seinen falschen Mangalitzaschinken schon lange in Ruhe. Und die Polizei war sowieso ungefährlich, solange Kapplhofer nur brav Dienst nach Vorschrift machte. Dieser behördliche Verlustposten würde selbst ein Flusspferd für ein Edelschwein halten, sofern man ihm ein rosa Ringelschwänzchen umband.
Aber die Touristen, die waren gefährlich. Ständig drückten sie auf ihren Kameras und Fotohandys herum. Nicht auszudenken, wenn irgendwann ein Bild vom ihm und seiner betrügerischen Fracht in die falschen Hände geriet. Jeder durchschnittliche Bauernschädel konnte eine nackerte Yorkshiresau von einem Wollschwein unterscheiden. Ganz zu schweigen von den Tierschützern. Die fand Bartl noch viel beängstigender als den gaffenden Haufen im Bus. Diese militanten Idioten schreckten ja offenbar vor nichts mehr zurück. Zigmal hatten sie sich mit dem Hummelbrunner Franz wegen seiner Hendln angelegt, aber der hatte von »artgerecht« so wenig wissen wollen wie eine Kuh von der Straßenverkehrsordnung.
Und jetzt war er tot. Auge um Auge, Hahn um Hahn! Bartl, der Schweinefleisch-Alchimist, hatte keinen Zweifel, dass dem Hummelbrunner sein harter Schädel von einem fanatischen Tierrechtler zertrümmert worden war. Der Schlag mit dem Gockel konnte symbolischer nicht sein. Unglücklicherweise stammten auch Bartls eigene Fadln aus einer grausamen Massentierhaltung. Folglich würden die Rächer ihn abstechen, mit Brühharz übergießen und ihm das Fell über die Ohren ziehen, sollten sie jemals erfahren, woher er den Großteil seiner Borstenviecher bezog. Und je länger er hier stand, desto gefährlicher wurde die Lage.
Zumindest brachte der Buschauffeur jetzt Bewegung in die seltsame Szenerie, indem er die Türen öffnete. Umgehend ergoss sich ein Strom aus Schaulustigen über Bartl und sein Vieh.
»Boooahhh, sind die fett! Jetzt guck doch mal, Mami.« Knips.
»Mensch, Egon, da könnte man die ganze Sippschaft von nähren!« Knips.
»Sagn Se mal, guter Mann, wie viele Buletten kommen da raus?« Knips.
»Papi, was is dat denn?« Knips.
»Hände weg, Kevin-Karl, die beißen bestimmt.« Knips.
»Leute, Zeit für Barbecue! Und eine feine Schorle dazu.« Knips.
»Igitt, wie die stinken! Mann oh Mann.« Knips.
Das Kommentieren und Fokussieren nahm kein Ende, nur Bartls Beherrschung.
Nun trat auch noch die Reiseleiterin, adrett im Pseudodirndl, mit Gretlfrisur und Haferlschuhen, an die Gruppe heran und begann ihr touristisches Belehrungswerk. »Die Damischtaler Panoramaweinstraße biegt nach dem Wadlpass südwärts und führt in steilen Kehren durch die Weingärten, welche die zum Fluss geneigten Hügelflanken einnehmen. Von hier blicken wir landeinwärts über weitläufige Kürbisfelder der Gattung ›Cucurbita pepo var. Styriaca‹, deren dunkles Kernöl nicht nur unter Feinschmeckern beliebt ist, sondern auch als Hausmittel zur Vorbeugung von Prostataleiden sowie als potenzsteigerndes Präparat wertvolle Dienste leistet.«
»Mami, was ist ein Popschtataleiden?«
»Nichts für kleine Mädchen, Michelle.«
»Pssst, Ruhe!«
Nachdem die Horde brav dem Fingerzeig ihrer Führerin landeinwärts gefolgt war, wartete sie nun auf weitere Weisungen.
»Die sumpfige Ebene zwischen Plutzenberger Platte und Klachlkapelle hingegen ist berühmt für ihre saftigen Mangalitzaschweine«, wusste die Reiseleiterin weiter zu erzählen.
Wie auf Kommando schauten nun alle Bartls rosige Borstenviecher an, die erstaunlicherweise wie ganz normale Hausschweine aussahen. Zumindest im Großen und Ganzen. Nur wer genauer hinsah, hätte die angebissenen Ohren und den Stummelschwanzstumpf bemerkt, ein untrügliches Zeichen für saumäßig schlechte Haltungsbedingungen.
»Das sind doch Mangalitzas, oder?« Mit besten Absichten trat die Flachlandheidi auf den erregten Fleischer zu.
»Draht di, du Sumpfwachtel, sonst reiß i dir den Oasch auf, dass dir des Bluat bei di Lauscher aussi spritzt!«
Entsetzt sprang das Sprachrohr des Fremdenverkehrsverbands ein paar Schritte nach hinten. Sie hatte zwar nicht alles verstanden, aber Bartls Tonfall war aussagekräftig genug. Und das rostige Schlachtbeil, das auf seinen riesigen Schenkeln lag, sah auch nicht nach Friedenspfeife aus.
Nachdem sie die Völkerverständigung auf eindeutig lebensbedrohliches Terrain geführt hatte, flohen die Umherstehenden eilig Richtung Bus, dem mittlerweile ein waghalsiges Umkehrmanöver gelungen war. Die Straße war wieder frei.
Bartl ließ grunzend den Motor an und tuckerte mit der vollen Kraft seines dreißigjährigen Steyrs los. Hundertdrei fassungslose Gesichter starrten ihm mit platt gedrückten Nasen und gezückten Kameras hinterher.
Wenn das nur kein böses Nachspiel hat, dachte Bartl besorgt. Sein linker Gichtzeh hatte schon zu zwicken und zu zwacken begonnen, was stets ein schlechtes Zeichen war.
Blindgängerische Leidenschaften
»Kommt ein Vogel geflogen, lässt sich nieder auf mein Fuß, hat ein …«
Bibiana zwitscherte in hellsten Tönen, während sie ihr unbekleidetes Bein über die Holzbrüstung streckte. Sie fand sich unwiderstehlich. Und Hubert fand das beruhigenderweise auch.
»Ich werd dir den Vogel gleich zeigen«, stöhnte er zum Beweis und verging sich erregt an den schier tausend Knöpfen ihrer dünnen Bluse, während sich die sonst so steife Bibiana äußerst gelenkig an seiner Gürtelschnalle zu schaffen machte.
Aufgrund langjähriger Praxis gelangte sie auch weitaus schneller an ihr erstes Etappenziel als er. Aber nun stand ihr noch Huberts meist recht unbefriedigender Endspurt bevor. Und danach erst das lange Warten auf das Ergebnis.
Denn Bibiana war nicht verliebt in den Umweltschutzreferenten, der bei ihr, ganz entgegen seiner beruflichen Gewohnheit, keinerlei Schutzmaßnahmen ergreifen durfte – sie war sozusagen hormongesteuert. Oder betriebswirtschaftlich gesprochen: effizienzoptimierend. Sie wollte ein Kind, keinen Mann.
Zwei kurze Ehen hatten ihr gereicht. Ihr erster Gatte war ausnehmend attraktiv gewesen. Als Chauffeur der staatlichen Fremdenverkehrsbehörde hatte er leider zu grenzüberschreitend verkehrt. Seine Leiche war genau an ihrem dritten Hochzeitstag aus einer Felskluft des dinarischen Gebirges geborgen worden. Was er dort verloren gehabt hatte, wurde niemals geklärt.
Ihren zweiten offiziellen Versuch Richtung Mutterschaft startete sie mit einem biederen, weitaus weniger attraktiven Lokführer. Doch ihre Ansichten der geschlechtlichen Verkehrsführung klafften zu weit auseinander. Sie strebte nach zielführendem Nahverkehr, er zog großräumige Umfahrungen vor. Aber bevor sie die heimischen Weichen der beidseitigen Annäherung umstellen konnte, verstarb auch er. Netterweise während der Dienstzeit, was ihr bis heute eine ordentliche Witwenpension einbrachte. Seitdem hatte sie zwar genügend Männer verführt, nur hatten ihre horizontalen Bestrebungen im wahrsten Sinn des Wortes nie gefruchtet.
Nun hatte sie also Hubert für einen Vorstoß Richtung Schwangerschaft gewählt. Er sah gut aus, war einigermaßen intelligent und stand spürbar seinen Mann.
»Spürst du den Specht, wie er pocht?«, raunte er und rammelte dann los, dass Bibiana Hören und Sehen verging.
Das Pochen spürte sie wohl, aber ihrer Ansicht nach stammte es von einem Ast, der sich schmerzhaft in ihren halbnackten Rücken bohrte. In gewisser Hinsicht entsprach ihr gestammeltes »Ahhhhh!« also durchaus wahren Gegebenheiten. Ihre Lage war nicht sonderlich bequem, aber im tratschsüchtig verleumderischen Damischtal musste man schon gut aufpassen, wo Liebe und Lust hinfielen, wollte man nicht zum Gespött der Leute werden. Also war Tarnen und Täuschen erste Bürgerpflicht.
Hubert und Bibiana betrachteten ihre Liebschaft jedenfalls als reine Privatangelegenheit. Daher hatten sie aus Gründen des guten Rufs und der noch besseren Rundumsicht einen der zahlreichen Ansitze auf der weitläufigen Plutzenberger Platte für ihren erotischen Zusammenstoß gewählt. Zu vogelkundlichen Zwecken bestieg der Umweltschutzreferent sowieso recht oft so einen Hochstand, am liebsten jedoch den vom Böllinger Sepp, denn der schlief um diese Uhrzeit noch seinen samstäglichen Rausch aus.
* * *
»So, wenn Sie jetzt alle mal zu mir herkommen, ja, gut, noch etwas näher. Hier sehen Sie ein wunderschönes, sehr seltenes Exemplar eines ausgewachsenen Reisseronia gertrudae. Dieser sogenannte Sackträger-Schmetterling steht streng unter Naturschutz, also bitte nicht berühren, nur schauen!«
Die Reiseführerin kniete so dekorativ in einer bunten Blumenwiese, dass die Männer der Gruppe ein Sehproblem bekamen, weil sie bis zu diesem Moment lieber dem Dirndl in den Ausschnitt als der Dotterblume auf die Blüte geschaut hatten.
»Was für ein reizender Anblick.« Ein pensionierter Oberlehrer wagte sogar einen diesbezüglichen Kommentar, denn seine Frau trug ein schlecht eingestelltes Hörgerät.
Die weiblichen Sonntagsausflügler hingegen schlugen sittsam die Augen nieder und fragten sich insgeheim, worin der Reiz dieses fadenscheinigen, blassbeige gefärbten Falters liegen sollte.
Den kommunikativen Zusammenstoß mit dem rabiaten Fleischer hatten sie offenbar alle gut verdrängt. Jetzt strahlten sie wieder wie frisch lackierte Gartenzwerge.
»Holger, guck mal, dort hinten! Dieses plumpe, klobige braune Ding, das aussieht wie ein prähistorisches Windrad. Was das wohl sein soll?«
Sofort stand das wandelnde Tourismuslexikon mit der Gretlfrisur neben der weitsichtigen Frau. »Das dort hinten, schauen Sie bitte mal alle rüber, dahin, gleich neben den Kirchturm, das ist ein Klapotetz. Diese riesigen Vogelscheuchen haben hier, im Gegensatz zu Slowenien, meist acht Flügel, wobei das Schlagbrett aus Kirschholz ist, die Flügel meist aus Fichte, der Block eher Kastanie und die Klöppeln bevorzugt aus Buche. Sie klappern sehr laut, daher übrigens der lautmalerische Name. Sie werden aufgestellt, um die Vögel aus den Weinbergen zu vertreiben, und gelten als das eigentliche Wahrzeichen dieser Gegend«, dozierte die Führerin.
Genau genommen durften diese Dinger ja erst ab Jakobi aufgestellt werden, aber viele Exemplare standen das ganze Jahr über herum. Vielleicht aus Gründen der Landschaftsdekoration, vielleicht aber auch nur wegen der umständlichen Auf- und Abbauarbeiten, die Jahr für Jahr damit verbunden waren. So ein ordentlicher Klapotetz konnte immerhin einige Tonnen wiegen und stand oftmals sogar auf einem Sockel aus Beton, weshalb es während der Winterzeit einfacher war, ihn auf mechanischem Weg zum Schweigen zu bringen. Deshalb drang den Ausflüglern auch jetzt kein noch so idyllisches Klappern an die erwartungsfroh lauschenden Ohren. Stattdessen war ständig ein rhythmisches Poltern und Rumpeln zu hören, auf das sich selbst die umfassend instruierte Reiseleitung keinen Reim zu machen wusste.
Aber es war ohnedies an der Zeit für den nächsten Programmpunkt. Die Aushilfsgretl scharte ihren Anhang um sich. »So, meine Damen und Herren, jetzt werden wir langsam Richtung Wald weiterziehen, wo der Plutzenberger Vogelstimmenweg beginnt. Dieser fünf Kilometer lange Pfad führt uns an den Brutstätten von bis zu zwanzig unterschiedlichen Singvögeln vorüber.«
Erwartungsvoll stellte die Horde ihre Ohren auf und trabte los. Ein wichtigtuerischer Hobbyornithologe, dessen Storchenbeine in Lederhosen und Tennissocken steckten, wies bereits nach wenigen Metern auf den melodischen Gesang einer Amsel hin. »Ein wahrer Sangeskünstler und echter Experte der Improvisation«, konstatierte er voller Inbrunst. »Dieses Lied erinnert mich irgendwie an die Arie im zweiten Aufzug der Zauberflöte, als die Königin der Nacht erscheint. Dieser grandiose Koloratursopran, der über zwei Oktaven geht, dieser unvergleichliche Auftakt zum Mord an Sarastro –«
Weiter kam er mit seinen musikalisch beflügelnden Worten allerdings nicht, denn am Waldesrand trat laut Anordnung der Reiseleitung die allgemeine Schweigepflicht in Kraft.
Um nur ja keinen Piepmatz zu verschrecken, tasteten sich die Vogelfreunde vorschriftsmäßig auf Zehenspitzen voran, was im dichten Gestrüpp aus Brombeerstauden und Haselbüschen gar nicht so einfach war. Schon bald gerieten sie auf Kriegsfuß mit dem eigenen Gleichgewicht. Äste knirschten, Knöchel knacksten, doch die Vogelstimmenfans bissen tapfer die Zähne zusammen und tapsten angestrengt voran.
»Pssst, Ruhe, ein Zilp-Zalp«, flüsterte jemand ehrfurchtsvoll.
»Ohhhhh!«
Sofort durchzog andächtiges Schweigen den Wald, die Gruppe hielt kollektiv den Atem an.
»Ahhhh!« Bibianas anrüchiges Gestöhne klang eher nach Brunftgeschrei. Wenig melodiös, dafür aber sehr dezibellastig. »… ja, ja, jaaaa …!«
Der Zilp-Zalp hielt abrupt den Schnabel, die Touristen rissen Augen und Ohren auf.
Doch alles, was sie hörten, waren die Geräusche des Waldes.
Ein rhythmisches Knarzen.
Ein frivoles Jauchzen. Und dann …
Ein Schuss!
Ganz in der Nähe.
Die Reiseleiterin, die eben noch in den Anblick eines rundblättrigen Knabenkrauts vertieft gewesen war, stürzte lautlos zu Boden.
Kurz darauf knallte es erneut.
Nun schlug auch der Umweltschutzreferent auf der Erde auf, direkt vor den Füßen der entsetzten Vogelfreunde. Ihm stand die Hose weit offen, den Zuschauern der Mund.
Über allen Gipfeln war jetzt Ruh’.
Dafür brach im Unterholz panisches Geschrei aus.
»Die Polizei, man muss die Polizei rufen!«
»In Deckung, schnell! Das war bestimmt ein Heckenschütze.«
»Vater unser, der du bist im Himmel …«
»Ein Arzt, ist denn kein Arzt unter uns?«
»Papi, wird dem Piephahn von dem Mann da nicht kalt?«
»Mensch, Joachim, so tu doch was!«
Hände wurden gerungen, Köpfe geschüttelt, Handys gezückt und Tränen vergossen, aber kein hilfreicher Plan fand sich. Alle redeten geschockt durcheinander, der vom Himmel Gefallene ächzte, die Reiseführerin stöhnte, und Joachim tat immer noch nichts. Irgendwo bellte aufgeregt ein Hund, aber der gesunde Hausverstand schwieg.
Nur ein kleiner Junge hatte sich von der Gruppe entfernt und kletterte vorsichtig die Leiter zum Ansitz hoch. Doch er kam nicht weit. Kaum hatte er die dritte Stufe auf dem Weg zur Erleuchtung der Umstände erreicht, brüllten seine Eltern im Duett los. »Kevin-Karl, herunter mit dir, und zwar auf der Stelle!«
»Aber der Mann kam von dort oben geflogen«, maulte der Junge, »da muss doch wer gucken, was da passiert ist.« Trotzig starrte er in die Höhe.
Seine Eltern befanden jedoch, dass in den Tiefen des Damischtals bereits genug passiert war, und zogen ihn vierhändig zur Gruppe zurück. Die stand immer noch tatenlos und schreckensstarr herum.
Von wegen sanfter südsteirischer Tourismus! Diese Gegend machte jedem Katastrophengebiet Konkurrenz. Zumindest die deutschen Touristen waren ausnahmslos dieser Meinung. Statt auf Schmankerl- und Wohlfühlwegen zu wandern, wurden sie tief in die Abgründe menschlicher Fehl(t)ritte gestürzt. Statt gelebter Gastfreundschaft schlug ihnen beinahe ein Kugelhagel aus Hass entgegen. Kein Blick fiel mehr auf die idyllische Landschaft, denn vor dem inneren Auge der Gruppe zogen schaurige Bilder vorüber.