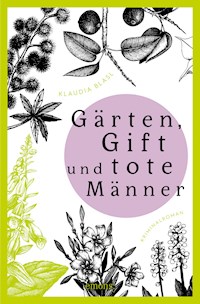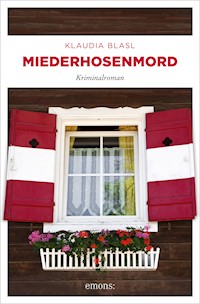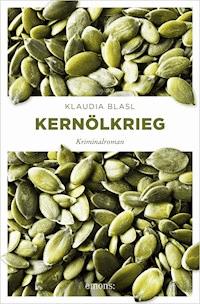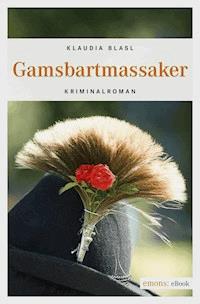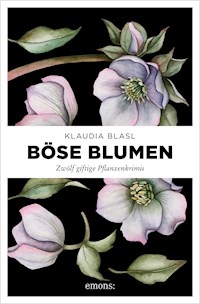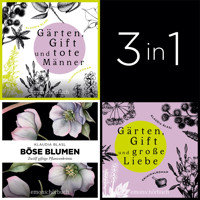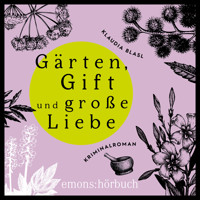Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Herrlich humorvoll und rabenschwarz neue botanische Kurzkrimis für Gartenfreunde,GiftmischerInnen und Beziehungsgeschädigte. Der Tod lauert immer und überall – vor allem in Gemüsebeeten, Gewürzregalen, Tiefkühlfächern und Blumenvasen. Mit Eisenhut und Sauerklee, Lerchensporn oder Muskatnuss wird selbst Gesundheitskost zum letzten Abendmahl. Und wenn hinterhältige Menschen mit bösen Absichten, fiesen Kräutern und botanischem Fingerspitzengefühl ausgestattet sind, tragen die Gärten Trauer!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaudia Blasl kocht gerne und gut, noch lieber befeuert sie allerdings ihre kriminelle Giftküche. Das Ergebnis dieser Leidenschaft sind spannende Kriminalromane mit schwarzem Humor, bösen Blumen und fiesen Gewächsen. Die Österreicherin lebt in der Steiermark und dem Südburgenland, wo sie auch einen Giftpflanzengarten hat.
Dieses Buch enthält fiktive Geschichten. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Die Pflanzenporträts sind dem Buch »111 tödliche Pflanzen, die man kennen muss« (Klaudia Blasl, emons 2018) entnommen.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: shutterstock.com/Inna Sinano
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Susanne Bartel
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-703-3
Fünfzehn giftige Pflanzenkrimis
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
Für Stephanie, Aldo, Mary und Claudia,
Erzähle mir, wie sie gestorben;
zweifach mehr wirst du mich erfreuen,
wenn grässlich sie zugrunde gingen.
Medea in »Medea« von Euripides
Die Geschichte der Gifte reicht weit hinter
das historische Zeitalter zurück.
Bei den Urstämmen wird der Jäger schon zeitig
die Giftstoffe in Fauna und Flora erkannt haben.
Inhalt
Vorwort
Hexenflug
Tod eines Biogärtners
Dracula-Kraut, selbst gebraut
Der Fehler ihres Lebens
Der Kern der Wahrheit
Wie gewonnen, so zerronnen
Bis dass der Tod euch scheide
In Gottes Namen
Das letzte Abendmahl
Gift für den Gatten im Homeoffice
Paradiesische Zustände
Vorwort
Eins vorweg: Ich liebe die Natur. Und natürlich Blumen. Vor allem böse Blumen sind mir seit Jahren besonders ans mörderische wie auch literarische Herz gewachsen. Egal, ob Herbstzeitlose, Kornrade, Schierling oder Oleander – sie alle sorgen zuverlässig für eine »schöne Leich«.
Wobei Pflanzengift, abgesehen vom unversehrten Erscheinungsbild der Ermordeten, noch mit weiteren Vorteilen aufwarten kann. Gemeingefährliche Gewächse sind umweltfreundlich, ressourcenschonend, sauber und sicher in der Handhabung sowie einfach zu beschaffen, denn sie finden sich im Wald und auf der Wiese, im Gartenbeet, der Blumenvase oder dem Gewürzregal. Wie bereits Agatha Christie bemerkte: »Gift übt eine gewisse Faszination aus. Es hat nicht die jähe Brutalität einer Revolverkugel oder einer blanken Waffe.« Gift ist viel eleganter, unblutig, lautlos, geräuschlos – und dennoch tödlich effizient.
Wenn man über gewisse botanische Kenntnisse, etwas Fingerspitzengefühl und ausreichend böse Absichten verfügt, dann steht dem perfekten Mord also nichts mehr im Weg. »Stirb durch die Blume« hat immer Saison.
Wobei der gute alte Paracelsus jedenfalls recht hatte mit seiner allseits bekannten Sentenz:
»WAS IST DAS NIT GIFFT?
ALLE DING SIND GIFFT/UND NICHTS OHN GIFFT/
ALLEIN DIE DOSIS MACHT DAS EIN DING KEIN GIFFT IST.«
In den vorliegenden schwarzhumorigen Erzählungen habe ich noch mehr »Böse Blumen« für Sie geerntet und gleich fünfzehn mögliche Ablebensszenarien mit Hilfe gemeiner Kräuter und fieser Blumen beschrieben. Wobei keinesfalls nur Frauen zur Giftmischerei tendieren, auch Männer haben viel Talent im Umgang mit toxischen Substanzen. Da geht es Poolpumpen-Betreibern, Wachsblumenfetischisten und Gurkengraveuren ebenso ans Leben wie Pilzfreunden, Katzenliebhabern und pädophilen Geistlichen – mit vermeintlich gesunden grünen Smoothies, mit Stechapfelsaft, Tollkirschentee, Apfelkernen oder Lerchensporn. Denn gegen jedes menschliche Übel ist garantiert ein tödliches Kraut gewachsen.
In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen!
Klaudia Blasl
Hexenflug
»Es gibt doch nicht Schöneres als die strahlenden Farben des Herbstes«, meinte Clemens und betrachtete beglückt den wilden Wein, dessen feuerrotes Blattwerk bereits den Giebel eines alten Gutshofs erklommen hatte.
Ich konnte ihm nur zustimmen. Der für einen Oktobertag ungewöhnlich blaue Himmel verlieh der idyllischen Landschaft einen nahezu überirdischen Glanz.
»Balsam für die Seele«, erwiderte ich enthusiastisch, während mir spontan ein paar Verse von Theodor Storm in den Sinn kamen: »Der Nebel steigt, es fällt das Laub. Schenk ein, den Wein, den holden …«
Clemens drehte sich um, tat so, als würde er eine Flasche Wein entkorken, und prostete mir mit einem imaginären Glas zu. »Auf dein Wohl, Udo! Und auf deinen Besuch.«
Mein alter Freund wirkte ehrlich erfreut über meine spontane Heimsuchung. Ich war doch recht überfallartig vor seiner Tür gestanden, nachdem der Arzt mir im Interesse meiner schwer angeschlagenen Nerven zu einer Auszeit fernab der Großstadt geraten hatte.
»Du wirst sehen, die gesunde Landluft wird dir guttun. Nichts als Ruhe, Frieden, glückliche Hühner und freundliche Menschen.«
Ich nickte. Es sah nach wahrhaft paradiesischen Zuständen aus.
Schon wollte ich meine Dankbarkeit darüber, hier Gast sein zu dürfen, in entsprechende Worte kleiden, als im ersten Stock des Gutshauses ein Fenster aufging, eine junge Frau erschien, auf den Sims kletterte und mit weit ausgebreiteten Armen in die Tiefe sprang.
Clemens und ich rannten nahezu gleichzeitig los. Als wir keuchend den leblosen Körper erreichten, kniete bereits ein Mann daneben.
»Dora«, flüsterte er. »Dora, sag doch was!«
Die Frau, die aus der Nähe betrachtet um die dreißig sein mochte, lag zusammengekrümmt auf der Erde und stöhnte leise vor sich hin. Obwohl es drei Uhr nachmittags war und außerdem Oktober, war sie nur mit einem dünnen Nachthemd bekleidet. Keine Strümpfe, keine Jacke, nichts.
»Wenn wir alle zusammen helfen, dann könnten wir sie ganz vorsichtig ins Haus tragen«, schlug ich vor und versuchte, die reglose Gestalt behutsam anzuheben.
»Auf gar keinen Fall.« Sanft drückte mich der verzweifelte Mann zur Seite. »Sie dürfen Dora nicht bewegen, keinen Zentimeter. Wenn ein Wirbel verletzt wurde, riskiert sie eine Querschnittlähmung.«
»Notarzt und Rettung sind bereits unterwegs«, bemerkte Clemens, der mit dem Handy in der Hand zu uns getreten war. »Und mach dir nicht zu große Sorgen, Felix. Es ist bestimmt nicht so schlimm, wie es aussieht.«
Der Mann, der demnach Felix (der Glückliche) hieß, wenngleich er gerade gar nicht danach wirkte, blickte zu uns hoch. »Es ist schlimmer«, seufzte er. »Viel schlimmer.«
Mein Freund nickte bedeutungsschwanger, ich schwieg betroffen. Hier musste mehr im Argen liegen als nur die Blumenrabatten, die einen recht ungepflegten Eindruck machten. Zwischen Löwenmäulchen, Studentenblumen, Astern, Silberkerzen und Herbst-Anemonen führten Fingerkraut, Gundelreben und Giersch einen wuchernden Kampf um die Vorherrschaft in den verwahrlosten Beeten. Die spärlich blühenden Rosen, die den Gutshof umgaben, sahen aus, als hätten sie bereits eine längere Durststrecke hinter sich, und zwischen den teuer wirkenden marmorierten Mosaikfliesen drängten sich büschelweise Gänsedisteln und Löwenzahn empor. Hier fehlte wohl schon seit Längerem eine liebevolle Hand, die diesem grassierenden Wildwuchs Einhalt gebot.
Gerade wollte ich nach einer Ackerwinde greifen, die sich mit strammen Ranken um eine Hochstammrose schlang, als der Klang des Martinshorns die bedrückende Stille durchbrach.
»Da kommen sie«, meinte Clemens hörbar erleichtert und eilte dem Wagen entgegen.
»Gleich sind sie hier, Liebling«, sagte der unglückliche Felix und strich der Frau über die Wangen.
»Kann ich irgendetwas tun?«, fragte ich, ohne die geringste Ahnung zu haben, wie Hilfe in so einem Fall beschaffen sein könnte.
Zu meiner Überraschung nickte der Mann. »Bitte bleiben Sie kurz hier, dann kann ich rasch ein paar Sachen holen.«
Ich kniete mich wieder hin, griff nach Doras Hand und sprach beruhigend auf sie ein, doch die verletzte Frau starrte mit weit aufgerissenen Augen reglos in die Ferne. Sie schien mich nicht zu bemerken. Ihr Atem ging kurz und flach, die Haut fühlte sich ungeachtet der spätherbstlichen Temperaturen heiß und trocken an, und ihre Pupillen glichen der einer Katze auf nächtlicher Jagd.
Vermutlich stand sie schwer unter Schock, dennoch –
Weiter kam ich mit meinen Überlegungen allerdings nicht, da die Rettungskräfte bereits im Eilschritt um die Kurve bogen und mich meiner Aufgabe enthoben. Mit routinierten Griffen betteten sie die junge Frau vorsichtig auf eine Bahre, während der Arzt mit Infusionsflaschen, Schläuchen, Kanülen und Blutdruckmanschette gleichzeitig hantierte.
Ich trat ein paar Schritte zurück, um den Einsatzkräften nicht im Weg zu stehen, und Clemens gesellte sich erneut zu mir.
»Hier können wir nichts mehr tun«, sagte er, nahm mich am Arm und zog mich Richtung Straße.
Widerwillig folgte ich ihm. Es missfiel mir, das Rosenstämmchen nicht von der Ackerwinde befreit zu haben.
»Nun, so gesund scheint die Landluft hier doch nicht zu sein«, neckte ich Clemens, als wir Stunden später unser Abendmahl einnahmen. »Eine junge Frau in Nachthemd ist mir selbst in der Großstadt noch nicht vor die Füße geflogen.«
Clemens kaute betroffen auf dem Tafelspitz herum, der so zart war, dass man ihn auch zahnlos hätte zerteilen können. »Glaub mir, zu den ländlichen Sitten und Gebräuchen zählt das wirklich nicht. Und ich wohne jetzt schon seit zwei Jahren hier.«
Mein Freund hatte sich nach seinem Pensionsantritt entschlossen, seiner großen Liebe, dem Golfspiel, zu folgen, und war in ein schmuckes kleines Haus direkt hinter der Driving Range gezogen, während ich in der Stadt geblieben war, um weiterhin daran zu scheitern, pubertären Fratzen biologisches und umweltkundliches Wissen einzutrichtern. Das größtenteils mangelnde Interesse von hormongesteuerten Jugendlichen an meinem Unterrichtsfach hatte mich allerdings nie gestört. Erst dem schier endlosen Dachbodenausbau einer profitgierigen und offenbar planungsunfähigen Bauträgergesellschaft war es nach beinahe einem Jahr Dauerkrawall, schwankenden Beleuchtungskörpern und zunehmend größeren Sprüngen im Plafond gelungen, mich an den Rande eines Nervenzusammenbruchs zu bringen. Als dann auch noch versehentlich die Hauptwasserleitung angebohrt wurde und mein Domizil zu einem Feuchtbiotop mutierte, hatte ich im wahrsten Sinne des Wortes das Handtuch geworfen, zwei Koffer gepackt und war auf Anraten meines Arztes zu Clemens geflohen.
»Fahren Sie an den abgeschiedensten und langweiligsten Ort der Welt«, hatte mir der Doktor empfohlen, »und zählen Sie dort die Schäfchenwolken. Wenn Sie bei siebenundachtzigtausendneunhundertdreizehn angelangt sind, können Sie wieder zurückkommen. Vorher nicht.«
Deshalb war ich also hier. Doch nach Langeweile und Wolkenzählen sah mir mein Aufenthalt nach nicht einmal einem Tag eher weniger aus.
Ich nahm einen großen Schluck Wein und wandte mich an Clemens.
»Erzähl mir etwas über diese Frau«, bat ich ihn. »Ich habe den Eindruck, als wäre ihr Fensterflug nicht ganz aus heiterem Himmel passiert.«
Wobei meteorologisch betrachtet absolut wolkenloses Wetter geherrscht hatte.
Clemens blickte mich traurig an, bevor er gleichfalls zu seinem Glas griff, als wollte er sich noch ordentlich Mut antrinken, bevor er den Mund aufmachte.
»Ich sollte wirklich nicht darüber reden, das Ganze ist doch so schon unangenehm genug für den armen Felix.« Er seufzte. »Aber als Augenzeuge hast du wohl ein gewisses Anrecht auf ein paar Hintergrundinformationen.« Er zog die Flasche näher zu sich heran. »Die Sache mit dieser Dora ist leider wirklich schlimm«, meinte er und schenkte sich nach. »Dabei ist oder besser gesagt war Felix’ Frau bis vor etwa zwei Monaten noch ein lebenslustiger, intelligenter und ganz normaler Mensch. Aber dann hat sie praktisch über Nacht den Verstand verloren.«
»Einfach so?« Das konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Man verlor seinen Verstand ja nicht wie Haustürschlüssel. Oder Einkaufszettel.
»Ja, einfach so. Ohne jede Vorwarnung. Nach einer gemeinsamen Runde auf der Driving Range war ich mittags bei Felix zum Essen geladen, und Dora trug die Suppe auf. Grießnockerlsuppe mit handgemachten Nockerln, so wie ich sie liebe. Und auf einmal springt sie auf, wirft ihren Teller gegen die Wand und beginnt zu brüllen, dass ein blutroter Delphin nach ihr schnappen würde. Dabei hat sie das Tischtuch vom Tisch gerissen, mitsamt Töpfen und Tellern, und einen auf Stierkampf gemacht. Es war gruselig. Grauenhaft und gruselig.«
Ich nickte. Das hörte sich wirklich nach schlechtem B-Movie an. »Und dann?«
»Dann fiel sie irgendwann erschöpft um. Felix, der unser Landarzt hier ist, hat ihr ein Beruhigungsmittel gespritzt, und dann haben wir die immer noch Tobende mit vereinten Kräften ins Bett verfrachtet.«
»Und dort ist sie dann bis zu ihrem heutigen Auftritt geblieben?«, fragte ich ungläubig.
»Aber nein, natürlich nicht. Nach ein paar Tagen war Dora wieder ganz die Alte und konnte sich an nichts erinnern. Doch am Wochenende darauf erlitt sie einen weiteren Anfall. Und die wiederholten sich in immer kürzeren Abständen. Einmal verfolgten sie Brontosaurier, dann hatte sie einen Krieg der Sterne auszufechten oder gegen einen Schreibtischstuhl zu kämpfen, und zweimal glaubte sie, ein Kind zu gebären, das sich als Hundewelpe beziehungsweise Marsmensch entpuppte. Dann waren da noch die kleinen blinkenden Killerwanzen, die sie bei lebendigem Leib auffressen wollten, und ein anderes Mal ist Dora nackt auf die Straße gerannt und hat den Postboten verbellt.«
Dieser Felix konnte einem wirklich leidtun, dachte ich. Alleinstehend zu sein war vielleicht doch nicht so schlecht. Zumindest musste man seinen Beziehungsstatus auf Facebook nicht wöchentlich von »verheiratet« zu »verrückt« und wieder retour ändern.
Clemens schienen ähnliche Gedanken durch den Kopf zu gehen, denn unvermittelt meinte er: »Besser allein als in gefährlicher Gesellschaft.«
Darauf erhoben wir die Gläser und erwähnten Felix und Dora den restlichen Abend über mit keinem Wort mehr.
Am darauffolgenden Tag machten wir uns auf in die Berge. Clemens hatte die Golfschläger vorübergehend gegen Wanderstöcke getauscht und eine gemütliche Drei-Hütten-Tour für uns zusammengestellt. Eine ganze Woche lang waren wir unter der strahlenden Herbsthöhensonne unterwegs, erfreuten uns an blühendem Enzian sowie berauschendem Almtee und dachten keine Sekunde lang an Doras Schicksal.
Erst nach unserer Rückkehr, mit müden Muskeln, aber erfrischtem Geist, fielen uns Felix und seine Frau wieder ein.
»Ich ruf ihn rasch an«, sagte Clemens, kaum hatte er sich die Bergschuhe von den Füßen getreten. »Der Arme ist bestimmt durch die Hölle gegangen, während wir unter dem siebten Himmel gewandert sind.«
Aber die Lage im Hause des Landarztes stellte sich – für beide Seiten – beruhigenderweise als einigermaßen stabil heraus. Dora hatte sich zwar einen Hüftbruch zugezogen und drei Rippen geprellt, war ansonsten aber unverletzt geblieben. Acht Wochen Bettruhe und ihre Knochen würden wieder zusammengewachsen sein, ließ Felix uns wissen. Nur für den angeschlagenen Geist sah die Prognose eher düster aus.
»Er hat uns übrigens für übermorgen zum Essen eingeladen«, teilte mir Clemens nach dem Telefonat mit. »Ich glaube, er braucht ein wenig Gesellschaft, um auf andere Gedanken zu kommen.«
Anderntags fanden wir uns also pünktlich zum Mittagsgeläut erneut am Schauplatz des Fenstersturzes ein. Im Gepäck zwei Flaschen köstlichen Bordeauxwein und jede Menge aufmunternde Worte.
Felix wirkte gefasst, aber ausgesprochen mitgenommen, und während der delikaten Mahlzeit vermieden wir alle Themen, die ihm auf den Magen schlagen könnten.
Erst beim Kaffee wagte Clemens einen Vorstoß. »Und Dora?«
Felix sog hörbar die Luft ein, ehe er sich zu einer Antwort durchringen konnte. »Ich musste sie weggeben.«
Entsetzt sahen wir ihn an.
»Nein, also, ich meine …« Vor lauter Nervosität begann der arme Mann zu stottern. »Also, weil sich doch ihr Geisteszustand einfach nicht besserte – sie hat sich ja permanent selbst gefährdet – und ich ihr doch auch nicht ständig Benzodiazepine verabreichen konnte, das hätte sie auf Dauer umgebracht, also, deshalb habe ich letztendlich den Empfehlungen einiger befreundeter Neurologen zugestimmt und Dora in eine speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Klinik verlegen lassen. Natürlich nur, bis sie wieder genesen ist. Dort ist sie jetzt in besten Händen, medizinisch und menschlich gesehen.«
Clemens und ich nickten. Das Wort »Nervenheilanstalt« getraute sich keiner von uns beiden in den Mund zu nehmen.
»Das war eine sehr vernünftige Entscheidung«, sprang Clemens dem Arzt schließlich moralisch bei. »Eine derartige Verantwortung ist zu viel für einen einzelnen Menschen. Noch dazu, wo du ja auch noch einen sehr anstrengenden und kräftezehrenden Beruf hast.«
Nun nickte auch Felix. »Es war bestimmt die schwerste Entscheidung meines Lebens, aber ich habe einfach keinen anderen Ausweg mehr gesehen.« Er schlug sich die Hände vors Gesicht. »Und trotzdem fehlt sie mir. Sie geht mir so unendlich ab. Wir waren noch nie länger als drei Tage getrennt.«
Es bedurfte zweier Stunden guten Zuredens plus dreier im Eichenholzfass gereifter Whiskys, um den Strohwitwer von seinen Selbstvorwürfen zu erlösen.
Als wir uns endlich verabschiedeten, drückte er uns mit Tränen in den Augen an die Brust. »Danke. Ich danke euch so sehr. Ihr seid wirklich wahre Freunde.«
Wir umarmten uns bestimmt noch ein halbes Dutzend Mal, bevor die Haustür endlich ins Schloss fiel.
»Gut, dass wir ihn wenigstens ein bisschen von seinen quälenden Gedanken abbringen konnten«, meinte Clemens, der auf Felix’ Terrasse stehen geblieben war, um sich eine Zigarre anzuzünden. »Nicht nur Dora braucht Hilfe, auch er. Wir sollten von jetzt an öfter nach ihm sehen.«
Dem konnte ich nur beipflichten. Und auf einmal fiel mir die Rose wieder ein.
»Wart noch einen Moment«, bat ich Clemens. »Bin gleich wieder da.« Rasch querte ich den Garten, um die Ackerwinde von der Hochstammrose zu entfernen. Ich konnte förmlich spüren, wie das edle Gewächs nach meiner Befreiungsaktion aufatmete, dafür legte sich mir ein Mühlstein um den Hals.
Den Heimweg verbrachten wir schweigend.
Am nächsten Tag täuschte ich einen dringenden Termin in der Stadt vor, von dem man mich angeblich viel zu spät in Kenntnis gesetzt hatte, und reiste schweren Herzens ab.
»In zwei Tagen bin ich wieder hier, versprochen«, verabschiedete ich mich von Clemens, während ich schuldbewusst den Blick senkte, um meinem warmherzigen Freund nicht in die Augen schauen zu müssen. Was ich vorhatte, würde mein gutes Gewissen und seine Gutgläubigkeit in ihren Grundfesten erschüttern.
Und ich hielt mein Versprechen. Keine achtundvierzig Stunden später klopfte ich erneut an seine Tür.
»Gut, dass du da bist!«, rief Clemens mir statt einer Begrüßung entgegen. »Komm schnell rein, der Kaffee ist schon fertig.«
Während ich Platz nahm und er die Tassen auf den Tisch stellte, fragte ich scheinheilig: »Was ist denn passiert? Du wirkst so aufgeregt.«
Mein Freund ließ sich ächzend auf seinen Lieblingsstuhl fallen und legte umgehend los. »Stell dir vor, der Felix, dieser Schuft, dieser widerliche Lügner, der so auf besorgter Ehemann gemacht hat, der ist gestern verhaftet worden.«
»Das glaub ich nicht.« Was eine glatte Lüge war, schließlich hatte ich für seine Verhaftung gesorgt. Mit einer anonymen Anzeige, für die ich mich bereits im Vorfeld ausreichend geschämt hatte.
»Doch. Und weißt du, warum?«
Ich schüttelte den Kopf, während ich mit dem Kaffeelöffel in der Tasse konzentrische Kreise rührte.
»Weil er Dora umgebracht hat. Kannst du dir das vorstellen? Während wir bei ihm am Tisch saßen und uns Hirschbraten mit Pilzsoße haben schmecken lassen, ist seine Frau schon tot im Garten gelegen.«
Theatralisch riss ich die Augen auf. »Aber dort hätten wir sie doch gesehen«, warf ich ein.
»Natürlich nicht auf der Erde, sondern unter der Erde. Dieses Schwein hat sie einfach vergraben. Von wegen Sanatorium …«
»Unglaublich. Auf so eine Idee wäre ich ja im Leben nicht gekommen.« Was gleichfalls gelogen war. Denn als ich die Rose von der Ackerwinde befreit hatte, war mein Blick zwangsläufig auf die umliegenden Rabatten gefallen. Und dabei hatte ich gesehen, dass dort, wo zehn Tage zuvor noch die Herbst-Anemonen und Silberkerzen ihr unkrautüberwuchertes Dasein gefristet hatten, mir – aus einem perfekt gejäteten Beet – auf einmal Rittersporn und Fingerhut entgegenlachten. Die zu dieser Jahreszeit eigentlich nicht mehr blühten, es sei denn, man hatte sie direkt aus einem Gewächshaus ins Freiland verpflanzt. Doch warum hätte man das tun sollen? Ein einzelnes Blumenbeet gartenmagazintauglich machen, aber die schädlichen Ackerwinden knappe zwei Meter daneben an den Rosen belassen? Dafür hatte es meiner Ansicht nach nur einen Grund geben können: Jemand hatte etwas vergraben. Etwas sehr Großes und sehr Geheimes, eine Ehefrau zum Beispiel.
»Niemand wäre auf so eine Idee gekommen«, pflichtete Clemens mir bei. »Und ich am allerwenigsten. Ich hab den Felix für einen Freund gehalten, einen ehrlichen, bemitleidenswerten Menschen, und stattdessen hat er sich als Mörder und Giftmischer entpuppt.« Zornesröte stieg ihm ins Gesicht. »Das muss man sich mal vorstellen, dass dieser Teufel seine Frau mit Hexenkräutern in den Wahnsinn getrieben hat. Wohldosiert und über Wochen hinweg, hat mir der Gerichtsmediziner gestern gesagt. Stechapfelsaft und Tollkirschentee musste die arme Dora trinken, bis sie völlig durchgedreht ist.«
»Und uns vor die Füße flog«, warf ich ein, nur um etwas zu sagen.
»Genau. Ein abscheulicher, vorsätzlicher und sorgfältig geplanter Mord. Nach dem Sturz und der Entlassung aus dem Krankenhaus hat dieser Unmensch ihr einfach eins über den Kopf gezogen und sie im Garten verscharrt. Und weißt du, warum? Aus Habgier! Weil er ihr Geld wollte. Sie war es nämlich, die Haus und Hof in die Ehe mitgebracht und damit seine ganze Ordination finanziert hat, aber das war ihm nicht genug, er wollte alles, und zwar einzig und allein für sich selbst.«
»Grauenhaft«, murmelte ich. »Einfach nur grauenhaft. Bitte lass uns von etwas anderem reden, sonst kommt mir noch die Galle hoch.«
Clemens nickte. »Da hast du recht, mir dreht sich auch schon der Magen um. Reden wir lieber über die Radtour, die wir noch unternehmen wollten. Ich dachte an eine Runde durch die Aulandschaft bis zum Dreiländereck. Viel Natur, wenig Leute.«
»Hervorragend«, stimmte ich ihm zu. Immerhin musste ich endlich damit anfangen, die ärztlich verordneten siebenundachtzigtausendneunhundertdreizehn Schäfchenwolken zu zählen.
Stechapfel, Datura stramonium (sehr giftig)
Mittel der Hurenwirte, Rosstäuscher, Hexen und Mörderbuben
Das Sündenregister des Stechapfels ist derart lang, dass er wohl ewiglich in der Hölle schmoren müsste, gäbe es ein Jüngstes Gericht für gemeine Gewächse. Bereits vor Jahrhunderten hat das Tollkraut die Menschen in Form von Liebestränken und Hexensalben um ihre Gesundheit und den Verstand gebracht. »Knochentrocken, stockblind, verrückt wie ein Huhn und heiß wie ein Vulkan«, so beschreibt ein Arzt die Symptomatik einer Vergiftung mit Datura. Die LSD-ähnliche Wirkung der Pflanze kann sich bei falscher Dosierung allerdings leicht bis ins Grab erstrecken. Allein in Indien ereigneten sich in fünfzehn Jahren 2.728Fälle von Mord oder Selbstmord durch die Donnerkugel.
Und auch hierzulande hat der Stechapfel für viel Unheil gesorgt. 1830 wird im »Handbuch des Straf-Verfahrens« sogar vermerkt, dass die damit Vergifteten vor ihrem Tode unter wahnsinnigen Zuständen litten. Doch manchmal sollten die Giftopfer nur vorübergehend sediert werden, was viel Fingerspitzengefühl erforderte. Hurenwirte und Bordellbesitzer etwa bewiesen meist ein gutes Händchen für exakte Dosierungen, wenn sie den »neuen« Mädchen die Samen (wie heutzutage K.-o.-Tropfen) unters Essen mischten, um diese wollüstig und willfährig zu machen. Pferdehändler hingegen schoben ihren Schindmähren gerollte Datura-Blätter in den Mastdarm, damit diese sich recht feurig – und somit verkaufsfördernd – verhielten. Und der Literat Gustav Meyrink hat dem Gewächs in »Coagulum« sogar ein literarisches Denkmal schwarzer Magie gesetzt, indem er eine Kinderleiche mit giftigem Rauch aus Ginster, Nachtschatten und Stechapfel würzte.
Dennoch wurden Extrakte der Pflanze lange Zeit und mit katastrophalen Folgen auch als Asthmamittel eingesetzt. Der Chemiker und Alchemist Johann Joachim Becher vermerkte bereits 1663 in seinem »Parnassus Medicinalis«: »Stechapffel seyend sehr kalt, man nimmt sie nicht in leib, wer nicht gerne sterben will.«
Info: auch Donnerkugel, Zigeunerkraut, Dornapfel, Tollkraut, Stachelnuss, Liebeszwinger oder Hexenkraut genannt. Strauchiges, unangenehm riechendes Nachtschattengewächs mit zugespitzten Blättern und großen weißen Trichterblüten. Die kastaniengroßen Fruchtkapseln haben rundum Stacheln und schwarze Samen. Blüte: Juni–September | Inhaltsstoffe: Hyoscyamin, Scopolamin, Atropin | Vergiftungserscheinungen: (ab 0,3 g) trockene Schleimhäute, brennender Durst, erweiterte Pupillen, heftige Krämpfe, Gedächtnisverlust, Sprachverlust, Lähmungen, Erregung, Heiterkeit, Tobsucht, Übelkeit, Schlaflosigkeit, Wahnvorstellungen, Atemlähmung, Tod
Tod eines Biogärtners
»Mysteriöse Todesfälle rund um bekannten Biogärtner«.
»Tödliche Schüsse, giftige Kuchen – die Rache des Naturgarten-Stars?«
»Schauplatz Tatterersee – wo der Tod einen grünen Daumen hat«.
So und ähnlich lauteten die Schlagzeilen in jenem dramatischen Sommer in Straßfelden am See. Die Titelseiten der Boulevardmedien übertrumpften sich in haarsträubenden Hypothesen, während die mit den mysteriösen Fällen beauftragten Ermittler den Tag bereuten, an dem sie sich für den Polizeidienst entschieden hatten. Drei Leichen, zwei davon vergiftet, eine erschossen, der halbe Pfarrgemeinderat im Krankenhaus und die gesamte Bevölkerung in Alarmbereitschaft – von einer derart mörderischen Bilanz konnten selbst Killerviren nur träumen.
Aber berichten wir von Anfang an.
Der kapitale Hirsch schien aus dem Nichts zu kommen, setzte direkt vor dem Mann mit der Waffe in majestätischer Manier über den schlammigen Forstweg nahe dem Ufer und verschwand schier lautlos im dichten Unterholz. Erschrocken verriss Dragomir das Gewehr und drückte ab. Kurt Blumburger, der exakt in diesem Moment den Forstweg erreichte, stürzte wie gefällt zu Boden. Das Projektil hatte ihn mitten ins Herz getroffen. Blattschuss, wie Jäger zu sagen pflegen. Der trainierte Läufer starb auf der Stelle und in Bestform, bei Kilometer neunzehn Komma sieben seines angestrebten Halbmarathons und mit perfekten Pulswerten. Der Schütze hingegen stand kurz vor einem Infarkt. Man hatte ihn bezahlt, um einen räudigen Köter abzuknallen, nicht, um einen Menschen zu töten. Er war doch kein Mörder. Panisch hetzte Dragomir zu seinem Wagen, riss die Tür auf, schob die Waffe in ihr Versteck neben dem Achsträger und gab Gas. Zwei Stunden später hatte er Österreich bereits auf Nimmerwiedersehen verlassen.
Etwa zur selben Zeit starrte Alex auf die hässliche graue Wand seiner Gefängniszelle. Er sehnte gleichfalls ein Nimmerwiedersehen mit diesem Ort des Grauens herbei, musste sich allerdings noch zwei Tage gedulden. Dann würde man ihn endlich in die lang vermisste Freiheit entlassen. Ein Ereignis, dessen Bedeutung irgendwo zwischen dem Untergang des Weströmischen Reichs und der Auferstehung Christi anzusiedeln war. Zumindest für ihn. Fünf Jahre lang hatte er wegen schweren Einbruchs hinter schwedischen Gardinen ausharren müssen, ein Leben in Zeitlupe geführt und den Kampf gegen gute Vorsätze, böse Fettzellen sowie die moralische Oberliga der Anstaltspsychologen verloren. Niedere Instinkte, unterdurchschnittliche Intelligenz und eine baldige Rückkehr auf die schiefe Bahn wurden ihm von diesen Seelenklempnern attestiert. Dann hatten diese hinterfotzigen Hirnpathologen mit krakeliger Handschrift und in roter Tinte einen Aktenvermerk darüber angebracht, fest davon überzeugt, ihn tief im Innersten durchschaut zu haben. Was für Blindgänger! Ausgerechnet er, der zu Höherem bestimmt war, intellektuelle Spitzenleistungen vollbracht hatte und statt erneut auf der schiefen Bahn geradewegs in paradiesischen Zuständen landen würde, weil draußen bereits das große Geld auf ihn wartete. Und zwar seit exakt fünf Jahren. Aber das war sein Geheimnis, von dem niemand auch nur die geringste Ahnung hatte. Außer einem Stück Brachland voller Brennnesseln, aber das hatte bestimmt geschwiegen.
Während Alex also weiterhin die Risse im schmutzig grauen Verputz der Zellenwand betrachtete, gab es für Blumburger gar nichts mehr zu sehen. Seine Aussichten, nach dieser zufälligen Inszenierung des Freischütz-Dramas auch noch den vorsätzlich geplanten Giftanschlag auf sich zu erleben, standen bei null.
Dabei hatten sich seine zwei Möchtegernmörder monatelang mit der heimtückischen Ablebensplanung des Biogärtners befasst. Und nun, wo sie endlich alles in die Wege geleitet hatten, war der Mann einer verirrten Kugel zum Opfer gefallen.
»Ich pack es nicht«, meinte Grubinger, der ältere Teilhaber von Grubinger & Grosz, dem unbestrittenen Marktführer des Landes in Sachen Pflanzenschutzmittel und Kunstdünger, kaum hatte ihm seine Sekretärin vom Tod Blumburgers erzählt. Loredana war die Nachbarin der verwitweten Schwester vom Inhaber der örtlichen Fleischerei, bei der die Dorfpolizisten ihre täglichen Leberkässemmeln bezogen, oder mit anderen Worten: ein langbeiniger und vollbusiger Garant für zuverlässige und rasche Informationsweitergabe.
Umgehend hatte Grubinger seinen Kompagnon zu sich bestellt. Nun saßen die beiden zusammen und überlegten, ob das nun eine Frohbotschaft oder vielmehr eine Hiobsbotschaft war.
»Wie ist es denn passiert?«, fragte Grosz, der jüngere Teilhaber der Pestizidmanufaktur, und fixierte seinen Bierkrug, als wollte er die Schaumkrone zu einem Geständnis zwingen.
»Beim Laufen haben s’ ihn erlegt. Im Wald. Sagt die Lori, die es von der –«
»Schon gut«, schnitt ihm Grosz das Wort ab. Er kannte die Abläufe des örtlichen Informationsclusters zur Genüge, hatte er doch selbst über Jahre Bettstatt und Berichterstattung mit Loredana geteilt. Damals hatte ihre blondierte Vorzimmerdame allerdings noch keine kostspieligen Silikondepots mit sich herumgetragen. »Sport ist halt manchmal wirklich Mord«, schlussfolgerte er.
»Jedenfalls hat uns irgendwer die Drecksarbeit abgenommen.« Grubinger erhob seinen Krug. »Lass uns auf den unbekannten Wohltäter anstoßen.«
Grosz zögerte. »Findest du es nicht auch seltsam, dass dieser verdammte Kompostkriecher über Jahre hinweg ungestört seinen Naturgartenquatsch predigen konnte, und kurz bevor wir ihn endlich zum Schweigen bringen wollen, lässt ihn ein anderer ins Gras beißen? Warum ausgerechnet jetzt? Warum nicht schon viel früher?«
»Ist doch egal. Hauptsache, er ruht auf ewig im Reich der Regenwürmer. Dort passt er eh gut hin.«
Ein paar Minuten lang gaben die beiden sich dieser erfreulichen Vorstellung hin.
»Verdient hat er’s jedenfalls«, sagte Grubinger schließlich. »Wenn ich mir unsere Bilanzen der letzten Quartale so anschaue, frag ich mich, warum wir diesem Bienchen-Blümchen-Mist überhaupt so lange zugeschaut haben.«
Grosz nickte. Seit Kurt Blumburger den biologischen Gartenbau für anspruchsvolle Faulpelze im ganzen Land propagierte, war dessen Anhängerschaft ins Unermessliche gestiegen, während sich ihr Absatz an Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden im kontinuierlichen Sinkflug befand. Früher, bevor dieser Biofuzzi die botanische Heimgartenbühne betreten hatte, da hatten sich die Leute noch um ihre Round-down-Bestände geschart wie um die Kronjuwelen der Kaiserin. Ihrer Ansicht nach gab es auch weit und breit keine bessere Waffe im Kampf gegen unliebsame Gewächse als Glyphosat. Doch wegen dieses Gartengurus war die Stimmung nach und nach gekippt. Statt zur Chemiekeule zu greifen, griff man zu Blumburgers Gartenbüchern, statt flächendeckend Pflanzenschutzmittel und Kunstdünger zu verteilen, verteilte man Urgesteinsmehl gegen Blattläuse oder Zimtpulver gegen Ameisen und setzte kübelweise Schachtelhalmsud und Brennnesseljauche an.
Ein Wahnsinn. Selbst traditionelle Unkräuter mutierten allmählich zu ausgewachsenen Delikatessen. Angeblich gab es bereits Menschen, die Giersch und Gundermann als Gemüse betrachteten statt als bodendeckenden Abschaum auf einem gepflegten Rasen.
Damit hatte es vor knappen zehn Jahren überhaupt begonnen. Mit dem traditionellen englischen Rasen, dessen Halme einen ordentlichen millimeterkurzen Schnitt aufwiesen, sortenrein angesät, ohne wildwüchsige Invasoren wie Löwenzahn oder Gänseblümchen, dafür begrenzt von akkurat gepflegten und mit der Wasserwaage ausgerichteten Kanten. An prominenter Stelle gehörten ihrer altväterischen Ansicht nach edle Teerosen platziert, die gekiesten Wege oder Waschbetonplatten wurden von Lavendel flankiert, und hinter dem Haus legte man die Gemüsebeete an. Dazu ein paar Topfgeranien, Petersilie, Schnittlauch und Liebstöckel für den Küchengebrauch sowie eine Hecke als Sichtschutz. Bevorzugt Thuje, Buchsbaum oder Kirschlorbeer.
Doch dann war Blumburger gekommen. Und der ließ der Natur einfach ihren Lauf, fand Blindschleichen nützlich, Brennnesseln praktisch und Farnkräuter hübsch. Er philosophierte über die Bedeutung von Wildbienen und Totholztürmen, baute Kartoffeln in Kisten an und Bohnen im Blumenbeet, schrieb ein Dutzend Gartenbücher, trat im Fernsehen auf und hatte sich einmal derart medienwirksam gegen stecknadelkurz abgemähte, sterile und insektenfeindliche Grünflächen ausgelassen, dass ihre Firma zwei Wochen lang keine einzige Packung ihres sensationellen Unkrautvernichters verkauft hatte.
Kurz gesagt, aus betriebswirtschaftlicher Sicht hatte sich der Biogärtner als Totengräber von Grubinger & Grosz entpuppt.
»Der Mann muss weg«, hatte letztendlich ihr einzig praktikables Sanierungskonzept gelautet. Um wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen, würden sie einen gärtnerischen Umkehrschwung Richtung Chemiekeule bewirken müssen.
Aber das Problem mit dem Wie war schwieriger zu lösen gewesen als jeder gordische Knoten.
Grubinger hatte eine Entführung erwogen. »Mit dem Lösegeld könnten wir unsere Verluste wieder ausgleichen!«, rief er euphorisch aus.
Doch Grosz war dagegen gewesen. »Und wenn er dann wieder freikommt, ist er berühmter als zuvor. Außerdem haben wir keine Ahnung von Freiheitsberaubung, Betäubungsmitteln, Fesselungstechniken, Erpresserbriefen und Geldübergabemodalitäten. Viel zu kompliziert. Mal ganz abgesehen von der Schwierigkeit, hier bei uns einen erwachsenen Menschen tagelang versteckt zu halten. Immerhin hat der Tatterersee das höchste Fremdenverkehrsaufkommen im ganzen Land. Da bleibt kein Mäuseloch unentdeckt.«
»Dann versenken wir ihn halt. Das Wasser ist tief und touristisch unerschlossen. Ich spendier Blumburger auch meine Bowlingkugeln für einen ordentlichen Tauchgang.«
Und wieder hatte Grosz abgewunken. »Wir müssen ihn durch sein Werk zerstören. Wenn er einfach stirbt, wird er vom großen Gott des Grünzeugs bestimmt noch heiliggesprochen.«
Ein Argument, dem sich auch Grubinger nicht entziehen konnte.
Wochenlang hatten sie ihre kleinen grauen Zellen strapaziert, bis Grosz eines Abends beim dritten Bier die Erleuchtung hatte. »Wir vergiften ihn. Aber nicht nur ihn, sondern auch seine Gäste. In zwei Wochen findet doch das sommerliche Gartenfestival bei ihm statt, eine bessere Gelegenheit gibt es nicht. Und wenn dann seine halbe Gefolgschaft statt im Blumenparadies im Krankenhaus landet, kann er mit seinem grünen Daumen in Zukunft nur noch in der Nase bohren, mehr nicht.«
»Ich versteh nicht ganz?«
»Ist doch ganz einfach. Wenn ausgerechnet ein Biogärtner sich und hundert andere mit echter Natur aus seinem ach so biologischen Garten vergiftet, dann steigt schlagartig das Vertrauen in synthetische Produkte. Also in zuverlässige Chemie. Glaub mir. Wer Wasser aus einem Bach trinkt und davon Durchfall bekommt, der nimmt sich bei der nächsten Wanderung ein Sprudelsafterl in der Plastikflasche mit.«
Das leuchtete auch Grubinger ein.
Nach dieser kriminellen Offenbarung hatten sie mit vereinten Kräften einen schlichtweg unfehlbaren Plan entworfen, um Blumburger mit seinen eigenen Waffen zu schlagen.
Nach nächtelangen Recherchen hatte Grubinger die Kornrade als perfekte Übeltäterin auserkoren. »›Bereits seit dem Frühneolithikum als Wintersaatunkraut gefürchtet, hat die schmucke einjährige Pflanze meist unter dem Namen Nigella raden über Jahrhunderte für böses Bauchgrimmen, migräneartige Zustände, Delirien, Koma und schlimmstenfalls Atemlähmungen gesorgt. Da sie am allerliebsten auf Getreideäckern wuchs, gelangten ihre Samen mitsamt Saponinen, allen voran das giftige Githagosid, ins Brot oder Bier, den Branntwein oder Kornkaffee‹«, hatte er aus einem bekannten Giftpflanzenführer zitiert. »Genau das, was wir brauchen.«
Und Grosz, der seine virile Standfestigkeit in Form von Beckenbodengymnastik gern auf slowakischen Matratzen trainierte, hatte sich daraufhin erstmals in seinem Leben mehr um Samenstände als um Samenspenden bemüht und in beziehungsweise um Bratislava herum sämtliche Kornradebestände aufgekauft oder aus Naturgärten gestohlen, da das bedrohliche Blümchen auf freier Flur nahezu ausgerottet war.
Der Rest war ein Kinderspiel gewesen. Sie hatten die Samen getrocknet, gemahlen und danach in einen Fünf-Kilo-Sack Mehl gemischt, den sie zuvor in einer exklusiven Biogetreidemühle erworben hatten. Da Elli, Blumburgers Gattin, auf ihren Gartenfesten stets selbst gebackene Kuchen und Torten offerierte, hatten sie das Behältnis mit den toxischen Backzutaten nur noch als Geschenk verpacken müssen. Dazu eine nette Karte, auf der eine Maria sich für die tollen Gartentipps bedankte und zudem sehr bedauerte, beim diesjährigen Fest nicht dabei sein zu können – unter Hunderttausenden Verehrerinnen des Gartengurus hieß garantiert irgendeine Maria –, und ab auf die Post.
Das also war ihr unfehlbarer Plan gewesen. Am Montag hätten sie das böse Überraschungspaket aufgeben wollen. Doch der Biogärtner hatte ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht und vor seiner Zeit ins Gras gebissen. Nun würde man ihm garantiert ein Denkmal errichten, seine Werke mit Trauerflor versehen, als Reliquien handeln und mindestens vier Storchenschnäbel nach ihm benennen. Kurz gesagt, es würde genau das passieren, was sie hatten vermeiden wollen. Die Leiche würde werbewirksame Schlagzeilen machen. Ihre anfängliche Freude darüber, sich nicht mehr selbst auf kriminelle Abwege begeben zu müssen, löste sich nach und nach auf wie ein WC-Stein.
»Na, wenigstens haben wir uns das Porto gespart«, meinte Grosz nach langem Schweigen.
Grubinger nickte.
»Ich glaub, wir sollten das Zeug jetzt am besten entsorgen. Hol den Sack her, wir schütten alles weg.«
»Das hat doch noch Zeit«, widersprach Grubinger. »Ich hab es im Lager versteckt. Hinter den alten Ammoniakfässern. Dort schaut nicht mal die Putzfrau hin.«
»Hol es.« Grosz gab weder auf noch nach. »Stell dir mal vor, irgendein spatzenhirniger Polizist kommt auf die Idee, dass wir indirekt vom Tod Blumburgers profitieren. Und dann kommt der her, also der Bulle, nicht der Tote, löchert uns mit Fragen, stellt die Bude auf den Kopf und findet das Mehl.«
»Du meinst, die haben noch keinen Verdächtigen?«
»Was, wenn das nur Waidmannspech von einem schussgeilen Sonntagsjäger war? So Typen haben doch gern mal zwei Promille im Blut, grauen Star und Parkinson, legen auf einen kapitalen Hirsch an und treffen statt des Rotwilds einen Waldläufer. Und von denen wird sich keiner freiwillig stellen.«
Grubinger blickte Grosz an. »Wenn du bei der Kundenakquise nur halb so viel Phantasie beweisen würdest wie beim Schwarzsehen, wären wir so gut wie saniert.« Und weil sein Kompagnon nichts darauf antwortete, fügte er hinzu: »Aber gut, hol ich das Packerl halt.«
»Es ist weg.« Obwohl Grubinger beinahe im Laufschritt zurück ins Büro stürzte, verbreitete er umgehend eine Art geistige Windstille.
»Was?«
»Na, das Paket. Es ist einfach weg.«
»Hast auch richtig geschaut?«
»Ich hab Augen im Kopf. Und mit denen kann ich eine Spinnmilbe von einer Schmierlaus auf zehn Meter Entfernung unterscheiden. Wenn ich sag, es ist weg, dann ist es weg. Nicht hinter den Fässern, nicht neben ihnen, nicht auf ihnen und auch sonst nirgends.«
Und er behielt recht.
Der Leiharbeiter, den sie seit einer Woche in der Logistikabteilung einsetzten, hatte sein Jahrespensum an Arbeitseifer leider ausgerechnet auf ihr Unternehmen verwandt, das seiner Ansicht nach versehentlich ins Abseits geratene Paket gefunden, dienstfertig zugestellt und in seiner Stundenabrechnung die zehn Minuten Zeitaufwand für die beschwerliche Bergung eines Fünf-Kilo-Pakets hinter Ammoniakfässern penibel vermerkt. Sie konnten nur hoffen, dass er die fatale Sendung nicht auch noch mit einem neuen Adressaufkleber versehen hatte. Wo sie doch extra eine Tasse schwarzen Johannisbeersaft über dem Absender ausgeleert hatten. Zwecks der besseren Unleserlichkeit. Immerhin hieß keiner von ihnen beiden Maria.
»Und jetzt?« Grosz durchlebte in Gedanken bereits eine Art existenzielle Grenzerfahrung.
»Jetzt können wir nur hoffen und beten, dass Elli noch nichts gebacken hat und nach dem Tod ihres Mannes auch keine Lust mehr darauf hat.« Grubinger, der als Bub ministriert hatte, sandte ein Stoßgebet zum Himmel. Und um sich beidseitig abzusichern, rief er still und heimlich auch noch den Teufel an.
Aber keiner von beiden half.
Dafür schlug die Nachricht vom tragischen Ableben des berühmten Biogärtners höhere Wellen als der Tatterersee bei Sturm. Bereits am frühen Vormittag drängten sich die Leute in den Stuben der heimischen Gastwirtschaft zusammen, weil man an derart denkwürdigen Tagen lieber in der Gerüchteküche verweilte als am heimischen Herd.
Über allen Tischen lagen dichte Wolken aus Sensationsgier, Tratschsucht und invasiver Anteilnahme. Wobei die landläufig übliche üble Nachrede natürlich auch nicht zu kurz kam. Aber die betraf in erster Linie den vermeintlichen Täter.
»Ich hab’s ja immer schon gewusst, ein Jäger, zehn Deppen«, posaunte etwa die Unterkofler Vreni durch den halben Speisesaal. »Hat meine Oma auch schon gesagt.«
Zustimmendes Nicken unter den Frauen.
»Offenbar muss man selbst am helllichten Tag mit Helm und Schutzweste laufen«, meinte der Wirt, der sein ganzes Leben noch nie spazieren gegangen, geschweige denn gelaufen war.
Da Blumburger mit einer Blaser Repetierbüchse Modell R8 erschossen worden war, einer typischen Waffe der Waidmannszunft, hegte niemand auch nur die geringsten Zweifel an deren Täterschaft.
Bis auf die Jäger selbst. Denn es war Schonzeit. Zumindest für Rotwild. Und beim Erlegen eines Hasen oder eines Wildkaninchens hätte man keinesfalls das Herz eines hochgewachsenen Mannes getroffen, sondern höchstens dessen Schienbein, wurde der zuständige Revierjäger nicht müde zu widersprechen. Aber seine Beteuerungen stießen auf taube Ohren.
Und die wirklich Schuldigen schwiegen.
Dragomir lernte erneut die Schönheiten seiner ostrumänischen Heimat schätzen und akzeptierte nach diesem unfassbaren Fall von Waidmannspech keinerlei Aufträge aus dem Ausland mehr. Dragomirs Auftraggeber hingegen, die FFLV-Front (Freedom for Lake View), also die ebenso geheime wie radikale Bewegung zum Schutz der freien Sicht an den Ufers des Tatterersees, hätte dem Schützen am liebsten noch einen Bonus ausbezahlt, hatte er ihre Anweisung doch mehr als erfüllt. Immerhin kämpfte die Front mit allen Mitteln für unverbaute Panoramablicke auf das Gewässer. Und da Gemeinde, Land und Ökoparteien ihrer Ansicht nach so viel beziehungsweise wenig Rückgrat bewiesen wie gekochte Spaghetti, musste eben sie weitere Grundstücksbebauungen verhindern. Etwa, indem sie den geliebten Golden Retriever einer neuen Investorin abknallen ließ, während die betuchte Dame gerade einen Lokalaugenschein der in Frage kommenden Parzellen abhielt. Ein Ferienhaus in einer Gegend, wo einem nicht nur Stockenten und Reiher, sondern auch tödliche Kugeln um den Kopf flogen, ließe sich bestimmt nur schwer an den Mann bringen. Da müsste der Käufer schon pathologischer Adrenalinjunkie sein oder Präsident von Russland. Indem ihr Auftragskiller allerdings nicht den Hund erschossen hatte, sondern den unbestrittenen Star der Grünen-Daumen-Fraktion, waren die Erfolgsaussichten eines derartigen Projekts zur großen Freunde der FFLV gleich um ein Vielfaches gesunken. Wenn man bei einem friedlichen Lauf um den See nicht nur Zecken, Kletten oder Bänderrisse riskierte, sondern gleich sein Leben, dann verbrachte man seinen Urlaub lieber anderswo.
Doch während Blumburgers Familie und alle Naturgartenfans der Nation um ihren Helden trauerten, hatte Alex ganz andere Sorgen. Am frühen Morgen hatten sich die Tore der Justizstrafanstalt hinter seinem Rücken geschlossen, am späten Nachmittag begab er sich bereits auf Schatzsuche. Sein letzter genialer Coup hatte ihm zwar dank einer dämlichen Überwachungskamera fünf Jahre Knast eingebracht, aber dafür auch eine Beute im Wert von etwa einer halben Million. Euro wohlgemerkt. Den edlen Kaschmir-Saphir, das mit Abstand teuerste Stück aus der Schmuckschatulle der von und zu Hohenstroller, hatte die Polizei nämlich nie gefunden. Nicht bei ihm, nicht bei Hehlern, nicht im Internet, weder im Ausland noch bei Versteigerungen, und er hatte geschwiegen. Von wegen unterdurchschnittliche Intelligenz. In Gedanken drehte er den Anstaltspsychologen ein paar Stricke für deren arrogante Überheblichkeit. Er hatte sie alle an ihren neugierigen Nasen, die sie unermüdlich in seinen Kopf zu stecken versuchten, herumgeführt, und niemandem von diesen Klugscheißern war das aufgefallen. Darauf war er ebenso stolz wie auf sein unauffindbares Versteck des als Zuckerhut geschliffenen Kaschmir-Saphir-Rings. Mit diesem Bruch hatte er sich aus der Liga der kleinkriminellen Vollzeitganoven in die Meisterklasse der Luxusdiebe katapultiert.
Wobei ein wenig Hausverstand schon genügt hätte, dem wertvollen Kleinod auf die Spur zu kommen, aber der schien bei den polizeilichen Berufsschnüfflern ebenso vom Aussterben bedroht wie Brachpieper, Gelbbauchunke oder Pechschnecke in freier Wildbahn. Wenn man den Tatort fluchtartig verlassen musste, hinter einem die Bullen, vor einem eine Straßensperre, linker Hand der See und rechter Hand ein Berg, dann blieben schließlich kaum Möglichkeiten, sich rasch seiner Beute zu entledigen. Außer direkt an der Straße. Und wenn man dann auch noch mit dreckigen Händen und lehmverkrusteten Schuhen verhaftet wurde, sollte doch selbst vorsätzlichen Intelligenzverweigerern klar sein, dass man kurz zuvor noch in der Erde gewühlt hatte.
Dem war allerdings nicht so gewesen. Sie hatten sein Auto zerlegt, seinen Magen geröntgt, den Stuhlgang untersucht und ihn auf Schritt und Tritt observiert, was angesichts seiner eingeschränkten Bewegungsfreiheit während der Untersuchungshaft ohnedies im Sitzen zu bewerkstelligen war, aber da lag der Klunker längst unter dem Busen wildwüchsiger Natur. Exakt tausendachthundertsiebenundachtzig Tage lang hatte sein Schatz in diesem von Brennnesseln überwucherten Grab geruht, nun würde er ihn endlich wiederauferstehen lassen. Und dank ihm ein neues, sorgloses Leben beginnen.
Doch als Alex sich der alten Villa mit der verwitterten Holzfassade näherte, schlug sein Enthusiasmus in Entsetzen um. Das einst verwilderte und verwahrloste Anwesen sah richtiggehend gepflegt aus. Das Haus war sauber verputzt, der Garten eine blühende Oase und die Brennnessel vor der morschen Veranda verschwunden. Noch schlimmer als der Anblick der ganzen Blumen, Büsche und Zierstauden traf ihn allerdings das riesige Aufgebot an Fahrzeugen der Funkstreife, die rund um das Grundstück parkten.
Die Schweißdrüsen des Ex-Knackis liefen zur Höchstform auf. Fünf Jahre lang hatte niemand etwas von seinem geheimen Versteck geahnt, aber kaum machte er sich auf, um seine hochkarätige Pensionsvorsorge aus ihrem erdigen Schließfach zu holen, schien das Anwesen auf einmal unter Polizeischutz zu stehen.
Obwohl der Juwelendieb noch meterweit von seinem Ziel entfernt war, fühlte er sich umgehend unter Beobachtung. Sein Gehirn rotierte im Schleudergang. Was machten die Bullen hier? Die konnten doch unmöglich von seinem Versteck wissen! Hatte er vor lauter vorfreudiger Entlassungsaufregung etwa im Schlaf gesprochen? Oder hatte der offensichtlich neue Hausbesitzer mit maximaler gärtnerischer Energie eine Umgrabungsoffensive gestartet und war dabei versehentlich auf das Kleinod gestoßen? Alex fand einfach keine Erklärung für diesen Aufruhr. Und die Bullen fragen war keine Option.
Missmutig wollte er bereits kehrtmachen, als ihm ein weibliches Walking-Geschwader wild gestikulierend entgegenkam. Zögernd trat er ihm in den Weg. »’tschuldigung, können Sie mir sagen, was da passiert ist?«, fragte er so freundlich wie möglich.
»Er will wissen, was da passiert ist«, äffte ihn eine walrossförmige Matrone mit Storchennestfrisur und Schweißflecken unter den Achseln lachend nach.
»Der muss auf dem Mond leben«, meinte eine andere in einem pink-gelb-blitzblauen Joggingensemble, dessen Anblick Augenkrebs verursachte.
»Nicht auf dem Mond, hinter dem Mond«, korrigierte eine dritte.
Alex bedauerte sein freundliches Lächeln, murmelte ein »Dann eben nicht« und drehte sich um.
»Kaufen Sie sich halt eine Zeitung!«, rief ihm eine der pseudosportlichen Schreckschrauben noch nach.
Und das tat er auch.
Im Haus der Blumburgers hingegen herrschte derweil bereits Friedhofsstimmung. Elli, die frisch verwitwete Gattin des Gartenidols, sah – botanisch ausgedrückt – wie eine Mischung aus Trauerweide und Tränendem Herzen aus, Sophie, die gemeinsame Tochter, erinnerte eher an eine verblühte Engelsträne, zart, zerbrechlich und mit weißem Gesicht, bis auf die vom Weinen geröteten Augen.
Selbst die anwesenden Polizisten machten eine traurige Figur. Sah man vom aufgefundenen Projektil einmal ab, das einer gängigen Jagdwaffe entstammte, hatten sie weder Spuren im Wald gefunden noch Hinweise aus der Bevölkerung erhalten. Und da es sich beim Opfer betrüblicherweise um eine im ganzen Land bekannte Berühmtheit handelte, bestand nicht die geringste Hoffnung, den Fall als ungeklärten Jagdunfall mit tödlichem Ausgang bald zu den Akten zu legen. Wobei die einheimischen Waidmänner nach wie vor jeden Vorwurf aufs Vehementeste bestritten und die Kugel tatsächlich aus keiner im Land registrierten Waffe stammte.
»Das waren nicht wir, das war ein Mord«, hatte der Revierjäger von Straßfelden wütend erklärt, »und den wollen s’ uns in die Schuhe schieben.« Was nicht ganz von der Hand zu weisen war.
Also fahndete die Polizei nicht nur nach einem unbekannten Jagdfreund, der zu viel Zielwasser getrunken hatte, sondern auch nach erklärten Feinden des Biogärtners. Die Suche gestaltete sich allerdings verworrener als jeder Schnittmusterbogen.
»Die von dieser Chemiefirma, die diese ganzen giftigen Unkrautvernichter herstellen«, Elli wies mit zitternder Hand vage über den See, »die haben meinen Mann bestimmt gehasst. Er hat ihnen ja das ganze Geschäft ruiniert, weil er für alle Probleme eine natürliche Lösung hatte.«
Natürlich konnte die Witwe nicht ahnen, wie nahe sie der Wahrheit mit ihrer Vermutung gekommen war. Allerdings hatten Grubinger & Grosz ja zu vergiftetem Mehl und nicht zu einer Waffe gegriffen, mit der sie ohnedies nicht hätten umgehen können.
»Der Fassold Fritz hat den Papa auch nicht gemocht, der war total neidisch auf ihn, weil der Papa sich besser ausgekannt hat als er«, schniefte Sophie.
Besagter Neidhammel war der mediale Konkurrent vom Blumburger, der bis zu dessen Auftreten die Nummer eins für botanische Themen in Fernsehen, Radio und Zeitung gewesen war. Doch der Biogärtner hatte ihm Rang und Reichweite abgelaufen. Nur blöd, dass der Fassold ausgerechnet zum Tatzeitpunkt im Krankenhaus gelegen hatte, weil er beim Rückschnitt eines Blauregens von der Leiter gestürzt war.
»Und sonst fällt Ihnen niemand mehr ein?«, fragte der älteste der vier anwesenden Inspektoren.
»Die Nachbarn, mit denen hatten wir anfangs auch viel Streit. Wegen der Brennnessel. Dem Wildwuchs. Weil wir die Forsythien ausgerissen haben. Das haben sie nicht verstanden«, antwortete die Witwe schluchzend.
Aber heute verstanden sie es. Es gefiel ihnen sogar. Und von den Verdächtigen besaß keiner einen Waffenschein.
»Ich hab dem Papa immer gesagt, er soll nicht so viel querfeldein laufen, das ist gefährlich.« Sophie hatte zwar eher an einen verstauchten Knöchel oder einen Herzinfarkt gedacht, aber letztlich mit ihrer Sorge recht behalten.
Da der sportliche Pflanzenflüsterer meist zur gleichen Zeit und auf denselben Pfaden seine schweißtreibenden Runden gedreht hatte, hätte ihm durchaus jemand auflauern können. Aber wer? Und warum?
Fragen, auf die die Betroffenen nie eine Antwort erhalten sollten, denn der Unglücksschütze und die FFLV-Front brachen ihr Schweigegelübde bis an ihr Lebensende nicht.
Nach diesem ersten bedauerlichen Vorfall legte das Schicksal fast achtundvierzig Stunden lang eine Pause ein, dann brach erneut die Hölle los.
Alex, der dank eifriger Zeitungslektüre das Rätsel der Polizeiinvasion auf dem Grundstück der alten Seevilla gelöst hatte, hatte bereits einen neuen Plan zur Hebung seines Schatzes gefasst. Da er wegen des gewaltsamen Todes des Hausbesitzers rund um die Uhr mit unliebsamer Polizeipräsenz rechnen musste, blieb ihm für seine Grabungsarbeiten im Grunde nur die Zeitspanne, in der das Begräbnis stattfinden sollte. Bestimmt würde auch die Polente an den Feierlichkeiten teilnehmen, Täter neigten ja angeblich dazu, der Verabschiedung ihres Opfers beizuwohnen.