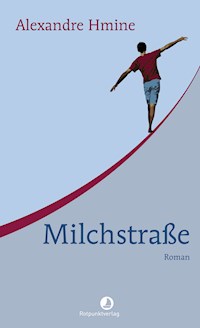
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Blau
- Sprache: Deutsch
Ein Junge mit marokkanischen Wurzeln kommt im Tessin zur Welt und wird in die Obhut einer alten Witwe gegeben, Elvezia. Die spricht Dialekt, klappert mit ihren Zoccoli durchs Haus, wärmt dem Jungen die Milch für die Ovomaltine, sie lehrt ihn das Vaterunser und näht jedes Jahr ein neues Karnevalskostüm. Bei Elvezia ist sein Zuhause. Und draußen, da wartet ein ganzes Dorf mit Schnee bis in den Frühling hinein, mit tausend Spielen auf der Piazza, einer Bude im Wald, dem Einkaufsladen, dem Fußballplatz. Als seine Mutter ihn dann das erste Mal mit nach Marokko nimmt, erwartet ihn dort eine andere Familie, die eine fremde Sprache spricht und ihn einem seltsamen Ritual unterzieht. In dem Kind regen sich erste Zweifel. Auf dem Dorffest schmeckt die Wurst nicht mehr; Schweine fressen ihre eigene Kacke, hat die Mutter gesagt. Auch irritierend, dass er plötzlich aus dem Religionsunterricht geholt wird. Und wozu nur soll er Arabisch lernen? Alexandre Hmine lässt mit starken Bildern und Momentaufnahmen eine Kindheit und Jugend vorbeiziehen, in der sich immer mehr ein Zwiespalt auftut. Zwischen zwei Welten hin- und hergerissen, droht der Heranwachsende die Balance zu verlieren, Identität und Zugehörigkeit stehen auf dem Prüfstand. Ein Entwicklungsroman unserer Gegenwart, originell erzählt und preisgekrönt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Junge mit marokkanischen Wurzeln kommt im Tessin zur Welt und wird in die Obhut einer alten Witwe gegeben, Elvezia. Die spricht Dialekt, klappert mit ihren Zoccoli durchs Haus, wärmt dem Jungen die Milch für die Ovomaltine, sie lehrt ihn das Vaterunser und näht jedes Jahr ein neues Karnevalskostüm. Bei Elvezia ist sein Zuhause. Und draußen, da wartet ein ganzes Dorf mit Schnee bis in den Frühling hinein, mit tausend Spielen auf der Piazza, einer Bude im Wald, dem Einkaufsladen, dem Fußballplatz.
Als seine Mutter ihn dann das erste Mal mit nach Marokko nimmt, erwartet ihn dort eine andere Familie, die eine fremde Sprache spricht und ihn einem seltsamen Ritual unterzieht. In dem Kind regen sich erste Zweifel. Auf dem Dorffest schmeckt die Wurst nicht mehr; Schweine fressen ihre eigene Kacke, hat die Mutter gesagt. Auch irritierend, dass er plötzlich aus dem Religionsunterricht geholt wird. Und wozu nur soll er Arabisch lernen?
Alexandre Hmine lässt mit starken Bildern und Momentaufnahmen eine Kindheit und Jugend vorbeiziehen, in der sich immer mehr ein Zwiespalt auftut. Zwischen zwei Welten hin- und hergerissen, droht der Heranwachsende die Balance zu verlieren, Identität und Zugehörigkeit stehen auf dem Prüfstand. Ein Entwicklungsroman unserer Gegenwart, originell erzählt – und preisgekrönt.
Alexandre Hmine
Milchstraße
Roman
Aus dem Italienischen von Marina Galli
Die Übersetzerin, die Mentorin Barbara Sauser und der Verlag bedanken sich dafür.
Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
Die Originalausgabe ist 2018 unter dem Titel La chiave nel latte bei Gabriele Capelli Editore erschienen.
© 2018 Gabriele Capelli Editore, Mendrisio
© 2021 Edition Blau im Rotpunktverlag, Zürich (für die deutschsprachige Ausgabe)
www.rotpunktverlag.ch
www.editionblau.ch
Lektorat: Daniela Koch
eISBN 978-3-85869-906-0
1. Auflage 2021
Für meine Familie
»Es ist schon spät. Geh heim zu deiner Frau, Berto.«
Umberto Saba, Drei Gedichte für meine Amme
Inhalt
Milchstraße
Im Text verwendete arabische Wörter
Casablanca, Flughafen Mohammed V, 1395 Hidschri. Eine Marokkanerin besteigt ein Flugzeug nach Europa. Sie ist siebzehn und schwanger. Sie flieht, um der Unehre zu entkommen.
In der Schweiz wird sie von ihrer Schwester erwartet, die dort seit einigen Jahren verheiratet ist.
Vezio, Kanton Tessin, 1976. Sieben Monate nach der Geburt gibt die junge Mutter ihren Sohn in die Obhut einer alten Witwe.
Ich sehe Elvezia. Das Haar grau, nach hinten gekämmt und mit Haarspray fixiert, eng zusammenliegende, funkelnde Augen, hervortretende Halsadern. Sie trägt einen dunklen, knielangen Rock, Wollstrümpfe und Zoccoli. Sitzt krumm am Tischende. Ich sehe auch die Tante und ihren Mann dort in der Stube vor der Anrichte stehen. Sie ist schwarz angezogen. Auf ihrer Mischlingshaut glänzt Gold. Er trägt ein helles Hemd und hat eine Glatze.
Alle blicken nach unten. Sie lächeln liebevoll. Blicken zu mir auf dem Teppich. Ob ich sitze oder liege, weiß ich nicht.
Vielleicht ist es auch nur ein Foto, vielleicht hat meine Mutter es aufgenommen.
Ich sehe die Gitterstäbe des Betts, die abgeblätterte Wand, das Zimmer im trüben Licht. Es ist stickig. Der Boden knarrt unter Elvezias Zoccoli. Sie trägt ein weißes, geblümtes Nachthemd. Tritt ans Bett, nimmt das weggestrampelte Duvet und deckt mich bis zu den Schultern zu. Ich sage nichts. Rolle mich auf die Seite, schiebe die Arme zwischen die Knie und warte.
Sie krault meinen Nacken. Das mag sie, sie mag es, meine Locken unter der Handfläche zu spüren. Ich hingegen mag es, mit den Fingern über ihren Handrücken zu fahren, dem Lauf ihrer Adern zu folgen, ab und zu vorsichtig draufzudrücken.
Die Umrisse und Farben entschwinden. Ich höre Elvezia:
»Dein Wille geschehe. Wie im Himmel so auf Erden …«
Gedämpft dringen ihre Worte zu mir, vielleicht weil ich den Kopf unter die Bettdecke gezogen habe oder weil ich allmählich einschlafe. Ich kann sowohl das Vaterunser als auch das Ave Maria. In Gedanken spreche ich mit:
»Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern …«
Ich höre sie jeden Tag. Manchmal bittet mich Elvezia, sie mit ihr zusammen aufzusagen, oft sonntags vor dem Essen, oder sie spricht sie alleine, flüsternd und mit gesenktem Kopf.
»Und führe uns nicht in Versuchung …«
Ich höre, wie der Fußboden knarrt. Wie die Bettfedern quietschen. Elvezia zieht an der Kordel. Alles wird schwarz.
Amen.
Ich spiele im Hof. Sehe den Flickenasphalt. In einer Ecke mein Dreirad. Das leuchtende Blau der Fensterläden, halb geschlossen, damit die Sonne in der Stube nicht blendet. Den Blechbriefkasten an der Wand. Die Haustür – die Maserung des hellen Holzes –, das Mattglas. Das gekippte Badezimmerfenster. Die imposante, graue Fassade des Hauses, das unseren Hof auf der anderen Seite begrenzt. Die Gartenmauer und die spitzen Gitterstäbe. Den Schuppen, wo das Holz gestapelt ist. Die Treppe hinunter zum Gemüsegarten.
Vielleicht jage ich der Katze nach.
Hinter dem Maschendraht ein weiteres Nachbarhaus – die Stockwerke kann ich nicht zählen –, ein Baum, der mitten im Garten steht, und hohes, wucherndes Gras. Diesseits des Zauns ein Zipfel Erde, auf dem Elvezia Salat anpflanzt, und die erste Stufe einer zweiten Steintreppe.
Vielleicht bin ich gestolpert.
Ich purzle hinunter.
Unten an der Treppe rufe ich. Die Hände sind aufgeschürft, Blut tropft, die Schläfen pochen vor Schmerz. Heulend rufe ich Elvezia.
Ich sitze auf ihrem Schoß. Keinesfalls den Rotz hochziehen, wehe dir. Bofagh sü, draufpusten, sagt sie und schmiert meine Beule mit Euceta ein.
Ich nehme die Rolle weg, öffne die Balkontür und setze meine Stiefel in den frischen Schnee. Atme die klare, reine Luft ein und bewundere die Aussicht: Die Berge verschmelzen mit dem milchigen Himmel und den Flächen der Felder. Ich trete ans Geländer. Streiche über die weiche Schneeschicht. Mit dem Unterarm fege ich einen Teil hinunter. Auch die Straße zur Piazza liegt unter einer weißen Schneedecke – ein langer, noch unberührter Pfad. Der Sohn der Bauernfamilie ist damit beschäftigt, einen Weg durch den Hof zu schaufeln.
Wie schön der Schnee, der auf den Stromleitungen liegen bleibt.
Ich gehe ans Balkonende. Die Sicht auf die Hauptstraße ist versperrt, weil der Pflug einen Schneehaufen aufgetürmt hat. Den Maschendraht erkenne ich gerade eben noch. Weiter oben lassen sich ein paar Felsen, der Lattenzaun vom Spielplatz und ein Baum erahnen.
Ich renne auf die andere Seite. Betrachte den ganz weißen Nachbargarten: Die Schneeschicht gleicht die Unebenheiten des Bodens aus, verdeckt die Pflanzen und das Gelände. Vom Kirchturm lese ich die Uhrzeit ab. Bis die Bar aufmacht, dauert’s noch.
Ich ziele auf Elvezia. Werfe einen frischen Schneeball. Ich treffe nicht, erschrecke sie aber. Keuchend dreht sie sich um, massiert sich den Rücken. Ich soll mich gefälligst gut einpacken, schimpft sie, beißend kalt sei es. Dann schaufelt sie weiter.
Ich sehe die akkurat zusammengefalteten Stoffservietten, die orange Ovomaltinedose und die Zuckerschale aus Steingut, die beiden Teller, auf denen Elvezia Zwieback vorbereitet hat. Sie sind mit Butter und Marmelade bestrichen – Erdbeer, Kirsch, Brombeer oder Zwetschge. Ich muss auf Elvezia warten und darf nicht mit dem Stuhl schaukeln, Rücken gerade, Hände auf dem Tisch. Stecke die Serviette in den Pyjamakragen.
Ich höre ihre Zoccoli über die Fliesen schleifen. Sie trägt die dampfenden Tassen an den Tisch. Meine stellt sie neben den Teller, dann streut sie das Ovomaltinepulver ein und mahnt mich zu pusten, es sei heiß. Aber warum sollte ich es eilig haben?
Ich gehorche und puste.
Während wir warten, erzählt sie mir von ihrem verstorbenen Mann – er hat das Haus gebaut, in dem wir wohnen –, Geschichten aus ihrer Kindheit, von den beschwerlichen Fußmärschen zur Schule, von ihren Lehrern und den riesengroßen Klassen.
»Ein Hirn wie ein Sieb!«, tadelt sie sich, wenn ihr Gedächtnis sie im Stich lässt.
Ich höre ihr gern zu.
Gedankenverloren pfeife ich vor mich hin. Elvezia runzelt die Stirn, ihr Blick verdüstert sich und sie mahnt:
»Ruhe! Am Tisch wird weder gepfiffen noch gesungen!«
Ich kann mir das Lachen nicht verkneifen. Jetzt reicht es ihr aber: »Noch einen Mucks«, droht sie und fixiert mich, »und ich zieh dir die Ohren lang!«
Vom Kindergarten ist nicht viel zu sehen, aber ich schaue jedes Mal hin, wenn wir daran vorbeifahren. Schon von Weitem habe ich die Hecke und die Postauto-Haltestelle im Blick. Dann erspähe ich das Gittertor, den Eingang und ein Stück der Rutsche – oder ist es die Schaukel? Das Gebäude markiert eine Grenze, von hier an fällt die Straße steil ab – das Auto wird schneller –, die Häuser weichen den Bäumen, werden seltener.
Ich drehe mich um und sehe die freiliegende Fassade die kleinen Fenster den Spielplatz die grünen Hänge.
Ich gehe durch den kurzen Korridor bis zu meinem Fach. Hänge den Beutel an den Haken und setze mich auf die Bank.
Auf meinem Kittel taste ich den Umriss des aufgenähten Häuschens ab.
Rechts liegt das hell beleuchtete Zimmer, wo die Staffeleien stehen. Hier male ich blaue Himmelstreifen, halbkugelige Sonnen, Strahlen, die bis ins Weiße hinunterreichen, noch mehr Häuser, rauchende Schornsteine.
Links ein quadratischer Mehrzweckraum.
Von der Liege nebenan breitet sich Uringeruch aus.
Heute kommt der Nikolaus mit den dicken Stiefeln. Er fährt mit dem Traktor vor.
Wir singen:
»Lasst uns froh und munter sein …«
Wir sitzen auf den Bänken und warten, bis wir an der Reihe sind. Er ruft uns mit Namen auf. Verteilt prall gefüllte Säckchen voller Erdnüsse, Mandarinen, Marzipan und Schokolade.
Lustig, lustig, traleralera. Auf den Teller hat er nichts gelegt.
Ich will unbedingt herausfinden, wer sich unter dem weißen Bart versteckt, meine ganze Fantasie biete ich auf. Jemand behauptet, es zu wissen.
»Wer ist es?«
»Geheimnis«, sagt er und fährt sich über die Lippen, als würde er einen Reißverschluss zuziehen.
Ich knie auf dem Teppich in der Stube und lege bunte Magnetbuchstaben aneinander, in der Hoffnung, dass sich ein Wort ergibt. Irgendjemand hat sie mir geschenkt. Elvezia sitzt im Sessel neben dem Ofen und liest die Libera Stampa. Vor dem Umblättern befeuchtet sie sich die Fingerkuppe. Hin und wieder lässt sie die Zeitung sinken und beugt ihren Kopf nach vorn, um mich über den Brillenrand hinweg anzusehen. Durch die beiden Fenster scheint die Nachmittagssonne herein.
Ich wühle im Haufen, hebe einen Buchstaben auf, überlege, ob ich ihn nehmen soll und wohin er kommt, will, dass Elvezia zu mir schaut, und frage sie, was ich geschrieben habe. Sie hat mir geraten, kurze Wörter zu schreiben – vier, höchstens fünf Buchstaben – und Vokale zu gebrauchen, aber meistens lege ich lange Reihen voller Konsonanten. Ich höre nicht auf sie, weil sie so lustig reagiert, wenn das Resultat unaussprechbar ist.
ASDFGHJKL
Sie lacht laut heraus, schüttelt den Kopf:
»Nein, mein Kind, doch nicht so.«
Also mische ich die Buchstaben wieder und fange von vorne an: Konsonant, Vokal, Konsonant, Vokal.
MAMA
Elvezia schaut zu. Liest und korrigiert.
Im Ofen knistert das Holz. Ich sehe das Gusseisen und das orange Rechteck. Das Metallrohr, das nach einem Bogen in der Wand verschwindet. Ich liege auf einer Decke, die Beine über die Sessellehne gestreckt. Auf dem anderen Sessel döst die Katze. Draußen ist es dunkel.
Neben der Nähmaschine mit Tretantrieb steht ein kleines Radio. Schwarz ist es, breiter als hoch. Vier weiße Zahlen, die herunterklappen, zeigen die Uhrzeit an.
Normalerweise schaltet Elvezia es an, wenn sie die Nachrichten hören will, oder am Sonntagnachmittag. Wegen der Sprachsendung La costa dei barbari.
Es ist nicht Sonntag, es muss ein Samstag sein. Ich höre die Übertragung der Schweizer Eishockeymeisterschaft. Mein Lieblingsklub ist der HC Lugano. Ich nicke ein. Die Stimme des Kommentators wird lauter und reißt mich aus dem Schlaf.
»Ab ins Bett«, sagt Elvezia.
Meine Lieblingszahl ist die Neun. Wir gucken nach, noch bevor wir uns hinsetzen. Wir stürmen hinein, heben das Glas hoch und rufen:
»Sieben!«
»Eins!«
Ich sehe die roten Fliesen, aneinandergereihte Tische und die beiden Türen. Ganz hinten die Küche – ich kann das Mittagessen schon riechen. In meinem Rücken weitere Tischreihen voller hungriger und lärmender Kinder und über die ganze Längsseite dort oben die kleinen Fenster, durch die Licht in den Saal dringt.
»Neun!«
»Du Glückspilz!«
Ich esse gern in der Schulmensa. Nudeln mit Schinken-Rahm-Soße. Fischstäbchen, die ich in Mayonnaise tunke. Schokoladenpudding.
»Tauschen wir?«
Ich trinke den Grapefruitsaft.
Nervig ist nur, wenn man mit dem Abräumen dran ist.
Er sollte jeden Moment eintreffen. Ich warte im Hof. Ein Abend im späten Frühling. Die Sonne ist noch nicht untergegangen. Ich kicke den Ball gegen die Mauer. Mit rechts, mit links. Mit dem Linken bin ich besser.
Ich erkenne das Auto. Endlich ist er da, der Nachbar von gegenüber. Er bremst ab und parkt in der Einfahrt, neben unserem Schuppen. Ich bin ganz zappelig. Lasse den Ball in eine Ecke des Hofs kullern, laufe zum Tor und mache ihm auf.
Und da ist auch er. Der Nachbar hat den Fernseher zwischen Arme und Brust geklemmt und greift nach einer Tüte mit einer Schachtel.
»Na, hallo du«, ruft er mir zu, als er mich bemerkt.
Ich erwidere seinen Gruß und halte ihm auch die Haustür auf.
»Jemand zu Hause?«, ruft er, als er durch den Korridor geht.
Sie hat uns gehört. Elvezia tritt aus der Kochecke und begrüßt ihn, dann gehen wir alle in mein Zimmer. Er kümmert sich darum, den Apparat zum Laufen zu bringen. Nachdem er ihn auf der Kommode platziert hat, verlegt er das Kabel, richtet die Antenne, schaltet ihn ein und beginnt, die Sender einzustellen.
»Kriegst du auch bestimmt keinen gewischt?«, fragt Elvezia.
Was bleibt, ist das Grau, das ins Blaue aufsteigt – ein Rauch ohne Feuer –, und die Aufregung. Es verblassen sogar die Fähnchen mit dem Schweizerkreuz die Treppe die Kirche die Felsen die Bäume das grüne Gras.
Wir feiern den Geburtstag des Vaterlands.
Wo bin ich? Auf der Wippe? Auf dem Karussell? Im Sandkasten? Auf der Schaukel? Auf den Stufen des Mini-Theaters? Auf der Wiese? Oder ich sause rastlos hin und her.
Und die Hunde? Ich sehe sie nicht wild herumspringen, sich in den Maschendraht verbeißen, ich höre sie nicht bellen.
Der Rauch wird dichter.
Dieses Jahr habe auch ich etwas beigetragen. Elvezia hat mir ein Holzscheit mitgegeben.
»Guck, die Katze tanzt allein, tanzt und tanzt auf einem Bein. Kam der Hase zu der Katze, bitte reich mir deine Tatze. Mit dem Hasen tanz ich nicht: Ist mir viel zu zappelig!« An dieser Stelle macht die Lehrerin Hasenohren.
Wir bilden einen Halbkreis, sitzen im Schneidersitz auf dem grünen Spannteppich. Die Bänke hinter uns sind hufeisenförmig aufgestellt. Die schwarzen Augen der Lehrerin, reglos im Weißen. Schneeweiße Haut. »Guck, die Katze tanzt allein …«, jetzt lächelt sie. Dann beginnt sie in die Hände zu klatschen.
Wir machen es ihr nach.
Ich spiele auf den kalten Fliesen des Korridors. Auf der einen Seite des Spielfelds habe ich Kartonstreifen mit Klebeband befestigt, um die beiden Ecken abzurunden. Und auf der anderen Seite stehen meine Pantoffeln, um den Puck aufzuhalten. Die Tore habe ich aus abgebrochenen Farbstiften, weiterem Karton und Orangennetzen gebastelt. Mit bunter Malkreide habe ich die Abwehrzonen und die Mittellinie aufgezeichnet. Den Puck hat Elvezia beigesteuert: ein schwarzer Knopf, einer von den dicken. Drei oder vier zusammengesetzte Legosteine sind die Spieler. Auf den Rückseiten habe ich mit schwarzem Stift Trikotnummern hingeschrieben. Die Mannschaften, die gerade nicht spielen, ruhen sich am Rand, unter der Garderobenleiste, aus.
Heute trifft der HC Lugano auf Davos. Ich bewege die Spieler und mache gleichzeitig die Berichterstattung:
»Die Bündner kämpfen verbissen … Ein unerlaubter Befreiungsschuss … Zwei Strafminuten für einen Stockschlag … Tor!«
»Mach nicht so’n Krach!«
Elvezia reklamiert, ihr Hörgerät fange an zu pfeifen, wenn ich so rumschreie. Sie kocht Pudding. Ich rieche das Karamell und höre, wie der Stabmixer gegen den Topfrand schlägt.
Ich senke die Stimme.
Plötzlich verdunkelt sich das Mattglas. Da kommt jemand. Ich muss unterbrechen. Eine Freundin von Elvezia tritt zur Tür herein.
»Pardon«, entschuldigt sie sich und versucht, durch den Korridor zu gehen, ohne auf die Spieler zu treten. Ich richte die Banden und die Tore wieder auf. Lasse in der Spielfeldmitte anspielen.
»Bob Hess schlängelt sich erfolgreich durch die gelbblaue Verteidigung und versenkt den Puck im Netz.«
Auch wenn es zwei kleine Dorfläden gibt, kaufen wir fast nur in einem ein, dem an der Hauptstraße neben der Bar. Man muss eine kleine Treppe hochsteigen und dann einige Meter am Laden entlanggehen. Elvezia hat mich beauftragt, ein Brot zu kaufen, un lunghìn.
An der Metalltür ist die Farbe an mehreren Stellen abgeblättert. Ich öffne sie und höre die Glocke. Jetzt weiß die Frau vom Laden, dass jemand da ist. Sie wohnt im ersten Stock und ist alt. Manchmal hört sie nichts, dann muss man warten und rufen oder die Tür von innen aufmachen, damit die Glocke ein zweites Mal bimmelt. Der Raum ist eng. Überall ist Ware aufgestapelt. Das Brot aber sieht man nicht, sie lagert es im Hinterzimmer. Die Süßigkeiten schon, die sind auf dem Tisch zu meiner Linken und auf der Theke ausgestellt: Smarties, Sugus, Chupa Chups, Schokoladentafeln – am besten schmeckt mir Milchschokolade.
Man könnte fast auf die Idee kommen zu klauen, so lange dauert es.
»Große Uhren machen tick tack, tick tack …«
Ich habe ihr sowohl den Text als auch die Choreografie beigebracht.
»Kleine Uhren machen ticke tacke, ticke tacke …«
Wir singen und klatschen im Takt mit.
»Und die kleinen Taschenuhren machen …«
Elvezia sitzt im Sessel neben dem Ofen. Ich stehe vor ihr. Werde immer schneller, ticke tacke, bis sie mir, ticke tacke, nicht mehr folgen kann. Ticke tacke! Ticke tacke! Ticke tacke!
Das Telefon klingelt: ein schriller Ton. Ich raffe mich auf, um abzunehmen. Sehe das karierte Deckchen – weiß und orange – und den grauen Apparat auf dem kleinen Tisch in der Ecke meines Zimmers.
Ich höre ihre sanfte und liebevolle Stimme, die fragt, wie es mir geht, ob ich etwas brauche, die sagt, morgen komm ich dich besuchen, die wissen will, ob ich glücklich bin.
Das WC ist sehr eng. Die Tür ist ramponiert und hängt lose in den Angeln. Sie quietscht und wackelt. Man kann sie nur anlehnen. Manchmal geht sie mit einem Luftzug wieder auf, manchmal, weil jemand anderes hineinwill. Die Kloschüssel steht quer zur Tür. Ich will nicht, dass man meinen Schniedel sieht: Wenn ich pinkle, rücke ich vorsichtshalber mein linkes Bein vor und schiebe mein Becken nach rechts hoch.
Elvezia hat Blumen und die Gießkanne mitgenommen. Ich versuche, meinen neuen Ball – einen weiß-schwarzen Tango – auf dem Kopfsteinpflaster zu führen. Er rollt mir weg, vor allem da, wo die Straße abschüssig wird. Wir begegnen niemandem, nur ein paar streunenden Katzen. Das letzte Stück ist zu steil, unmöglich, den Ball unter Kontrolle zu behalten. Ich nehme ihn in die Hand.
Das Gittertor ist rostig. Um es zu öffnen, muss ich kräftig mit der Schulter dagegenstoßen. Ich trete ein, lasse den Ball auf den Boden fallen, setze mich drauf und warte auf Elvezia. Sie hat sicher beim Brunnen angehalten, um die Gießkanne mit frischem Wasser zu füllen.
Da kommt sie. Bevor sie den Friedhof betritt, hält sie sich am Tor fest und holt Luft. Massiert sich den Rücken, dort, wo sie Schmerzen spürt.
Jetzt kniet sie vor dem Grab ihres Manns. Im Zickzack zwischen den Grabsteinen übe ich dribbeln.
Zu wenig Platz, zu viel Kies. Beschleunigen und lenken gleichzeitig ist gar nicht so einfach.
Auf dem gepflasterten Weg, der den Friedhof in zwei Teile trennt, versuche ich, den Ball in der Luft zu halten.
Kopfbälle sind schwierig.
Der Lehrer hat uns auf dem grünen Teppich versammelt. Wir sitzen im Kreis. Zählen und rechnen find ich gut. Ich habe es schnell gelernt. Zu Hause übe ich, zusammen mit Elvezia oder alleine. Es macht Spaß, so schnell wie möglich bis hundert zu zählen, auf Italienisch oder Dialekt:
»Vün düu trii …«
Unser Klassenclown hingegen will nichts davon wissen, Stäbchen zu zählen und zusammenzufügen. Auch heute wirft er lieber damit um sich. Jedenfalls bis ihm der Lehrer einen Klaps verpasst.
Ich sehe mich dort im Morgenlicht, wie ich Stäbchen verschiebe und Zahlen vorsage.
Es sind immer achtzehn. Ich nehme eine Scheibe Schwarzbrot aus dem Körbchen und breche es in Stücke, um das letzte bisschen Soße aufzutunken. Elvezia bemerkt den übrig gebliebenen Raviolo auf meinem Suppenteller. Ich weiß, dass sie mich nicht zwingen wird, ihn aufzuessen. Sie hat es mittlerweile aufgegeben. Es sind immer achtzehn. Sie fragt nur:
»Isst du nicht auf?«
»Nein«, sage ich, »heute ist etwas durcheinander geraten, es waren neunzehn.« Sie lacht laut auf. Dann spießt sie den Raviolo auf ihre Gabel, lässt ihn auf ihren Teller fallen und schneidet ihn in der Mitte durch.
Die Hackfleischfüllung quillt hervor.
Ein warmer, sonniger Tag. Die Zuschauer stehen dicht gedrängt um das rechteckige Spielfeld oder sehen sitzend von den erhöhten Bänken an der Längsseite aus zu. In der Schule gelte ich als einer der Besten: Ich kann den Ball gut kontrollieren, kann gut dribbeln und schießen. Doch hier ist alles viel schwieriger. Ich spüre die Aufregung: Meine Mitspieler schaffen es nicht, einen Pass zu mir nach vorne zu schlagen, ich irre ziellos im Strafraum umher, und die gegnerischen Verteidiger kommen mir vor wie böse, unbezwingbare Riesen.
Die herumschreienden, anfeuernden, protestierenden Zuschauer lenken mich ab. Der Lehrer, der auch den Trainer spielt, will mehr Tempo und fordert uns auf, uns freizulaufen und nicht wie eine Herde Schafe dem Ball hinterherzurennen.
Ich bewege mich an der Abseitslinie und strecke den Arm hoch. Jemand sagt, man solle quello negro, diesen Neger da, decken.
Ein Aufschrei, dann bricht die Menge in tosenden Jubel aus. Ein paar Mitspieler kommen zu mir, feiern. Fallen über mich her. Meine Knie geben nach, ich sacke zusammen. Es werden immer mehr, auch die Ersatzspieler kommen und drücken mich auf den Rasen. Am Rücken tut’s weh, doch ich bin glücklich, ich bin der Held.
Der Schiedsrichter pfeift uns zurück. Basta, das Spiel geht weiter, wir müssen uns wieder in Stellung bringen. Ich richte mich auf und kehre, von Kreide und Erde beschmutzt, in unsere Spielfeldhälfte zurück, langsam, damit die Menge mich noch etwas länger feiern kann.
»Bravo, Juary«, gratuliert mir der Lehrer.
Hier, an der steilsten Stelle, gehe ich mitten auf der Fahrbahn. Wenn die Hunde anfangen zu bellen und direkt hinter dem Zaun herlaufen, weiche ich nach rechts aus. Weil sie mir Angst machen. Ich weiß, dass sie nicht darüberspringen können. Der Zaun ist zu hoch. Doch was, wenn sie ihn durchbeißen?
Ich laufe schneller. Hüpfe die Treppe zur Kirche hoch, biege nach links ab auf den Weg am Felsen entlang. Sehe rote Ameisen und ein paar davonhuschende Eidechsen. Es geht weiter bergauf, ich lege ein Stück auf Asphalt zurück, dann auf einer Schotterstraße und lande schließlich auf einem grasbewachsenen Pfad.
Rundherum ist, abgesehen vom Gelb des Löwenzahns und dem Weiß der Schneeglöckchen, alles grün. Ununterbrochen zirpen die Zikaden. Jetzt kann ich die Backsteinmauer sehen. Ich biege in den Wanderweg ein, noch ein paar Schritte den Waldrand entlang, und ich bin am Ziel.
Unsere Hütte ist fast fertig. Für die letzte offene Stelle am Dach müssen wir uns noch ein Wellblech besorgen.
Ich lege die Matte aus und setze mich.
Mein Freund sagt, diesem Franscini haben wir es zu verdanken, dass wir zur Schule müssen.
Er macht das Feuer an. Ich bereite die Cervelats vor.
Am Dreikönigstag werde ich bei der Aufführung der Pfarrei mitspielen. Ich darf eine der wichtigsten Rollen übernehmen. Den König Balthasar.
Ich stehe auf, um es mir aus der Nähe anzusehen. Das Kostüm gefällt mir gut. Ich streiche über den Stoff und frage Elvezia, ob sie heute noch damit fertig wird. Sie überlegt. Flehend blicke ich zu ihr, die Hände zum Gebet gefaltet, bis ich ihre Nase berühre. Sie nickt, trotz ihres verdrießlichen Blicks. Während sie näht, lege ich mich auf den Teppich und spiele mit Silvans Zaubertrickkiste.
Studiere die Ringe.
Doch ich kann mich nicht konzentrieren. Ich will wissen, was zur Hölle Weihrauch ist.
»’ne Pflanze«, sagt Elvezia und zieht sich eine Nadel aus dem Mund. »Lenk mich nicht ab, mein Kind.«
»Und Myrrhe?«
Elvezia überhört meine Frage. Stattdessen runzelt sie die Stirn. Ein Zeichen, dass ich ihr auf die Nerven gehe. Ich gebe auf und versuche mich weiter an den Zaubertricks. Der Zauberstab …
»Simsalabim!«
Ich sehe sie nicht, sehe sie noch nicht. Höre den Motor, als sie vor das Tor gefahren kommt. Das Hupen.
Die automatische Gangschaltung, als sie wieder anfährt. Nachdem sie bei der Post, wo die Straße breiter wird, gewendet hat, kommt sie zurück.
Die Päckchen stapeln sich am Fuß des Schemels, auf dem unser kleiner Baum thront. Bunte, blinkende Lichter beleuchten die Stube, aber auch der Schnee: Flocken so groß, dass das dunkle Fenster davon getupft ist. Ich in Pyjama, Wollsocken und Pantoffeln.
Ich sehe die geöffneten Türchen des Adventskalenders, die Schokolade ist verputzt. Nun widme ich mich den Päckchen. Hebe sie hoch, schüttle und drehe sie und versuche zu erraten, was sich in ihnen verbirgt. Die weichen sind vermutlich Kleider. Die mittelgroßen Schachteln Gesellschaftsspiele. Vielleicht genau diejenigen, die ich mir gewünscht habe: Risiko … Monopoly … Cluedo … Ich versuche mich auch zu erinnern, was Elvezia bekommt. Meine Mutter hat ihr einen Seidenschal gekauft, das weiß ich. Die Tante ein Fläschchen Eau de Cologne. Das größte Paket aber ist für mich. So riesig, dass wir es an der Wand aufstellen mussten.
Ich packe es aus.
Mitternacht ist schon vorüber. Ich beginne oben an einer Ecke. Nur weißer Karton. Aufgeregt reiße ich bis zum Boden weiter.
Ein Tischhockey. Fantastisch!
Ich will alle auf der Packung aufgedruckten Figuren sehen. Also reiße ich alles weg und lasse die Papierfetzen auf den Teppich fallen.
Von der Türschwelle aus beobachtet mich Elvezia, ihr Blick ist düster. Das Haar zerzaust. Ich sehe ihr Nachthemd, die bläulichen Adern auf ihren Waden, die Wollsocken und die Zoccoli.
Sie tadelt mich, weil ich das Papier zerfetzt habe, und befiehlt mir, es aufzuheben. Dann ab ins Bett, aber dalli!
Früh bin ich auf den Beinen. Klebe die Nummern auf. Stelle die Spieler auf ihre vorgesehenen Positionen. Richte Tore, Batterie und Lämpchen ein, die bei einem Treffer aufleuchten.
Den Puck lege ich in die Spielfeldmitte und fordere Elvezia zu einer Partie auf.
Sie faltet gerade das heil gebliebene Geschenkpapier zusammen. Vielleicht hat sie mich nicht gehört. Ich frage noch einmal, diesmal lauter. Ich solle nicht so rumschreien, sagt sie, sie habe schon verstanden. Nur habe sie keine Ahnung, wie man dieses Hockey spiele.
Ich sehe den grauen Schulbus, das Parkmanöver des Fahrers an dieser engen Stelle, die Eingangstür, den Wartebereich und meine Klassenkameraden, die von der Kontrolle zurückkehren und stolz ihren Preis herumzeigen – einen Apfel? Einen Aufkleber? Zahnpasta?
Meine Zähne gewinnen nie etwas. Jedes Mal brauche ich wieder eine neue Füllung. Jedes Mal die Nadel, die ins Zahnfleisch sticht, der Sauger, das unangenehme Geräusch des Bohrers und die Frage:
»Wie oft putzt du dir die Zähne?«
Nur wenn ich Lust habe, also fast nie. Nach den Mahlzeiten sagt Elvezia »I deenc, die Zähne!«, doch ich gehorche ihr selten. Gehe ins Bad, drehe den Hahn auf und spucke nach ein paar Sekunden ein wenig Wasser aus.
Und gut ist.
»Zwei oder drei Mal.«
Sie behaupten, ich bräuchte eine Zahnspange, ich soll es mit meinen Eltern besprechen.
Nein, nein.
Wenn keine Autos dort stehen, ist es lustiger, weil wir über den ganzen Platz rennen und dribbeln können, ohne befürchten zu müssen, irgendwelche Wagentüren zu verbeulen. Es gibt auch keine Unterbrechung wegen Bällen, die unter einem Auto stecken bleiben. Ärgerlich ist einzig die nah gelegene Schlucht. Am Abhang sieht man Balkenstücke, vermoderte Schuhe, Eimer, alle erdenklichen kaputten Spielsachen. Ganz unten sogar alte Möbel und verschimmelte Matratzen.
Ich laufe, so schnell ich kann, doch ich habe keine Chance, unmöglich, ihn einzuholen und zu stoppen. Der Ball rollt davon. Ich bleibe am Rand der Schlucht stehen, verschwitzt, außer Atem, sehe, wie er immer kleiner wird und ein letztes Mal aufspringt.
Ich zeige ihn den anderen.
Sie sind sauer. Jemand sagt:
»Jetzt musst du ihn holen!«
Da geh ich nicht runter. Ich habe Angst. Da gibt es Kreuzottern. Man hat keinen Halt. Es ist zu steil. Ich könnte abrutschen. Und wer weiß, ob ich wieder hochkäme?
Ich stehe in den Pedalen und trete fester, um Schwung zu holen, bevor es wieder steil hochgeht.
Das Fahrrad ist blau – ein dreigängiges Rennrad. Ich habe ein Stück Karton an die Gabel des Hinterrads gesteckt, das rattert beim Fahren. Am Lenker habe ich einen Tacho anbringen lassen.
Es ist einer jener Sommernachmittage, an denen die Sonne den Asphalt zum Glühen bringt und es besser wäre, bei geschlossenen Fensterläden zu Hause zu bleiben. Eine Bruthitze. Aber ich will es versuchen – ich habe es ihr versprochen –, will zu ihr fahren.
Ich radle über die Brücke und bereite mich auf den steilsten Abschnitt vor. Beschleunige. Hier spenden Berge und Bäume Schatten. Ich drücke den Schalthebel herunter und nehme den letzten Kilometer zum nächsten Dorf in Angriff. Das Atmen fällt mir immer schwerer, ich spüre die Anstrengung vor allem in den Beinen, ein wenig auch in den Armen. Ich sporne mich selbst an, mache mir Mut, nicht aufzugeben. Heute will ich nicht absteigen und schieben.
Ich bin oben. Kann wieder Luft holen, mich aufrichten, in den zweiten Gang schalten.
Beim Hinunterfahren kitzelt der Wind auf meiner Haut. Ich brauche nicht mehr in die Pedale zu treten. Kann den Moment genießen. Ich muss nur auf die Schlaglöcher und die trockenen Kuhfladen aufpassen. Bilde ich mir das bloß ein, oder ist sie es …
Ein langer, blonder Zopf, die schon hervortretende Wölbung ihrer Brust …
Tückische Kurven, hoch und runter, kleine Pause, um mich zu erholen und einen Schluck Wasser zu trinken.
Vergebens. Weil kein Hund bellt, das Auto nicht auf dem Parkplatz steht, alle Rollläden heruntergelassen sind.
Es ist eine feste Verabredung zwischen uns geworden. Ich richte die Antenne für das optimale Bild, rufe Elvezia und lege mich wieder hin. Ich höre, wie ihre Zoccoli über den Teppich schleifen, auf den Fliesen und dann auf den Holzdielen klappern.
Die Fensterläden sind geschlossen. Der Fernseher taucht mein Zimmer in schummriges Licht.
Da kommt sie. Ich ziehe die Decke weg, damit sie es sich auf der Bettkante gemütlich machen kann.
Ihr Gelächter, das oft in Hustenanfälle übergeht. Vor allem die Komiker haben es ihr angetan, Zuzzurro e Gaspare und D’Angelo mit dem Lied Has Fidanken. Den Ohrwurm von Greggio hingegen, wenn er sagt cerrrto che è lui, kann sie nicht ausstehen. Sie schüttelt den Kopf und kommentiert:
»Skandalös! … Du Trottel! … Makkaroni! … Esel!«
Ich mag die Showgirls, am meisten Tini Cansino.
Irgendwann schlafe ich ein.
Dieses Weiß kenne ich! Wie weiß das Mattglas ist! Ich laufe durch den Korridor und reiße die Tür auf. Die Schneeschicht, die sich über Nacht gebildet hat, ist fast so hoch, wie ich groß bin. Der Hof ein unüberwindbares Hindernis. Ich sehe die Spitzen der Gitterstäbe, die Gartenmauer aber nicht. Von der Fußmatte aus atme ich die reine Luft ein. Frage mich, wie man jetzt wohl zur Postauto-Haltestelle kommt.
Ich rufe Elvezia, sie soll sich das ansehen.
Weil sie mich nicht hört, gehe ich zu ihr in die Küche.
Sie habe es schon gesehen, sie werde sich später ums Schneeschaufeln kümmern, sagt sie.
Wie das?
»Es pressiert nicht«, beruhigt sie mich. Die Schulen bleiben heute sowieso geschlossen.
»Was?«
Dann breche ich in Jubel aus, als hätte Kenta Johansson den Puck ins Tor gepfeffert.
Ich laufe über die roten Fliesen, vielleicht gehen wir in Zweierreihen. Links die Stufen zur Ecke, wo wir uns bei Regen die Pausen mit unserer Art Hockey vertreiben: Auf dem glatten Boden rutschen wir auf den Knien herum, in der Hand einen Pantoffel, der unser Schläger ist, und versuchen, den Gummiball zu treffen. Zur Rechten eine Reihe von Garderobenständern, die oft für ein anderes Spiel gut sind: Sobald die Pausenglocke klingelt, darf keiner mehr mit den Füßen den Boden berühren, sonst ist man tot, hat verloren.
Wir gehen die Treppe hinunter, auch hier sind die Fliesen rot. Hinter der Glasfront der Sportplatz, noch einmal Stufen, der Wald, ein Himmelsstreifen.
Ganz hinten, da, wo es auf den Korridor unserer Klasse geht, schaltet man besser das Licht ein, bevor man um die Ecke biegt, wegen der zweiten, engen Treppe ohne Fenster.
Es soll ein Holzauto werden. Ich hasse Laubsägearbeiten. Mir gelingt keine gerade Linie, der Rand wird wellig, unsauber. Sofort tut mein Handgelenk weh.
Ich rufe den Lehrer und bitte ihn, mir zu helfen.
Wenn er an meinem Brettchen herumwerkelt und erklärt, wie ich vorgehen muss, kommt mir immer derselbe Gedanke: Soll er dieses Auto doch alleine fertig machen, dann wird es sowieso schöner.
Ich springe vom Holzschuppen herunter und bringe mich in Stellung, sodass ich alles überblicken kann. Sie winken mir zu, ich soll kommen, rudern mit den Armen, ermutigen mich. Jetzt ist der richtige Moment.
Ich laufe über den Kies. Renne, so schnell ich kann, durch die Arkaden hinunter auf die Piazza. Es ist fast geschafft. Die Befreiung naht, Einzelne wagen schon kleine Schritte in Richtung der abgehenden Straßen.
Ich schieße kräftig – ohne die geringste Angst, mir wehzutun – mit dem linken Fußrist. Die Büchse fliegt, kreist und kreist und landet im Brunnen. Ich höre den dumpfen Aufprall, die Freude jener, die davonlaufen.
Freiheit für alle!
Motorengeräusch. Die übliche halbe Stunde Verspätung. Sie hält an, hupt zweimal und fährt weiter.
Als sie bei der Post gewendet hat, stehe ich bereits auf der Hauptstraße und erwarte den weißen Range Rover.
Wir lassen das Ortsschild hinter uns. Die Straße verläuft eben bis zur Brücke, zwischen dem Grün und dem Grau der Felswände. Dann beginnt sie anzusteigen und macht beim Schießstand eine scharfe Kurve. An der grauen Mauer haben unachtsame oder waghalsige Autofahrer Spuren hinterlassen – schwarze Streifen, zerbrochene Backsteine.
Ich blicke zur verlassenen Autowerkstatt. Sehe die Plakate am Holztor: Chilbi, Tombola, Fußballspiele.
Und manchmal passiert es, dass man genau dort, wo die Straße eng ist, dem Postauto begegnet. Wir halten den Atem an. Schweißtropfen perlen meiner Mutter von der Stirn, sie schaut sich unruhig um, macht ruckartige Bewegungen, dreht die Musik leiser und flucht auf Arabisch. Ich versuche ihr zu helfen und passe auf, dass sie der Leitplanke nicht zu nahe kommt.
Der Busfahrer bedankt sich und grüßt.
Ohne zu wissen, wo ich bin, wache ich mit einem Fuß auf dem Kissen auf. Ich mag dieses Bett nicht, so groß, so hart, so tief. Das Zimmer mag ich auch nicht, obwohl es viel größer ist als meins. Es gibt keinen Fernseher, keinen Schrank. Nur einen Nachttisch, einen Garderobenständer und einen Spiegel. An der Wand eine Fototapete mit einer exotischen Landschaft – kristallklares Ozeanwasser, Palmen und Sand. Es ist das Gästezimmer.
Ich habe Hunger. Schlüpfe in meine Hausschuhe und gehe zum Zimmer meiner Mutter. Die Tür steht weit offen.





























