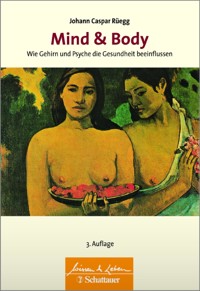
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schattauer
- Kategorie: Bildung
- Serie: Wissen & Leben
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Ein Buch aus der Reihe "Wissen & Leben". "Es ist der Geist, der sich den Körper baut" (Friedrich Schiller). Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Gehirn, Emotionen und Körper? Wie werden traumatische Erfahrungen erinnert; kann man sie löschen oder "überschreiben"? Wie beeinflussen frühkindliche Erlebnisse die Gesundheit? Und wie kann Meditation das Gehirn verändern? Die aktuellen Erkenntnisse der Hirnforschung, Immunologie und Genetik werfen zahlreiche spannende Fragen auf. Wissenschaftlich fundiert, anschaulich und unterhaltsam erklärt der bekannte Heidelberger Physiologe Johann Caspar Rüegg die komplexen Wechselwirkungen zwischen "mind" und "body" und wie man sie gezielt nutzen kann. Neue Denk- und Verhaltensweisen, aber auch spirituelle Erfahrungen können Veränderungen hervorrufen, die über unsere Psyche auf den Körper wirken – denn: Gesundheit beginnt im Kopf! In der 3. Auflage ergänzt ein Kapitel zur "sprechenden Medizin" das breitgefächerte Themenspektrum. Rüegg zeigt auf, wie Worte nachhaltig die Funktionsweise des Gehirns verändern: Sie können die Wirkung von Medikamenten verstärken und sogar wie ein Medikament wirken. Ein neues Glossar erklärt kurz und präzise über 50 Fachbegriffe. Ein geist- und lehrreiches Lesevergnügen für alle, die mehr über die Wechselwirkungen zwischen Gehirn, Psyche und Körper wissen möchten! Keywords: Mind-Body-Medizin, sprechende Medizin, Gehirn, Hirnforschung, Neurobiologie, Psyche, Psychosomatik, Psychoneuroimmunologie, Genetik, Epigenetik, Optogenetik, Immunologie, Immunsystem, Emotionen, Stress, Resilienz, Herz, Schmerz, Trauma, Traumagedächtnis, Meditation, Achtsamkeit, spirituelle Erfahrungen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 270
Ähnliche
Johann Caspar Rüegg
Mind & Body
Wie Gehirn und Psyche die Gesundheit beeinflussen
3., aktualisierte und erweiterte Auflage
Prof. Dr. med. Johann Caspar Rüegg, Ph.D.
Haagackerweg 10
69493 Hirschberg
Ihre Meinung zu diesem Werk ist uns wichtig! Wir freuen uns auf Ihr Feedback unter www.schattauer.de/feedback oder direkt über QR-Code.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Besonderer Hinweis:
In diesem Buch sind eingetragene Warenzeichen (geschützte Warennamen) nicht besonders kenntlich gemacht. Es kann also aus dem Fehlen eines entsprechenden Hinweises nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Das Werk mit allen seinen Teilen ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert werden.
© 2010, 2014, 2017 by Schattauer GmbH, Hölderlinstraße 3, 70174 Stuttgart, Germany
E-Mail: [email protected]
Internet: www.schattauer.de
Lektorat: Volker Drüke, Münster; Alina Piasny, Stuttgart
Umschlagabbildung: Paul Gauguin, „Mädchen mit Mangoblüten (Tahitianische Frauen)“, 1899 (Ausschnitt)
Satz: am-productions GmbH, Wiesloch
ISBN 978-3-7945-9033-9
Für Elvi
Vorwort
„Es ist der Geist, der sich den Körper baut“
(Schiller, Wallensteins Tod)
Manchmal wirken Worte wie ein Medikament. So wussten sich im Zweiten Weltkrieg Krankenschwestern oft zu helfen, wenn ihnen die Schmerzmittel ausgingen. Sie spritzten den Schwerverwundeten einfach eine Kochsalzlösung und sagten, es wäre Morphium. Oftmals verschwanden dann die Schmerzen, zumindest vorübergehend, wenn die Leidenden dachten, sie erhielten ein wirksames Mittel – ein Placebo-Effekt, zweifelsohne. „Worte sind die mächtigste Droge, welche die Menschheit besitzt“, sagte schon der englische Schriftsteller Rudyard Kipling. Aber: Wie können Worte und Gedanken – ohne Medikamente – das körperliche und geistige Wohlergehen und damit die Gesundheit beeinflussen? Davon wird noch die Rede sein; es ist eine wichtige Frage – auch an die Psychosomatische Medizin, die sich damit beschäftigt, wie Gehirn, Psyche und Körper („mind“ und „body“) aufeinander einwirken.
Begriffe wie Psychokardiologie, Psychoimmunologie und Psychoendokrinologie, aber auch die moderne Stressforschung machen deutlich, dass die Psychosomatik zu einer Disziplin geworden ist, die naturwissenschaftlichen Ansprüchen genügen sollte. In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hatte hingegen die (psychoanalytisch orientierte) Psychosomatik die Bedeutung des Gehirns für die Gesundheit von Körper und Geist weitgehend unterschätzt. Manche Psychosomatiker der älteren Generation hatten wenig Verständnis für die biologische Blickrichtung, da dabei der Mensch auf eine „seelenlose Maschine“ reduziert werde. Sie waren der Meinung, in der „Organsprache“ des Körpers drückten sich verdrängte seelische Nöte und Wünsche aus, und körperlichen Symptomen wurde deshalb Symbolcharakter zugeschrieben. „Krankheit als Symbol“ war der Slogan. So wurde etwa ein Gebärmutterkrebs von Therapeuten1 als „unbewusster Wunsch nach Mutterschaft“ gedeutet. Oder: Ein Manager entwickelt Schwindelanfälle, weil ihm „vor lauter Verantwortung schwindelig wird“.
Gegenwärtig ist in der Psychosomatik kaum mehr von „Organsprache“ die Rede, dafür umso mehr von den Errungenschaften moderner bildgebender Verfahren, die einen Einblick in die Arbeitsweise des Gehirns gewähren. Wie wir sehen werden, gehen psychosomatische Leiden wie chronische Schmerzen, Angststörungen und Depressionen nachweislich mit gut lokalisierbaren Veränderungen im Gehirn einher. Sie haben ihre Ursache häufig in Stress und (z.B. frühkindlichen) traumatischen Erfahrungen.
Die komplexen Wechselwirkungen zwischen „mind“ und „body“ lassen sich aber auch gezielt nutzen: Psychotherapie, neue Denk- und Verhaltensweisen, auch spirituelle Erfahrungen wie Meditation und Gebet können nämlich ebenfalls Veränderungen im Gehirn hervorrufen, die nun ihrerseits auf den übrigen Körper einwirken. So beeinflussen Psyche und Gehirn chronische Schmerzen, die körpereigene Abwehr von Infektionen oder die Funktionen von Herz und Kreislauf, z.B. den Blutdruck. Gesundheit beginnt im Kopf („Gesunder Geist in gesundem Körper“, wie Juvenal schrieb). Das ist, kurz gesagt, auch die Mission der neurobiologisch unterfütterten „Neuen Psychosomatik“, um die es in diesem Buch geht.
Wer mit Begriffen, Funktionen und dem anatomischen Aufbau unseres komplexesten Organs etwas vertraut ist, wird das einführende Kapitel – eine Tour d’Horizon durch die Landschaften des Gehirns – vermutlich überspringen und sich gleich den anderen Essays zuwenden, die sich den Fragen einer biologisch fundierten Psychosomatik widmen. Sie alle sind in sich konsistent und können daher auch einzeln gelesen werden. Ich hoffe, dass in den Essays mitgeteilte Einsichten in psychophysische Zusammenhänge zur Überbrückung der Kluft zwischen einer rein somatisch orientierten Medizin und einem „ganzheitlichen“, psychosomatischen Krankheitsverständnis beitragen. Sie dürften daher auch für Betroffene hilfreich sein. Und wer möchte nicht gerne erfahren, was es – aus der biologischen Perspektive – mit der in der angloamerikanischen Welt so genannten „Mind-Body Medicine“ auf sich hat? So wendet sich dieses Buch an einen weiten Leserkreis, und wenn es einen Eindruck von den komplexen Wechselwirkungen zwischen „mind“ und „body“ geben kann, hätte ich mein Ziel erreicht.
In meinen Essays konnte ich die einschlägige Fachliteratur bis Ende 2015 berücksichtigen, aber auch – ergänzt und überarbeitet – Ideen und Studienergebnisse, über die ich in den letzten Jahren bereits in verschiedenen Fachzeitschriften sowie in „Psychologie Heute“ und in der „Frankfurter Rundschau“ berichtete. Für zahlreiche Literaturhinweise und hilfreiche Diskussionen bin ich Freunden und Kollegen dankbar – insbesondere jedoch Heiner Schirmer für seine vielen Anregungen und die hilfreichen Gespräche, aber auch für den Hinweis auf das passende Zitat aus Schillers Wallenstein II. Ebenso gilt mein großer Dank Wulf Bertram und seinem Team vom Schattauer Verlag, vor allem Petra Mülker, Alina Piasny, Sandra Schmidt, Birgit Heyny, und, nicht zuletzt, Volker Drüke für die hervorragende, kreative Zusammenarbeit. Und viel bedeutet mir, bei all meiner Arbeit, der Rückhalt in der Familie, den ich Elvi danke. Meiner Frau ist dieses Buch gewidmet – von ganzem Herzen.
Hirschberg, im Sommer 2016
Johann Caspar Rüegg
Inhalt
1 Blick ins GehirnEine Tour d’Horizon
2 Der Geist prägt das Gehirn Wie mentale Prozesse unser Gehirn verändern
3 Emotion und BewegungGefühle ausdrücken und verstehen
4 Psychosomatik und EpigenetikFrühkindliche Erfahrungen beeinflussen die Gesundheit
5 Schmerz, lass nach Den Schmerz mental beeinflussen
6 Herz und Psyche Herzkrank durch emotionalen Stress
7 Die Angst verlernen Neue Erkenntnisse aus der Hirnforschung
8 Das TraumagedächtnisFaszinierende Einsichten dank Optogenetik
9 Hirnforschung und SpiritualitätMeditation verändert das Gehirn
10 ResilienzResistent gegen Stress
11 Optimismus tut gutWie Psyche und Immunsystem aufeinander einwirken
12 Heilende Worte„Sprechende Medizin“ wirkt
13 Wie Worte wirkenGespräche verändern das Gehirn – nachhaltig
14 EpilogStress, Psyche und Gehirn
Glossar
Personen- und Sachverzeichnis
1 Blick ins Gehirn
Eine Tour d’Horizon
Gesunder Geist in gesundem Körper! Wie Körper und Geist aufeinander einwirken, das sei die „Grundfrage der Psychosomatik“, sagt der bekannte Heidelberger Psychosomatiker Gerd Rudolf (10). Mittlerweile ist die Psychosomatische Medizin zu einer Disziplin geworden, die auch naturwissenschaftlichen Kriterien genügen muss. Das war nicht immer so. Noch in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts verstand man unter Psychosomatik meist eine hermeneutisch orientierte Medizin in der psychoanalytischen Tradition mit so bedeutenden Vertretern wie Georg Groddeck und Viktor von Weizsäcker – insbesondere, wenn es um die Deutung dessen ging, wie seelische Konflikte bei psychosomatischen Erkrankungen in die „Sprache der Organe“ übersetzt werden. So war man davon beeindruckt, wie gut sich beispielsweise Magenbeschwerden als Folge unterdrückter Gefühle interpretieren lassen: „Der Ärger schlägt einem auf den Magen.“
Bis in die 90er Jahre wurde die Bedeutung des Gehirns für die Gesundheit von Leib und Seele von den meisten Psychosomatik-Forschern unterschätzt, wenn nicht ignoriert. Inzwischen hat sich das allerdings geändert, vor allem dank des Siegeszugs moderner bildgebender Verfahren wie Positronenemissionstomographie (PET) und funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT), mit denen man einen Blick ins Gehirn werfen und ihm so gewissermaßen „bei der Arbeit zuschauen“ kann.1 So lässt sich feststellen, welche Teile des Gehirns bei bestimmten Emotionen oder kognitiven Prozessen gerade aktiv sind (4).
In den letzten Jahren ist immer deutlicher geworden, wie sehr psychosomatische Störungen, insbesondere Angststörungen, Depressionen und Schmerzkrankheiten, mit strukturellen und funktionellen Veränderungen des Gehirns einhergehen. Und diese können mit bildgebenden Verfahren fast millimetergenau in unserem komplexesten, knapp drei Pfund schweren Organ geortet werden. Was geschieht im Gehirn, wenn Menschen beispielsweise unter Ängsten leiden? Oder „körperliche“ oder „seelische“ Schmerzen haben? Und wo im Gehirn geschieht dann etwas? Das sind Fragen, die nicht nur Therapeuten, sondern zunehmend auch Betroffene bewegen. Die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse dürften deshalb auch zur eigenen „Psychoedukation“ hilfreich sein, sofern ein gewisses Grundwissen über Bau und Funktion des Gehirns vorhanden ist. In diesem Sinne folgt nun eine kurze „Tour d’Horizon“ durch die „Landschaften unseres Gehirns“, um erste Einblicke in die Funktionelle Neuroanatomie zu vermitteln bzw. früher erworbenes Wissen aufzufrischen.2
▶ Im Verlauf der Evolution der Hominiden zum Homo sapiens hat sich das Gewicht des Gehirns innerhalb von „nur“ etwa 2 bis 3 Millionen Jahren fast verdreifacht. Betroffen von diesem enormen Wachstum ist vor allem die in ihrer Komplexität jüngste Errungenschaft der Evolution, das Großhirn, auch Endhirn (Telencephalon) oder Cerebrum genannt. Es setzt sich aus den beiden Hirnhemisphären zusammen, die durch einen dichten Filz von Nervenfasern miteinander verbunden sind, dem so genannten Balken (Corpus callosum). In ihrem Inneren enthalten die Hemisphären die mit einer klaren, farblosen Flüssigkeit (Liquor cerebrospinalis) gefüllte linke und rechte Hirnkammer (Ventrikel). Der Balken legt sich über diese Ventrikel und das Stammhirn, also das Zwischenhirn (Diencephalon) mit dem darunter gelegenen Hirnstamm, der durch „Stiele“ (Pedunculi) mit dem Kleinhirn (Cerebellum) verbunden ist (Abb. 1.1).
Der Hirnstamm (Truncus cerebri) umfasst das Mittelhirn (Mesencephalon), die „Brücke“ (Pons) mit ihren Verbindungen zum Groß- und Kleinhirn sowie das verlängerte Rückenmark (Medulla oblongata), das viele unserer vegetativen Funktionen reguliert, beispielsweise Atmung und Blutdruck. Es geht am hinteren (kaudalen) Ende in das – in der Wirbelsäule gelegene – Rückenmark (Medulla spinalis) über. Ist also, etwa infolge eines Schädeltraumas, die Medulla oblongata beschädigt, so versagt die Atmung, der Blutdruck kann nicht mehr reguliert werden. Bei einer Verletzung des übrigen Hirnstamms fällt der Mensch in einen Zustand tiefster Bewusstlosigkeit, das Koma. Der Hirnstamm enthält nämlich eine netzwerkartige Struktur, die Formatio reticularis, die sich von der Brücke bis zum Mittelhirn zieht und nicht nur an der Steuerung so wichtiger Körperfunktionen wie Schlafen und Wachen beteiligt ist, sondern auch an der Regulation von Aufmerksamkeit und Bewusstseinszuständen.
Im Hirnstamm entspringen zehn der zwölf Hirnnerven, z.B.
der Nervus trigeminus, der u.a. für Wahrnehmungen der Hautsinne im Kopfbereich zuständig ist;
der Nervus facialis, der die mimische Gesichtsmuskulatur innerviert;
der Nervus vagus (der „Umherschweifende“), der die Herzschlagfrequenz kontrolliert, aber auch im Bauch „vagabundiert“, wo er fast alle Eingeweide mit Nervenfasern versorgt.
Der „Vagus“ enthält sowohl sensorische als auch motorische Fasern (die z.B. die Schlundmuskulatur innervieren), aber auch Fasern des autonomen (vegetativen) Nervensystems. Letztere gehören zum Parasympathikus, dessen Aktivität zu einer ruhigen Erholungslage im Organismus führt, indem sie die Leistung drosselt und Energieverbrauch, Blutdruck und Herzfrequenz senkt. Gegenspieler ist der Sympathikus, dessen Ursprungsneuronen im Brust- und Lendenbereich des Rückenmarks liegen und (wie der Parasympathikus) vom Hirnstamm kontrolliert werden.
Zwischen Hirnstamm und Großhirn befindet sich das Zwischenhirn (Diencephalon). Es beherbergt den Thalamus, eine wichtige Umschaltstelle für Nachrichten von den Hautsinnen und anderen Sinnesorganen, die aus der Körperperipherie über das Rückenmark (oder Hirnnerven) dem Großhirn zugeleitet werden. Dort erst können sie uns bewusst werden – wenn überhaupt. Denn von den unzähligen Eindrücken, denen wir jeden Augenblick ausgesetzt sind, können wir nur einen sehr kleinen Teil bewusst wahrnehmen (12). Unterhalb des Thalamus, in der untersten Etage des Zwischenhirns, liegt der Hypothalamus. Er kontrolliert automatisch eine Reihe von vegetativen Körperfunktionen, etwa die Körpertemperatur. Über den Hypophysenstiel ist er mit der Hirnanhangsdrüse, der Hypophyse, verbunden, die unter dem Hypothalamus in einer sattelförmigen Knochengrube („Türkensattel“) der Schädelbasis liegt und sich an den Boden des Zwischenhirns schmiegt. Durch CRH (corticotropin releasing hormone, auch: Kortikotropin-Releasing-Hormon oder Kortikoliberin), ein im Hypothalamus gebildetes Neurohormon, wird in der Hypophyse die Sekretion von ACTH (adrenocorticotropic hormone) angestoßen, das in der Nebennierenrinde die Synthese und Ausschüttung des Stresshormons Kortisol ankurbelt. (Die Sekretion des Stresshormons Adrenalin erfolgt durch das Nebennierenmark, nach Aktivierung des Sympathikus.)
Das Großhirn lässt sich in vier Lappen (Lobi) unterteilen, nämlich Stirn-, Scheitel-, Schläfen- und Hinterhauptlappen (Frontal-, Parietal-, Temporal- und Okzipitallappen). Seine Oberfläche wird durch zahlreiche Furchen vergrößert, welche die nur wenige Millimeter dicke Hirnrinde in Windungen (Gyri) unterteilen. Die Großhirnrinde (Cortex cerebri) wird auch als „graue Substanz“ bezeichnet. Darunter (subkortikal) befindet sich das Marklager. Es enthält die weiße Substanz des Gehirns, also die unzähligen markhaltigen Nervenfasern. Diese Fasern sind mit dem „Isoliermaterial“ Myelin ummantelt, d.h. myelinisiert. Sie verkabeln u.a. die in der Hirnrinde gelegenen Nervenzellen (Neuronen) mit anderen Teilen des Zentralnervensystems, etwa mit den Neuronen anderer Hirnlappen oder – als Projektionsfasern – mit dem Kleinhirn, dem Hirnstamm und dem Rückenmark. Gleichsam eingebettet in die weiße Substanz des Marklagers sind verschiedene Hirnkerne (Nuclei), die aus den Ansammlungen von Zellkörpern zahlreicher Nervenzellen bestehen, so beispielsweise der Mandelkernkomplex (Amygdala) und die Basalganglien (z.B. Putamen, Nucleus caudatus und Nucleus accumbens).
In der Hirnrinde befinden sich fast 100 Milliarden Nervenzellen, die in bis zu sechs Schichten übereinanderliegen. (Außerdem gibt es noch unzählige Gliazellen, z.B. Oligodendrozyten, die die Markscheiden um die Nervenfasern bilden, sowie die zwischen den Nervenzellen und Blutgefäßen gelegenen Astrozyten, welche die Weite der zerebralen Blutgefäße und damit die Hirndurchblutung regulieren.) Jedes Neuron besteht aus dem Zellkörper (Perikaryon bzw. Soma), aus welchem zwei Fortsätze sprießen, nämlich das Axon (auch Neurit genannt) mit seinen zahlreichen terminalen Verzweigungen und die vielfach verästelten Dendriten. Letztere knüpfen – an ihren Dornfortsätzen („Spines“) – unzählige Kontakte mit den Endigungen der Axone anderer Neuronen. Zu den größten Neuronen zählen die Pyramidenzellen im motorischen Kortex, deren Axone entlang der Pyramidenbahn (im Tractus corticospinalis) durch das Marklager und den Hirnstamm bis ins Rückenmark ziehen. Dort kontaktieren sie die Dendriten von Motoneuronen, welche ihrerseits die Muskulatur des Bewegungsapparates innervieren.
Die unzähligen Verknüpfungspunkte eines Axons mit den Dendriten und dem Perikaryon anderer Neuronen heißen Synapsen. Hier berühren sich die Fortsätze der Neuronen, allerdings nicht direkt; sie bleiben dabei nämlich immer noch durch eine submikroskopisch enge Kluft, den synaptischen Spalt, voneinander getrennt. Über diesen Spalt hinweg tauschen die Nervenzellen mithilfe von Neurotransmittern Informationen aus. Sie „sprechen“ miteinander, indem jede Nervenzelle mittels ihrer verzweigten Axone über unzählige Synapsen an andere Nervenzellen Nachrichten sendet und umgekehrt mit ihren „Antennen“, den Dendriten, wieder solche Signale empfängt. Von diesen Impulsen wird die Nervenzelle entweder erregt oder in ihrer Aktivität gehemmt.
Letztlich entscheidet dann die algebraische Summe aller empfangenen hemmenden bzw. erregenden Signale darüber, ob ein Neuron zum „Schweigen“ gebracht wird oder nicht. Auf diese Weise wird die Aktivität des Gehirns von den zahllosen Neurotransmittern (Überträgerstoffen) bestimmt, welche die Billionen von erregenden oder hemmenden Synapsen der grauen Substanz durchfließen. Der Neurotransmitter hemmender Synapsen heißt GABA (Gamma-Aminobuttersäure), der wichtigste erregende Transmitter ist die Aminosäure Glutamat. Zu den Überträgerstoffen zählen auch Acetylcholin, Dopamin, Serotonin und Noradrenalin, aber auch Neuropeptide wie etwa die schmerzlindernden Endorphine. Ein Übermaß, aber auch ein Mangel an einem ganz bestimmten Überträgerstoff kann zu mehr oder weniger schweren Störungen der Gehirnfunktion und des Verhaltens führen. Man denke z.B. an die Symptome der Parkinson-Krankheit, die durch einen dramatischen Abfall des Gehalts an Dopamin in den Basalganglien bedingt sind.
Neurotransmitter reagieren auf der Oberfläche der Neuronen (in den Synapsen) mit Rezeptoren, die jeweils für einen bestimmten Transmitter spezifisch sind – Proteinmoleküle, die in der Zellmembran verankert sind und zum Teil auch als ionendurchlässige Poren (Ionenkanäle) fungieren. Ihre Aktivierung durch Neurotransmitter bringt im Inneren der Nervenzellen komplizierte Programme zum Laufen, beispielsweise solche, die den Stoffwechsel oder die Ionendurchlässigkeit der Zellmembran und damit die bioelektrischen Eigenschaften der Neuronen verändern und auf diese Weise das Neuron hemmen oder erregen, so dass es Salven elektrischer Impulse (Aktionspotenziale) „feuert“. Für die Gedächtnisbildung von Bedeutung ist ein besonderer Typ eines Glutamat-Rezeptors, der so genannte NMDA-Rezeptor3 – insbesondere im Hippocampus (3), einem Teil des limbischen Systems.
▶ Das limbische System (von lat. limbus, der Saum) umsäumt den Balken und das Zwischenhirn und führt über unsere Emotionen und das Gedächtnis Regie (Abb. 1.1). Dazu zählt man u.a. den Gyrus cinguli (auch „Gürtelwindung“ genannt), den Gyrus parahippocampalis, den in den Basalganglien gelegenen Nucleus accumbens, den Mandelkern (Amygdala) und, wie wir schon sahen, den Hippocampus, ein entwicklungsgeschichtlich urtümlicher Abschnitt der Hirnrinde. Letzterer ist während der Entwicklungsphase durch die „moderneren“ Rindenabschnitte ganz an den medialen Rand des Schläfenlappens gedrängt worden, wo er sich wie ein Tuch faltete und nach innen aufrollte. Dadurch erhält dieser Hirnteil eine charakteristische S-förmig geschweifte Form, die etwas an ein Seepferdchen (lat. hippocampus) erinnert. Der Hippocampus hat eine zentrale Bedeutung für das Gedächtnis, genauer gesagt: für das Ortsgedächtnis und das so genannte explizite Gedächtnis. Bewusst abrufbare (explizite) Gedächtnisinhalte können nur über den „Prozessor“ Hippocampus auf der „Festplatte“ des Langzeitgedächtnisses im Assoziationskortex des Temporal- und Parietallappens abgespeichert und von da wieder abgerufen werden (12). Wird also der Hippocampus beschädigt, z.B. infolge degenerativer Hirnerkrankungen wie der Alzheimer-Krankheit, dann leidet das explizite Gedächtnis. Beispielsweise können dann neue Namen nicht mehr im Langzeitgedächtnis gespeichert und wiedererinnert werden. Auch bei lang andauerndem (chronischem) Stress und klinischen Depressionen schrumpft oftmals der Hippocampus, weil seine Neuronen vermehrt zugrunde gehen; sie können aber, selbst bei Erwachsenen, aus neuronalen Stammzellen wieder neu gebildet werden. Man spricht von Neurogenese bzw. von Neuroplastizität, wenn man generell die strukturellen Veränderungen in den Verschaltungen des Gehirns meint (3).
Vor dem Hippocampus liegt an der (medial gelegenen) Innenseite jeder Hirnhemisphäre der Mandelkern (Amygdala), und zwar unter der Hirnrinde in der Tiefe des Temporallappens. Mit dem Hippocampus, aber auch mit vielen anderen Hirnarealen ist er durch Nervenstränge (Bahnen) verbunden – vor allem mit dem Hypothalamus, aber auch mit den medialen Arealen des präfrontalen Kortex. Eine besondere Verbindung besteht mit dem über der Augenhöhle gelegenen frontoorbitalen Kortex, der die Aktivität der Amygdala überwacht und gegebenenfalls dämpft (13). Die Amygdala beurteilt – uns unbewusst – beim Auftreten einer Gefahr blitzschnell, wie gefährlich diese ist, oft Sekunden bevor das Gefühl „Angst“ bewusst wird. Sie löst dann gegebenenfalls eine Angst- und Fluchtreaktion oder eine Erstarrung aus (falls die Flucht nicht mehr möglich ist). Auch Muskelzittern und vegetative Reaktionen wie ein Adrenalinstoß oder Herzklopfen und beschleunigte Atmung (Hyperventilation) gehören zu dem von der Amygdala angekurbelten Notfallprogramm. Die Erregung des Vegetativums kommt über eine Aktivierung des Hypothalamus und des autonomen Nervensystems zustande, gefolgt von der Ausschüttung von Stresshormonen. Das alles sind unbewusste subkortikale Reaktionen. Das bewusste Gefühl „Angst“ entsteht erst etwas verzögert durch Aktivierung der Großhirnrinde. Die Amygdala mit ihren Projektionen zur Großhirnrinde spielt übrigens auch eine entscheidende Rolle bei der Speicherung fürchterlicher traumatischer Ereignisse im (impliziten) emotionalen Gedächtnis bzw. im „Traumagedächtnis“, dessen Inhalte nicht bewusst abgerufen werden können (11). Dafür gibt es viele Hinweise, vor allem dank der funktionellen Magnetresonanztomographie, mit welcher bei erlernter Furcht (Furchtkonditionierung) eine lokale Aktivitätssteigerung in der Amygdala geortet werden kann (1).
Gewissermaßen der Gegenspieler des Mandelkerns ist der Nucleus accumbens (der „anlagernde Kern“), der dem vorderen Ende zweier Kerne der Basalganglien anliegt, nämlich dem Schalenkörper (Putamen) und dem Kopf des Schwanzkerns (Nucleus caudatus). Er dient sozusagen als Sensor für positive, lustvermittelnde und motivierende Schlüsselreize – etwa, wenn wir Schokolade naschen. Er erzeugt dann Glücksgefühle, zumal er im Frontalhirn körpereigene Opioide (Endorphine) freisetzt, wenn seine Neuronen mit Dopamin berieselt werden. Dieser motivierende Neuromodulator wird bei entsprechender Motivation – aber auch nach Einwirkung süchtig machender Drogen wie z.B. Kokain – von Projektionsneuronen abgegeben, die ihren Ursprung (d.h. ihren Zellkörper) im Mittelhirn haben. Wird im Nucleus accumbens zu wenig Dopamin freigesetzt, so verliert ein Mensch jegliche Motivation. Er wird lustlos (anhedonisch), ja geradezu depressiv und nicht selten auch sehr empfindlich für Schmerzreize, die eine Aktivierung des vorderen (anterioren) Gyrus cinguli (ACC, s. Abb. 1.1) bewirken (5).
Der Gyrus cinguli (unser „emotionales Hirn“) liegt auf der medialen Seite einer Hirnhemisphäre direkt über dem Balken und windet sich wie ein Gürtel um dessen vorderes (d.h. der Stirn zugewandtes) Ende, das „Knie“ des Balkens. Der direkt unter dem Knie (subgenual) gelegene Teil der Windung wird nach Ausbruch einer schweren (klinischen) Depression hyperaktiv, wie mit funktioneller Kernspintomographie gezeigt wurde. Unlängst gelang es, bei scheinbar unheilbar depressiven Patienten die Aktivität dieses winzigen Teils der Hirnrinde durch eine tiefe Hirnstimulation mittels elektrischer Impulse gezielt zu „zähmen“. Die Hyperaktivität verschwindet dann nachhaltig, ja sogar dauerhaft. Dadurch werden die für die Depression typischen seelischen Schmerzen gelindert, die Stimmung hellt sich auf (7). Eine nachhaltige Besserung der Symptomatik und eine Besänftigung des anterioren Gyrus cinguli traten jedoch nicht nur nach einer tiefen Hirnstimulation auf, sondern oft auch nach einer vom Patienten als erfolgreich erlebten Psychotherapie oder einer Pharmakotherapie mit SSRI (selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer).
Dank solcher Erkenntnisse wissen wir, wo genau in der „Hirnlandschaft“ sich unser Zentralorgan bei einer Depression und nach deren Therapie verändert. Das ist ein großer Fortschritt in der Neurobiologie der Psychotherapie. Aber: Wir wissen damit noch lange nicht, warum die Therapie wirkt und welche Hirnregionen eigentlich an der Entstehung einer Depression ursächlich beteiligt sind.
Wie wir in Kapitel 12 (S. 163) noch genauer sehen werden, kann durch eine Psychotherapie oder eine Pharmakotherapie der Depression nicht nur der subgenuale Gyrus cinguli verändert werden. Auch andere Teile der Hirnrinde profitieren gewissermaßen von solchen Therapien, so der direkt hinter der Stirn gelegene präfrontale Kortex und der Hippocampus (2). Könnte es also sein, dass die eigentliche Ursache der Depression nicht – jedenfalls nicht allein – in der Hyperaktivität des subgenualen Gyrus cinguli zu suchen ist? Beispielsweise könnte die tiefe Hirnstimulation dieses Areals bestimmte neuronale Netzwerke anderer Hirnregionen modulieren, deren Dysfunktion zu einer Depression führt (9). Dadurch würde das Befinden fühlbar verbessert, die Stimmung aufgehellt.
Fest steht: Die Aktivität eines bestimmten Hirnteils kann das bewusste Erleben und die Befindlichkeit beeinflussen („bottom-up“). Umgekehrt kann die mentale Ebene bzw. das Bewusstsein wiederum auf die Aktivität einer Hirnregion zurückwirken („top-down“). Wie bereits erwähnt, können die neuronale Aktivität und der Energie-Stoffwechsel des subgenualen und anterioren Gyrus cinguli nicht nur durch Psychopharmaka und tiefe Hirnstimulation, sondern auch durch eine gelungene Kognitive Verhaltenstherapie langfristig gehemmt werden – sogar durch den Glauben an die Heilkraft eines Placebos kann dies funktionieren (2, 6), und bei manchen Depressiven hilft Psychotherapie sogar zuverlässiger als Pharmakotherapie (8)4.
Ist also der Geist des Menschen – unsere Gedankenwelt – nicht nur ein Epiphänomen neuronaler Aktivität, sondern (wie wir im nächsten Kapitel sehen werden) umgekehrt auch eine emergente Instanz mit der Fähigkeit, das Gehirn zu verändern („top-down“)?
Literatur
1 Büchel C, Dolan RJ (2000). Classical fear conditioning in functional neuroimaging. Curr Opin Neurobiol; 10: 219–23.
2 Goldapple K, Segal Z, Garson C, Lau M, Bieling P, Kennedy S, Mayberg H (2004). Modulation of cortical-limbic pathways in major depression: treatment-specific effects of cognitive behavior therapy. Arch Gen Psychiatry; 61: 34–41.
3 Kandel ER (2006). Auf der Suche nach dem Gedächtnis. Die Entstehung einer neuen Wissenschaft des Geistes. München: Siedler.
4 Lane RD, Waldstein SR, Critchley HD, Derbyshire SW, Drossman DA, Wager TD, Schneiderman N, Chesney MA, Jennings JR, Lovallo WR, Rose RM, Thayer JF, Cameron OG (2009). The rebirth of neuroscience in psychosomatic medicine, Part II: clinical applications and implications for research. Psychosom Med; 71(2): 135–51.
5 Leknes S, Tracey I (2008). A common neurobiology for pain and pleasure. Nat Rev Neurosci; 9: 314–20.
6 Mayberg HS, Silva JA, Brannan SK, Tekell JL, Mahurin RK, McGinnis S, Jerabek PA (2002). The functional neuroanatomy of the placebo effect. Am J Psychiatry; 159: 728–37.
7 Mayberg HS, Lozano AM, Voon V, McNeely HE, Seminowicz D, Hamani C, Schwalb JM, Kennedy SH (2005). Deep brain stimulation for treatment-resistant depression. Neuron; 45: 651–60.
8 McGrath CL, Kelley ME, Holtzheimer PE, Dunlop BW, Craighead WE, Franco AR, Craddock RC, Mayberg HS (2013). Toward a neuroimaging treatment selection biomarker for major depressive disorder. JAMA Psychiatry;70 : 821–9.
9 Ressler KJ, Mayberg HS (2007). Targeting abnormal neural circuits in mood and anxiety disorders: from the laboratory to the clinic. Nature Neuroscience; 10: 1116–24.
10 Rudolf G (2011). Geleitwort. In: Rüegg JC. Gehirn, Psyche und Körper. Neurobiologie von Psychosomatik und Psychotherapie. 5. Aufl. Stuttgart: Schattauer.
11 Rüegg JC (2009). Traumagedächtnis und Neurobiologie. Konsolidierung, Rekonsolidierung, Extinktion. Trauma & Gewalt; 3(1): 6–17.
12 Rüegg JC, Bertram W (2010). Hirnlandschaften. Eine funktionell-neuroanatomische Tour d’Horizon. In: Spitzer M, Bertram W (Hrsg). Hirnforschung für Neu(ro)gierige. Braintertainment 2.0. Stuttgart: Schattauer; 1–11.
13 Spitzer M (2005). Frontalhirn an Mandelkern. Letzte Meldungen aus der Nervenheilkunde. Stuttgart: Schattauer.
14 Walter H, Erk S (2010). Seh ich da was, was Du nicht siehst? Methoden, Möglichkeiten und Mängel des Neuroimagings. In: Spitzer M, Bertram W (Hrsg). Hirnforschung für Neu(ro)gierige. Braintertainment 2.0. Stuttgart: Schattauer; 185–206.
2 Der Geist prägt das Gehirn
Wie mentale Prozesse unser Gehirn verändern
„Change the mind and you change the brain“
Wie wirken Geist und Körper – „mind“ und „body“ – aufeinander ein? Es geht um die Frage, wie unsere Gedanken, unsere Erwartungen, aber auch Worte, Glaube und Emotionen die Gesundheit von Körper und Seele beeinflussen – und wie sie dabei das Gehirn verändern. Zu diesem Thema fanden im März 2000 in der nordindischen Stadt Dharamsala und drei Jahre später am MIT (Massachusetts Institute of Technology) in Cambridge Massachusetts zwei für das menschliche Selbstverständnis bedeutende Symposien statt. In den beiden Konferenzen trafen sich international renommierte, herausragende Neurowissenschaftler und Hirnforscher mit dem 14. Dalai Lama und anderen buddhistischen Mönchen, um die Wirkung von Emotionen und Meditationen auf das menschliche Gehirn zu erörtern (11). Die anwesenden Hirnforscher erinnerten die Zuhörer daran, dass unser Gehirn mit seinen neuronalen Netzwerken während des ganzen Lebens veränderbar ist; es ist plastisch – man spricht von neuronaler Plastizität –, und noch im Alter können sich aus Stammzellen neue Nervenzellen bilden. Daraufhin stellte der Dalai Lama eine gewichtige Frage: Kann der menschliche Geist („mind“) sein Gehirn verändern?
▶ Dass strukturelle Veränderungen im Gehirn die Psyche und das Verhalten beeinflussen können, wissen wir schon lange. Aber: Genauso gut könnten – umgekehrt – auch Änderungen im Verhalten und unsere Gedanken die neuronalen Netzwerke unseres Gehirns umstrukturieren, sagte der amerikanische Neurobiologe Alvaro Pascual-Leone (26). Imaginationen – Gedanken – könnten Einfluss nehmen auf die „Hardware“ des Gehirns. Wenn etwa Versuchspersonen auf einer Klaviatur mit einer Hand immer wieder eine einfache Fingerübung einübten, so würde sich das für diese Finger zuständige Areal im motorischen Kortex vergrößern; aber erstaunlicherweise sei dies genauso der Fall, wenn die Probanden die Fingerübungen nur im Geiste – in ihrer Imagination – machten (25).
Unser Gehirn kann sich allein schon dadurch verändern, dass wir etwas Neues lernen. Dies erkannte als Erster der amerikanische Neurobiologe Eric Kandel, der im Jahre 2000 für seine Verdienste in der Gedächtnisforschung den Nobelpreis für Medizin und Physiologie erhielt. Zu Beginn war sein Forschungsobjekt allerdings noch nicht das hochkomplexe Gehirn des Menschen, sondern „nur“ die große Meeresschnecke Aplysia californica, die mit ihren etwa 20000 Neuronen über ein besonders einfaches Nervensystem verfügt, an dem sich Reflexe auslösen lassen. So zieht die Schnecke bei Reizung des Schneckenschwanzes oder des Siphons reflektorisch die Kiemen zurück – eine motorische Reaktion ihrer Muskeln.
Dieser Schutzreflex ist normalerweise eher schwach, lässt sich aber durch Konditionierung verstärken – im Prinzip ganz ähnlich wie der berühmte Pawlow’sche Reflex. Der „Befehl“ zur Kontraktion des Rückziehmuskels der Kiemen wird an der Verbindung – der Synapse – vom sensorischen Neuron und motorischen Neuron durch den Neurotransmitter Glutamat übertragen. Gewöhnlich wird der Überträgerstoff nur sparsam in den synaptischen Spalt ausgeschüttet. Durch Konditionierung wird jedoch die Menge des ausgeschütteten Transmitters erhöht, wie Kandel erkannte. Und dies verstärkt natürlich die synaptische Übertragung und damit aber auch die reflektorische Muskelkontraktion. Kurz: Das einfache neuronale Netzwerk der Schnecke hat gelernt, ausgeprägter auf den Reiz zu reagieren. Das so Gelernte wird langfristig im Gedächtnis gespeichert, wenn sich die betroffene Synapse auch strukturell verändert und damit die funktionelle Verknüpfung zwischen der prä- und postsynaptischen Nervenzelle festigt – so Kandel in seinem Buch „Auf der Suche nach dem Gedächtnis“ (15).
Die Neuronen von Meeresschnecken, an denen Kandel seine Versuche anstellte, sind ein – besonders einfacher – Modellfall. Ganz analoge Veränderungen spielen auch eine wichtige Rolle bei Lernvorgängen des Menschen (bei dem man bekanntermaßen verschiedene Arten des Gedächtnisses unterscheiden kann; s. Abb. 2.1).
Auch in den komplizierten neuronalen Netzwerken höherer Tiere und des Menschen werden Neuronenpopulationen nach einem Lernvorgang durch ein molekulares „remodeling“, d.h. durch strukturelle und biochemische Veränderungen plastischer Synapsen bzw. durch Ausbildung zusätzlicher Synapsen effektiver vernetzt sein als zuvor (4, 15, 40). Dabei sind jeweils bestimmte Gedächtnisinhalte, etwa Begriffe oder Erfahrungen, nicht in einzelnen Synapsen oder Neuronen, sondern als „Engramm“ durch die gemeinsame Aktivität von Abertausenden von Synapsen und Nervenzellen kodiert bzw. repräsentiert (wie es in der Fachsprache heißt) und in einem komplizierten Mosaik von Neuronen gespeichert, die miteinander vernetzt sind. Man spricht von einem Ensemble bzw. auch von „neuronalen assemblies“.
Wie Valentin Braitenberg (5) in seinem Buch „Das Bild der Welt im Kopf“ erläutert, stellt man sich vor, dass die zu einem „assembly“ gehörenden Neuronen infolge ihrer gemeinsamen, synchronen Aktivität durch plastische Synapsen zunächst vorübergehend und – nach einem Lernprozess – auch auf Dauer fest miteinander verbunden, sozusagen „verdrahtet“, sind.
Abb. 2.1 Gedächtnisformen (mod. nach 16, S. 131, und 23): Das deklarative (explizite) Gedächtnis beherbergt Erinnerungen an Fakten (semantisches Gedächtnis) bzw. Lebenserinnerungen (episodisches Gedächtnis) und Orte, die sich sprachlich wiedergeben lassen. Sie werden kurzzeitig im Präfrontalhirn gespeichert, dann im Hippocampus in Inhalte des Langzeitgedächtnisses umgewandelt und in verschiedenen Regionen der Hirnrinde gespeichert – insbesondere im Temporallappen, von wo sie (im Prinzip) bewusst abgerufen werden können (15). Implizite Erinnerungen an Emotionen, Fertigkeiten, Gewohnheiten und Konditionierungen werden im prozeduralen Gedächtnis (in Kleinhirn, Basalganglien und Amygdala) abgelegt. Sie sind der bewussten Erinnerung nicht zugänglich und können nicht willentlich abgerufen werden.
Der kanadische Psychologe Donald Hebb (12) postulierte schon Ende der 40er Jahre, dass (benachbarte) Neuronen, die simultan „feuern“, miteinander „verdrahtet“ werden („Neurons which fire together, wire together“). Auf diese Weise werden gemeinsam und synchron aktive Neuronen der Hirnrinde zu Ensembles zusammengebunden, die beispielsweise eine Erfahrung repräsentieren und diese auch im Gedächtnis speichern können (31).
Eric Kandel (14, 16) hat die generelle Bedeutung seiner Erkenntnisse für Lernprozesse erkannt, wenn er schreibt, dass Lernen immer auch nachhaltige Veränderungen in der Effektivität der Informationsübertragung in synaptischen Verbindungen zwischen den Neuronen bedeute. Und er geht noch einen Schritt weiter, wenn er sagt, dass auch zwei Menschen, die miteinander sprechen, gegenseitig die synaptischen Verbindungen des anderen verändern (sofern sie sich ihr Gespräch merken).1 Kurz gesagt: Sie verändern ihre Gehirne, und dies auch in einer Verhaltens- bzw. Psychotherapie, also in ganz spezifisch gestalteten Gesprächen, wie mit bildgebenden Verfahren nachgewiesen werden konnte (2, 33, 34). Darauf werden wir später noch einmal zurückkommen (Kap. 12, S. 160ff u. Kap. 13, S. 180f).
Auch all das, was wir in unserer Kindheit und später durch das gesprochene Wort aufnehmen, was uns prägt, was wir lernen, mithin die gesamte Kulturwelt – die Welt III im Sinne Poppers – wird unsere synaptischen Vernetzungen langfristig verändern. Deshalb stellen sich wohl die synaptischen Feinstrukturen neuronaler Netzwerke bei heutigen zivilisierten Menschen völlig anders dar als bei den Menschen einer Steinzeitkultur, obschon sich die Genome wahrscheinlich nicht wesentlich unterscheiden (31).
Bildlich gesprochen, ist durch das gesprochene (und geschriebene) Wort die „Hardware“, also die „Verdrahtung“ der Schaltkreise im „Biocomputer Hirn“ bei Menschen verschiedener Kulturen unterschiedlich. Daher kann eine Kultur nur durch Sprache entstehen und lebensfähig sein. Durch das gesprochene Wort und durch verbales „ansteckendes“ Lernen verbreiten sich Kulturen (und Ideen). Ideen, Riten und Mythen (um nur einige Beispiele zu nennen) wurden auf diese Weise schon vor Jahrtausenden – lange vor der Erfindung der Schrift – von Generation zu Generation tradiert und im kulturellen Gedächtnis gespeichert. Anders gesagt: Die menschlichen Gehirne „infizieren“ sich durch das Medium Sprache gewissermaßen gegenseitig mit Geist. Sie beeinflussen und koordinieren dadurch ihre mentalen bzw. neuronalen zerebralen Strukturen. Kultur und Geist prägen das Gehirn. Die wichtigste Voraussetzung des Geistwerdens aber ist das Wunder der Sprache. „Geist ist Wort“, sagt Martin Buber (6, s. auch Kap. 13, S. 179).
▶ Doch nicht nur Gespräche mit anderen führen zu mittel- und langfristigen Veränderungen von Synapsen im Gehirn. Wir können natürlich auch zu uns selbst sprechen und auf uns selbst einwirken, so wie das die Autosuggestionstechniken von Emile Coué (1857–1926) und Laura Huxley (13) lehren – und wie es nicht selten auch kleine Kinder machen, wenn sie sich etwas überlegen. Bekanntermaßen gibt es verschiedene Arten des Überlegens, etwa verbales Denken und visuelles anschauliches Denken, z.B. in inneren Bildern. Und man kann sich auch Bewegungen ausdenken, etwa beim Tanzen. Wenn wir „verbal“ denken, benutzen wir Mentalismen oder Begriffe, nicht selten so, als sprächen wir im Stillen zu uns selbst – „silent speech“ nennen es angelsächsische Psychologen. Und wir können uns diese Gedanken auch merken.





























