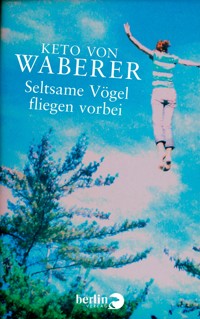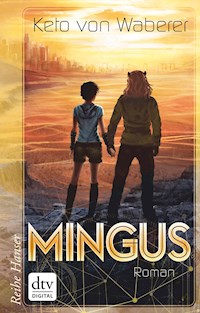
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Ein Märchen aus urneuer Zeit: unheimlich, verführerisch, anrührend.« Friedrich Ani Für die einen ist dieses Wesen ein Wunder, für die anderen der neue Messias oder eine mörderische Waffe: Mingus. Alle wollen ihn haben. Er ist aus den Wäldern gekommen und ahnte nichts von seiner Einzigartigkeit. Ein Mädchen war bei ihm, Nin, vor Jahren entführt aus der Stadt. Alle denken, er hätte sie geraubt. Niemand glaubt Nin, als sie beteuert, dass Mingus ihr Retter sei. Alle suchen ihn. Doch Mingus findet immer wieder Unterstützer, die ihn vor allem für ihre Ziele einzuspannen versuchen. Dabei will er nur eins: Nin finden und mit ihr dorthin zurückkehren, wo sie beide glücklich waren. Für Nin ist es unerträglich, nicht zu wissen, ob Mingus noch lebt. Er muss leben, sie würde doch spüren, wenn der Liebe ihres Lebens etwas Schreckliches zugestoßen wäre. Und so macht sie sich auf die Suche...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
KETO VON WABERER
MINGUS
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
© 2012 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
eBook ISBN 978-3-423-41597-2 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-24937-9
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website
www.dtv.de/ebooks
MINGUS
TARA
NIN
TARA
MINGUS
BORIS
NIN
MINGUS
TARA
NEILA
NIN
BORIS
TARA
NIN
MINGUS
NIN
TARA
NIN
BORIS
MINGUS
TARA
NIN
MINGUS
NIN
TARA
NIN
BORIS
NIN
MINGUS
ALAN
NIN
TARA
BORIS
MINGUS
ALAN
NEILA
NIN
TARA
BORIS
ALAN
MINGUS
AGLAIA
NIN
AGLAIA
BORIS
MINGUS
AGLAIA
ALAN
BORIS
TARA
MINGUS
BORIS
NIN
ALAN
NEILA
AGLAIA
NIN
MINGUS
ALAN
MINGUS
NEILA
BORIS
TARA
ALAN
AGLAIA
NIN
MINGUS
TARA
MINGUS
TARA
AGLAIA
ALAN
TARA
NIN
MINGUS
[Informationen zum Buch]
[Informationen zur Autorin]
Für Lilith
»Ausgerechnet der Mensch ist unmenschlich.«
Thomas Bernhard
Es sprechen:
MINGUS: muss in einer ihm fremden Welt zurechtkommen.
NIN: kennt diese Welt, aber fühlt sich fremd in ihr.
TARA: schlägt sich durch.
BORIS: schlägt Gewinn für sich heraus.
ALAN: will die Welt retten.
NEILA: will die Welt bekehren.
AGLAIA: will die Welt verbessern und beherrschen.
MINGUS
Papa ist tot.
Sein Schlüsselbund mit dem Löwenkopf wiegt schwer in meiner Tasche. Ich bin noch nie lange draußen gewesen. Ich bin noch nie alleine draußen gewesen, und ich setze mich sofort auf einen Stein neben dem Tor und sehe zu, wie die Sonne untergeht. Ich weiß, dass dies die Sonne ist, die hinter den Bergen wegtaucht wie eine glühende Scheibe. Papa hat sie mir gezeigt durchs Fenster. Das ist lange her, viele, viele Zeiten, Zeiten von Hitze und Kälte. Jahreszeiten, sagt Papa. Jetzt ist Sommer. Meine Lieblingszeit. Draußen riecht es gut, und doch, ich möchte zurück in mein Bett kriechen. Aber vor meinem Bett liegt Papa. Er lebt nicht mehr, und all sein roter Saft ist ausgelaufen. Ich habe ihn abgeworfen, nur das, nichts weiter, ich habe ihn abgeschüttelt, weggeschleudert, weiter nichts. Ich wollte ihm nicht wehtun. »Du musst lernen, dich zu bezähmen«, sagt Papa. »Du hast solche Kraft«, sagt Papa. »Das ist gut, aber gefährlich.«
Er hat mich angesprungen, von hinten, und nach meinem Mund gesucht mit seiner Hand, in der er die Tablette hielt. Ich wollte sie nicht nehmen. Ich hasse es, so lange zu schlafen. Immer macht er, dass ich schlafe.
Man kann weit sehen von hier aus. Das rote Tal, sandiger Boden mit Steinen, die Schatten werfen. Weit weg, so weit weg die Berge. Es sind keine Berge, sondern Hügel, sagt Papa. Ich habe noch nie einen Berg gesehen. Die Sonne ist weg, und alles färbt sich dunkelblau, dann grau, dann schwarz. Die Steine sehen aus wie kleine Menschen, die sich zum Schlafen zusammengekauert haben. Nichts bewegt sich. Nur Wind geht und kommt, unsichtbar, hebt Stöckchen auf und trockene Halme und trägt sie ein Stück, ehe er sie fallen lässt. Ich höre das große Windrad über mir klappern. Ich möchte essen. Drinnen mache ich die Kiste auf, in der es Winter ist, immer Winter, sagt Papa. Ich nehme Fleisch heraus. Ein großes Stück mit einem Knochen. Der glänzt wie Metall im trüben Licht.
»Ich esse das alles auf«, sage ich. Natürlich antwortet er nicht. Und ich lache. Die toten Tiere kann man essen, aber nicht die Menschen, sagt mein Papa. Menschen muss man ganz lassen, wenn sie tot sind, und dann eingraben, ehe sie schlecht riechen.
In der Winterkiste ist kein Platz für Papa. Ich werde ein Loch graben. Morgen. Und einen Stein draufrollen. Ich bin stark. Viel stärker als Papa. Ich kann ihn aufheben und tragen. Er will das nicht.
Papas Bett ist zu klein für mich, aber es riecht gut, nach ihm. Er hat ein Kissen. Ich werfe es auf den Boden. Morgen grabe ich Papa ein. Morgen gehe ich weg. Morgen geht die Sonne auf, und es wird heiß. Ich werde Papas Tasche mitnehmen. Sie packen, so wie er es immer getan hat. »Geh nicht weg, Papa! Geh nicht weg!« – »Ich bin bald zurück. Dein Essen ist da. Komm her, lass mich die Kette festmachen. Nimm schön deine Tabletten, schau, ich nehme auch Tabletten. Papa Tabletten. Das sind deine, da in der roten Schachtel. Da steht ›Mingus‹ drauf. Dein Name.« Ich will die Tabletten nicht. Ich will nicht schlafen. Jetzt aber werde ich schlafen.
Papa ist tot. Ich höre das Windrad klappern hoch überm Haus. Da stehen seine Schuhe vor dem Bett. Ich schaue hinüber und versuche, seine nackten Füße zu sehen, dort, wo er liegt. Er ist nur ein dunkler Haufen.
Als es hell wird, schließe ich die Tür auf und stehe auf der Schwelle. Ich stehe da. Ich habe Lust gehabt, gleich loszulaufen, und es macht mich böse, dass er mich zurückhält, ganz so, als könnte er noch sprechen. Ich weiß, wo er die Spaten hat, drüben im verbotenen Haus aus Metall, in das ich noch nie hineindurfte. »Das ist gefährlich«, sagt Papa. »Das ist kein Ort für dich. Du würdest sofort sterben, sobald du auch nur die Tür berührtest. Verstehst du mich?« Ich weiß, was sterben ist. Ich habe gesehen, wie die Kleinen starben, hässliche magere Dinger, die schlecht rochen und mit offenen Mäulern schrien, nicht essen wollten, um sich schlugen und uns nachts nicht schlafen ließen. Sie wollten nicht sterben. Dann lagen sie still, und Papa brachte sie weg. Eingewickelt in ihre Schlafdecken. Er selbst hockt da und heult, als wäre er selber gestorben. »Was ist mit dir los?«, frage ich ihn. »Das sind deine Brüder!«, brüllt er, und als ich lache, schlägt er mich. »Du warst auch so klein«, flüstert er. »Du warst auch so klein.« Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich war immer stark, und ich habe immer gerne gegessen. Mehr weiß ich nicht.
Am Morgen liegt Tau auf den Felsen, ich lecke daran. Ich laufe los, meine Schritte werden immer größer. Sie werden zu hohen Sprüngen. Noch einer, noch einer, weiter, höher, noch höher. Das ist schön. Ich brülle. Ich umrunde das Haus, das Windrad, und es trägt mich weiter bis zu den fernsten Felsen. Ich fliege. Sand hebt sich und streift meine Beine mit Nadelstichen. Ich mag Nadelstiche nicht, aber diese prickeln wunderbar. Ich renne, bis ich keine Luft mehr in mir habe. Ich lasse mich in den Sand fallen. »Brüll nicht so hässlich«, sagt Papa. »Hör auf«, sagt Papa. Ich gehe und trinke Wasser. Viel Wasser.
Das Metallhaus hat keine Fenster. Es sieht so böse aus wie immer. Die Sonne lässt es glänzen und zerfließen gegen den blauen Himmel. Papa sagt, es ist lebendig und lässt nur ihn herein. Vielleicht ist es ja noch am Leben, obwohl Papa nicht mehr zu ihm kommt. Ich lege die Hand auf die Tür. Nichts passiert. Ich schlage mit den Fäusten dagegen. Es seufzt. Nein. Das Haus brummt, wenn ich es schlage. Die Tür bebt unter meinen Handflächen. Ich laufe zurück in unser Haus und mache die Tür zu.
Am Mittag ist die Luft unruhig über dem Metallhaus, als würde es gleich wegfliegen. Ich warte. Ich setze mich auf unsere Schwelle und esse trockene süße Bröckchen aus einer Dose. Ich mag diese Bröckchen. Ich bekomme sie immer, wenn ich etwas für ihn getan habe und er zufrieden ist mit mir. Auf den Händen laufen. Den Ball finden, den er versteckt hat, untertauchen in der Wanne voll kaltem Wasser, ohne zu klagen, das Fleisch mit der Gabel festhalten und mit dem Messer winzige Scheiben abtrennen, um sie zu essen. »Du bist kein Tier«, sagt Papa. Die Sonne senkt sich über den Hügeln, und ich stehe auf und gehe hinüber. Ich habe den Schlüssel schon in der Hand. Ich singe ein bisschen vor mich hin. Ich lasse mir nichts verbieten von Papa, der nichts mehr sagen kann.
Drinnen ist es dunkel, und es riecht nach fremden beißenden Sachen. Ich muss niesen, und sofort danach weiß ich, dass ich nicht allein bin in der Dunkelheit. Ich habe einen Stock dabei, ich hebe ihn hoch und halte den Atem an. Ich lausche. Es ist ganz still, und doch spüre ich in der lauen Luft etwas wie eine wärmere Zone, wie eine prickelnde Blase, die sich gegen mein Gesicht wölbt. »Wo bist du?«, schreie ich, und ich schlage mit dem Stock in die Finsternis. Dann wird es hell. Sehr hell. Überall stehen Tische und metallene Kästen. Auf den Tischen sind Gläser und Bottiche, Metallfäden wie Spinnennetze spannen sich dazwischen und zittern. Da liegen glitzernde Metallstäbchen schön geordnet auf Tüchern. Da ist ein Käfig, ähnlich wie meiner, als ich noch klein war vor langer Zeit. In dem Käfig bewegt sich etwas. Ich sehe Haare und Tücher, die zusammengedreht sind zu einem Bündel. Kein Laut. Das ist ein lebendiges Ding, da ist ein Bett, ein Teller, Eimer, Papiere in Haufen. Aber es ist viel größer als die Kleinen, und es riecht anders, und es ist nicht gefährlich für mich, das spüre ich, so als würde es mit mir reden. Ich habe immer gewusst, was mit Papa los war, auch wenn er kein Wort sagte. Viele Tage, ohne ein Wort. Ich wusste, was er sagte. Er will recht haben. Er will, dass ich an ihn glaube. Er will, dass alle – ich und das ganze Haus, der Himmel, der Sand und die Steine und die Hügel und der Wind und die Sonne – verstehen, wer er ist und was er will. »Ich bin ein Schöpfer«, sagt er. »Die Welt ist noch nicht reif für mich«, sagt er. »Ich werde die Zukunft erschaffen.« Ich verstehe die Worte nicht, aber ich fühle, was er meint, nein, was er braucht, nein, was er will.
Manchmal singe ich für ihn, und ich tanze für ihn. Er hat mir das nicht gezeigt. Ich kann das von Anfang an. Das hat er selbst gesagt.
Ich hocke mich neben den Käfig und steche mit dem Stock in das Bündel. Und es zischt. Ein seltsamer Laut. Was ist das für ein Lebewesen? Ich schubse es mit dem Stock hin und her. Es quiekt, hat plötzlich zwei Hände, packt den Stock und stößt mich damit zurück, dass ich umfalle. Ich lache. Es hustet. Das klingt so, wie wenn ich huste. Ich habe keine Angst vor ihm. Ich probiere die Schlüssel, schließe den Käfig auf, ohne es aus den Augen zu lassen. Aber ehe ich noch richtig durch die Klappe kriechen kann, kommt es hoch, versetzt mir einen Stoß und ist fast schon an mir vorbei. Ich erwische es an den langen Haaren. Meine hat Papa immer abgeschnitten. Es schreit. Aber nicht ängstlich, sondern wütend, und es beißt mich in die Hand. Ich kriege es am Hals zu fassen und schüttle es. Es hält still und starrt mich an mit verdrehten Augen. Es sieht nicht aus wie Papa, aber auch nicht wie die Kleinen. Und doch hat es wie er und ich Arme, Beine und einen Kopf auf ebendiesem Hals, den ich etwas zudrücke, um ihm das Beißen auszutreiben. Ich schüttle es noch ein bisschen, und es macht sich ganz schlaff und schwer, und ich hebe es auf und trage es durch die Tür hinaus in die Dämmerung, denn die Sonne ist schon verschwunden, nur der Himmel ist noch hell.
Im Haus will ich ihm Wasser geben und Fleisch. Es sieht mager aus, wie die Kleinen, und ich will nicht, dass es stirbt. Ich bin froh, dass ich es gefunden habe, und ich bin froh, dass ich nicht alleine bin. Ich lege es auf Papas Bett, Papa hebe ich auf und trage ihn hinüber und hocke ihn in die Käfigecke – drüben im Metallhaus. Dann nehme ich den Stock und zerschlage diese hässlichen gleißenden Würmer, die von der Decke hängen und meinen Augen wehtun, und ich schließe die Tür ab.
Das ist besser, als unter der Erde zu liegen, sage ich mir, und ich bin erleichtert.
Das Ding hat keine Lust, sich zu bewegen. Ich horche an seiner Brust und höre das Herz schlagen und höre die Luft, die eingesogen wird und wieder hinausgeblasen durch den offenen Mund. Kleine flache Zähne.
In Papas Bett ist es sehr eng für uns, und ich drücke mich an die Wand und lege meine Arme und Beine um das Ding. »Du bist mein kleiner Bruder, oder was?«, sage ich in sein Ohr. Ich habe Lust, ihn zu schütteln, ihn zu einer Antwort zu zwingen. Ich würde Papa gerne fragen, ob das mein Bruder ist, aber er ist nicht mehr da. Auch in meinem Kopf spricht er nicht, so als könnte er durch diese Metallwände da drüben nicht mehr bis zu mir gelangen mit seiner Stimme. Ich finde das gut so.
Er kann nicht sprechen.
Er trinkt Wasser und stopft sich Essen in den Mund, alles, was noch da ist in der Winterkiste. Grünes, Rotes, Gelbes, kein Fleisch. Das ist für mich. Er hockt auf dem Boden, so wie ich hocke. Ich versuche, ihm in die Augen zu sehen, aber er lässt mich nicht. Er hat goldenen Dreck an der Stirn, und ich will ihn abkratzen. Er weicht meiner Hand aus. Die Tür hab ich abgesperrt, er schaut oft zur Tür. Er trägt jetzt etwas von meinen Sachen. Ein Hemd, es reicht ihm bis über die Knie. Ich will ihn in die Wanne voll Wasser setzen, aber er zappelt wild. Ich setze mich selbst hinein und seife mich ab. Ich versuche ihm zu zeigen, dass das gut ist. Haare scheint er nur am Kopf zu haben. Seine Nägel sind lächerlich. Vielleicht ist er krank.
Die Sonne geht auf und unter – wieder und wieder. Ich sehe, dass es ihm besser geht. Wir essen alles, was wir finden, in Truhen, in Säcken, in Tüten, in Dosen. Manches müssen wir lange kochen, ehe es weich genug ist. Ich kann das, aber wie sich zeigt, kann er das auch. Er ist geschickt mit seinen lächerlich kleinen Händen. Er wickelt einen Fetzen Stoff um meine verletzte Hand, als hätte er das schon oft gemacht. Er macht Dosen auf, schneller als ich. Er versucht, die Tür aufzukriegen, wenn ich schlafe. Von da an verstecke ich die Schlüssel, und nachts halte ich ihn fest, ich merke sofort, wenn er sich losmachen will. Er will nicht, dass ich zusehe, wenn er pinkelt.
»Wir gehen!«, sage ich und packe Papas Tasche mit allem, was wir vielleicht brauchen. Kleider, Messer, Wasserflaschen, Decken. Sogar einen Topf nehme ich mit, vielleicht müssen wir was kochen. Papa hat mir nie erlaubt, alleine Feuer zu machen. Ich nehme alle Streichhölzer mit und alle Kerzen. Ich weiß nicht, wie lange wir damit auskommen.
Die Sonne steht schon hoch.
Ich schließe die Tür ab. Ich warte darauf, dass er losrennt und zwischen den Steinen verschwindet, aber er bleibt neben mir stehen. Da ist Papas Maschine unter ihrer glitzernden Zeltblase. Ich gehe um sie herum. Der Kleine klettert hinein und wartet. Papa sagt, man braucht einen Zauberspruch, um die Maschine zum Leben zu erwecken, um dann von ihr fortgetragen zu werden. Wir wissen den Zauberspruch nicht. Der Kleine will nicht glauben, dass wir die Maschine nicht wecken können, das sehe ich. Er drückt auf alle möglichen Knöpfe und Fensterchen. Er schlägt mit seinen Fäusten auf das Rad, mit dem Papa dem Ding sagen kann, wohin es ihn tragen soll. Ich sehe zu und lache. Ich gehe los.
Man kann Papas Weg sehen, an den Spuren im Sand. Der Kleine bleibt sitzen, und als ich mich umschaue, sehe ich, dass er versucht, die Maschine anzuschieben. Ich lache. Nach einer Weile kommt er mir nach, bleibt ein paar Schritte hinter mir. Dann laufen wir los. Ich muss langsam gehen, sehr langsam, sonst kommt er nicht mit. Ich stopfe trockenes Krautzeug in seine Schuhe, die Papas Schuhe waren, und binde sie fest um seine Knöchel. Er schaut mir dabei zu, als wären das nicht seine Füße. Ich lasse ihn trinken, nicht zu viel. Ich binde seine schmutzigen Haare zusammen. Er schwitzt. Ich schwitze nicht. Er klagt nicht, aber ich sehe, wie er die Zähne zusammenbeißt. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat.
Wir machen halt, immer wieder. Es dauert lange, ehe ich ihn wieder dazu bringe, aufzustehen. Die Sonne geht unter. Der Mond geht auf. Wir rasten, an einen Stein gelehnt. Er schläft. Ich nicht. Es ist kalt. Ich fange ein kleines wolliges Tier. Es ist leicht zu fangen. Wir braten es am Morgen, als es gerade anfängt, hell zu werden. Der Kleine klappert mit den Zähnen. Ich nehme ihn in meine Jacke. Er zittert und trinkt gierig Wasser. »Nur ein wenig«, sage ich. Er versteht jedes Wort, das weiß ich längst.
Papas Spur ist nicht mehr zu erkennen. Eine Zeit lang glaube ich noch, den stechenden Geruch seiner Maschine zu atmen zwischen den Steinen, dann sind wir allein mit dem Sand, den Steinen, den Hügeln in der Ferne, die kein bisschen näher gekommen sind. Die Sonne steht über uns. Ich habe Lust, umzukehren und in mein Bett zu kriechen, aber die Winterkiste ist leer, und die Hügel sehen so schön aus, wie aus blauem Glas.
Als es anfängt dunkel zu werden und kalt, sehen wir den Mond über den Hügeln stehen, wie eine Scheibe aus Eis. Ich grabe eine Kuhle in den Sand und lege die Kleider über uns. Der Kleine zittert und lässt sich anfassen und zurechtrücken an mir. Wir trinken Wasser. Wir essen die letzten süßen Bröckchen aus der Dose. Ich pinkle an einen Stein, und er sieht neugierig zu. Er hockt sich zwischen die stachligen Pflanzen, und ich glaube, er pinkelt auch. Ich höre es plätschern. Wenn er krank ist, ist er vielleicht krank im Kopf, nicht im Körper, sonst wäre er nicht gelaufen den ganzen Tag. Papa sagt, die Welt ist voller Menschen, die krank sind im Kopf. Er hat immerzu Ärger mit diesen Leuten. Er will nicht, dass sie mich sehen. Sie würden mich nicht mögen. Sie würden mich töten, sagt Papa. Ich glaube ihm das nicht. Papa sagt Sachen, die nicht wahr sind, aber das merke ich immer erst später. Er sagt, Besuch kommt, aber niemand kommt. Er sagt, er schlägt mich, weil er mich gern hat, aber das stimmt nicht. Er schlägt mich, weil er sich selber schlagen will. Ich habe immer gewusst, was Papa denkt. Der Kleine ist dicht. Ich weiß nicht, was er denkt. Wahrscheinlich ist er doch krank. Aber das macht nichts. Er ist zu schwach, um gefährlich zu sein. Ich will nicht allein sein, und nachts wärmt er mich. Das gefällt mir. Ich habe nie zu Papa ins Bett gedurft. Am Morgen ziehen wir weiter, er hinter mir. Ich trage alle unsere Sachen, er hat genug damit zu tun, sich selber zu tragen.
Wasser kann ich riechen. Es riecht gut, eben wie Wasser riecht – hellgrün. Wir trinken, und dann baden wir. Es ist viel schöner als in der Wanne und sehr kalt. Ich weiß sofort, wie ich mich bewegen muss. Ich laufe mit allen vieren im Wasser und spritze und schreie. Der Kleine macht es anders. Er bewegt Arme und Beine ganz merkwürdig. Er ist schneller als ich, und zum ersten Mal höre ich ihn lachen. Es gibt Fische. Ich tauche unter Wasser und sehe sie. Sie sind groß und blitzen. Ich habe Fische bis dahin nur steif gesehen und mit trüber Haut und blinden Augen in Papas Winterkiste. Ich fange sie. Ich fange viele. Ich kann gar nicht mehr aufhören, sie zu fangen. Ich werfe sie ans Ufer zwischen die Steine. Sie zappeln noch. Der Kleine fädelt sie auf einen Stock wie Perlen. Ich habe mit Perlen gespielt und lange Ketten gemacht für Papa. Der kleine Bruder ist geschickt, er hängt den Stock auf, zwischen den Steinen, zwei Stöcke mit Fischen, zum Trocknen, das verstehe ich sofort. Wir können sie später essen. Es ist heiß, und sie trocknen schnell und verlieren ihre schöne Farbe. Ein paar essen wir gleich. Ich schneide sie in kleine Stücke, er legt sie, schön geordnet, auf einen flachen Stein und gibt mir ein kleines Stöckchen zum Aufspießen. Dumm ist er nicht.
Ich rieche auch den Wald schon lange, ehe wir ihn sehen. Das ist ein Wald. Papa hat mir Bilder gezeigt, er hat mir erzählt von den großen Bäumen, die zusammenstehen, und viele Pflanzen wachsen in diesem Schatten, um sie herum, und auch, dass es alle möglichen Geschöpfe gibt zwischen den Bäumen im Gebüsch und oben in den Blättern. Ich habe es eilig, zum Wald zu kommen. Der Kleine bleibt zurück. Er klagt nicht.
Ich bin im Wald. Es riecht hier noch besser als am Wasser. Es riecht nach Lebendigem, nach Tieren, nach Beeren, nach Pilzen. Papa hat Pilze mitgebracht und getrocknet. Er liebt Pilze. Papa kocht sie für uns. Ich sehe ihn essen und schmatzen. Wo ist er jetzt? Er sagt, wenn man stirbt, zieht man den alten Fleischanzug aus und bekommt einen »nigelnagelneuen«. Das Wort hat mir schon immer gefallen, und ich sage es ein paarmal vor mich hin. Es riecht hier so wunderbar. Es gibt außer uns noch viele im Wald, aber wer sie auch sind, sie verstecken sich.
Ich lege mich auf eine grün bewachsene Stelle, auf der keine Bäume stehen, nur diese harten dünnen Halme, die sich im Wind bewegen. Ich liege da und strecke mich. Insekten surren über mir, und Vögel fliegen über mich hin. Ich schlafe.
Der Kleine findet mich, als die Sonne dabei ist, hinter den Bäumen zu verschwinden. Er legt sich zu mir und zittert. Er hält sich an mir fest. Er hat Angst gehabt, allein zu sein, ohne mich. Ich lecke sein Gesicht.
Als es dunkel ist, fange ich ein kleines Tier. Ich höre es leise graben, dicht neben uns im Dunkeln. Ich rieche seinen verführerischen Duft.
Ich mache Feuer, und wir wickeln das Tier aus seinem Fell und in ein großes Blatt. Es braucht lange, ehe er es gut beißen kann. Der Kleine friert. Er liegt auf mir und schläft, seine Nase in meinem Brusthaar. Er mag meinen Geruch, das kann ich sehen. Ich mag ihn auch, meinen Geruch, aber lieber noch mag ich den Geruch des Kleinen. Er riecht nach Honig und ein bisschen bitter, wie Medizin.
Wir bleiben im Wald. Dreimal wird der Mond rund und schmilzt dann, bis er nicht mehr zu sehen ist. Der Mond wandert, sagt Papa. Der Kleine mag den Mond, und manchmal sitzen wir beide und schauen zu, wie er wandert. Es ist gut im Wald, und wir haben immer zu essen. Es gibt süße saftige Sachen auf den Bäumen und im Gebüsch. Es gibt Wurzeln, die wir ausgraben. Es gibt Blumen, die gut schmecken, und fette Käfer und Maden unter der lockeren Rinde der Bäume. Wir trinken Wasser aus einem Bach, der durch das hohe Gras fließt. Der Bach spricht. Er spricht die ganze Nacht. Der Kleine hockt im Wasser und wäscht seine Haare. Er wäscht auch unsere Kleider und breitet sie in der Sonne aus zum Trocknen. Ich rolle ohne Kleider nass und wie befreit im Moos. Er sieht mir zu. Er schaut mich ganz genau an. Ich glaube, ich gefalle ihm. Er selbst zieht nie alles aus. Er will das nicht. Ich lasse ihn. Er hat nasse Haare und immer noch diesen glänzenden Streifen auf der Stirn. Es ist kein Dreck, es ist Schmuck, wie meine Kette aus Glasperlen, die ich gemacht habe für Papa. Er wollte sie nicht um seinen Hals. Ich habe sie verloren. Der Kleine nimmt eine rote Beere und macht mir einen Streifen auf die Stirn. Er sammelt alle möglichen Beeren und fädelt sie auf Grashalme, für später, den Rest legt er auf ein großes Blatt und bringt es mir, um es anzuschauen. Ich lobe ihn. Er versteht das sehr gut. Ich könnte immer hierbleiben.
Weiter gehen wir, schon früh am Morgen auf die Hügel zu. Sie sind höher geworden und haben scharfe Zähne, die weiß leuchten gegen den blauen Himmel. Wir laufen den ganzen Tag ohne Pause. Er kann das jetzt, doch ich könnte viel schneller sein ohne ihn. Am Abend verdunkelt sich der Himmel. Wir suchen einen Platz für die Nacht. Die ganze Nacht fällt Regen.
Am Morgen wird es nicht heller. Wir warten. Es regnet und regnet. Wir hocken in einer flachen Höhle, der Wind treibt den Rauch unseres Feuers herein, und wir haben schwarze Gesichter und husten. Wir verschlafen den ganzen Tag und stehen nur auf, um zu essen oder um Holz nachzulegen, nasses Holz, es brennt schlecht und raucht noch mehr.
Ich sehe nur Steine, so weit ich schauen kann. Alles ist flach, und überall liegen große Steine verstreut, dazwischen ein paar Bäume, magere Zwergbäume. Wir warten. Der Kleine hat keine Stimme. Ich spreche mit ihm. Ich singe. Ich erfinde alle möglichen Geschichten. Ich lasse die Steine sprechen. Ich lasse die Bäume sich beim Namen rufen. Ich gebe sogar der Schlange eine Stimme, ehe ich sie packe und sie in meiner Hand ersticke. Wir essen sie. Sie schmeckt uns beiden.
Wir gehen weiter. Die Hügel kommen näher. Wir haben aufgehört zu zählen, wie oft der Mond auf- und untergegangen ist. Wir gehen weiter. Wir waten durch reißendes Wasser. Wir kämpfen uns durch dornige Büsche. Wir sind zerkratzt, und der Kleine ist verbrannt von der Sonne. Ich pflücke Hautfetzen von seinem Gesicht. Die Haare auf meinen Armen sind hell geworden, und meine Kleider sind zerrissen.
Wir erreichen die Hügel an einem Tag mit heftigem Wind. Ich weiß schon lange nicht mehr, wie viele Tage wir gelaufen sind. Meine Augen tun mir weh, und der kleine Bruder fällt oft hin, bleibt liegen und muss aufgerichtet werden und geschüttelt. Wir haben kein Wasser mehr, und was wir zu essen finden, schmeckt nicht gut. Kleine Tiere, die hart zu kauen sind und schwer zu schlucken. Die Hügel sehen von Nahem sehr hoch aus.
Ich rieche es schon von Weitem.
Es gibt Menschen. Wir verstecken uns. Vielleicht werden sie uns töten. Ich beobachte sie, wie sie herumlaufen, in der Erde wühlen und zusammensitzen, um zu essen. Ja, sie essen. Es riecht gut. Sie haben Wasser.
Zuerst entdecken sie den kleinen Bruder, weil er anfängt, laut zu schreien und zu heulen. Ich schaue zu, wie sie ihn wegtragen. Seine Arme und Beine baumeln, als wäre er tot. Dann suchen sie nach mir. Ich verstecke mich. In einer kleinen Schlucht kann ich ihnen nicht mehr entkommen. Ich lasse mich anfassen und betasten. Ich verstehe nicht alles, was sie sagen. Sie sehen nicht aus wie Papa. Sie binden meine Hände aneinander und schleppen mich in eines der kleinen Häuser. Sie riechen fürchterlich. Sie haben Angst vor mir. Trotzdem. Sie geben mir Wasser, sie halten mich fest und gießen Wasser in meine Augen. Sie geben mir Essen und hocken um mich herum, so weit entfernt von mir, wie sie können, während ich esse. Sie wollen sehen, wie ich esse. Es ist herrliches Essen. Ich sage ihnen das, aber ich weiß nicht, ob sie das verstehen. Ich lache und reibe meinen Bauch, das verstehen sie, und auch sie lachen. Ich spüre, dass sie mir nichts tun werden. Sie sprechen mit mir, alle sprechen, es ist so laut und macht mich böse, aber ich will nicht zuhören. Ich halte mir die Ohren zu. Sie lachen darüber. Ich denke, ich kann weglaufen, wenn ich mich ausgeruht und mich vollgefressen habe. Den kleinen Bruder will ich mitnehmen. Ich muss herausfinden, wo sie ihn eingesperrt haben. Ich muss schlafen. Es gibt einen Haufen trockener Gräser, auf dem rolle ich mich zusammen. Meine Hände und Füße sind mit Stricken zusammengebunden. Ich lasse sie glauben, ich könnte mich nicht befreien.
Den ganzen Tag graben sie in der Erde. Es gibt dort Steinmauern, die einmal zu Häusern gehört haben, ehe sie unter die Erde versunken sind oder ehe man sie eingerissen hat oder abgebrannt. Sie graben und finden seltsames Zeug, kleine Sachen aus Metall oder Stücke von Tellern oder Tassen. Nichts Schönes. Sie zeigen mir, was ich machen soll. Ich soll Erde mit der Schaufel durch ein Gitter werfen. Ich kann das. Ich spüre, an welchen Stellen etwas unter der Erde liegt. Ich zeige es ihnen. Das gefällt ihnen. Sie haben mir Hosen gegeben, die groß sind, aber ich binde sie mit meinem Gürtel fest. Sie geben mir immer zu essen und zu trinken. Sie lassen mich nie aus den Augen.
Der kleine Bruder sitzt den ganzen Tag unter einem Baum und lässt den Kopf hängen, so als wäre er eingeschlafen. Ist er aber nicht. Wenn ich vorbeikomme, rede ich mit ihm. Ich sage: »Bald hauen wir hier ab, hab keine Angst.« Dann hebt er den Kopf und schaut mich an. Er versteht alles. Er ist traurig. Das spüre ich. Vielleicht weil Papa tot ist. Wasser läuft aus seinen Augen. Ich weiß nicht, wie er das macht.
Wie bei uns gibt es auch hier große Metallhäuser, in die ich nicht darf, und es gibt auch hier so etwas wie einen Papa. Das ist ein Mann, der den anderen sagt, was sie tun sollen, und obwohl sie ihn immer anlächeln, wenn sie ihn sehen, sieht es doch so aus, als zeigten sie ihm die Zähne und würden ihn beißen, wenn sie sich das trauen würden. Tun sie aber nicht. Ich verstehe sie. Sie werden nicht geschlagen, und ihn schlagen sie auch nicht, aber ich sehe, dass sie mich immer anschauen, anders als sie sich gegenseitig anschauen. Sie zeigen auch mir ihre Zähne, und ich kann an ihnen riechen, dass sie Angst vor mir haben. Das ist gut so.
An einem Abend kommt großer Lärm aus dem Himmel. Eine gefleckte Maschine, in der Leute sitzen und die keine Räder hat, sondern obendrauf ein Windrad, das den Sand aufwirbelt und die großen Pflanzen umbiegt, kommt langsam herunter, bis sie den Boden berührt und keinen Lärm mehr macht. Menschen steigen heraus. Ich verstecke mich. Zum ersten Mal kümmert sich keiner darum, was ich mache. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass etwas Böses passieren wird. An meinem ganzen Körper stellt sich das Haar auf. Ich finde den kleinen Bruder in seinem Haus. Er kommt sofort zu mir und klammert sich an mich. Ich habe so lange nicht gefühlt, wie es ist, seine Wärme an mir zu spüren. Ich drücke ihn an mich und rieche an ihm. Auch er riecht an mir. Er leckt sogar meine Schulter, und ich beiße ihn nur ganz wenig in den Hals, ganz wenig nur, es tut ihm nicht weh. So stehen wir eine Zeit lang und atmen zusammen. Draußen suchen sie nach mir, ich höre es. Bald sind sie da. Ich möchte sofort los mit dem kleinen Bruder, aber ich weiß jetzt, dass wir Wasser brauchen, Essen, Messer, Decken, die Stäbe, aus denen Licht kommt, all das. Wir schleichen uns hinter das Haus und verstecken uns zwischen den Bäumen. Sie finden uns. Es ist dunkel, und wir werden beide erst wach, als sie schon über uns sind. Sie zerren uns schreiend auseinander. Mich drücken sie auf den Boden. Sie tun mir weh, ihm tun sie nichts, aber sie schleppen ihn fort. Sie trennen uns. Sie glauben, ich tue ihm was.
Sie schleifen mich in das Metallhaus, es ist nicht voller Maschinen und gläserner Flaschen wie Papas Metallhaus war. Es gibt Tische, auf denen Sachen liegen, die sie in der Erde gefunden haben, und Tische voll mit Papieren. Das Licht aber ist so hell und weiß wie das in Papas Metallhaus. Ich weiß nicht, was sie wollen. Ich sitze auf einem Stuhl. Sie wollen, dass ich dort sitzen bleibe, und geben mir einen Teller mit gebratenem Fleisch, meinem Lieblingsessen. Der mit den langen roten Haaren und der weichen Stimme streichelt meine Hand, die anderen stehen um mich herum und schauen mir beim Essen zu. Ich will warten, bis sie mich nicht mehr umringen und mich in Ruhe lassen. Ich finde den kleinen Bruder schon. Ich habe seine Witterung.
Ein Mann, der aus der Maschine gestiegen ist, kommt ganz langsam auf mich zu, dabei schaut er mir in die Augen. Er streckt seine Hand aus, um mich zu berühren, meinen Kopf, so wie Papa das macht, wenn er wütend ist und mich gleich schlagen wird. Ich zeige alle meine Zähne und knurre, das ist ein Scherz, der Papa manchmal zum Lachen bringt, und dann kann er mich nicht mehr schlagen. Der Mann aber springt zurück, als habe er sich verbrannt an mir. Er macht Fotos von mir aus der Ferne. Papa hat mir genau erklärt, wie das geht. Er hat mir diese Bilder von mir nie gezeigt. Er sagt, das bringe Unglück. Ich spüre, dass er mich trotz seiner Angst anfassen will, und ich mache Bewegungen mit den Händen, dass er näher kommen soll. Er ist ein langer dünner Mann mit krummem Rücken und Augen, die aussehen wie Wasser. Er wagt sich heran und betastet sehr vorsichtig meine Ohren, meine Nase, meine Brusthaare. Seine Hand riecht sauer nach Angst.
Sie trinken alle das scharfe Zeug, das mir nicht schmeckt. Sie sind laut und das, was Papa »albern« nennt, umarmen sich, schreien, lachen, singen sogar. Ich schleiche mich davon. Ich finde den kleinen Bruder. Er hat ein richtiges Bett, ein winziges Bett auf Holzbeinen, die wackeln. Wir passen nicht hinein. Wir schlafen auf meinem Heubett. Es ist lange her, dass ich mich so gut gefühlt habe. Fast so, wie ich mich gefühlt habe, wenn Papa mich herumgetragen hat, als ich noch kleiner war. Das fällt mir jetzt wieder ein.
»Ich heiße Mingus«, sagte ich zu dem kleinen Bruder, und zu meinem Erstaunen hörte ich ihn »Mingus« sagen, ganz leise, aber ich habe gute Ohren. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet.
Als es hell wird, sind sie wieder da, alle, sie nehmen ihn mit. Mich halten sie fest und stechen mir in den Arm, und ich schlafe ein. Als ich wieder etwas sehen und hören kann, ist um mich her ein großes Getöse, und als ich das Gesicht an die Glasscheibe neben mir drücke, sehe ich weit unter mir große grüne Flecken, gelbe, braune und eine blaue Schlange, die sich dazwischen ringelt. Wir fliegen. Meine Hände und Füße sind zusammengebunden, und der lange Mann mit den Wasseraugen sitzt dicht neben mir und drückt mir die Schulter. Ich könnte ihn beißen. Ich bin blitzschnell. Aber ich tue es nicht. Vielleicht hätte ich es tun sollen.
TARA
Schon am Morgen ist der Kaffeegeruch so stark, dass ich im Bett liegen bleibe, mit geschlossenen Augen, und ihn einatme wie ein Parfum. Ich liege da und flechte langsam meine langen weißen Haare zu Zöpfen, um sie aus dem Gesicht zu haben. Meine Haare sind dick und lästig, aber ich bin immer noch stolz auf sie. Ich bin alt, und ich habe mehr Haare als manche junge Frau. Es ist so heiß heute, und die lange vergessenen Geister der Kaffeerösterei steigen zu mir herauf und machen mich unruhig. Ich wohne über den verfallenen Räumen der Kaffeerösterei, schon seit ein paar Jahren. Natürlich wird dort kein Kaffee mehr geröstet. Die Räume stehen leer. Viele Räume. Ich wohne ganz oben. Die unteren Räume, die an der Straße, betrete ich nie. Abfall liegt dort in Haufen, welke Blätter sammeln sich in den Ecken. Um in mein Zimmer zu kommen, muss ich über die Dächer steigen und mich durch alle möglichen Höfe arbeiten. Manche Häuser sind eingestürzt oder abgebrannt. Es gibt kaum noch bewohnte Häuser in dieser Gegend, der verbotenen Zone. Es ist nicht erlaubt, hier zu wohnen. Die Ci-Po macht Razzien. Hier soll »Auroville« entstehen, die Trabantenstadt, das Lieblingsprojekt unseres Präsis. Irgendwann werde ich weiterziehen müssen. Ich weiß das. Aber noch nicht. Es ist Abend, und ich hocke vor den Kisten, in denen die Pilze wachsen, im Dunkeln, denn sie vertragen kein Licht. Ich hocke im feuchten Geruch und taste behutsam nach den glatten Halbkugeln, schätze ihre Größe, und mein Herz klopft vor Freude über das neue Wachstum. Wenn man älter wird, hat man nur noch wenige Freuden, eine davon ist, Dinge beim Wachsen zu beobachten.
Ich denke den ganzen Tag an mein Abendessen.
Das Messer liegt neben mir, und ich fasse es und führe es sorgsam flach über dem feuchten Erdreich an die kleinen Stämmchen und überlege, wie viele ich mir heute Abend erlaube. Über mir knackt es, und Putz rieselt auf meine Hände. Verdammtes Getier. Etwas kriecht da oben herum, auf dem Dach über mir. Ich weiche zurück an die Wand. Die morsche Decke ächzt und splittert. Ich warte bewegungslos, das Messer in der Hand. Ein Geräusch, ein abscheuliches Geräusch, gefolgt von einem Schlag, einem Aufprall, der den Holzboden unter mir zittern lässt. Etwas Schweres ist heruntergefallen, nicht auf mich, aber auf die Pilze, meine empfindsamen Plantagen am anderen Ende des Zimmers. Ich bring das Vieh um! Schon bin ich an der Tür und reiße sie auf, das Messer in der Hand. Ich kann umgehen mit einem Messer. Zeig dich, Mistding!
Es ist ein Mensch, er hockt am Boden in einer Staubwolke. Ein großer Mensch, mehr sehe ich nicht. Vielleicht gefährlich. Sicher gefährlich. Ich schlage die Tür zu und verriegle sie, aber das wird nichts nützen, dieses Türchen, morsch und wacklig, wird niemanden aufhalten. Flucht. Ich stecke das Messer in den Gürtel und renne durch den Gang hinaus auf den gusseisernen Balkon, der um den