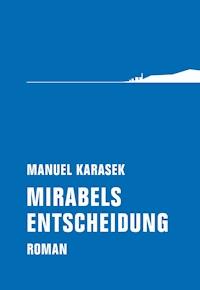1
Als Javier Torzek elf Jahre alt war, fuhr er zusammen mit seiner Mutter, der fast vierzigjährigen Mirabel Mendoza, auf einem Schiff nach Venezuela. Es war der Januar 1979, eine sibirische Wetterlage hatte Europa regelrecht vereist. Im Hamburger Hafen sahen er und seine Mutter den Frachter Caracas anlegen. Sie hörten die Matrosen, die mit den letzten Handgriffen des Manövers auf Deck beschäftigt waren, die Kälte verfluchen.
Das Schiff, das zwei Drittel seines Volumens für den Ex- und Import von Waren benötigte und das letzte Drittel an Platz für Menschen und Maschinen bereithielt, gehörte einem venezolanischen Unternehmen. Eine von Mirabels zahlreichen Schwestern – es handelte sich um Isabel – arbeitete in Caracas als Sekretärin für jene Firma, die über eine große Flotte verfügte. Angehörige von Mitarbeitern konnten kostengünstig eine der vielen Gästekabinen buchen.
Schon einmal hatte Mirabel diese Möglichkeit genutzt, 1972, als die eheliche Harmonie zwischen ihr und Hanns wieder mal empfindlich gestört gewesen war. Mehrere Wochen lang waren Javier und seine Mutter über den Atlantik geschaukelt. Tatsächlich hatte er eine Erinnerung an dieses Erlebnis. Irgendjemand – vielleicht der Kapitän oder der erste Offizier – hatte ihn an eines der Bullaugen im Speisesaal gehoben, damit er das Spektakel eines wütend Wellen schlagenden Ozeans bestaunen durfte.
Mirabel hatte Hanns Torzek 1958 kennengelernt. Das war lange her. Sie war damals achtzehn Jahre alt gewesen. Er hatte gerade seinen vierundzwanzigsten Geburtstag hinter sich gebracht, sein Studium abgeschlossen und einen Job in einer Sprachschule in Brilon ergattert, die wohlhabenden Ausländern Deutsch-Crashkurse anbot.
Mirabel war von ihrer Familie zu einer ihrer Schwestern, Flora, die einen reichen Mann aus Deutschland geheiratet hatte, nach Bad Godesberg geschickt worden. Auf den ersten Blick wirkte der Trip nach Europa wie eine Studienreise. In Bonn hätte sie Klavierunterricht erhalten und nebenbei eine, wenn nicht sogar mehrere Fremdsprachen lernen sollen – außerdem stünde sie unter der Obhut ihrer Schwester Flora, die als besonnener und strategisch denkender Mensch galt. Doch ein zweiter Blick verriet, dass der Zweck ihrer Reise ein anderer war. Im Propellerflugzeug der Lufthansa saß im März 1958 ein hübsches Mädchen, das eine kurze, aber durchaus glanzvolle Karriere als Schönheitskönigin und Fernsehstarlet hinter sich hatte und einen gewaltigen Titel mit nach Europa schleppte: Sie war in Caracas zur Miss Amazonas gekürt worden. So kam eine Schönheitskönigin in das graue und puristische Nachkriegsdeutschland.
Mirabels Familie war mittellos. Es war gerade drei Jahre her, da war ihr Vater, den sie sehr geliebt hatte, an den Folgen einer schweren Asthmaerkrankung gestorben. In den Zwanzigerjahren hatte Venezuela zwei Millionen Einwohner, die noch nicht begriffen, welch unglaubliche Menge Öl unter ihren Füßen sprudelte. Der aus Kolumbien stammende Mendoza hatte sich damals in Maracay als Schneider niedergelassen, weil die venezolanische Militärregierung ihren Sitz in diese staubtrockene Stadt verlegt hatte – und hier die Aussicht bestand, Geld zu verdienen. Hinter der Stadt begannen die Llanos, die weiten und heißen Ebenen Venezuelas.
In der venezolanischen Geschichte hatten die Regierungen aus wechselnden militärischen Cliquen bestanden, ein Erbe der spanischen Kolonialherren, aber auch eine Folge der Befreiungskriege während der napoleonischen Epoche. Simón Bolívar war der Nationalheld und Übervater Venezuelas, für viele war er bedeutender als Jesus. Die Unabhängigkeit zahlreicher lateinamerikanischer Länder hatte Simón Bolívar jedoch mit Waffengewalt erzwungen – und von dem düsteren Zauber der Kriege und Gewalttaten kamen diese jungen Länder schließlich nicht mehr los: Sie blieben Diktaturen. Hinzu kam: Das dünn besiedelte Land war seit jeher ein Verbund von Machos mit katholischen Überzeugungen und einem ländlich geprägten Weltbild. In dieser Nation waren Frauen, wenn sie nicht aus begüterten Verhältnissen stammten, entweder Huren oder Ehefrauen.
1926 heiratete Jorge Mendoza die schöne Blanca Cruz, deren Eltern – ohne einen Cent ihr Eigen nennen zu können – um 1890 von den kanarischen Inseln nach Venezuela emigriert waren. Blanca und ihre Schwestern verdienten ihr Geld als Schneiderinnen, zogen ihre Haupteinnahmen aber aus ihrem Dasein als Mätressen. Sie waren die Geliebten von Offizieren und wohlhabenden Bürgersprösslingen. Blanca verschwieg ihren Kindern später, wie sie als junge Frau gelebt hatte.
Von 1927 bis 1940 setzte sie zwölf Kinder in die Welt – acht davon überlebten und wurden alt. Mirabel war das jüngste Kind. Währenddessen prosperierte Jorge Mendozas Schneiderei, die Familie wurde wohlhabend. Alles ging gut. Als jedoch der alte Mendoza erkrankte und daraufhin seine Geschäfte schlecht liefen, setzte eine ungünstige ökonomisch-soziale Kettenreaktion ein. Um seine Familie vor dem Ruin zu retten, setzte er alles auf eine Karte und verkaufte die Schneiderei. Der Erlös des hastigen Verkaufs jedoch sicherte der Familie gerade mal das moderate Überleben für ein Jahr, dann begann die Armut.
Um 1948 gab es in Venezuela kein staatliches soziales Netz. Setzte der Verarmungsprozess ein, dann stürzte man ins Bodenlose. Inzwischen hatte die um das Dreifache gewachsene Bevölkerung begriffen, welche Möglichkeiten ihnen ihre Bodenschätze boten, doch sie hatte mit den Nebeneffekten nicht gerechnet. Im Nachbarland Kolumbien brach der Bürgerkrieg aus, welchem man den Namen »La Violencia« – »Die Gewalt« – verleihen würde. Immer mehr Kolumbianer strömten in das friedliche und reiche Venezuela.
Doch der Reichtum war nur für wenige da. Die gesellschaftlichen Strukturen waren auf eine kleine Bevölkerung ausgelegt, die patriarchalisch geprägt war und sich an einer Handelsform orientierte, wie das die Stadtstaaten Hamburg und Bremen im frühen 19. Jahrhundert getan hatten. Die riesigen Ölvorkommen aber schläferten die kaufmännische Energie der Bürger ein, weil man sich von den Quellen eine unbeschwerte, sorgenfreie Existenz versprach. Venezuela wurde zu einem reinen Import-Land, das fast jede Ware aus den USA und Europa bezog. Die Industrie, soweit vorhanden, verkümmerte, die einst blühende Landwirtschaft ebenfalls. Der Wandel von einer Handelsgesellschaft mit überblickbarem kaufmännischen Raum zu einem Industriestaat, der maschinell Massenprodukte herstellte und nun in den abstrakten, von Konkurrenz geprägten Weltmarkt eintrat, vollzog sich ungleichmäßig und nahm groteske Züge an.
Die venezolanische Staatsidee lebte letztlich vom Mythos des starken Caudillos. Simón Bolívar, der lateinamerikanische Napoleon, hatte ein verheerendes geistiges Erbe hinterlassen. Noch immer versprachen sich die Venezolaner vom starken Mann an der Spitze des Staates, dass er wie ein gütiger Familienpatron alle Angelegenheiten regelte und die Kräfte des Schicksals kanalisierte. Kurzfristig hatte es um 1948 halbherzige demokratische Reformversuche gegeben. Doch wie in der übrigen Welt gab es auch in Venezuela linke, sozialistische Kräfte, die eine radikale Umstrukturierung der Gesellschaft forderten. Damit wuchsen die Ängste der Konservativen und Rechten. Unter General Pérez Jiménez putschte das Militär. Im Zuge seiner Alleinherrschaft nutzte der Staat die enormen Einnahmen aus dem Ölverkauf und verwandelte die in einem Tal liegende Hauptstadt Caracas, in deren Architektur größtenteils noch der provinzielle Charme der ehemaligen spanischen Kolonialverwaltung schlummerte, in eine von Abrisswut dominierte Baustelle. Die plötzliche und ausufernde Nutzung der Materialien Beton und Stahl war aber nicht allein dem Bauboom und der Aufbruchstimmung zuzuschreiben, sondern war auch eine improvisierende Maßnahme gegenüber einer nicht mehr kontrollierbaren Bevölkerungsexplosion. An den Hügeln der Stadt wuchsen die Slumgürtel.
Als sich immer stärker ein depressiver Zug bei Jorge Mendoza bemerkbar machte, der sich aufgrund seiner starken Asthmaerkrankung kaum noch bewegen konnte – selbst kurze Spaziergänge führten zu Atemnot, und regelmäßig wiederkehrende Erstickungsanfälle machten deutlich, an welch dünnem Faden sein Leben hing –, nahm Blanca die Geschicke der Familie in die Hand. Sie entschied, in die Nähe ihrer Schwestern zu ziehen, die mittlerweile in Caracas in wohlhabenden Verhältnissen wohnten. Sie war sich sicher, dass sie ihr in der größten Not beistehen würden. Die älteren der Schwestern Mirabels – Flora, Elvira und Amalia – würden in Caracas leichter als in Maracay Arbeit finden. Es bekamen auch alle Arbeit, die allerdings nicht gut entlohnt wurde. Sie verdingten sich als Sekretärinnen oder arbeiteten im Verkauf. Die beiden Söhne – Jorge Manuel und Juan Daniel – verschonte man von dieser Maßnahme, weil sie Männer waren; und als solche sollten sie studieren. Ihr möglicher gesellschaftlicher Aufstieg war eine Investition in die Zukunft. So begann Jorge Manuel, ein Jahr jünger als Elvira, in Caracas ein Jurastudium.
Der Umzug führte dazu, dass das wacklige Gleichgewicht in der Familie ins Kippen geriet. Flora und Amalia, die als Siebzehn-, Achtzehnjährige von den Eingriffen am stärksten betroffen waren, hielten die Krankheit des Vaters für nicht so gravierend. Sie warfen ihm Verantwortungslosigkeit vor und unterstellten ihm zu schauspielern. Die Situation wurde zusätzlich dadurch verschärft, dass die Mendozas in eine Parterrewohnung ziehen mussten, die sich in einem erbärmlichen Zustand befand. Die Wände faulten, Ratten und Kakerlaken liefen herum. Abgesehen von Jorge Manuel, der in einem Studentenwohnheim hauste, mussten sich neun Leute, die bisher unter angenehmen Bedingungen gelebt hatten, mit sechzig Quadratmetern begnügen. Die Wohnung lag zwar zentral, das Haus war jedoch heruntergekommen. Caracas war eine in hysterischem Tempo wachsende Metropole, in der der Wohnraum knapp, begehrt und teuer war.
Für die jüngeren Kinder – Mirabel, Isabel, Lidia und Juan Daniel – bedeutete der Umzug von Maracay nach Caracas, dass sie ihre gewohnten sozialen Verhältnisse verlassen und sich in einem neuen Umfeld ihren Platz erkämpfen mussten. Außerdem verstörte sie der hilflose Zustand des Vaters, der soziale Abstieg, den sie überhaupt nicht verstanden, und der rigorose Zug Blancas bei der Verwaltung der Familienverhältnisse. Blanca, die nichts gelernt hatte außer dem Schneiderhandwerk, baute sich mit Zeit und Geduld einen Kundenstamm in der Nachbarschaft auf. So arbeiteten mehr oder weniger alle, um das Überleben zu sichern, während Jorge Mendoza tatenlos auf dem Sofa saß. Der Anblick wirkte grotesk. Der Altersunterschied zwischen Blanca und Jorge Mendoza betrug zwanzig Jahre. Der alte Mann, durch die Krankheit gezeichnet und verändert, sah fast wie jemand aus, der nicht zu dieser Familie gehörte. War er noch vor ein paar Jahren ein kräftig gebauter, schnauzbärtiger Kleinunternehmer gewesen, so hatten die veränderten Umstände einen dünnen, gebrechlichen, grauen Mann aus ihm gemacht.
Einst hatte der Underdog aus Kolumbien mit viel Fleiß und Geduld aus einer kleinen Schneiderei ein florierendes Geschäft gemacht. Seinen Aufstieg verdankte er dem Umstand, dass ein Teil der Nomenklatura der Regierung Gómez ihn zu seinem Schneider erklärt hatte. Dass ihm seine mestizischen Wurzeln keine Nachteile bescherten, lag daran, dass Venezuela damals in den Augen der lateinamerikanischen Nachbarn als rückständiges, noch bäuerlich geprägtes Land galt. Die wenigen Einwanderer, die Venezuela als neue Heimat wählten, waren durchaus willkommen. Und da Jorge Mendoza zudem kein Interesse an politischen Mitspracherechten zeigte, blieb er von ethnischen Benachteiligungen verschont.
Mit dreiundvierzig Jahren hatte er um die fünfundzwanzigjährige Blanca geworben. Er begriff das als seine letzte Chance, eine bürgerliche Existenz aufzubauen. Und da die Schneiderei gut lief und er Blanca, die als Teilzeitangestellte in seinem Betrieb arbeitete, schon etwas besser kannte, lag es nahe, die Verbindung zu vertiefen. Beide schlossen im Grunde ein gutes Geschäft ab: Blanca wollte nicht als Hure enden, Jorge Mendoza fürchtete sich vor dem Junggesellendasein im fortgeschrittenen Alter.
Vom Charakter her waren sie jedoch sehr unterschiedlich: Blanca neigte zu einer Art kalkulierter Bitternis. In gewisser Weise rechnete sie den anderen immer gerne vor, wie viel Unrecht ihr die Welt angetan hatte. Wenn ihr etwas gegen den Strich ging, konnte sie schweigsam sein wie ein Stein. Sie hatte kaum eine Schulbildung genossen. Sie konnte zwar lesen und rechnen, doch Bildung war in ihren Augen etwas für die Reichen. Blanca mochte banale Liebesgeschichten. Dass diese so sehr von ihren eigenen Erfahrungen abwichen, machte die Storys ungeheuer wertvoll. In ihnen war Verlass auf die Emotionen, sie waren nicht so unbeständig und wankelmütig wie die Realität. Jorge Mendoza dagegen war ein Intellektueller. In Maracay hatte er einen Kreis von Freunden, mit denen er sich über Philosophie und Literatur unterhielt. Er schätzte Schopenhauer und Nietzsche – ihr individualistisches, non-theoretisches, anarchisches Denken, in dem er seine Zeit und die aktuellen Umstände wiedererkannte. Staaten wie Kolumbien und Venezuela hatten einen Entwicklungsstand erreicht wie die deutschsprachigen Länder um 1820. Natürlich gab es in einer Stadt wie Maracay mit ihren 50.000 Einwohnern schon motorisierte Gefährte, aber die Infrastruktur war von Pferden abhängig. Auch herrschte eine Mentalität vor, die es gestattete, Parallelen zur europäischen, vorindustriellen Phase zu ziehen.
Es war ganz ausgeschlossen, dass Jorge Mendoza seine Frau an den geistigen Debatten beteiligt hätte. Es gab strikte, klar hierarchische Verhältnisse. Blanca war zusammen mit den Hausmädchen für die Ordnung im Haus zuständig und bestimmte über die Erziehung der Kinder – mit der Einschränkung, dass Jorge Mendoza bei entscheidenden Fragen eine Art Vetorecht geltend machen konnte, das etwaige Unklarheiten in den Herrschaftsverhältnissen beseitigte: Er verfügte über das letzte Wort.
Blanca und ihr Mann redeten selten vertraut miteinander und beratschlagten sich nie in wichtigen Fragen. Blanca spürte, dass ihr Mann auf sie herabsah. In ihrem Jawort dürfte ein Hauch von Hilflosigkeit mitgeschwungen haben. Mit fünfundzwanzig Jahren war für Blanca, die ein hübsches Gesicht mit einem sinnlichen, vollen Mund und großen, ausdrucksvollen Augen hatte, der Zug schon fast abgefahren. Das wusste auch Jorge Mendoza, der zwar dem Konstrukt der Ehe misstraute, aber eine instinktive Furcht vor der Einsamkeit hatte. Sex war für einen ledigen Mann in seiner gesellschaftlichen Position ein kostspieliges Vergnügen. Zudem beinhaltete Jorge Mendozas Eheprojekt, dass eine große Zahl an Kindern ihm günstige Perspektiven eröffnen sollte. Die Übernahme des Geschäfts durch eines der Kinder oder die Heirat mit einem vielversprechenden Kandidaten sollte einerseits gewährleisten, auch im Alter nicht der Armut zu verfallen, andererseits brachte man kinderreichen Familien Achtung entgegen. Und dieser Respekt war ihm wichtig – für sein Geschäft und seine Eitelkeit. Das alles galt so lange, bis der Modernisierungsschub einsetzte und die kleinstädtischen Gesetze aufhob. Die Gewinne aus dem Öl, die Wellen an Einwanderern (selbst aus Europa – bedingt durch Kriege und Wirtschaftskrisen – strömten die Massen herbei), das veränderte Selbstverständnis bei der Planung der Existenz, all das erodierte die Grundlagen kinderreicher Familien. Ihr Kinderreichtum wurde zu einer Zeitbombe.
Auch Jorge Mendozas Geschäft ging nicht allein wegen seiner Krankheit zugrunde. Blanca hätte mit ihrem Know-how die Geschäftsleitung übernehmen können. Es hätte nicht mal scheele Blicke gegeben, man hätte in einer so prekären Situation Verständnis gehabt, dass die Frau die Rolle ihres Mannes übernahm. Aber da war es schon zu spät. Die ab Ende der Dreißigerjahre zunehmend importierten, preiswerten Waren brachen Jorge Mendoza das Genick. Und den Gnadenschuss erteilten ihm schließlich Einwanderer aus Italien und Frankreich, die den Wettbewerbsvorteil neuer Moden und exquisiter Stoffe aus Europa mitbrachten.
Auf einer anderen Ebene war es ebenfalls unmöglich, dem Schicksal eine andere Richtung zu geben. Weil sie von ihrem Gatten nicht ernst genommen wurde, hatte sich Blanca die Rolle der »einfachen Frau« angeeignet. Von vornherein war sie dem Vorurteil ausgesetzt gewesen, nicht intelligent zu sein. Selbst ihre Kinder waren davon überzeugt, ihre Mutter wäre dumm. Blanca nahm diese Rolle an, sie machte es sich in ihr bequem.
Blanca war jedoch alles andere als dumm, und schließlich war ihre Rechnung aufgegangen. Innerhalb von vier Jahren hatte sich die Familie aus dem Gröbsten herausgearbeitet, war in eine bessere Wohnung gezogen und die drei ältesten Töchter hatten sich interessante Partien geangelt.
Am interessantesten war Floras Fang. Flora war eine attraktive, junge Frau mit feinen Gesichtszügen. Im Gegensatz zu ihren Schwestern hielt sie ihr volles Haar kurz und pflegte das Erscheinungsbild der gut erzogenen Tochter. Ihr Modebewusstsein aber, aus dem das Verlangen nach Geld sprach, signalisierte die unverbindliche sexuelle Bereitschaft eines leichten Mädchens. Gerade Floras ambivalente Züge machten ihren Erfolg bei der Partnerschaftssuche aus. Im Rahmen ihrer Ausbildung zur Fremdsprachensekretärin hatte sie einen Aufenthalt in London ermöglicht bekommen und dort Jürgen Kran kennengelernt. Er war der Sohn einer reichen Familie, die ihr Geld mit erfolgreichen Bekleidungsgeschäften in Köln und Bonn gemacht hatte.
Der Sex war aufregend, in seinem Umfeld kam sie gut an, und bald würde er Vater werden. Sie mochte diesen jungen, hellblonden Mann, der leutselig und laut war. Wäre da nicht die seltsam klingende deutsche Sprache gewesen, hätte Jürgen Kran locker als Venezolaner durchgehen können. Überhaupt fühlte sich Flora endlich glücklich. Die Berührung mit dem Jetset verdeutlichten ihr unmissverständlich, dass Geldsorgen die Grundstimmung trübten und berufliche Tätigkeiten, welche die Not einem aufzwang und die man ohne Überzeugung ausführte, verletzbar machten.
Jürgen Krans Vater war über die Verbindung nicht sonderlich glücklich. In seinen Augen war sein Sohn ein Lebemann, der zu Großspurigkeit neigte – und eine lateinamerikanische Frau an dessen Seite bewertete er als ein nicht kalkulierbares Risiko. Jürgens Mutter dagegen schloss Flora schnell ins Herz. Ihre Familiensituation rührte sie. Frau Kran unterstützte die Mendozas, und Floras Schwangerschaft beflügelte sie.
Floras Achtung vor den Deutschen wuchs. Sie bewunderte vor allem deren Effizienz. Der Vater von Jürgen vermittelte ihr das Bild von Leuten, die ihre Ideen ruhig, entschlossen und geduldig durchsetzten. Selbstverständlich blieb der Vergleich mit dem eigenen Vater nicht aus – zumal die berufliche Ausgangssituation beider nahezu identisch gewesen war. Zwar warf Flora ihrem Vater nicht mehr vor, er hätte seine körperliche Hinfälligkeit simuliert, doch der melancholische Zug und die Erfolglosigkeit erschreckten sie nach wie vor, als wäre Erfolglosigkeit seine eigentliche Krankheit.
Amalia hatte eine Zeit lang in einem Plattengeschäft gearbeitet, weil das jedoch nicht genügend abwarf, eine Zusatzstelle als Hilfssekretärin bei einer der größten Tageszeitungen des Landes, El Universal, angenommen. Zunächst ähnelte ihr Tätigkeitsbereich der einer Hospitantin, die für die Redakteure Kaffee holen ging, aber allmählich verdrängte diese Beschäftigung die langweilige Verkäuferinnenexistenz, vor allem weil sie sich Fertigkeiten wie Schreibmaschinenschreiben und Stenografie aneignete. Sie lernte den Feuilletonredakteur Roberto Luizonas kennen. Er war zwar zwölf Jahre älter als sie, allerdings ein schlanker und sich elegant bewegender, jugendlicher Mann. Seine ruhige Art entsprach nicht der Mehrheit venezolanischer Männer. Amalia hatte ihre Erfahrungen mit dem künstlich aufgepumpten Selbstbewusstsein junger Männer gemacht. Auch wenn Roberto einen offenen Sportwagen besaß und sich manchmal lässig gebärdete, war die Rolle des Dandys nur eine bewusst gewählte Fassade. Mit ihrer Hilfe lernte er einerseits Mädchen kennen, andererseits täuschte er damit die venezolanische Geheimpolizei, die Journalisten aufmerksam beobachtete. Amalia merkte, dass Roberto hinter dieser Fassade auf eine fast strebsame Weise darauf bedacht war, als ernsthafter Mann wahrgenommen zu werden.
Das war angesichts der Willkür, mit der die Junta unter Pérez Jiménez politische Oppositionelle verfolgte, ein angemessenes Verhalten für den Redakteur einer liberal gesinnten Zeitung, die in ihren Artikeln Staatskritik verklausulierte. Wichtige politische Figuren wie der ehemalige Offizier und Verteidigungsminister Chalbaud waren zu Beginn der Fünfzigerjahre wie in einem Gangsterfilm entführt und ermordet worden. Solche Handlungen sowie die Versuche der Führung, sich durch fingierte Wahlen zu legitimieren, schufen ein Klima der Paranoia, das jedoch auch stimulierend wirken konnte. Die ständig konspirative Stimmung sorgte bei Roberto und seinen Kollegen für Nervenkitzel. Ihr Handeln – und war der Beitrag noch so gering – hatte Bedeutung.
Amalia verliebte sich in diesen Mann vor allem, weil ihn eine romantische Aura umgab. Mit seinen Kollegen und Freunden sprach er, sobald es um die politische Situation des Landes ging, in einer Geheimsprache. Mit ihm zu reden, war aufschlussreich und anregend. So sagte er einmal zu Amalia: »Was wir Seele nennen, sind in Wirklichkeit Ideen und Ideologien, die wir vertreten.«
Robertos Neigung, sein Sprechen in Merksätze münden zu lassen, hatte nichts von einem Oberschullehrer. Im Gegenteil. Sein Tonfall wirkte auf Amalia wie ein beruhigendes Murmeln. Wenn er an seinem Schreibtisch saß und an einer Geschichte schrieb – Robertos großer Traum war die Schriftstellerei –,vermittelte dieses Bild eine Häuslichkeit und Wärme, die sie bei ihrer Familie vermisst hatte.
Die Sicherheit, die er ausstrahlte, war jedoch kein Dauerzustand. Manchmal hielt sich Roberto für keinen potenten Autor. Dann haderte er mit seinem Los, kein Genie zu sein und nicht vor Einfällen zu sprühen. Andere Sorgen hatten allerdings mehr Gewicht: Es konnte jederzeit passieren, dass er wegen irgendeiner Bagatelle verhaftet wurde und in einem der Folterverliese von Pérez Jiménez’ Geheimdienst landete. Die Nähe zu Amalia verdrängte diese Ängste. Roberto verliebte sich in Amalia, weil sie dazu neigte, gute Laune zu haben, gleichzeitig irritierte und faszinierte ihn, dass sie nahezu simpel und abgründig wie eine Zote sein konnte, aber gleichzeitig verständig und ernsthaft wirkte. Sie hörte ihm mit ernster Miene zu, und er benötigte Bewunderung wie das täglich Brot.
Und er war froh darüber, weniger geil durch die sonnige Welt Venezuelas zu wandeln, in der junge Menschen herumliefen, als seien ihre Körper Juwelen. Wie oft hatte er mit Freunden am Strand die Zeit totgeschlagen und nichts weiter gemacht, als den halb nackten Frauen hinterherzublicken und ihre Qualitäten zu kommentieren. Jetzt konnte er mit Abstand auf dieses beliebte Freizeitvergnügen schauen.
Elvira heiratete den Ingenieur Mario Williams. Er war ein stämmiger Kerl, der wie ein verschlossener, mürrischer Bauarbeiter wirkte, hatte jedoch die Rednergabe eines Politikers. Sobald das Gespräch eine technische Frage streifte, konnte Williams seine Zuhörer unverdrossen mit Einzelheiten des Brückenbaus oder der maschinellen Fabrikation von Toilettenpapier unterhalten. Seine Neigung, das Leben unter dem Aspekt der Wechselwirkung von Problem und Lösung zu betrachten, empfand Elvira als besänftigend. Außerdem lebte die älteste Tochter Blancas mit dem Verdacht, untüchtig zu sein. Arbeiten machte ihr grundsätzlich wenig Freude. Die Sekretärinnentätigkeit stufte sie, sobald die Anfangsbegeisterung verpufft war, als langweilig ein. Schon in der Schule hatte sie mehr mit den Tücken der Müdigkeit zu kämpfen gehabt als mit dem Lehrmaterial. Mario Williams vermittelte den Eindruck von Zielstrebigkeit, eine Eigenschaft, die auf bequeme Menschen anziehend wirkte. Denn Fleiß konnte die Attribute von Zauber annehmen. Da sich Elvira oftmals von Zweifeln und Unsicherheiten überwältigt fühlte, erschien ihr Marios Verhalten wie die mühelose Überwindung von Mängeln und Macken. Sie wurde von seiner Energie mitgezogen.
Doch Williams war ein Getriebener. Natürlich war er froh, mit Elvira regelmäßig Sex zu haben. Diese sichere Verköstigung beruhigte jedoch sein Begehren nicht. Sein Verlangen forderte seine Intelligenz. Plötzlich musste er sich etwas einfallen lassen, um an noch mehr Sex zu kommen. Das Hin und Her in seinem Innern beunruhigte ihn, war aber gleichzeitig auch ein Treibstoff für sein Glück. So saß Mario im Büro über die ödesten Kalkulationen gebeugt und sah sich im Geiste, wie er in der tropischen Mittagshitze in halbdunklen Zimmern junge Frauen von hinten nahm.
Sein Vater, der von mindestens zwei Frauen Kinder hatte, sagte ihm einmal bei einem Mittagessen in einem Steakrestaurant, dass man bis zu seinem vierzigsten Lebensjahr hauptsächlich an Sex dächte. Ab vierzig, so der Vater weiter, würde der Gedanke an den Tod das Leben bestimmen. Diese Aussage hatte etwas Tiefgründiges, fand Mario. Es war ein Satz, der genau in die heiße Phase seiner Ehe mit Elvira fiel. Ihre beginnende Schwangerschaft machte sie sexuell empfänglicher, doch bemerkte er an ihr erste Spuren des Alters. Es irritierte ihn, dass sie ihrer Mutter ähnelte.
Mario hatte Doña Mendoza, wie Blanca von der Nachbarschaft genannt wurde, als jemanden kennengelernt, der ihm mit sicherem Instinkt seine geheimen Neigungen vom Gesicht ablesen konnte. Und sie war eine Frau, die ihrer Verachtung, ohne ein einziges Wort darüber zu verlieren, deutlich Ausdruck verleihen konnte. Gleichzeitig jedoch grenzte der Respekt, den sie Männern mit akademischem Grad entgegenbrachte, an Bewunderung. Blanca war ein pragmatischer Typ. Sie wusste, dass Typen wie Mario Williams Ferkel waren, aber sie brachten einen ordentlichen Batzen Geld mit nach Hause.
Erleichtert war Blanca über die Entwicklung ihrer Familie, insgeheim auch stolz wie ein Feldherr, dessen Strategie zum Sieg geführt hatte. Es war ihr Projekt. Zwar waren die Mendozas nur mühselig aus einem sozialen Loch gekrabbelt, nun aber befanden sie sich, dank des Geldes der Familie aus Deutschland und weil mit der Verheiratung der ältesten Töchter weniger Mäuler zu stopfen waren, in einer weitaus besseren Lage. Die neue Wohnung war komfortabel, Blanca musste nicht mehr wie ein Gaul ackern, und das Klavier, das Jorge Mendoza einst für seine jüngeren Töchter gekauft hatte und welches gleich zu Beginn der Krise verpfändet hatte werden müssen, konnte wieder ausgelöst werden.
Doch zum Ausüben von Musik schien in der Familie kaum jemand tauglich zu sein oder gar Interesse zu bekunden. Die stämmige Lidia, deren Aussehen von allen Kindern am stärksten an die indianischen Wurzeln des Vaters erinnerte, mochte die Klavierlehrer der staatlichen Musikschulen nicht; Isabel, vom Charakter her ein eher zur Gemütlichkeit neigender Typ, schreckten die Mühen ab, die die Beherrschung eines Instrumentes ihr abverlangt hätte; Juan Daniel empfand das Musizieren als unmännlich und verbrachte seine Freizeit lieber in einer semiprofessionellen Baseballtruppe. Allein Mirabel blieb dabei. Sie mochte Musik, vor allem klassische Musik, und war bereit, die Geduld, die das Einüben technisch fortgeschrittener Stücke erforderte, aufzubringen.
Das Üben am Instrument, ihr bezauberndes Aussehen und ihre Neigung zur Anhänglichkeit machten sie zur Lieblingstochter des alten und kranken Mendozas. Seit die Krankheit ihn ans Haus gefesselt hatte, war er seinen Kindern ohnehin nähergekommen – näher als ihm eigentlich lieb war. So verband ihn beispielsweise mit seinem ältesten Sohn eine Art Sippenstolz. Aber Jorge Manuel hatte etwas Langsames, beinahe Träges an sich, das der Vater als eine Art Skepsis ihm gegenüber wertete. Der Liebe des Vaters zur Literatur (überhaupt zum Musischen) begegnete der Sohn mit einem Unterlegenheitsgefühl, das schließlich nationalchauvinistische Züge hervortreten ließ, wenn er venezolanische Musik, venezolanische Literatur, überhaupt alles Venezolanische überbetonte. Und das Langsame hatte sich Jorge Manuel von der einheimischen Landbevölkerung abgeguckt, die langsam sprach, auch weil eben die ewige Hitze in diesem Land es einem nicht gestattete, hektisch oder rasch zu denken und zu handeln.
Seine vielköpfige Familie erinnerte Jorge Mendoza an die mehrstimmige Musik Johann Sebastian Bachs. Ein stolzer Vergleich. Doch Mendoza sah in der Musik Bachs nicht das Regelwerk einer himmlischen Ordnung, sondern ein fiktionales System, das sich spiegelverkehrt zum Chaos der Welt verhielt: hier die schöne Musik mit ihren komplizierten, aber überschaubaren Regeln, dort die Welt mit der rätselhaften Existenz, in der die Menschen keinen Halt fanden und sich verloren. Eines Abends saß er in seinem Schaukelstuhl, in seinem Kopf drehten sich die üblichen Alltäglichkeiten – wie fand er den gekochten Reis? Roch sein langsam vor sich hin faulender Körper wieder leicht nach Scheiße? –, da überfiel ihn der Gedanke, dass er mit den vielen Kindern, die er gezeugt hatte, so etwas wie eine Fuge komponiert hatte. Offensichtlich hatte er als alternder Junggeselle etwas verspürt, was jedem Menschen zutiefst zu eigen war. Man gründete Familien, schuf Kunstwerke oder zettelte Kriege an, weil das Dasein beängstigend leer und sinnfrei war. Man spannte sozusagen Brücken über einen Abgrund, man erfand eine Ordnung, weil dem Leben Ordnung unbekannt war.
Jorge Mendoza sah eine Mücke vor seiner Nase herumsurren, die er mit einem Schlag zerklatschte. »Diese Mücke weiß nicht mal, dass sie gelebt hat«, dachte er. Dann setzte in ihm eine Kaskade von Gedanken ein. Seine älteste Tochter Elvira war ein weichherziger Mensch, der allerdings furchterregend schnell wütend werden konnte und sich schlecht im Griff hatte. Sie hatte einen Mann geheiratet, den Jorge Mendoza, nachdem er mit ihm ein paarmal gesprochen hatte, als maßlosen Egomanen einschätzte. Wie sollte das bei diesen beiden jungen Leuten gut gehen? Bei Floras Wahl hatte er regelrecht eine Attacke von Vorfreude gehabt, weil Jürgen Kran ein Deutscher war. Ein Deutscher wie Nietzsche! Doch schon beim ersten Venezuela-Aufenthalt Jürgen Krans hatte er nach zehn Minuten gemerkt, dass dieser ein Playboy war, der seine Sonnenbrille mehr liebte als irgendeinen Menschen und einschläfernde Monologe über edle schottische Whiskymarken hielt. Aber Flora, die Jorge Mendoza als eher kaltherzig einstufte, klatschte vor Begeisterung in die Hände, wenn ihr Mann in philosophische Stimmung geriet. Wenigstens hat er Geld, dachte er.
Ausnahmslos gut gefiel ihm der Journalist und Schriftsteller Roberto Luizonas. Die ernsthaften Unterhaltungen erinnerten ihn an seine ehemaligen Freunde in Maracay, die nun alle alt und krank geworden waren. Oder sie waren tot. Viele von ihnen hatte er seit Jahren nicht mehr gesehen. Es stand ja auch nicht gut um die Chancen eines Wiedersehens, denn alle hatten mehr mit ihren Gebrechen zu tun als mit ihren Gedanken. Umso mehr freute sich Jorge Mendoza auf den Besuch von Amalia und ihrem Mann, der einen als Redakteur auch umfassend informieren konnte. Las man eine Zeitung (und Jorge Mendoza las sehr gerne Zeitung), schwamm man bei innenpolitischen Themen sofort in einem Meer aus Lügen und Propaganda. Jetzt hatte er wieder sichere Informationen aus erster Hand.
Die sanfte Stimme Luizonas’ war Balsam für seine Ohren, die erst das Geschrei von Kindern, dann das Geheul Pubertierender und schließlich das übertrieben optimistische Gekreisch konsumhungriger Jugendlicher hatten ertragen müssen. Außerdem war der alte Macho, von der Asthmakrankheit zur Unbeweglichkeit verdammt, dauernd von Frauen umgeben, die ununterbrochen plapperten und jammerten. Endlich sah er einen Gedanken auf zwei Beinen, endlich sprach einer wie ein Mensch. Das brachte ihm Amalia näher. Sie war auch das erste seiner Kinder, das ihm ein Enkelkind gebar. Der Tag der Geburt Veronicas war in seinen Augen und denen seiner Frau ein nahezu religiöses Ereignis – selten eine solche Übereinstimmung bei zwei Personen, die derart unterschiedlich gepolt waren. Gott, an den seine Frau jeden Morgen und jeden Abend brav ihre Gebete richtete, dieser stumme Gott, den Jorge Mendoza bei schlechter Laune als lächerlichen Zwerg empfand – hatte er gute Laune, dann fand er Gott immerhin ganz originell –,dieser Gott also hatte für einen kurzen Augenblick etwas von seiner Herrlichkeit demonstriert und einen Funken Hoffnung in diese dunkle Welt gesandt.
Seine Favoritin war jedoch Mirabel. Sie war die Anmut in Person. Zu sehen, wie die Dreizehnjährige jeden Tag nach der Schule Tonleitern und Stücke von Bach und Schubert übte, war Labsal für seine Augen. Die Mutter billigte zwar die musische Begabung der Tochter, meinte jedoch, dass die Liebe zur Kunst die Menschen verdarb. Warum sie dieser Verdacht überfiel, hätte Blanca nicht sagen können. Die Schönheit Mirabels begann jedenfalls ihr Sorgen zu machen. Juan Daniel und Isabel bewunderten ihre Schwester und hielten sie für talentiert wie Mozart. Zur staatlichen Musikschule im Stadtteil El Paraíso fuhr Mirabel zweimal die Woche ohne Begleitung und fand dort schnell heraus, dass sie im Gegensatz zu Gleichaltrigen kein musikalischer Überflieger war, auch wenn sie nicht unbegabt war. Diese Erfahrung zeigte ihr allerdings, dass es nicht ganz unbedeutend war, ein gutes Image zu pflegen.
Zum Beispiel betonte sie vor Leuten, die nichts mit Musik am Hut hatten, die Bedeutung von Tonleitern und Übungen von Czerny. Mirabel hielt kleine Vorträge über die Bedeutung der Rolle ihrer Klavierlehrer, so dass der Eindruck entstehen musste, sie sei in einer vielversprechenden Auseinandersetzung mit der Musik verstrickt. Sie war dreizehn – und manche der Freundinnen Blancas hielten sie für altklug. Indirekt teilten sie ihr mit Worten oder Blicken mit, dass die Musik nichts weiter sei als ein Hobby. Als Mirabel die Pubertät überschritt, entwickelte sie trotz der Unkenrufe ein Gefühl dafür, sich mit einem technisch anspruchsvollen Stück zu beschäftigen.
Roberto staunte einmal, als Mirabel erzählte, dass niemand geringerer als Rómulo Gallegos ihr Schullehrer gewesen sei, der berühmteste Schriftsteller Venezuelas, Spitzenkandidat der Acción Democrática für die Präsidentschaftswahl von 1947, Präsident bis 1948, bis die Herren Generäle um den krötenhässlichen Pérez Jiménez nach neun Monaten Demokratie fanden, dass Literaten besser Papier bekritzeln sollten als ein Land regieren. Roberto runzelte die Stirn. Er wusste, Gallegos hatte während der Zeit, in der Mirabel schulpflichtig gewesen war, im Exil gelebt. Aber er fand Mirabels Flunkerei charmant. Vielleicht war da auch eine Verwechslung im Spiel.
Rómulo Gallegos war eine starke Figur in den Köpfen venezolanischer Intellektueller. Roberto Luizonas schrieb Geschichten in einem Stil, den man allgemein als »realistisch« bezeichnete. Wenn man mit ihm über seine Schriftstellerfavoriten sprach, dann nannte er sofort berühmte Franzosen des 19. Jahrhunderts – Flaubert, Balzac, Zola. Aber dann fügte er gleich einige latein- und nordamerikanische Autoren hinzu – darunter stets Rómulo Gallegos oder William Faulkner. Aber selbst Leute, die sich für die Literatur gar nicht interessierten, wie beispielsweise Mario Williams, kannten den Schriftsteller. In den Vierzigerjahren hatte Mario als Jugendlicher im Kino immer wieder diesen elegant gekleideten und würdevoll sprechenden älteren Herren gesehen, dem man mit einem Respekt begegnete, als hätte er die moralisch einwandfreie Welt erfunden, die hin und wieder von unattraktiven Generälen durch eine schwarze und abgrundtief böse Welt ersetzt wurde. Rómulo Gallegos sprach zudem mit einer Erhabenheit, fast einem Singen. Hielt er eine Rede im Parlament, dachte Roberto Luizonas an Hellenen und Römer. So mussten in früheren Zeiten die Dichter gesprochen haben. Mario Williams hingegen erstaunte die Sprechweise Gallegos – vor allem wegen der Benutzung des erlesenen Vokabulars –, weil er dachte, dass Leute, die solch eine Bildung besäßen, eigentlich unerträgliche Langweiler wären. Aber dieser Typ war irgendwie geschickt und unterhaltsam.
Auch Jorge Mendoza mochte Gallegos, wenngleich mit Einschränkungen. So fand er zum Beispiel die Zeichnung der Bewohner der Llanos – mehrheitlich waren es Viehzüchter, die Unmengen an Land besaßen, oder Bauern, die ums nackte Überleben kämpften – im Roman »Doña Bárbara« als etwas zu idealisiert. In Maracay hatte er als Schneider mit vielen Viehbaronen und einfachen Bauern zu tun gehabt. Teilweise waren diese Leute so vulgär, dass, hätte Gallegos nur zehn Prozent ihrer Sprech- und Verhaltensweisen übernommen, der Roman niemals an einer Zensur vorbeigekommen wäre. Doch diese Kunst, die man auch als Naturalismus kannte, beeindruckte die Leute. Gallegos bekam in ihren Augen schließlich etwas von einem Homer, er war ein Homer Venezuelas, der die harten Lebensbedingungen der Prärie besang. Mendoza wusste, dass sich nur wenige Menschen, die nicht in solchen Verhältnissen lebten, für die Lebensbedingungen der ländlichen Bevölkerung interessierten. Aber dass jemand einen Roman über reale venezolanische Verhältnisse schrieb, der dann auch noch im Ausland wahrgenommen wird – das rang allen Respekt ab.
Jorge Mendoza blieb da lieber bei seinen Europäern. Als er noch ein paar Freunde um sich scharen konnte, um sich mit ihnen intellektuell auszutauschen, war dies zwar eine einsame Beschäftigung, doch sie war noch nicht der hoffnungslose Spleen eines alten und mit dem Sterben beschäftigten Menschen.
Als Mirabel jünger gewesen war, hatte sie sich an ihn geschmiegt und ihn gefragt, was er da läse. Allerdings war Mirabel eine Frau, konnte also den Mann als schöpferisches Wesen nicht begreifen. Frauen waren Geschöpfe. Sie waren Natur, nicht Kultur. Kultur war männlich. So seufzte er und sagte: »Mein Kind, das war ein berühmter Philosoph.« Und dann hatte er erklärt, warum dieser Philosoph so berühmt war. Seine Einsamkeit in den Bergen der Schweiz, seine Genialität, seine Geisteskrankheit, als er um den Hals eines Rosses fiel und das Fell nass weinte. Damit hatte Jorge Mendoza weiter an dem Bild des einsamen männlichen Genies gebaut.
In einer Nacht im März 1955 hörte Isabel, die mit Jorge Mendoza und ihrer Mutter ein Schlafzimmer teilte, wie ihr Vater aufstand, leise und kurz stöhnte und dann zu Boden polterte. Es war eine Herzattacke. Man rief den Arzt. Ein unaufgeregter Herr in einem langen, braunen Mantel und mit einem braunen Hut erschien wenig später, konnte aber nur noch den Tod des Fünfundsiebzigjährigen feststellen.
Zuerst empfand Mirabel dieses Ereignis wie eine lästige Störung. Sie war schlaftrunken, man hatte sie mit dramatischer Geste aus dem Bett gerüttelt. Den leblosen Anblick ihres Vaters, der mit offenem Mund und geschlossenen Augen auf dem Bett lag, fand sie bizarr. Es wirkte, als wäre der Vater auf und davon, sei in ein fremdes und unbekanntes Land gezogen, und hätte eine Puppe, die eine entfernte Ähnlichkeit mit ihm hatte, zum Trost aller hinterlassen. Als jedoch ihre Mutter anfing zu weinen, weinte auch sie. Die Gewalt, die das Sterben auslöste, hatte etwas nahezu Unbegreifliches.