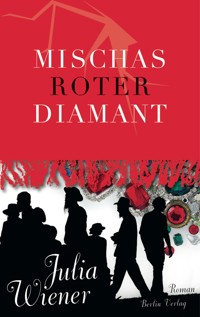
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mischa Cherikover ist von Russland nach Israel ausgewandert. Jetzt knüpft er Teppiche, guckt aus dem Fenster und sorgt dafür, dass sich alle schuldig fühlen. Seine Frau Tatjana schimpft ihn einen Antisemiten, weil er behauptet, dass der jüdischen Seele etwas Unangenehmes anhaftet. Als ihm ein paar gestohlene Edelsteine zufallen, darunter der dubiose rote Diamant, ist das beschauliche Leben vorbei. Die Ereignisse überschlagen sich: Mischa landet im Bett einer marokkanischen Jüdin, Tatjana verlässt ihn und Tochter Galina heiratet den Palästinenser Azzam. Es kommt noch dicker: Azzam wird ermordet, Tatjana und die schwangere Galina werden schwer verletzt. Schuld an allem: der rote Diamant, aber Mischa kann und will ihn nicht loswerden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Aus dem Russischen von Franziska Zwerg
BERLIN VERLAG
ERSTER TEILDer Teufel hat mich geritten
1
Ich halte sie in der hohlen Hand, betaste sie, lasse sie von einer Hand in die andere kullern und denke darüber nach, was ich mit ihnen anstellen soll, ich sitze, wie es so schön heißt, zwischen Baum und Borke. Im Fernsehen berichten sie darüber, dass eine Siedlung beschossen und ein arabischer Selbstmordattentäter mit einer Bombe verhaftet wurde, aber ich bin nur mit mir selbst beschäftigt. Welche Verantwortung habe ich mir da bloß aufgehalst, ausgerechnet ich! Wie viele Unannehmlichkeiten, wie viel Ärger und Aufregung! Habe ich das nötig? Ich, ein kranker Mann? Der Teufel hat mich geritten.
Für uns ging in Israel alles glatt. Wir haben uns eine Wohnung gekauft, und wenn sie auch nicht neu ist und eher klein, liegt sie doch mitten in der Stadt, im ersten Stock, die Treppe ist leicht zu bewältigen, und wir haben alles in der Nähe, Geschäfte, den Markt, Busse fahren in alle Richtungen, und es ist ruhig. Da haben alle gestaunt, wie kann das sein, eure Wohnung liegt mitten im Zentrum und ist so ruhig. Ganz einfach, die Wände sind dick und unsere Fenster gehen nicht zur Hauptstraße hinaus, sondern auf die Rückseite, auf eine ruhige Sackgasse. Das Haus ist ein Altbau von verblichener Schönheit, die Wohnungen haben hohe Decken, aber ein Hof fehlt praktisch, da ist nur ein schmaler Streifen, der mit allerlei Gerümpel voll gestellt ist, nicht gerade einladend, aber das ist mir egal, ich gehe mittlerweile kaum noch hinaus.
Ich bin mit meiner Wohnung sehr zufrieden. Auch mit meinem Leben war ich immer zufrieden, mein Unglück erwies sich für mich als Glück, obwohl andere meinen, ach, der Ärmste. Sie bemitleiden mich, und ich habe nicht vor, sie davon abzubringen. Sollen sie mich doch bedauern, vielleicht ist das am Ende sogar besser so.
Bis ich eines Tages in diesen Schlamassel geriet. Vor ungefähr einem halben Jahr saß ich an meinem gewohnten Platz am Fenster, sortierte, wenn ich mich recht entsinne, hellrosa Flicken, rauchte eine Zigarette und schaute aus dem Fenster, ich beobachte gern, was auf der Straße los ist, man ist zu Hause, nimmt aber trotzdem am Leben teil, nur passiert in unserer kleinen Gasse selten etwas, Menschen gehen vorüber, Katzen stolzieren über Müllberge, auf dem Bürgersteig parken die Autos kreuz und quer, das ist mir auch schon genug.
Auf einmal fingen sie im Haus gegenüber an, das Erdgeschoss zu renovieren, das bedeutete Krach, Staub, Fahrzeuge mit Baumaterial, und ein Betonmischer wurde herangeschafft. Sie betonierten zwischen unserem und dem gegenüberliegenden Haus eine ebene Fläche. Was das wohl werden soll, überlegte ich. Na schön, irgendwann hören sie wieder auf, das ist auszuhalten, ich dachte an nichts Böses, auch war ihr Dilettantismus äußerst erheiternd, das muss man ihnen lassen.
Geld hatten die Bauherren offenbar genug, sie kamen gut voran, setzten verspiegelte Fenster ein, den Türdurchbruch versahen sie mit einem schönen Bogen und hängten Samtvorhänge auf, die Terrasse bestückten sie mit Palmtöpfen und anderen Pflanzen und eröffneten ein Restaurant. Sie eröffneten im März, ich freute mich sogar darüber, es kann schließlich amüsant sein, Menschen dabei zuzusehen, wie sie Nahrung zu sich nehmen. Außerdem ist es schön, ins Grüne zu schauen, Blumen fingen an zu blühen, ich weiß diese kleinen Freuden sehr zu schätzen. Es kamen hauptsächlich Religiöse in dieses Restaurant, sie kamen in großen Gruppen, mit Kindern und Säuglingen in Kinderwagen und feierten ihre Feste, von mir aus, ich hatte nichts dagegen.
Aber als es draußen richtig warm wurde, begann mein Martyrium. Nicht ohne Grund hatten sie diese Terrasse gebaut, sie gingen dazu über, ihre Feste direkt unter unseren Fenstern abzuhalten. Die Lautsprecher dröhnten, der Boden unter meinen Füßen erzitterte, sie brüllten ihre Lieder und tanzten bis spät in die Nacht, das drang bis zu mir in den ersten Stock, sogar die Wände hallten wider. Es machte keinen Spaß mehr, am offenen Fenster zu sitzen.
Zunächst dachte ich, bis zum Herbst halte ich das aus, im Winter setzen sich die Gäste sowieso hinein, und ehe man sich’s versieht, macht der Laden dicht.
Aber nachts konnte ich nicht schlafen. Besonders dann nicht, wenn die Gäste eigentlich schon ruhiger wurden und sich endlich auf den Nachhauseweg machten. Da war man schon fast eingeschlafen, und prompt fingen die Kellner an, die Tische und Stühle ins Restaurant zu räumen. Für die Tische hatten sie sich nicht sonderlich in Unkosten gestürzt, sie waren aus Sperrholz und hatten hohle Metallbeine. Und jedes Mal, wenn sie einen der Tische oder die Stühle über den Boden schleiften, stand ich senkrecht im Bett. Und sie hatten viele Tische, ungefähr zwanzig, dazu noch die Stühle, und es waren nur zwei Kellner. Sie hoben sie nicht zu zweit an und trugen sie hinein, nein, jeder zerrte allein an den Tischen herum, es klang wie Gewehrfeuersalven und an Schlaf war nicht zu denken.
Einmal sagte ich zu meiner Frau, geh runter und droh ihnen damit, dass wir uns bei der Polizei beschweren, es gibt jetzt ein neues Gesetz wegen des Lärms. Meine Frau meinte, vielleicht geht es auch ohne Polizei, immerhin wohnen wir gleich gegenüber, die tun uns vielleicht was an, da hilft uns auch die Polizei nicht mehr. Daraufhin brüllte ich sie an, ich nannte sie eine dumme Gans, eine Memme, ich habe sie sogar in den Rücken geboxt, so sehr sehnte ich mich nach Ruhe. Das hätte ich besser unterlassen, sie ist weder eine dumme Gans noch eine Memme. Vielleicht hatte sie sogar recht. Ich habe sie trotzdem gescheucht, geh, sagte ich, oder soll ich etwa selbst aufstehen? Ich tat so, als wollte ich aus dem Bett steigen. Wohin willst du, das sollst du doch nicht, schon gar nicht mitten in der Nacht. Sie zieht sich also an und geht. Natürlich wird sie nichts erreichen, dachte ich, sie kann nicht so krakeelen wie die Leute von hier, sie wird höflich um Ruhe bitten, und die werden sich herausreden, dann wird sie noch ein Weilchen herumstehen und schließlich gehen. Sie tat mir sogar leid.
2
Sie tut mir oft leid. Angeblich ist das ein Zeichen für Liebe. Nun ja, ich weiß nicht, ob man bei uns noch von Liebe sprechen kann. Früher gab es natürlich ein Gefühl, Liebe oder was auch immer, aber inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher. Meine Frau ist alt geworden, ich mag sie kaum mehr ansehen, an den Hüften und am Busen hat sie zugelegt, die Beine sind dünner geworden, und nackt habe ich sie schon lange nicht mehr zu Gesicht bekommen, wozu auch.
Ich hätte sie allerdings nicht beschimpfen sollen. Mit meiner Frau habe ich, wie mit überhaupt vielen Dingen im Leben, großes Glück gehabt, obwohl Glück vielleicht das falsche Wort ist, schließlich habe ich sie mir auserkoren, aber ich hätte mich ja auch täuschen können.
Als ich noch jung war und man mir meine Diagnose gestellt hatte, machte sich meine Mutter völlig verrückt, entweder du bleibst allein oder du gerätst an eine Schlampe, die dich bald verlassen wird. Während all der Jahre konnte sie nicht glauben, dass meine Frau tatsächlich bei mir blieb, ich hingegen hatte da nie den geringsten Zweifel.
Mit einem Mädchen etwas anzufangen, fiel mir damals noch leicht, anfangs war mir äußerlich nichts anzumerken, ich kam ganz nach meinem Vater. Vielleicht liegt es an der jüdischen Gemeinschaft hier, dass ich heute eher nach meiner Mutter komme. Den Mädchen habe ich jedenfalls nie etwas vorgemacht, ich erwähnte ihnen gegenüber stets, dass ich krank bin und was sie von mir zu erwarten hatten. Einige habe ich damit verschreckt, andere waren mir umso mehr zugetan, vielleicht war es für sie der größere Kitzel, so ein attraktiver Typ und solche Qualen, und eines Tages wird es ihm noch schlechter gehen. Gern hätte ich mich noch länger ausgetobt, aber ich begriff sehr rasch, dass ich heiraten musste, solange ich die Wahl hatte. Ich brauchte etwas Längerfristiges.
Eine gefiel mir, sie war kein Mischling wie ich, sondern eine echte Russin. Auch ich gefiel ihr offenbar, denn sie war es, die vom Heiraten anfing. Trotzdem entpuppte sich die Sache als Reinfall. Anständig, wie ich bin, klärte ich sie über meine Krankheit auf, sagte ihr, was in zehn Jahren sein würde und was in zwanzig, damit du gleich weißt, worauf du dich einlässt, da hält sie mir den Mund zu und umarmt mich, Liebster, Liebster, wenn ich mit dir zusammen bin, schreckt mich gar nichts, ich liebe dich trotzdem und will dich. Ich hatte meiner Mutter schon gesagt, halt dich bereit. Da kommt sie einen Tag später zu mir, ganz bleich, Liebster, meine Eltern sind kategorisch dagegen, dass ich einen Behinderten heirate, mein Vater hat geweint und meint, ihr könnt doch auch ohne Trauschein zusammen sein. Aber so ging das nicht, ich brauchte eine richtige Ehefrau, es war betrüblich, sie gefiel mir sehr, und fast hätte ich nachgegeben. Aber ich wusste schon damals, was ich wollte, und sagte ihr, entweder du lebst richtig mit mir zusammen oder du hörst auf deine Eltern, andernfalls gibt es nur Ärger.
Außerdem hatte ich noch eine zweite Kandidatin in Reserve, auch sie war Russin, und das war Tatjana, meine Tanja.
3
Da hörte ich, wie sie mit den Schlüsseln klimperte, Tatjana kam zurück. Auf der Terrasse schien es allerdings keineswegs ruhiger geworden zu sein, sie lärmten noch immer mit den Tischen.
»Und, was haben sie gesagt?«
»Sie wollen sich bemühen, abends um zwölf Schluss zu machen. Und die Musik wollen sie auch leiser drehen.«
»Und was ist mit den Tischen?«
»Von denen habe ich gar nicht erst angefangen.«
Na bitte, ich wollte ihr nicht böse sein, es tat mir sogar leid, dass ich sie beschimpft hatte. Aber wie sollte ich da an mich halten? »Wozu habe ich dich hinuntergeschickt, Tanja?«
Sie schwieg und zog sich aus. Wer trägt heute eigentlich noch solche Unterwäsche? Wo hatte sie die überhaupt her, ließ sie sich die etwa aus Russland schicken? Und diese Nachthemden, wenn sie sich doch mal was Moderneres gekauft hätte, vielleicht wäre es dann auch schöner gewesen, mit ihr im Bett zu liegen.
»Wozu habe ich dich hinuntergeschickt, hm? Damit du frische Luft schnappst?«
Da legte sie sich vorsichtig zurück ins Bett, sie war immer sehr darum bemüht, mir nicht wehzutun, aber zu liegen ist für mich so oder so unbequem, wir hätten ein orthopädisches Bett kaufen sollen, es hätte ohnehin so vieles angeschafft werden müssen. Der Krach hatte endlich nachgelassen, aber es gelang mir nicht zu schlafen, und ich konnte die Sache nicht auf sich beruhen lassen.
»Ich hab dich was gefragt, und du antwortest mir nicht. Ist das deiner Meinung nach in Ordnung?«, fragte ich.
Da legte sie mir die Hand auf den Rücken, genau dorthin, wo es besonders wehtat, streichelte und massierte mich ein bisschen und sagte leise:
»Mischa, lass uns schlafen. Der Chef war nicht da, was bringt es, mit den Kellnern zu diskutieren. Ich werde morgen noch mal hingehen.«
Eigentlich wollte ich meinem Ärger Luft machen, war aber zu faul dazu, sie streichelte mich sanft, also schlief ich irgendwann ein.
So ging es jede Nacht. Sie drehten die Musik etwas leiser und machten etwas früher Schluss, aber das mit den Metallbeinen wollten sie einfach nicht einsehen, vor halb zwei war an Schlaf nicht zu denken. Und gegen acht Uhr morgens begann alles von vorn. Vielleicht übernachteten die Kellner ja im Restaurant? Morgens spritzten sie die Terrasse mit einem Wasserschlauch ab, dabei unterhielten sie sich in voller Lautstärke, während ich versuchte zu dösen. Und dann zerrten sie die verfluchten Tische und Stühle erneut auf die Terrasse. Tagsüber bei Musik und Gesang zu schlafen, davon konnte keine Rede sein.
Ich rief dann doch die Polizei an, um mich zu beschweren. Gab es irgendwelche Zwischenfälle, Schlägereien?, fragten sie. Nein, sagte ich, aber die Musik ist sehr laut und die machen jede Menge Krach. Musik darf bis elf gespielt werden, antworteten sie. Falls es später werden sollte, sag Bescheid. Aber wegen der Tische und Stühle, des lauten Geschreis, das musst du schon selbst klären. Ihr wohnt mitten in der Stadt, das wirst du doch einsehen, wie soll es da ruhig sein. Sonst musst du dir eben Doppelfenster einbauen lassen.
Mein bis dahin im Großen und Ganzen so glückliches Leben geriet völlig aus den Fugen. Tanja hatte es leichter, sie rackerte sich tagsüber ab und legte sich anschließend schlafen, aber ich bin nun mal sehr empfindlich.
Wie ich vorher gelebt habe? Maßvoll. Die Ärzte haben mir schon immer gesagt, dass ein ausgeglichenes, ruhiges Leben das Beste für mich sei. Deshalb habe ich seit meiner Jugend alles in meinem Leben sorgsam geplant. Besondere Verantwortung musste ich nie übernehmen, denn was kann man von einem Behinderten schon erwarten? Wenn er es nur halbwegs schafft, sich durchzuschlagen und zu funktionieren, rufen alle »ah!« und sind gerührt, er ist behindert, und trotzdem ein Mensch! Andere, die ähnliche Erkrankungen haben wie ich, finden das erniedrigend, aber mir sind solche Reaktionen egal, es ist bequem und schont die Nerven.
Zum Beispiel beim Thema Kinder. Ich konnte ohne weiteres welche in die Welt setzen, einen Sohn und eine Tochter, das ja, aber mich mit ihnen abrackern, das hat keiner von mir erwartet. Die Leute waren vielmehr erstaunt, wie ein Kranker solche Prachtkinder haben kann, was für ein toller Kerl, sagten sie, hat seine Frau nicht enttäuscht und ihr geschenkt, was sie will. Leute, die so reden, wissen nicht, dass mich meine Krankheit in dieser Hinsicht kein bisschen beeinträchtigt, ich kann auch jetzt noch, nur mit den Stellungen habe ich meine Schwierigkeiten, aber Tanja nimmt darauf Rücksicht.
Ein gesunder Kerl muss immer in Form sein, er kann sich nicht mit Kopfschmerzen herausreden, er muss seiner Pflicht nachkommen, und wenn er es nicht bringt, ist er in seiner Ehre gekränkt. Bei mir hingegen heißt es: Was kann man da schon erwarten? Aber irgendwie klappt es, Tanja lobt mich immer und sagt sogar, du bist ein toller Kerl.
Dabei weiß ich selbst, dass ich ein toller Kerl bin. Als ich noch besser gehen konnte und mein Rücken noch nicht so krumm war, hatte ich viele Frauen. Eine von ihnen ruft noch heute an, aber ich kann sie ja schlecht zu mir nach Hause bitten, und zu ihr zu fahren würde mir Mühe bereiten, und natürlich verfügt sie auch nicht über Tanjas Gewandtheit. Ich kann es also nur noch mit meiner Ehefrau tun, und die finde ich nicht mehr so attraktiv wie früher.
Ab und zu muss es natürlich trotzdem sein. Aber selbst das hat mir dieses verfluchte Restaurant verdorben. Schließlich muss man dafür in Stimmung sein. Und kaum ist man so weit, ertönt draußen Musik oder man hört, wie Metallbeine über den Boden kratzen, und alles war umsonst. Dank Tanja muss ich mich nicht grämen, die nimmt die Sache dann in die Hand, das ist natürlich eine Erleichterung, aber weniger vergnüglich.
4
Ich fing an, dieses Restaurant zu hassen, wie ich im Leben noch nichts gehasst habe, allen voran die Kellner. Obwohl sich herausstellen sollte, dass nicht alle von ihnen meine Feinde waren. Für meine Gesundheit ist nichts schädlicher als Hass, besonders wenn er sich nirgendwo entladen kann. Ich fing sogar an, mehr zu rauchen als sonst, das war nun gänzlich überflüssig.
Da sitze ich also den ganzen Tag am Fenster und male mir aus, wie ich sie allesamt ins Verderben stürze. Ich habe mir diese Jungs genau angesehen, der eine ist ein Schönling mit Schnurrbart, groß und schlank, er bewegt sich zwischen den Tischen, als würde er Ballett tanzen, heißt Azzam und ist Araber. Der andere heißt Coby, er ist etwas kleiner und trägt eine gelb gefärbte Bürste auf dem Kopf. Der Wirt, ein fettes Schwein, kommt selten heraus, meist sitzt er drinnen in der Nähe der Klimaanlage. Dann gibt es noch eine junge Kellnerin, auf sie habe ich eigentlich keine Wut, sie benimmt sich unauffällig, und ich weiß auch gar nicht, wie ihre Stimme klingt. Die anderen beiden, Coby und Azzam, sind zwar halbwegs leise, wenn sie die Bestellungen aufnehmen, aber auf Entfernung brüllen sie sich an, hol die Aschenbecher! Zwei Gulasch! Azzam, wo hast du deine Augen, wo ist der Salat?
Und nur wegen dieses verfluchten Restaurants war ich auch noch weniger produktiv als sonst. Dabei muss ich eigentlich pünktlich liefern. Meine Arbeit ist mir lieb und teuer. Ich bin ihr durch meine Krankheit verpflichtet, auch unsere wunderbare Wohnung habe ich ihr zu verdanken, denn von Tanjas Einkünften und meiner Invalidenrente hätten wir sie uns wohl kaum leisten können.
Ich hatte überhaupt keine Lust mehr, mir neue Muster auszudenken, stattdessen konzentrierte ich mich einzig und allein auf meine Rache. Ich sitze also am Fenster, schaue hinunter und male mir aus, wie ich Azzam, der ein volles Tablett trägt, eine Bananenschale vor die Füße werfe. Er rutscht aus, Coby will ihn auffangen, hat aber selbst ein Tablett in der Hand, dann krachen die beiden der Länge nach hin, Flaschen und Teller mit warmen Speisen fliegen in alle Richtungen, und auch die Gäste kriegen ordentlich was ab. Es gibt ein großes Gezeter, der Wirt kommt heraus, stößt übelste Flüche aus und jagt die beiden zum Teufel … Aber was soll das bringen? Er wird sie feuern und zwei neue Kellner einstellen, die genauso sind wie sie.
Oder ich nehme eine Handvoll Stofffetzen, lege einen Stein, ein paar Streichhölzer und glimmende Kippen hinein, umwickle das Ganze mit Garn, tauche es in Petroleum und schleudere es abends, wenn es besonders laut und fröhlich zugeht, in den Torbogen. Ich werde treffen, denn meine Arme sind ziemlich durchtrainiert. Während das Knäuel fliegt, wird es in Flammen aufgehen, die Samtvorhänge und auch alles andere in Brand stecken, die Tischdecken, die Sperrholztische und Stühle, die Kleidung der Gäste … Den Gästen passiert natürlich nichts, sie kommen rechtzeitig hinaus, aber im Lokal werden die Flammen lodern, Coby und Azzam werden sich durch den Rauch kämpfen, die Gäste hinaustreiben und versuchen, die Vorhänge herunterzureißen. Die Feuerwehr wird kommen, ein Krankenwagen, nun ja, viele Opfer soll es nicht geben, nur ein paar Verletzte mit leichten Verbrennungen im Schockzustand, die im Krankenhaus eine kleine Spritze kriegen, und alles ist wieder in Ordnung. Dafür werden vom Lokal nur die nassen, schwarzen Wände übrig bleiben. Der Wirt wird umhergehen, sich alles ansehen, durchrechnen und befinden, dass es sich nicht lohnt, noch mal von vorne anzufangen.
Doch auch dieser Plan taugt nicht. Mein Knäuel aus Lappen wird kein Feuer entfachen, sie werden augenblicklich eine Flasche Wasser daraufkippen. Und selbst wenn es in Flammen aufgeht, wird die Polizei schnell herausfinden, wer gezündelt hat.
Ich sitze also da, rauche und schaue auf das Restaurant hinunter, und während ich mich vor der Arbeit drücke, kocht Wut in mir hoch und vergiftet meinen Körper.
5
Einmal mehr konnte ich mittags nicht schlafen, denn unten feierten sie eine Hochzeit. Ich setzte mich an den Webstuhl und starrte wutentbrannt aus dem Fenster. Und auf einmal sehe ich, wie der Wirt vor die Tür tritt. Er steht im Torbogen, die Hände in den Taschen, lässt seinen Blick unauffällig umherschweifen, blickt sogar in meine Richtung, kann mich aber wegen des Gegenlichts nicht erkennen, außerdem sind unsere Fenster nicht geputzt, wie oft habe ich Tanja das schon gesagt, aber sie hat ja keine Zeit. Das Fest ist inzwischen in vollem Gange, und alle tanzen.
Da rennt Coby am Wirt vorbei, der raunt ihm etwas zu, so dass Coby stehen bleibt und seinerseits Azzam zunickt. Erneut sagt der Wirt irgendetwas und scheint Coby die Hand zu geben, mit der anderen winkt er in Richtung Terrasse. Dann verschwindet er im Lokal. Die beiden Jungs reden kurz miteinander und gehen dann auf einen der Tische in der Ecke zu, der neben einem Palmentopf steht. Dort sitzen zwei alte Damen, die bereits gegessen haben und den Gästen beim Tanzen zusehen. Coby lächelt und sagt irgendetwas zu ihnen, es sieht aus wie eine Entschuldigung, und daraufhin nimmt Azzam seine Serviette vom Arm und zerknüllt sie. Die alten Damen lächeln ihrerseits und nehmen bereitwillig die Teller vom Tisch. Die Jungs heben den Tisch an, Coby bückt sich, greift nach Azzams zerknüllter Serviette, und da sehe ich, wie er sie flink unter das Tischbein schiebt. Blitzartig lässt Azzam den Tisch wieder auf den Boden herunter, probiert, ob er fest steht und nicht wackelt, sie gestikulieren, ja, der Tisch steht fest und wackelt nicht mehr. Dann lächeln sie den alten Damen zu und verschwinden.
Ich dachte gerade darüber nach, was diese seltsame Aktion zu bedeuten hatte, als plötzlich zwei Polizisten im Restaurant auftauchten. Eine Minute später führten sie den Wirt auch schon ab. Er tat so, als ob er freiwillig mitginge, zuckte mit den Schultern und rief Coby aus einiger Entfernung zu: »Bin gleich wieder da, macht ihr mal ohne mich weiter.« Die Gäste verstummten und hörten auf zu tanzen, obwohl Coby und Azzam zwischen den Tischen herumgingen und redlich versuchten, sie zu beruhigen. Da klingelte mein Telefon, und ich war abgelenkt. Aus der Fabrik war Material für mich eingetroffen, sie hatten es wie immer am Hauseingang, der auf die Sackgasse hinausgeht, abgestellt.
Natürlich hatte ich begriffen, dass die Jungs etwas in einem der Tischbeine versteckt hatten. War es Geld? Wohl kaum, das passte da nicht hinein. Drogen? Wohl auch nicht. Aber irgendetwas hatte der Wirt Coby zugesteckt, als er ihm die Hand drückte, sicher keinen Kleinkram, immerhin war die Polizei aufgetaucht. Außerdem war klar, dass man den Wirt gewarnt hatte, das konnte nur heißen, dass er jemanden bei der Polizei sitzen hatte.
Zu meinem großen Unglück wusste ich auf einmal, wie ich dem Restaurant schaden konnte. Nie hätte ich mir träumen lassen, welche Wendung mein Leben durch diese Entscheidung nehmen würde.
Ich schaue also aus dem Fenster und sehe, dass offenbar alles beim Alten ist: Meine Feinde haben die Musik wieder laut aufgedreht, sie servieren Eis und Torte und die Gäste sitzen an ihren Plätzen, wenigstens singen sie nicht. Auch besagter Tisch ist besetzt, die Leute haben genug getanzt und machen sich hungrig an das Dessert. Ich muss mich ranhalten, dachte ich und griff zum Telefon. Ich war gerade dabei zu wählen, als mir plötzlich klar wurde, die Polizei findet deine Nummer sofort heraus, das ist heutzutage ganz einfach.
Also musste ich zur Telefonzelle hinunter. Es ist ja nicht so, dass ich nicht gehen kann, es strengt mich nur sehr an. Außerdem ist es unangenehm, die Leute auf der Straße starren immer so. Bis zur Telefonzelle konnte ich es allerdings ohne weiteres schaffen, sie steht nur ein paar Schritte entfernt.
Im Handumdrehen hatte ich sie erreicht, Schadenfreude trieb mich, wie würde ich ihnen jetzt in die Suppe spucken! Allen, dem Wirt und den Jungs, nur die Kellnerin würden sie wohl in Ruhe lassen, die hatte ja nichts mit der Sache am Hut. Ich wählte die Nummer der Polizei und steckte mir ein Stück Papier in den Mund, um die Stimme zu verstellen. Eine junge Dame nahm meinen Anruf entgegen, und ich erzählte ihr in abgehackten Sätzen, was ich mir auf dem Weg zur Telefonzelle zurechtgelegt hatte: Hören Sie genau zu, sagte ich, das, was Sie suchen, befindet sich im Restaurant Soundso in einem Tischbein versteckt, auf der Terrasse neben der Palme in der Ecke. Kommen Sie schnell, sonst ist es weg. Die junge Dame wollte Näheres wissen, aber ich wiederholte nur, Restaurant Soundso, Tisch neben der Palme in der Ecke und legte auf. Wenn sie meine Nachricht schnell weiterleitete, würden sie kommen und abholen, was immer im Tischbein versteckt war, wenn nicht, war es auch nicht schlimm.
Ich ging zurück in meine Wohnung. Ungeduld quälte mich. Einige Gäste hatten sich bereits auf den Nachhauseweg gemacht, gleich würden Coby und Azzam den Tisch wegräumen, und dann konnte man ihn suchen, bis man schwarz wurde. Wut kochte in mir hoch, und es war niemand da, mit dem ich hätte reden können, Tatjana war nach der Arbeit gleich zu unserem Sohn gefahren, um auf seinen Kleinen aufzupassen, sie würde erst spät nach Hause kommen.
Nein, dachte ich, so geht das nicht, das schadet meiner Gesundheit. Ich setzte mich ans Fenster. In meinen Webstuhl war ein kleiner Teppich eingespannt, ein einfaches Stück aus Strickresten, das meine Nachbarin in Auftrag gegeben hatte. Ich suchte an die zwanzig Stoffreste aus, rollte sie zusammen, fing an, sie zu verknoten, und merkte, dass an einer Stelle ein heller Farbton, an einer anderen ein brauner fehlte. Ich kramte in meinen Stoffvorräten. Nichts. Dann fiel mir ein, dass unten bereits eine neue Lieferung auf mich wartete. Ich hatte mich wirklich völlig in diese Restaurant-Geschichte verbissen.
Ich sah hinaus, und da standen sie vor dem Eingang, zwei Bündel in Plastiksäcken, schlampig mit Klebeband umwickelt. Warum waren es nur zwei, sonst brachten sie doch immer drei? Ich hätte anrufen und mich beschweren sollen, aber mir war nicht danach.
6
Die Terrasse hatte sich inzwischen geleert, aber besagter Tisch war noch immer besetzt. Ich sah, wie Coby dort herumwirbelte, geschäftig räumte er die umstehenden Tische ab. Es war ihm anzusehen, dass er vor Ungeduld beinahe platzte. Ach, du meine Güte, dachte ich, gleich geht alles flöten. Zugleich redete ich mir ein, hör auf damit, dich verrückt zu machen, du hast deine Sache getan, jetzt hängt es nicht mehr von dir ab, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ich rief Itzik an, den Jungen aus der Wohnung von gegenüber, der mir manchmal hilft, und bat ihn, mir die beiden Stoffbündel hochzutragen. Gleich, sagte er, ich schau nur noch diese Sendung zu Ende, dann hol ich sie dir.
Es fing an zu dämmern. Ich wollte Licht machen, konnte mich aber nicht dazu durchringen, vielleicht hätten sie sonst gesehen, dass ich am Fenster saß und sie beobachtete. Also blieb ich eine Weile im Halbdunkel sitzen, da ging unten das Licht an, das um einiges heller war als das in unserer Wohnung.
Ich machte mich wieder an die Knoten, kam aber schlecht voran, meine Finger zitterten, und mein Blick wanderte immer wieder zum Fenster. Und auf einmal sehe ich, dass die Leute an besagtem Tisch aufstehen. Mechanisch stehe ich mit auf und höre, wie unten ein Handy zirpt. Coby zieht es aus der Tasche, hält es fünf Sekunden an sein Ohr, dann steckt er es wieder zurück und ruft Azzam zu: »Mach schnell!«
Und schon stürzen die beiden auf den Tisch zu, schieben die alten Damen beiseite, grinsen dreist, Azzam drängt sie in Richtung Ausgang, Coby schultert den Tisch, die Hand hat er unter das Tischbein geklemmt und tastet es ab. Die zerknüllte Serviette wirft er fort, und schon hält er etwas in der Hand, bleibt stehen und sieht sich mit wildem Blick um.
Azzam verdeckt ihn, schäkert mit den aufbrechenden Gästen, es ist ihm anzusehen, dass er Witze reißt. Coby bewegt sich Richtung Restaurant, überlegt es sich aber anders und steuert auf den Palmentopf zu. Wieder überlegt er, schaut sich noch mal um, und da sehe ich, wie er direkt auf meine Stoffbündel zusteuert, das Klebeband von einem der beiden Bündel abzieht, seine Hand in die Öffnung gleiten lässt, sie wieder herauszieht, das Band festdrückt und das Bündel packen will – offensichtlich will er es irgendwo anders hinbringen. Aber dann dreht er sich zu Azzam um, denn vor der Terrasse hält ein Auto, aus dem zwei Männer steigen. Als Coby sie sieht, ist er in zwei Sprüngen zurück auf der Terrasse und räumt geschäftig das Geschirr von den Tischen. Die beiden Männer kommen lautlos näher, fassen Azzam an der Schulter und führen ihn direkt an jenen Tisch in der Ecke. Coby tut so, als kriege er nichts davon mit. Die Männer verlangen irgendetwas von Azzam, daraufhin zieht er den Tisch Richtung Restaurant. Weil er einen ziemlichen Krach veranstaltet, drehen sich die übrig gebliebenen Gäste nach ihm um. Einer der beiden Männer ruft Coby zu sich, zeigt ihm etwas, das er in seiner Hand versteckt hält, und schon tragen die Jungs den Tisch lautlos hinein.
Ich schäumte vor Wut. Wieso hatte die Polizei so lange gebraucht? Jetzt würden sie nichts mehr finden. Nur drei Minuten früher und ihr Informant hätte keine Zeit mehr gehabt, Bescheid zu geben. Vielleicht wäre das Restaurant dann am Ende gewesen.
Die übrigen Gäste waren schnell verschwunden, ich freute mich sogar, dass sie sich aus dem Staub machten, ohne die Rechnung zu begleichen, aber dann erinnerte ich mich daran, dass derartige Feste immer im Voraus bezahlt werden. Die Terrasse glich einem Schlachtfeld, und ich, der geschlagene Feldherr, saß oben wie ein Papagei.
Da kam Itzik aus dem Eingang, griff sich die Stoffbündel und verschwand damit im Haus. Oben öffnete ich ihm die Wohnungstür und wühlte in meinem Portemonnaie, ich wollte einen Zehner rausholen, nein, dachte ich, er bekommt immer einen Fünfer, warum sollte es diesmal anders sein, das ist verdächtig. Plötzlich überkam mich ein ungutes Gefühl.
Itzik stellte die Bündel bei mir ab. Ich fragte sicherheitshalber, hast du auch genau hingesehen, es sind heute nur zwei, sonst sind es doch immer drei, nein, sagte er, heute sind es nur zwei. Dann nahm er den Fünfer und ging.
Ich blieb allein zurück, weder tot noch lebendig. Neugier trieb mich nachzusehen, was in den Säcken versteckt war, zugleich hatte ich schreckliche Angst, denn schließlich würden sie sich auf die Suche machen und unweigerlich bei mir landen. Oder sollte ich gleich die Polizei rufen? Dann schnappte man sie auf jeden Fall, aber mich selbst offenbaren, aus dem Schatten treten? Auf gar keinen Fall.
Ich ziehe das Ding kurz heraus, dachte ich, sehe es mir an und lege es gleich wieder zurück, damit es so aussieht, als hätte ich das Bündel noch gar nicht aufgemacht. Falls sie dann kommen und irgendetwas von mir wollen, können sie den ganzen Sack mitnehmen, und ich weiß von nichts.
Meine Hände zitterten, ich zog das Klebeband ab, das sowieso nicht mehr hielt, steckte meine Hand in den Sack, die Stofflappen wollte ich dabei nicht herausholen, also tastete ich mich langsam vor, kriegte aber nur Stoff zwischen die Finger. Ich war völlig verschwitzt, mein Rücken schmerzte, ich tastete mich vorsichtig weiter, damit das Bündel weiterhin wie unberührt aussah. Durch die Fetzen hindurch spürte ich etwas Kleines, Festes. Ein Samtsäckchen, das mit einem Gummi zugebunden war, so klein, dass es in meine Hand passte. Drinnen bewegte sich etwas, das sich anfühlte wie kleine Nüsse. Bis ich das aufgekriegt hatte! Ich blickte aus dem Fenster, unten war scheinbar alles unverändert, auf der Terrasse Verwüstung, am Eingang stand die Kellnerin und wimmelte neue Gäste ab. Im Restaurant waren die Vorhänge zugezogen, die Musik war aus, aber es brannte noch Licht. Offenbar durchsuchten sie das Lokal.
Ich wickelte das Gummiband ab, in der Eile zog ich zu fest daran, da war es auch schon gerissen und alles, was in dem Säckchen war, fiel mir direkt in die Hand. Ich ballte sie zur Faust, und mein Herz raste. Ohne hinzusehen, ahnte ich es schon, aber ich sagte mir, geh in die Küche, da findest du genauso ein Gummi, halb so schlimm. Tanja betreibt eine Vorratswirtschaft, Gummis sammelt sie am Knauf der Küchenschranktür. Meine Hand war noch immer zur Faust geballt, ich fand ein passendes Gummi, die Farbe war ein klein bisschen anders, aber das fiel kaum auf. Ich ging zurück ins Wohnzimmer, schaute aus dem Fenster, dort war alles wie gehabt.
Dann öffnete ich die Faust.
7
Wenn ich meine Arbeit, die mir so sehr ans Herz gewachsen ist, nicht gehabt hätte, wäre das alles nicht passiert. Dann hätten die Stoffbündel nicht vor dem Eingang gestanden, und niemand hätte etwas darin verstecken können. Mein Leben wäre in geordneten Bahnen verlaufen.
Es ist ja nicht so, dass ich den Beruf, den ich erlernt habe, nicht gemocht hätte, im Gegenteil. Ich hatte nur keine Lust, zu arbeiten, ich hatte zu rein gar nichts Lust, ich wollte weder studieren noch arbeiten gehen. Meine Mutter war deshalb oft betrübt, studieren willst du nicht, arbeiten willst du nicht, was willst du denn dann? Aber wer will schon arbeiten? Warum muss man überhaupt irgendetwas tun? Was soll daran gut sein? Gut, manche machen sich des Geldes wegen krumm, aber abgesehen davon ist es das Beste, nichts zu tun, nur kann sich das kaum jemand leisten. Ich habe eben Glück gehabt. Man bemitleidet mich, ach, der arme Behinderte, heißt es, dies kann er nicht und jenes nicht, dabei will ich weder – noch, die Krankheit kam mir einfach zupass, aber das gebe ich natürlich nicht zu.
Hier in Israel halten es viele für selbstverständlich, dass sie ein Recht auf dies und jenes haben, wer es ihnen zuspricht und weshalb, spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Wie heißt es so schön? »Das steht mir zu« oder »Das wird mir angerechnet« – als hätte man selbstredend ein Anrecht auf Sozialleistungen. Höchst selten kann man dem Staat etwas entreißen.
Nehmen wir zum Beispiel meinen Cousin, er hat sein einigermaßen glückliches Leben in Russland aufgegeben und ist nach Israel ausgewandert. Hier geht es ihm schlecht, und er leidet darunter. Er ist total verzweifelt und jammert, mein ganzes Leben habe ich geackert, was denn, bekomme ich das hier nicht angerechnet? Da liegt doch der Hund begraben. Man kann aus seinem Leben nun mal keinerlei Ansprüche ableiten. Nur die Eltern haben eine gewisse Pflicht, denn sie haben einen schließlich in die Welt gesetzt. Dann aber muss jeder leben, wie er kann. Es stellt sich natürlich die Frage, ob man Benachteiligten helfen soll. Wenn das Gespräch darauf kommt, muss ich immer als Beispiel herhalten, wie könnte ich schließlich überleben, wenn es keine Sozialhilfe von der Bituach Leumi gäbe oder überhaupt irgendeine Form der Unterstützung.
Meine Antwort darauf ist simpel. Womöglich würde ich ohne fremde Hilfe nicht auskommen. Na und? Auch kein großer Verlust. Für die anderen zumindest nicht, für mich natürlich schon. Wenn ich mich so äußere, sehen die Leute ein, dass sie sich taktlos verhalten haben, fangen an, sich zu winden, und sagen, sie hätten es nicht so gemeint. Denn sie kennen meine zweite Antwort nicht, die nicht ganz so simpel ist und die ich lieber für mich behalte. Und die lautet: Was das Schicksal für mich bereithält, weiß ich nicht, dafür weiß ich, was ich schon immer wollte: a) nichts tun und b) keine Verantwortung übernehmen (was sich daraus ergibt, ist eine andere Frage).
Wer kann sich in unserer modernen Gesellschaft schon erlauben, nichts zu tun? Nur Reiche und Behinderte. Da mir das Schicksal keinen Reichtum zugedacht hat (erkläre ich später), bleibt mir nur Letzteres. Dabei bin ich kein Simulant, meine Krankheit ist durchaus echt und durch Röntgenbilder und ein medizinisches Gutachten belegt. Auf diese Weise habe ich die mir entsprechende Lebensform gefunden.
Stimmt, ich habe teuer dafür bezahlt, ich pflege ja auch zu sagen, nicht mal im Schlussverkauf kriegt man etwas umsonst. Aber ich sitze wenigstens nicht untätig herum und flenne, dass mir das Leben etwas schuldig geblieben ist. Sicher, für einen Gesunden ist das schwer nachzuvollziehen, ich kann mich nur wiederholen – ich habe eben Glück gehabt.
8
Ich wollte also weder studieren noch arbeiten gehen, aber meine Mutter trieb mich an, ich solle etwas lernen, denn damals waren Ungelernte nicht gerade in Mode. Also machte ich eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Interessant ist, dass ich damals noch keine Ahnung von meiner Krankheit hatte, nur manchmal fühlte sich mein Körper morgens ein bisschen steif an, und meine Wirbelsäule schmerzte. Ich wählte diesen Beruf, als hätte ich gewusst, dass er mir eines Tages von Nutzen sein würde. Ich habe ja auch eine Krankenpflegerin geheiratet – Liebe war da zweitrangig. Bis zu diesem Zeitpunkt verlief mein Leben also nach Plan. Aber auf einmal hatte ich keinen Plan mehr, es war, als täte sich ein Abgrund vor mir auf. Nach meiner Ausbildung arbeitete ich bei einem Rettungsdienst, dann war ich auf einmal nicht mehr belastbar; man stellte mir die Diagnose, und ich wurde in die Patientenregistrierung versetzt. Dort bekam ich dann bald den Behindertenstatus zuerkannt, und alles war gut. Aber das Eigentliche kommt erst noch. Wir waren gerade in Israel angekommen – ist das etwa schon zehn Jahre her? –, da musste ich plötzlich ins Krankenhaus. Obwohl Tanja den Umzug gut organisiert hatte, war die Sache anstrengend für mich, kurz und gut, ich wurde ernsthaft krank. Von meiner Behinderung erzählte ich niemandem, ich klagte nur über meine Unbeweglichkeit und starke Schmerzen, aber sie kamen schnell dahinter, der Arzt führte ein langes Gespräch mit mir, wir haben in deiner Wirbelsäule eine ernsthafte Erkrankung gefunden, sagte er, nicht tödlich, aber unheilbar. Du musst dir jetzt genau überlegen, wie du weiterleben willst, im Gesundheitswesen kannst du jedenfalls nicht mehr arbeiten. Trotzdem fingen sie an, mich zu behandeln. Darüber war ich sogar ein wenig erschrocken – was, wenn sie mich tatsächlich geheilt hätten? Es wäre natürlich schön gewesen, die Schmerzen los zu sein und wieder aufrecht gehen zu können, aber ich hatte mich an meinen Zustand gewöhnt, er war mir sozusagen zur zweiten Natur geworden, oder besser gesagt, zur ersten und einzigen, meine ursprüngliche hatte ich ja längst abgestreift. Sollte ich etwa noch mal von vorne anfangen?
Natürlich haben sie mich dann doch nicht geheilt, aber sie fingen an, alle möglichen Therapien an mir auszuprobieren. Sie brachten mich in einen Raum, in dem Schlaganfallpatienten irgendetwas aus Plastilin kneteten, Herrgott, dachte ich, wo bin ich nur gelandet. Aber mir gaben sie kein Plastilin, sondern führten mich zu einer Art Rahmen, eine Frau drückte mir Fäden und Stofffetzen in die Hand und sagte, ab sofort wirst du Teppiche weben. Na dann eben Teppiche, dachte ich, alles, was ich verlangte, war, dass mein Grad der Behinderung möglichst hoch eingestuft wurde. Die Frau brachte mir bei, mit dem Rahmen zu arbeiten. Kann man dieses Ding nicht tiefer einstellen, fragte ich, ich kann so schlecht die Arme heben. Nein, sagte sie, das ist extra so eingestellt, damit du die Arme, den Hals und den Rücken strecken musst. Gar nicht dumm, das muss man ihnen lassen, denn zu diesem Zeitpunkt war ich bereits stark verkrümmt, wenn auch noch nicht so sehr wie jetzt.
So fing ich also damit an, einfach nur, um es ihnen recht zu machen, und konnte mich mit den Teppichen verwirklichen. Es gefiel mir so gut, dass ich wie im Fieber arbeitete, nachts konnte ich nicht einschlafen, dachte mir die ganze Zeit Muster aus, konnte den Morgen kaum erwarten, um nur schnell wieder an den Webstuhl zu gelangen. Die Stofffetzen bekam ich von der Fabrik geliefert, ich wählte sie nach Farben aus, mal probierte ich dies, mal das, ich spielte mit verschiedenen Materialien, Wolle, Seide, Synthetik, Baumwolle und Strickstoffe. Alle sagten, du bist begabt. Im Krankenhaus veranstalteten sie sogar eine Ausstellung, bei der die Teppiche zum Verkauf angeboten wurden. Ich bekam kein Geld, aber sie schenkten mir zur Entlassung den Webstuhl. Der war zwar miserabel, ich hatte mir längst einen größeren und besseren gekauft, aber wenn ich daran arbeitete, konnte ich wenigstens meine Glieder strecken.
Ich schrieb mich in einem Behindertenclub ein, eine Art Genossenschaft für Behinderte, die allerlei aus Buntpapier ausschneiden, kleben, Perlen fädeln, Servietten besticken und auf Wohltätigkeitsbasaren verkaufen. Man kann sich nur schwer vorstellen, wer all das kaufen soll, aber meine Sachen wurden tatsächlich gekauft. Nur konnte ich nicht die ganze Produktion über den Club abwickeln, ich arbeitete schnell, es kam zu viel dabei heraus, und das trieb die Abgaben in die Höhe. Aber dann rief mich eine der Ärztinnen aus dem Krankenhaus an und bestellte zwei Teppiche. Sie wollte mir Geld dafür geben, aber ich gab sie ihr umsonst, als Dankeschön für die Behandlung. Dann fingen ihre Bekannten an, mich anzurufen.
Ich traf eine Abmachung mit der Nähfabrik, und sie lieferten mir das Material in Säcken direkt nach Hause. Wegen meiner Behinderung musste ich nur die Transportkosten zahlen. Ich wurde berühmt, kam sogar ins Fernsehen, die Sendung trug den Titel »Das Schicksal eines Talents«.
Kleine Fußabtreter-Teppiche fertigte ich dann kaum mehr an, ich konzentrierte mich auf große Wandteppiche. Einige davon hängen heute in Wohnungen reicher Leute, und einer, für den ich gutes Geld bekommen habe, sogar in einem Museum. Ein paarmal habe ich Teppiche in Läden zum Verkauf angeboten, aber das lohnt sich nicht, die nehmen zu viel Provision, außerdem hatte ich auch so genug Aufträge. Man bezahlte mich mittelmäßig, alle wollten Rabatt, erstens, weil ich nicht von hier, und zweitens, weil ich behindert bin. Dabei brauchten wir noch fünfzehn Jahre, um die Wohnung abzubezahlen, und dann kam unsere Tochter von der Armee zurück und wollte studieren, und unser Sohn hatte geheiratet und angefangen, sich zu vermehren, wir mussten ihm eine Wohnung kaufen, hatten aber nicht genug Geld. So saß ich da und dachte über all das nach, konnte mich aber zu nichts weiter durchringen.
9
Ich hatte allen Grund, mir den Kopf zu zerbrechen. Denn schließlich öffnete ich die Faust, und was sah ich? Geschliffene, glänzende Nüsschen, dreiunddreißig an der Zahl.
Ich ließ sie in meiner Handfläche hin und her kullern und redete mir ein, sieh an, was für tolle Glasperlen das sind. Dabei wusste ich nur zu gut, dass niemand auf die Idee kommen würde, derlei Perlen panisch zu verstecken, und dass die Polizei ihretwegen ganz bestimmt nicht im Restaurant aufgekreuzt wäre.
Ich hielt die Steine mal von der einen, mal von der anderen Seite gegen das Licht. Acht waren erbsengroß und pyramidenförmig, dann gab es noch ein paar in Tränenform, die sicher für Ohrringe gedacht waren, und einen richtig großen, rund und von rötlicher Färbung. Die Übrigen waren unterschiedlich groß, und dieser ganze Haufen lag in meiner Hand, funkelte, und der Rote in der Mitte leuchtete wie eine kleine Laterne.
Lange habe ich mich an diesem Anblick nicht ergötzt, ich nahm das Säckchen, schüttete die Glasperlen hinein, band es mit dem Gummi zu, stopfte es zurück in das Stoffbündel und drückte das Klebeband fest.
Wieder blickte ich aus dem Fenster und sah, dass der Koch und der Küchenjunge aus dem Lokal kamen. Das hieß, sie hatten jetzt Feierabend, und ich musste mich beeilen.
Zuerst fing ich an, den Webstuhl vom Fenster wegzurücken, sonst hätten sie gleich gesehen, wo ich die ganze Zeit über gesessen hatte. Der Webstuhl ist schwer, ich verrücke ihn eigentlich nie, das macht Tanja normalerweise. Ich drehte ihn so, dass ich mit dem Rücken zum Fenster saß, und zog den Vorhang zu. Dann holte ich meinen Rollstuhl aus dem Schlafzimmer, eigentlich benutzte ich ihn kaum mehr, nur bei schweren Anfällen. Ich stellte ihn vor den Webstuhl, damit sie gleich sehen konnten, dass ich krank und harmlos bin.
Dann machte ich mich daran, die Flicken einzuweben, arbeitete aber ohne Sinn und Verstand und verpatzte das Muster. Um mich zu beruhigen, rollte ich näher an den Fernseher heran und schaltete ihn ein, es war von irgendeinem Anschlag die Rede. Polizisten liefen aufgeregt hin und her, nun ja, das passiert hier oft. Wieder sah ich aus dem Fenster, Coby trat gerade aus dem Restaurant, der Wirt kam ihm entgegen, offensichtlich hatten sie nichts bei ihm gefunden und ihn laufen lassen. Coby redete aufgeregt auf ihn ein, mit dem Kopf deutete er Richtung Hauseingang.
Mir war vollkommen klar, solange die Durchsuchung nicht vorbei ist, werden die beiden es nicht wagen, das Haus auf den Kopf zu stellen. Mir blieb noch ein bisschen Zeit.
Wenn mich jemand in diesem Moment gefragt hätte, was machst du da eigentlich, Mischa, bist du verrückt geworden, hätte ich selbstredend die Finger davon gelassen. Dann wäre mein Leben nach Plan verlaufen, so, wie das Leben eines Behinderten eben verläuft.
Aber mein Kopf war völlig leer, ich holte das Säckchen wieder hervor, ließ die Steine in der Brusttasche meines Hemdes verschwinden, fuhr zur Toilette und spülte das Säckchen hinunter. Dann rollte ich zum Webstuhl zurück und fing an, die Steine einzeln in die Flicken einzubinden, wahllos nahm ich einen Stofffetzen nach dem anderen, steckte ein Steinchen hinein, machte ein Knoten, rollte das nächste ein, machte wieder einen Knoten; meine Hände zitterten nicht, und innerhalb von fünf Minuten hatte ich alles eingearbeitet.
Ich schaute aus dem Fenster und sah, dass die Polizisten inzwischen Azzam abführten, der Wirt lief hintendrein und redete auf sie ein, aber sie schüttelten nur die Köpfe, setzten Azzam ins Auto und fuhren davon. Coby stöberte unterdessen am Eingang herum.
Längere Zeit schaute ich nicht hinunter, rollte zurück zu meinem Webstuhl und webte die präparierten Stofffetzen hastig in den Teppich. Ich webte und lauschte und wusste, was jetzt geschehen würde.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























