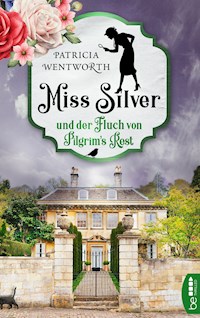4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Cosy-Krimi-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Zwielichtige Adlige, ein falsches Testament und eine seltsame Zeugin
London, 1936: Marion Grey ist verzweifelt - ihr Mann Geoffrey sitzt wegen Mordes an seinem Onkel im Gefängnis. Er beteuert vehement seine Unschuld, obwohl alle Beweise gegen ihn sprechen. Doch dann lässt die wichtigste Zeugin des Prozesses eine Andeutung fallen, die den Fall in einem vollkommen anderen Licht erscheinen lässt. Die zu Hilfe gerufene Miss Silver beginnt, nach dem wahren Mörder zu suchen ...
Ein charmanter Krimi-Klassiker aus dem "Golden Age of Crime", der in einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Ein abgeschlossener Fall " erschienen ist.
Zur Serie: Was macht eine pensionierte Lehrerin, der langweilig ist? Sie wird Privatdetektivin und unterstützt Scotland Yard bei den Ermittlungen in kniffligen Fällen. Mit ihrem unauffälligen gouvernantenhaften Aussehen wird Miss Silver oftmals unterschätzt - aber man sollte sich nicht mit der reizenden alten Dame anlegen. Bewaffnet mit einer scharfen Kombinationsgabe, ihrem Strickzeug und einem Zitat ihres Lieblingsdichters Alfred Lord Tennyson auf den Lippen, bringt Miss Silver jeden Verbrecher zur Strecke ...
Jetzt als eBook bei beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
"Unbeirrbare Gelassenheit und jede Menge Spürsinn sind das Markenzeichen von Miss Silver, eine der größten Privatdetektivinnen des klassischen Kriminalromans." New York Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin:
Über dieses Buch
Über die Serie
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Weitere Titel der Autorin:
Miss Silver und der Mord im Herrenhaus
Miss Silver und die Tote am Strand
Miss Silver und der Fluch von Pilgrim’s Rest
Miss Silver und die vergiftete Lady
Über dieses Buch
London, 1936: Marion Grey ist verzweifelt – ihr Mann Geoffrey sitzt wegen Mordes an seinem Onkel im Gefängnis. Er beteuert vehement seine Unschuld, obwohl alle Beweise gegen ihn sprechen. Doch dann lässt die wichtigste Zeugin des Prozesses eine Andeutung fallen, die den Fall in einem vollkommen anderen Licht erscheinen lässt. Die zu Hilfe gerufene Miss Silver beginnt, nach dem wahren Mörder zu suchen …
Über die Serie
Was macht eine pensionierte Lehrerin, der langweilig ist? Sie wird Privatdetektivin und unterstützt Scotland Yard bei den Ermittlungen in kniffligen Fällen. Mit ihrem unauffälligen gouvernantenhaften Aussehen wird Miss Silver oftmals unterschätzt – aber man sollte sich nicht mit der reizenden alten Dame anlegen. Bewaffnet mit einer scharfen Kombinationsgabe, ihrem Strickzeug und einem Zitat ihres Lieblingsdichters Alfred Lord Tennyson auf den Lippen, bringt Miss Silver jeden Verbrecher zur Strecke …
Über die Autorin
Patricia Wentworth ist mit ihren klassischen englischen Krimis die Wiederentdeckung unter den großen Ladies of Crime. 1878 in Indien geboren, ließ sie sich nach dem Tod ihres ersten Mannes in Camberly, England, nieder. 1923 schrieb sie ihren ersten Krimi, dem im Laufe der Zeit 70 weitere folgen sollten. Ihre bekannteste Heldin ist Miss Silver, die in 31 Romanen die Hauptrolle spielt und damit zu einem der bekanntesten Vorbilder für Agatha Christies Miss Marple wurde.
Patricia Wentworth
Miss Silver und die falsche Zeugin
Aus dem Englischen von Barbara Först
beTHRILLED
Digitale Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1937 by Patricia Wentworth
Titel der britischen Originalausgabe: «The Case Is Closed«
Originalverlag: Hodder and Stoughton, London
Für die deutschsprachige Erstausgabe:
Copyright © der deutschen Übersetzung 2001 by Wilhelm Goldmann Verlag, München
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: »Ein abgeschlossener Fall«
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven © Evgeny Karandaev/Shutterstock, © mubus7/Shutterstock, © Simon Baylis/Shutterstock, © Felicity.S/Shutterstock, © molaruso/Shutterstock, © Vitaly Ilyasov/Shutterstock, © Ola-la/Shutterstock, © Essl/Shutterstock, © Katflare/Shutterstock, © Stephen Rees/Shutterstock
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar
ISBN 978-3-7325-7244-1
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Kapitel 1
Hilary Carew saß im falschen Zug und hegte bittere Gedanken über Henry. Es war Henrys Schuld, dass sie im falschen Zug saß – allein und unwiderruflich Henrys Schuld, denn wenn er nicht den Bahnsteig entlangstolziert wäre mit seiner typisch arroganten Miene, als gehöre dieser Bahnsteig ihm, dann hätte sie nicht die Nerven verloren und wäre blindlings ins nächste Abteil gestürzt. Dies war zufällig ein Dritter-Klasse-Abteil im Zug auf dem rechten Gleis. Inzwischen war ihr vollkommen klar, dass sie in den Zug auf der anderen Seite hätte einsteigen müssen. Statt des Bummelzuges nach Winslow Grove, der alle fünf Minuten hielt und sie gemütlich nach Myrtle Terrace Nr. 20 bringen sollte, wo sie bei Tante Emmeline zu Tee und Kuchen eingeladen war, saß sie nun in einem D-Zug, der immer schneller wurde und wahrscheinlich noch stundenlang nicht halten würde.
Hilary starrte aus dem Fenster und sah Henrys Gesicht. Es war ein scheußlich nasser, nebliger Nachmittag. Henry funkelte sie durch den Nebel wütend an. Nein, wütend war nicht das richtige Wort: Wütend blickt man erst, wenn man die Beherrschung verliert, und das passierte Henry nie – er sah einen bloß an, als sei man eine Küchenschabe oder ein furchtbar verzogenes kleines Gör. Das war natürlich wirkungsvoller als die Beherrschung zu verlieren, doch dazu musste man aus dem gleichen Stoff gemacht sein. Hilarys Temperament war von anderer Art: Es machte einen Riesenwirbel und stürzte sich mit Wonne ins Getümmel. Sie kochte vor Wut, als sie an den Streit – den Großen Verlobungs-Auflösungs-Streit – und an Henrys unverschämte Gelassenheit dachte. Damals hatte er sie genauso angesehen wie jetzt auf dem Bahnhof. Überlegen, das war Henry – immer so verdammt überlegen! Wenn er sie gebeten hätte, nicht mit Basil wandern zu gehen, hätte sie vielleicht nachgegeben, aber Henry hatte es ihr ausdrücklich untersagt und ihr überdies noch genau erklärt, was und wer Basil war – und das alles ging ihn überhaupt nichts an und hatte Hilarys Temperament natürlich erst recht zum Überkochen gebracht.
Am ärgerlichsten war, dass Henry zum Schluss Recht behalten hatte – nach dem Streit, und nachdem sie bereits mit Basil auf die Wanderung gegangen, jedoch nicht sehr weit gekommen war. Doch leider hatte sie Henry damals schon gesagt, was sie von ihm und seinem besitzergreifenden Gebaren hielt, und ihm den Verlobungsring vor die Füße geworfen.
Und wenn er dann endlich die Beherrschung verloren hätte, wäre eine Versöhnung vielleicht noch möglich gewesen, die in einer zärtlichen Umarmung hätte enden können. Aber er war vollkommen ruhig gewesen – ruhig, während sie ihre Verlobung löste! Ein Knittelvers lag Hilary auf der Zunge. Sie besaß eine Art inneren Kobold, der immer dann mit lästerlichen Versen zur Stelle war, wenn man eigentlich ernst und feierlich sein sollte. Dieser Kobold hatte sie ernstlich in Schwierigkeiten gebracht, als sie sechs Jahre alt gewesen und mit einem Reim über ihre mittlerweile verstorbene Tante Arabella herausgeplatzt war:
»Tante Arabella hat ›ne furchtbar lange Nase,
Keiner weiß,
Warum sie wächst
So lang und spitz wie’s Ohr beim Hase.«
Sie hatte Tante Arabella nie sonderlich leiden können, und nach diesem Vers empfand die Tante das Gleiche für ihre Nichte.
Der Kobold gab nun folgende Perle zum Besten:
»Wenn man bloß Henry brächte zum Toben,
Dann bräuchten wir uns nicht zu entloben.«
Und das war leider nur allzu wahr.
Seit der Auflösung der Verlobung war jetzt ein Monat vergangen.
Es ist ziemlich schwer, einen ganzen Monat lang böse zu bleiben. Hilary konnte sehr leicht böse werden, hielt jedoch nicht lange durch. Nachdem ungefähr die Hälfte des Monats verstrichen war, fand sie es allmählich an der Zeit, dass Henry ihr einen Brief schrieb und sich entschuldigte. Eine Woche später ertappte sie sich dabei, wie sie auf den Briefträger wartete. Im Laufe der letzten Tage hatte die Vorstellung einer Zukunft ohne Henry – und auch ohne Kräche mit Henry – ihr mehr und mehr zugesetzt, und deshalb war es geradezu eine Erleichterung, wieder in Wut geraten zu können.
Und dann spielte die Einbildung ihr einen wirklich gemeinen Streich: Henrys Augen, die sie durch den Nebel angeschaut hatten, wirkten nun nicht länger verächtlich und hochmütig; ihr Ausdruck veränderte sich, wurde milde, liebevoll ... »Und so wird es nie mehr sein – nie wieder. O Henry!« Es war, als habe ihr jemand einen Messerstich versetzt, so sehr schmerzte es. Eben noch hatte sie eine gesunde Wut auf ihn gehabt, und im nächsten Augenblick war sie verletzt und hilflos; der Ärger verflog, und eine kalte Mutlosigkeit überfiel Hilary. Hinter den Augen spürte sie ein Brennen ... »Du wirst doch nicht in aller Öffentlichkeit in einem Eisenbahnabteil zu heulen anfangen –«
Sie blinzelte die Tränen weg und wandte sich vom Fenster ab. Lieber nicht mehr hinausschauen. Dieser Nebel spielte einem Streiche – gab einem das Gefühl, mutterseelenallein zu sein, ließ einen an Dinge denken, an die man einfach nicht denken wollte. Und statt so ein Trottel zu sein, sollte sie lieber herausfinden, wohin dieser verflixte Zug fuhr und wann er endlich einmal halten würde.
Als Hilary einstieg, waren noch zwei andere Leute im Abteil gewesen. Sie saßen auf den Plätzen an der Tür und hätten für Hilary ebenso gut zwei Koffer sein können. Als sie sich nun vom Fenster abwandte, sah sie, dass einer der beiden, der Mann, die Tür aufgeschoben hatte und auf den Gang hinaustrat. Er verschwand. Fast sogleich beugte sich die Frau, die ihm gegenüber gesessen hatte, vor und sah Hilary eindringlich an. Sie war schon etwas älter, und Hilary fand, dass sie sehr krank aussah. Sie trug einen schwarzen Filzhut und einen grauen Mantel mit schwarzem Pelzkragen – die typische unauffällige Kleidung einer respektablen Frau, die sich keine Gedanken mehr über ihr Erscheinungsbild macht, aus Gewohnheit jedoch stets ordentlich angezogen ist. Unter der dunklen Hutkrempe wirkten Haar, Gesicht und Augen gleichermaßen grau.
»Ich bin im falschen Zug«, erklärte Hilary. »Es klingt unglaublich dumm, aber wenn Sie mir vielleicht sagen könnten, wohin wir fahren – denn leider weiß ich nicht einmal das.«
Ein seltsamer Laut drang aus der Kehle der Frau. Sie griff sich mit der Hand an den Mantelkragen und zerrte daran.
»Ledlington«, antwortete sie schließlich. »Der nächste Halt ist Ledlington.« Und dann, mit stockender Stimme: »O Miss, ich hab Sie sofort erkannt! Er zum Glück nicht! Und er kann jeden Moment zurückkommen – er wäre nie weggegangen, wenn er Sie erkannt hätte. O Miss!«
Hilary schwankte zwischen Mitleid und Widerwillen. Sie hatte diese Frau noch nie gesehen – oder doch? Sie wusste es nicht. Dann begann sie zu glauben, dass sie ihr doch schon einmal begegnet sei, aber sie wusste nicht, wo das gewesen sein könnte. Nein, das war Unsinn! Sie kannte die Frau nicht; die Ärmste musste verrückt sein. Hilary hoffte, der Mann werde bald zurückkommen, denn diese Frau, die möglicherweise verrückt war, versperrte ihr den Weg zum Gang –
»Ich fürchte –«, begann sie mit leiser, höflicher Stimme, wurde jedoch sogleich von der Frau unterbrochen, die sich eifrig vorbeugte.
»O Miss, Sie kennen mich nicht, das hab ich gleich daran gesehn, wie Sie mich angeguckt haben. Aber Sie hab ich sofort erkannt, als Sie reinkamen, und ich hab ja so gehofft und gebetet, dass ich mal mit Ihnen reden könnte.«
Ihre schwarz behandschuhten Hände krampften sich ineinander; das Leder spannte über den Fingerknöcheln, die Fingerenden standen über, weil sie zu lang waren. Die Finger selbst verkrampften sich, zupften und zerrten. Hilary sah mit gelindem Entsetzen zu; es war, als beobachte man ein Tier, das sich vor Schmerz windet.
»Bitte –«, sagte sie.
Doch die Frau fuhr mit tonloser, drängender Stimme fort, immer wieder von einem nervösen Räuspern, fast schon einem Husten, unterbrochen.
»Ich hab Sie im Gericht gesehn, bei dem Prozess. Sie sind mit Mrs. Grey reingekommen, und da hab ich gefragt, wer Sie wär’n, und es hieß, Sie wär’n die Kusine Miss Carew, und da fiel mir ein, dass ich schon mal von Ihnen gehört hatte – von Miss Hilary Carew.«
Hilary hatte nun keine Angst mehr, sie empfand nur noch kalte Wut. Als hätte es nicht schon gereicht, diesen Albtraum von einer Gerichtsverhandlung gegen Geoffrey über sich ergehen zu lassen, erschien nun diese Frau, eine aus der Menge der krankhaft Neugierigen, die Geoffreys Pein und Marions Kummer bestaunen wollten – da sprach dieses verdammte Weib sie an, weil sie Hilary erkannt hatte und eine Gelegenheit zum Schnüffeln und Tratschen witterte. Wie konnte sie es wagen!
Hilary war sich nicht bewusst, dass sie bleich geworden war und ihre Augen zornig funkelten. Sie bemerkte es erst, als die Fremde ihre verkrampften Hände voneinander löste und sie hochhielt, als wolle sie einen Schlag abwehren.
»O Miss, bitte nicht! Ach, um Gottes willen, schau’n Sie mich doch nicht so an!«
Hilary stand auf. Sie musste unbedingt in ein anderes Abteil. Falls diese Frau nicht verrückt war, dann war sie völlig hysterisch. Hilary war gar nicht wohl bei der Vorstellung, so dicht an ihr vorbeizugehen, doch das Abteil sofort zu verlassen war immer noch besser, als gleich eine furchtbare Szene zu erleben.
Als sie den Griff der Schiebetür fasste, hielt die Frau sie am Mantel fest.
»O Miss, ich wollte mich doch bloß nach Mrs. Grey erkundigen. Ich dachte, Sie wüssten Bescheid.«
Hilary blickte auf die Frau hinab. Die hellen, farblosen Augen erwiderten ängstlich ihren Blick. Die Hand an ihrem Mantelsaum zitterte so stark, dass sie es spüren konnte. Sie wollte nur weg, nur heraus aus diesem Abteil! Doch dies hier war mehr als bloße Neugier. Hilary war zwar erst zweiundzwanzig, aber sie wusste, wie Menschen mit großem Kummer aussehen – das hatte sie bei Geoffreys Prozess gelernt. Diese Frau hier hatte Kummer. Sie ließ den Griff los. »Was wollen Sie denn über Mrs. Grey wissen?«
Sofort ließ die Fremde Hilarys Mantel los und sank auf den Sitz zurück. Mit großer Anstrengung zwang sie sich zur Ruhe.
»Ich wollt nur wissen, wie’s ihr geht – wie sie’s aushält. Ich bin nicht neugierig, Miss. Sie würde sich an mich erinnern, und ich hab so viel an sie denken müssen – ach Gott, wie oft bin ich nachts aufgewacht und hab an sie gedacht!«
Schon war es wieder um ihre Beherrschung geschehen; mit einem Schluchzen beugte sie sich vor.
»O Miss – wenn Sie nur wüssten!«
Hilary setzte sich. Wenn diese arme, bedauernswerte Frau Neuigkeiten von Marion hören wollte, dann sollte sie sie auch bekommen. Sie sah beängstigend krank aus. Und zweifellos war ihre Sorge echt. So begann Hilary mit sanfter Stimme: »Es tut mir leid, dass ich so wütend war. Ich dachte, Sie wären nur eine von diesen Schaulustigen, aber wenn Sie Marion wirklich gekannt haben, dann ist es etwas anderes. Sie – sie ist schrecklich tapfer.«
»Es hat mich richtig verfolgt, wie schlecht sie ausgesehn hat, Miss. Am letzten Tag hab ich gar nicht gewusst, wie ich’s länger ertragen sollte, wirklich nicht. Und dann wollte ich zu ihr – hab versucht, mit ihr zu reden. Miss, ich will nie mehr ›n Wort sagen, wenn’s nicht wahr ist, ich hab’s versucht. Bin ihm entwischt und bin raus, dahin, wo sie untergebracht war, aber die wollten mich nicht zu ihr lassen – sagten, sie dürfte keinen Besuch haben – sagten, sie würd sich ausruhen –« Plötzlich brach sie ab, den Mund halb offen, und schien einen endlos langen Augenblick nicht einmal mehr zu atmen. Dann fuhr sie flüsternd und kaum merklich die Lippen bewegend fort: »Wenn ich mit ihr hätte reden können –« Sie blickte Hilary verstört an und sagte in wachsender Panik: »Sie hat mich aber nie zu sehen gekriegt. Ruht sich aus, haben die mir erzählt. Und dann kam er, und ich hatte keine Gelegenheit mehr dazu – dafür hat er schon gesorgt.«
Hilary konnte sich keinen Reim auf das wirre Gefasel machen, hatte dabei jedoch das deutliche Gefühl, dass sie es verstehen sollte. Wieder bemühte sie sich um einen besonders sanften Ton: »Sagen Sie mir Ihren Namen? Mrs. Grey würde sicher gern erfahren, dass Sie sich nach ihr erkundigt haben.«
Die Frau legte die Hand an den Kopf.
»Hab ja ganz vergessen, dass Sie mich nicht kennen! Hab einfach drauflosgeschwatzt. Hättʼ ich nicht tun sollen, aber wo ich Sie gesehen hab, ist es einfach über mich gekommen. Ich hab Mrs. Grey immer schon gern gehabt und wollt schon das ganze Jahr wissen, wie’s ihr geht und dem Baby. Mit dem ist doch alles in Ordnung, oder?«
Hilary schüttelte den Kopf. Die arme Marion – und das arme Baby, das nie einen Atemzug getan hatte.
»Nein«, erwiderte sie schließlich. »Sie hat das Kind verloren. Es kam zu früh. Sie hat es verloren.«
Die Hände im schwarzen Leder verkrampften sich wieder. »Das hab ich nicht gewusst. Das hat mir keiner gesagt.«
»Sie haben mir noch nicht gesagt, wie Sie heißen.«
»Nein«, sagte die Fremde und schnappte nach Luft. »O – er wird gleich zurück sein! O Miss – und was ist mit Mr. Geoffrey – wenn Sie mir sagen könnten, ob’s irgendwas Neues gibt –«
»Es geht ihm gut«, versicherte Hilary. »Er schreibt, sooft er darf. Sie ist ihn heute besuchen gefahren. Wenn ich zurückkomme, wird sie mir erzählen, wie es war.«
Während des Sprechens schaute sie die Frau nicht mehr an, hatte deren Anwesenheit schon fast vergessen. Vor ihren Augen flimmerte es, und das Herz wurde ihr so schwer, dass sie nichts anderes mehr wahrnahm. Geoff, zu »lebenslänglich« verurteilt – Marion, die sich durch einen dieser furchtbaren Besuchstage im Gefängnis quälte, die ihr jedes Quäntchen Kraft und Zuversicht raubten ... Hilary konnte den Gedanken nicht ertragen. Geoff, der so lebensfroh gewesen war, und Marion, die ihn liebte und nun in einer Welt weiterleben musste, die Geoff für einen Mörder hielt und ihn eingesperrt hatte ... Was nutzte es zu sagen: ›Ich kann es nicht ertragen‹, wenn es doch immer weiterging und weitergehen musste und man es ertragen musste, ob man wollte oder nicht?
Ein Mann kam den Gang entlang und zog die Schiebetür auf. Hilary erhob sich, und er trat höflich zur Seite, um sie vorbeizulassen. Sie ging so weit wie möglich den Gang hinunter, blieb an dessen Ende stehen und starrte hinaus auf Bäume und Felder und Hecken, die im Nebel an ihr vorüberglitten.
Kapitel 2
»Du siehst furchtbar müde aus«, sagte Hilary.
»Ach ja?«, gab Marion Grey gleichgültig zur Antwort.
»Ja, müde – und als ob dir kalt wäre. Diese Suppe hier ist gut, wirklich. War erst so ein Glibber, aber jetzt, nachdem ich sie aufgewärmt habe ... Du musst sie aber schnell essen, sonst bleibt sie nicht heiß, und lauwarme Suppe ist einfach grässlich.« Hilary sprach mit sanftem Drängen.
Marion erschauerte, aß einen Löffel Suppe, dann einen zweiten, legte den Löffel wieder hin. Es war, als sei sie für einen Moment aus tiefen Gedanken hochgefahren und dann wieder darin versunken. Sie war noch in Straßenkleidung, trug einen braunen Tweedmantel, der zu ihrer Brautausstattung gehört hatte, und ein braunes Barett aus Wolle, das Tante Emmeline für sie gehäkelt hatte. Der Mantel fing allmählich an, ein wenig schäbig auszusehen, doch wie alles, was Marion trug, schmiegte auch er sich eng an ihre schlanke, hoch gewachsene Gestalt. Sie war viel zu dünn, doch selbst wenn sie zu einem Skelett abgemagert wäre, hätte sie elegant ausgesehen. Und mit ihrem dunklen Haar, das immer noch feucht war vom Nebel, der zurückgeschobenen Mütze und den grauen Augen, die vor Schmerz und Müdigkeit verschleiert waren, war ihr immer noch eine Apartheit zu Eigen, die gewöhnliche Schönheit noch steigert und letzten Endes das Einzige ist, das bestehen bleibt.
»Iss die Suppe auf, Liebes«, mahnte Hilary.
Marion nahm einen neuen Löffel voll. Die Suppe wärmte sie. Sie aß alles auf und lehnte sich aufatmend zurück. Hilary war so ein liebes Kind – nett von ihr, dass sie den Kamin angezündet und heiße Suppe gekocht und Rühreier gebraten hatte. Marion verzehrte die Eier, weil man ja etwas essen musste und weil Hilary so lieb zu ihr war und sich sonst große Sorgen gemacht hätte.
»Und das Badewasser ist auch schon heiß – du kannst also ein schönes heißes Bad nehmen und direkt danach ins Bett gehen, wenn du willst.«
»Gleich«, erwiderte Marion. Sie lehnte sich in dem chintzbezogenen Sessel zurück und starrte in das stetig glühende Feuer.
Hilary räumte die Teller ab, eilte geschäftig zwischen dem Wohnzimmer und der kleinen Küche hin und her. Die leuchtenden Chintzvorhänge hatte sie zugezogen. Auf dem Kaminsims stand eine Reihe Porzellanvögel in Blau, Grün, Gelb und Braun, darunter der rosafarbene mit dem spitzen Schnabel, den Geoff Sophy getauft hatte. Jeder dieser Vögel trug einen Namen. Geoff musste sich für alles, was er kaufte, einen Namen ausdenken. So hatte sein letztes Auto Samuel geheißen, und die Namen der Vögel waren Octavius, Leonora, Ermengarde, Sophy und Erasmus.
Hilary kam mit einem Tablett aus der Küche zurück. »Möchtest du deinen Tee jetzt oder lieber später im Bett?«
Marion riss sich aus ihrer Versunkenheit. »Später. Und du machst dir so viel Arbeit.«
Hilary stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Allmählich erwachte Marion aus ihrer Erstarrung. Wenn sie sich in Schmerz und Kummer begrub, war es unmöglich, zu ihr durchzudringen; man konnte dann nur noch auf Zehenspitzen gehen, versuchen, es ihr warm und behaglich zu machen und sie zum Essen zu bewegen – und sie überdies von ganzem Herzen lieb haben. Doch wenn sie sich aus ihrer Erstarrung löste, würde sie zu reden beginnen, und das konnte ihr nur guttun. Erleichterung brachte die Farbe in Hilarys Wangen zurück und ließ ihre Augen leuchten. Sie hatte eines jener Gesichter, die sich unablässig wandeln: Eben noch hatte sie ausgesehen wie ein blasses, unscheinbares Ding mit den Augen eines verlassenen Kindes, das mit aller Kraft brav und tapfer sein will, jetzt jedoch zeigten ihre Züge Farbe und Anmut. »Ich tue das gern«, sagte sie. »Das weißt du doch.«
Marion lächelte sie an.
»Und was hast du gemacht? Warst du bei Tante Emmeline?«
»Nein, leider nicht. Ich wollte zwar, bin aber nie dort angekommen. Liebes, ich bin ein Trottel! Ich bin in den falschen Zug gestiegen, einen D-Zug noch dazu, und konnte vor Ledlington nicht aussteigen. Und so habe ich natürlich Stunden für die Rückfahrt gebraucht und habe mich dann nicht mehr getraut, nach Winslow Grove zu fahren, weil ich Angst hatte, nicht hier zu sein, wenn du zurückkommst.«
»Ach, du liebes Kind«, sagte Marion gedankenverloren. Und dann plötzlich: »Tante Emmeline wird sich aber furchtbare Sorgen machen.«
»Ich habe sie schon angerufen.«
Hilary setzte sich auf den Kaminvorleger und faltete die Hände vor den Knien. Das kurz geschnittene Haar lockte sich wild um ihren Kopf. Sie war schmal und leicht gebaut wie ein Kind, auch die Hände waren klein, aber kräftig und ans Zupacken gewöhnt. Ihr roter Mund hatte eine stark geschwungene Oberlippe und eine sehr volle Unterlippe. Sie war braun gebrannt, hatte eine Stupsnase und leuchtende Augen von unbestimmbarer Farbe. Wenn sie aufgeregt, freudig erregt oder zornig war, schimmerte unter der bräunlichen Haut ein lebhaftes Rot hervor. Sie besaß eine angenehme Stimme und hatte eine entzückende Art, den Kopf zu drehen. Ein liebes, nettes Mädchen, warmherzig und mit einem aufbrausenden Temperament gesegnet. Sie hätte sich für Marion Grey ein Bein ausgerissen, und Geoffrey liebte sie wie den Bruder, den sie nie gehabt hatte. Jetzt nahm sie sich vor, Marion aufzutauen und sie zum Reden zu bringen.
»Ich habe in diesem falschen Zug ein richtiges Abenteuer erlebt. Zuerst habe ich geglaubt, mit einer Geistesgestörten im Abteil eingesperrt zu sein, aber dann hat sich herausgestellt, dass sie dich kannte.«
Marion lächelte tatsächlich. Hilary spürte vor Freude einen Kloß in der Kehle. Sie löst sich aus ihrer Erstarrung, ja wirklich! Und sie versuchte, ihr Abenteuer im Zug so spannend wie möglich zu schildern.
»Weißt du, ich bin so rasch in den Zug gesprungen, weil ich Henry gesehen hatte –«
»O«, machte Marion.
Hilary nickte heftig. »Stand da, als wäre er drei Meter groß, dermaßen entschlossen, dass man es gar nicht beschreiben kann. Ich nehme an, er war gerade bei seiner Mutter gewesen, und die hat ihm erzählt, dass er noch mal davongekommen ist. Sie hat ja von Anfang an gewusst, dass ich nicht zu ihm passe und ihm auch nie die gute Ehefrau sein könnte, die sie für seinen Vater war.«
Marion schüttelte vorwurfsvoll den Kopf. Hilary schnitt eine Grimasse und fuhr hastig fort: »Wenn ich nur daran denke, dass ich Mrs. Cunningham als Schwiegermutter hätte kriegen können, läuft’s mir eiskalt den Rücken hinunter! Ich bin gerade noch davongekommen! Mein Schutzengel muss das seit langem geplant haben, um mich zu retten.«
Wieder schüttelte Marion den Kopf. »Henry wird nicht von dir erwarten, dass du sie allzu oft besuchst.«
Hilary lief dunkelrot an und streckte trotzig das Kinn in die Höhe.
»Wie meinst du das: ›Henry wird nicht erwarten ...‹? Wir haben uns auf immer und ewig getrennt, und es ist mir völlig gleichgültig, was er von mir erwartet und was nicht. Und du lässt mich meine Geschichte nicht weitererzählen, und dabei ist sie doch so spannend. Im Übrigen habe ich Henry nur erwähnt, weil ich ein sehr offener Mensch bin und erklären wollte, warum ich in den falschen Zug eingestiegen bin und es nicht gemerkt habe, bis er losfuhr. Und da erst wurde mir klar, dass es ein D-Zug war, und ich dachte noch, da habe ich ja was Schönes angerichtet. Und als ich die Frau im Abteil fragte, wohin wir fahren, hat sie zuerst Ledlington gesagt, dann aber hat sie die Hände zusammengeschlagen und gesagt, sie habe mich gleich beim Einsteigen erkannt.«
»Und wer war sie?«
»Liebes, ich weiß es nicht. Aber du solltest sie kennen, denn sie hat sich nach dir erkundigt. Und zuerst glaubte ich, sie sei bloß neugierig, weil sie durchblicken ließ, dass sie uns zusammen im Gerichtssaal gesehen hatte – das muss an dem Nachmittag gewesen sein, als Tante Emmeline zusammengebrochen ist, denn das war das einzige Mal, dass ich bei der Verhandlung war –, und da bin ich natürlich in die Luft gegangen vor Wut. Bin aufgestanden, um mir ein anderes Abteil zu suchen, denn diese Schaulustigen machen mich ganz krank. Und dann habe ich erst gemerkt, dass sie gar nicht zu dieser Sorte gehörte.«
»Und woran hast du das gemerkt?« Marion klang angespannt.
»Sie hat mich am Mantelsaum gefasst, und ich habe gemerkt, dass sie furchtbar zitterte. Sie sah auch schrecklich unglücklich und irgendwie verzweifelt aus – es war wirklich nicht so, dass sie sich an deinem Unglück geweidet hätte. Und dann sagte sie, sie wolle nur wissen, wie’s dir ginge, weil sie dich immer gern gehabt habe und – na, eben solche Sachen.«
Es kam Hilary ein wenig verspätet in den Sinn, dass es vielleicht unverfänglicher gewesen wäre, weiter über Henry zu reden. Jetzt war sie schon zum zweiten Mal an diesem Tage blindlings irgendwo eingestiegen, und das Ergebnis war ungefähr das Gleiche. Sie hatte die Geschichte ihres Abenteuers zuerst nur begonnen, um Marion von ihrem Kummer abzulenken. Nun aber musste sie in den sauren Apfel beißen und fortfahren, denn Marion wiederholte mit Nachdruck: »Wer war diese Frau?«
»Ich weiß es nicht, Liebes, das habe ich dir doch schon gesagt. Ich glaube wirklich, sie war ein bisschen übergeschnappt – sie redete so komisch. Und dann war da noch ein Mann: Er ging auf den Gang, kurz nachdem ich mich wieder gefangen hatte – nachdem ich Henry gesehen hatte. Und die Frau hat ganz komische Dinge über diesen Mann gesagt, zum Beispiel, sie danke Gott, dass er fort sei, weil sie so gehofft und gebetet hatte, allein mit mir sprechen zu können. Sie war wirklich furchtbar aufgeregt, weißt du, krampfte dauernd die Hände zusammen und griff sich an den Hals, als ob sie keine Luft kriegen würde.«
»Wie sah sie aus?«, fragte Marion nachdenklich. Sie hatte den Kopf in die Hände gestützt. Ihre Finger bedeckten die Augen.
»Tja, ungefähr so wie Tante Emmelines guter Geist Mrs. Tidmarsh – du weißt schon, die Aushilfe, die immer kommt und einspringt, wenn Eliza Urlaub nimmt. Sie sah ihr nicht wirklich ähnlich, war aber der gleiche Typ – bieder und respektabel –, und dann die Art, wie sie mich die ganze Zeit ›Miss‹ genannt hat. Ich habe schon erlebt, wie Mrs. Tidmarsh das zweimal pro Satz fertigbringt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die arme Frau im Zug es auch geschafft hat.«
»War sie im mittleren Alter?«
»Wahrscheinlich ist sie schon so geboren worden. Du weißt doch, wie Mrs. Tidmarsh ist – man kann sich einfach nicht vorstellen, dass sie einmal jung war, oder gar ein kleines Mädchen. Wie ihre Kleider – die werden auch nie älter, man kann sich aber auch nicht vorstellen, dass sie jemals neu gewesen sind.«
»Ich glaube nicht, dass es eine große Rolle spielt«, meinte Marion Grey. »Was wollte sie denn wissen?«
»Neuigkeiten über dich – wie’s dir geht – ob es dir gut geht – und – und über Geoff –« Sie hielt inne, zögerte. »Marion, sie hat etwas ganz, ganz Komisches gesagt. Ich weiß nicht, ob ich’s dir –«
»Aber ja – sag schon.«
Hilary schaute ihre Kusine zweifelnd an. Das war das Schlimmste daran, wenn man in den falschen Zug einstieg: Man wusste nie, wohin die Fahrt gehen würde.
»Also, ich nehme an, sie war wirklich übergeschnappt. Sie hat gesagt, sie habe versucht, dich zu treffen oder mit dir zu sprechen, und zwar während der Verhandlung. Sie sagte, sie sei ihm entwischt und dorthin gekommen, wo du untergebracht warst, aber natürlich hätte man sie nicht zu dir gelassen. Aber dann hat sie noch halblaut so was gesagt wie: ›Wenn ich doch ...‹ – ich hab’s nicht ganz verstanden, weil es so erstickt und zittrig rauskam. Nein, stimmt gar nicht – sie sagte: ›Ich habe nicht mit ihr reden können‹, oder etwas in der Richtung, und dann: ›Aber wenn mich doch ...‹. Sie war so durcheinander, dass ich es einfach nicht richtig verstehen konnte.«
Hilarys Stimme wurde immer leiser, bis sie schließlich verstummte. Irgendwie hatte sich die Atmosphäre im Raum verändert. Sie war seltsam aufgeladen, und diese Veränderung ging von Marion aus, die wie versteinert dasaß und keinen Ton von sich gab. Sie hatte eine Hand über die Augen gelegt, und die seltsame Atmosphäre ging in Wellen von ihr aus und erfüllte das ganze Zimmer.
Hilary hielt die Spannung aus, so lange sie es vermochte. Dann löste sie ihre Hände und kniete sich hin. Im gleichen Augenblick stand Marion auf und ging zum Fenster. Dort stand als Fenstersitz eine Eichentruhe, die dunkel getäfelte Front dem Zimmer zugewandt, auf dem Deckel viele grüne und blaue Kissen. Marion fegte die Kissen herunter, hob den Deckel hoch und holte ein Fotoalbum heraus. Immer noch schweigend ging sie zu ihrem Sessel, setzte sich und blätterte die Seiten um.
Endlich fand sie, wonach sie gesucht hatte, und hielt das Album hoch, damit Hilary es auch sehen konnte. Es war ein Schnappschuss, in einem Garten aufgenommen. Eine Pergola, mit Kletterrosen bewachsen, ein Lilienbeet, ein Teetisch, eine kleine Teegesellschaft. Marion, die über das ganze Gesicht lächelte – und ein älterer Mann mit einem gewaltigen Schnurrbart.
Hilary hatte James Everton nie kennen gelernt, doch seine Züge waren ihr schrecklich vertraut. Vor einem Jahr waren sein Name und sein Foto in jeder Zeitung Englands zu sehen gewesen, damals, als Geoffrey Grey des Mordes angeklagt worden war.
Geoffrey selbst war nicht auf dem Bild, weil er der Fotograf war, und Marions Lächeln galt allein ihm. Doch es war noch eine dritte Person zu sehen, eine Frau, die sich über den Teetisch beugte und ein Tablett mit Teebrötchen hinstellte. Wie Marion blickte auch sie in die Kamera. Sie hielt das Tablett in der rechten Hand und sah aus, als habe man sie gerade angesprochen oder nach ihr gerufen.
Hilary schnappte nach Luft. »O ja – das ist sie!«
Kapitel 3
Beide schwiegen. Hilary starrte auf das Foto, und Marion sah Hilary mit bitterem Lächeln an.
»Das ist Mrs. Mercer«, sagte sie. »Jamesʼ Haushälterin.« Sie ließ das Album sinken und legte es auf ihre Knie. »Geoffrey hätte freigesprochen werden können, wenn sie nicht gewesen wäre: Ihre Aussage hat den Ausschlag gegeben. Sie hat die ganze Zeit geweint, und das nahm die Geschworenen natürlich für sie ein. Hätte sie einen rachsüchtigen Eindruck gemacht, dann hätte es Geoffrey nicht halb so viel geschadet, aber als sie unter Schluchzen schwor, sie habe ihn und James über das Testament streiten hören, hat sie sein Verderben herbeigeführt. Es gab noch eine winzige Chance, dass die Geschworenen ihm geglaubt hätten, dass er James bereits tot vorgefunden hat, aber Mrs. Mercer hat ihm diese letzte Chance genommen.« Marion verstummte, ihre Stimme schien zu versagen. Dann fuhr sie in einem merkwürdigen, verwunderten Ton fort: »Ich habe sie immer für eine äußerst liebenswerte Person gehalten. Sie hat mir das Rezept für diese Teebrötchen da gegeben. Ich dachte immer, sie mag mich.«
Hilary hockte sich auf die Fersen. »Das hat sie auch gesagt: Sie sagte, sie habe dich immer gern gehabt.«
»Warum hat sie dann Geoff so schwer belastet? Warum nur? Ich habe darüber gegrübelt, bis ich bald verrückt geworden bin, aber ich kann immer noch nicht verstehen, warum sie das getan hat.«
»Ja – warum?«, fragte auch Hilary.
»Sie hat gelogen. Aber warum sollte sie lügen? Sie hat Geoff doch gern gehabt. Sie hat diese belastende Aussage gemacht, als läge sie auf der Folterbank – und deshalb war die Wirkung so fatal. Das ist so – ich finde einfach keine Antwort darauf. James war schon tot, als Geoff das Haus betrat. Wir haben das zusammen immer und immer wieder durchgekaut: Es war acht Uhr, als James ihn anrief. Wir waren gerade mit dem Dinner fertig, und Geoff ist sofort aufgebrochen, ich weiß, du hast das schon tausendmal gehört, aber es geht doch darum, dass dies die Wahrheit ist. James hat wirklich angerufen. Geoff ist wirklich nach Putney gefahren, genau, wie er ausgesagt hat. Er stand da drüben, legte den Hörer auf und sagte: ›James will mich sofort sprechen. Er klingt furchtbar aufgeregt.‹ Dann gab er mir einen Kuss und rannte die Treppe hinunter. Und als er bei James ankam, war der tot – war quer über seinen Schreibtisch gefallen, und da lag auch die Pistole. Und Geoff hat sie aufgehoben. Ach, wenn er das doch bloß nicht getan hätte! Er hat selbst gesagt, er war sich gar nicht bewusst, was er tat, bis er merkte, dass er das Ding in der Hand hielt. Er war zum Gartentor hereingekommen und hatte niemanden gesehen außer James, und der war tot, und am Boden lag die Pistole, und er hat sie aufgehoben! Und dann kommt Mercer, klopft an die Tür – und die Tür war verschlossen! Hilary – wer hat diese Tür abgeschlossen? Sie war nämlich von innen zugesperrt, und der Schlüssel steckte im Schloss. Und nur Geoffs Fingerabdrücke waren darauf, weil er zur Tür gegangen ist und auf die Klinke gedrückt hat, nachdem Mercer geklopft hatte. Und dann dreht er den Schlüssel herum und lässt den Mann herein, und da stehen die beiden Mercers vor ihm, und Mr. Mercer sagt: ›0 Gott, Mr. Geoff! Was haben Sie getan?‹«
»Marion!«, flehte Hilary. »Du musst das alles nicht noch einmal erzählen – das nützt doch nichts.«
»Glaubst du, ich würde hier sitzen und reden, wenn ich stattdessen etwas tun könnte?«, fragte Marion mit leiser, erschöpfter Stimme. »Mercer hat gesagt, er habe nichts gehört außer einem Knall ungefähr eine Minute vorher, den er für einen geplatzten Autoreifen oder eine Fehlzündung gehalten hätte. Er war gerade in der Geschirrkammer und hat Gläser poliert und das Tafelsilber geputzt und weggeräumt. Das stimmte auch, denn überall lagen Poliertücher herum, und das Reinigungsmittel klebte noch an seinen Händen. Aber Mrs. Mercer war oben gewesen, um Jamesʼ Bett aufzudecken, und sie sagte, auf dem Weg durch die Halle habe sie laute Stimmen im Arbeitszimmer gehört. Und da habe sie es mit der Angst bekommen und an der Tür gelauscht, und sie schwor, dass Geoffrey dort drin mit James gestritten habe. Und dann, schwor sie, habe sie einen Schuss gehört, habe geschrien und sei zu Mercer gerannt.« Marion stand jäh auf, und das Fotoalbum fiel auf Hilarys Knie.
Mit einer heftigen und doch anmutigen Bewegung schob Marion ihren Stuhl zurück und begann, ruhelos im Zimmer auf und ab zu gehen. Sie war so bleich, dass Hilary um sie bangte; ihre Erschöpfung war einer nervösen Rastlosigkeit gewichen.
»Ich habe darüber nachgedacht, immer und immer wieder. Ich habe es so lange durchgekaut, bis ich es fast im Schlaf aufsagen konnte, und es ergibt immer noch keinen Sinn. Nichts davon ergibt einen Sinn. So war es auch vor Gericht – ein sinnloser Lärm – sinnlose Worte. Und diese Frau, die im Zeugenstand geschluchzt und Geoff um sein Leben gebracht hat ... Und es gab doch keinen Grund, und nirgendwo ein Motiv – niemand hatte einen Grund, James zu töten. Außer Geoff, falls er den Kopf verloren und es in einem Wutanfall getan hätte, nachdem James ihm von dem neuen Testament erzählt hatte, das ihn enterbte. Aber Hilary, er hat es nicht getan – er war es nicht! Ich schwöre, er war es nicht! Sie haben es auf sein hitziges Temperament geschoben, aber ich kann beschwören, er war es nicht! James hatte ihn zum Erben ausersehen, und er hatte kein Recht, das einfach so zu ändern. Er hatte kein Recht, Geoff im Büro aufzunehmen und ihm eine Teilhaberschaft zu versprechen, nur um ihn dann so abrupt fallen zu lassen. Aber Geoff hätte nie die Hand gegen ihn erhoben, das weiß ich. Es ist einfach nicht möglich, dass er auf James geschossen haben soll.« Sie hielt in ihrer rastlosen Wanderung vor dem Fenster inne und starrte hinaus. »Es ist einfach nicht möglich – außer in einem Albtraum –, aber dies ist ja ein Albtraum – der schon so lange dauert –, und manchmal habe ich das Gefühl – dass ich vielleicht anfange – daran zu glauben.«
»Nein!«, stieß Hilary mit einem Aufschluchzen hervor.
Marion fuhr zu ihr herum.
»Warum hat James sein Testament vernichtet und ein neues aufgesetzt? Warum hat er alles Bertie Everton hinterlassen? Über den hatte er nie ein gutes Wort zu sagen, Geoff hingegen hatte er gern. Den ganzen Tag vor dem Mord waren sie zusammen, und es gab keinen Streit – nichts. Und dann vernichtet er am nächsten Tag das alte Testament und macht ein neues, um acht lässt er Geoff kommen, und Geoff findet ihn tot über dem Schreibtisch liegen.«
»Du denkst doch nicht –?«, fragte Hilary.
»Ich habe seitdem nichts anderes getan, als nachzudenken – es macht mich verrückt, dieses Grübeln.«
Hilary bebte vor Aufregung. Sie wohnte nun schon fast ein Jahr mit Marion zusammen, und niemals, niemals hatte Marion mit ihr über den Fall gesprochen. Sie hielt ihn an einem schrecklichen, geheimen Ort in ihrem Herzen unter Verschluss und vergaß ihn gewiss nie, ob im Schlafen oder im Wachen – doch noch nie hatte sie mit Hilary darüber geredet.
Und Hilary hätte so viele kluge Einfälle gehabt! Wenn Marion doch nur darüber geredet, ihr verschlossenes Herz geöffnet hätte – dann hätte Hilary, dessen war sie sicher, irgendetwas aufstöbern können, das man vorher übersehen hatte; und damit hätte sie vielleicht die ganze verfahrene Geschichte aufgeklärt.
»Nein – nein – Liebes, hör zu. Marion, bitte. Du glaubst doch nicht, dass jemand das Testament gefälscht hat?«
Marion stand vor der Eichentruhe, halb vom Raum abgewandt. Sie stieß ein Lachen aus, das fast wie ein Schluchzen klang. »Hilary, was bist du doch für ein Kind! Meinst du, daran hätte ich nicht gedacht? Meinst du nicht, man hätte an alles gedacht? James ist mit dem neuen Testament zur Bank gefahren, und der Bankdirektor und einer seiner Angestellten waren Zeugen.«
»Warum?«, fragte Hilary. »Ich meine, warum hat er nicht die Mercers als Zeugen genommen? Man fährt doch für gewöhnlich nicht zu einer Bank, um sein Testament beglaubigen zu lassen.«
»Das weiß ich nicht«, antwortete Marion müde. »Er hat es jedenfalls so gemacht. Die Mercers durften nicht unterschreiben, weil er ihnen schon ein Legat ausgesetzt hatte. James hat seinen Anwalt kommen lassen und hat in dessen Beisein das alte Testament vernichtet. Dann hat er den Anwalt ein neues aufsetzen lassen, sie sind zusammen zur Bank gefahren, und James hat es dort unterschrieben.«
»Und wo war Bertie Everton zu diesem Zeitpunkt?«
»In Edinburgh. Er war mit dem Nachtzug gefahren.«
»Dann war er also am Tag davor hier?«
»O ja – er war in Putney und hat James besucht – hat mit ihm zu Abend gegessen, genauer gesagt. Aber daraus kann man absolut nichts schließen außer der Tatsache, dass irgendetwas gesagt oder getan wurde, das James dazu brachte, seine Ansichten und damit sein Testament zu ändern. Er hatte Bertie immer verachtet, aber in diesen knapp anderthalb Stunden ist etwas geschehen, das ihn zu dem Entschluss veranlasst hat, Bertie jeden Penny zu hinterlassen. Nach dem alten Testament sollte ich zum Beispiel tausend Pfund bekommen, aber sogar diese Verfügung hat er gestrichen. Und auch Frank, Berties Bruder, der immer eine Art Unterstützung bekam, weil er sich allein nicht über Wasser halten kann, wurde aus dem Testament gestrichen. Frank ist ein Taugenichts und ein Herumtreiber, aber er ist Jamesʼ Neffe, genau wie Bertie oder Geoff, und James wollte, dass auch er versorgt wäre. Er meinte immer, bei Frank sei eine Schraube locker, aber er hat ihn nie derart verachtet wie Bertie. Bertie stand für alles, was er nicht ausstehen konnte – und er hat ihm sein ganzes Vermögen vermacht.«
Hilary stützte die Hände hinter sich auf den Boden. »Warum hat er ihn denn so verachtet? Was ist denn mit Bertie?«
Marion zuckte die Achseln.
»Eben nichts – das war es ja, was James so aufgeregt hat. Er pflegte zu sagen, Bertie habe niemals in seinem Leben einen Handschlag getan und werde es auch nie tun. Er besitzt ein wenig eigenes Vermögen und gondelt in der Weltgeschichte herum, sammelt Porzellan, spielt Klavier, tanzt mit den jungen Mädchen und hofiert ihre Mütter, Tanten und Großmütter – und nie sieht man ihn mit einem Mann sprechen. Und als James erfuhr, dass Bertie für ein paar Louis-Quinze-Stühle, die er günstig erworben hatte, Sitzpolster stickte, da hatten Geoff und ich den Eindruck, ihn werde gleich der Schlag treffen.«
»Marion, woher weißt du denn, dass dieser Bertie wirklich in Schottland war, als James – erschossen wurde?«
»Er hat doch den Nachtzug genommen. Und er ist wieder im Caledonian Hotel in Edinburgh abgestiegen. Da hatte er schon ein paar Tage gewohnt, bevor er hierher kam und James aus wer weiß welchen Gründen besucht hat. Jedenfalls hat er diesen Besuch gemacht und sich danach wieder auf den Weg nach Norden gemacht. Der Kellner sagte aus, er habe Frühstück und Lunch im Hotel eingenommen. Nach dem Lunch habe er sich über den angeblich defekten Klingelzug in seinem Zimmer beschwert, und um vier Uhr hätte er sich um einen Anruf gesorgt, den er erwartete.« Sie hob die Hand und ließ sie schwer auf den Truhendeckel fallen. »Du siehst – er hätte zur Tatzeit gar nicht in Putney sein können. James war um Viertel nach acht tot. Außerdem – Bertie – wenn du ihn kennen würdest –«
»Ich dachte gerade an den anderen«, meinte Hilary, »an Frank, den Taugenichts und Herumtreiber.«
»Der nützt uns auch nichts, fürchte ich«, entgegnete Marion. »Frank hielt sich zu der Zeit in Glasgow auf. Er hat das beste Alibi von allen, denn ausgerechnet an jenem Abend bekam er vor sechs Uhr sein Taschengeld ausbezahlt. James hat das einmal wöchentlich von einem Anwalt in Glasgow erledigen lassen, weil Frank nie länger als eine Woche mit seinem Geld auskommt, egal wie hoch die Summe ist. Er hat an dem Abend kurz vor sechs bei dem Anwalt vorbeigeschaut, um sein Geld abzuholen, und hat die Kanzlei erst verlassen, als es fast Viertel nach sechs war, und deshalb, fürchte ich, kommt er als Mörder wohl kaum in Frage. Es wäre ja auch zu schön gewesen, aber – er kann es nun einmal nicht getan haben.«
»Und wer dann?«, platzte Hilary heraus, ohne nachzudenken.
Marion schien auf diese Frage hin zu erstarren wie eine Statue. Wo Leben ist, ist auch Atem, und wo Atem ist, entsteht Bewegung. Marion jedoch schien nicht einmal mehr zu atmen. Eine bange Minute lang kam es Hilary so vor, als habe ihre Kusine wirklich zu atmen aufgehört. Sie starrte Marion mit weit aufgerissenen, erschrockenen Augen an, und dann kam ihr blitzartig die Erkenntnis, dass Marion sich nicht sicher war – dass sie Geoffs wegen nicht sicher war. Sie liebte ihren Mann von ganzem Herzen, aber sie war nicht sicher, ob er nicht doch James Evertons Mörder war. Diese Vorstellung bestürzte Hilary so sehr, dass ihr nichts einfallen wollte, das sie zum Trost sagen oder tun könnte. Sie stützte sich nur noch schwerer auf ihre Hände, die allmählich taub wurden.
Die Statue regte sich. Marion drehte sich abrupt um, und plötzlich brach die eiserne Selbstbeherrschung eines ganzen langen Jahres zusammen. »Ich weiß es nicht – niemand weiß es – und niemand wird es je wissen. Wir werden einfach immer so weiterleben – und wir werden es nie erfahren. Ich bin fünfundzwanzig, Geoff ist achtundzwanzig. Vielleicht müssen wir noch fünfzig Jahre so weiterleben. Fünfzig Jahre.« Ihre Stimme klang wie aus einem kalten Grab.
Hilary nahm die taub gewordenen Hände vom Boden und mühte sich auf die Beine. »Marion, Liebes, sprich nicht so! Es ist doch nicht wirklich lebenslänglich – sie werden doch meistens früher entlassen.«
»Fünfundzwanzig Jahre«, stieß Marion gequält hervor. »Fünfundzwanzig Jahre, und vielleicht ein paar weniger wegen guter Führung. Sagen wir zwanzig – zwanzig Jahre. Du weißt ja nicht, was schon das eine Jahr ihm angetan hat. Es wäre besser gewesen, sie hätten ihn gleich umgebracht. Denn jetzt töten sie ihn langsam, jeden Tag ein Stückchen mehr, und lange vor Ablauf dieser zwanzig Jahre wird er ein toter Mann sein. Von dem Mann, den ich kannte und liebte, wird nichts mehr übrig bleiben. Eine leere Hülle wird er sein – eine leere Hülle namens Geoffrey Grey. Sein Körper wird nicht sterben; er ist stark, und angeblich ist das Häftlingsleben sogar gesund. Nur der, der mein Geoff war, der stirbt – langsam und qualvoll –, während wir hier sitzen und reden.«
»Marion!«
Marion schob ihre Kusine beiseite. »Du weißt nicht, wie das ist. Jedes Mal, wenn ich ihn besuche, denke ich vorher: Diesmal werde ich zu ihm durchdringen, wirklich zu ihm durchdringen, ich werde nicht zulassen, dass mich irgendetwas davon abhält. Der Aufseher, die ganze Umgebung – das alles spielt überhaupt keine Rolle – wir sind zusammen, das ist das Einzige, was zählt. Aber wenn ich dann diesen Raum betrete –«, sie machte eine verzweifelte Geste, »– dann sind wir nicht zusammen. Ich kann ihm nicht nahe kommen – ich kann ihn nicht berühren –, das ist nicht erlaubt – und auch nicht, dass ich ihn küsse. Wenn ich nur meine Arme um ihn legen dürfte, dann könnte ich ihn zurückholen. Er treibt immer weiter von mir fort – er stirbt mir weg –, und ich kann nichts dagegen tun!« Sie griff nach der Lehne des Sessels und hielt sich zitternd daran fest. »Und nun stell dir mal vor, er kommt nach zwanzig Jahren nach Hause, als Toter! Was kannst du schon für einen Toten tun? Denn bis dahin wird er so gut wie tot sein. Und ich? Vielleicht bin ich dann auch tot.«
»Marion – Marion, bitte!«
Marion erschauerte von Kopf bis Fuß.
»Nein, das nützt auch nichts, nicht wahr? Man muss ja weiterleben. Wenn mein Baby nicht gestorben wäre –« Sie brach ab, richtete sich auf und legte die Hände vors Gesicht. »Ich werde nie Kinder haben. Sie töten Geoff, und sie haben meine Kinder getötet. O Gott, warum – warum ist das alles nur geschehen? Wir waren so glücklich!«
Kapitel 4
Hilary erwachte aus ihrem Halbschlaf, als die Uhr im Wohnzimmer zwölf schlug. Sie hatte nicht einschlafen wollen, bevor sie nicht sicher war, dass Marion ebenfalls schlief, und nun war sie wütend auf sich selbst, weil sie doch eingedöst war. Sie warf sich vor, in einen Traum geflüchtet zu sein und Marion wach und unglücklich im Stich gelassen zu haben. Aber vielleicht schlief die Kusine ja auch tief und fest.
Hilary schlüpfte aus dem Bett und tappte barfuß ins Badezimmer. Marions Zimmer lag gleich neben dem Bad. Wenn sie sich mit der linken Hand an der Handtuchstange festhielt und sich weit aus dem Fenster beugte, konnte sie sich mit der rechten Hand auf Marions Fensterbank stützen. Und wenn sie dann den Kopf drehte, bis sie glaubte, sich gleich den Hals zu verrenken, konnte sie mit einem Ohr in Marions Zimmer hineinhorchen und feststellen, ob Marion schlief oder nicht. Hilary hatte dies schon unzählige Male getan und war nie erwischt worden, weil die Vorhänge sie verbargen. Hundertmal hatte sie gelauscht und Marion seufzen und weinen gehört. Sie hatte nie gewagt, zu ihr zu gehen, war jedoch aus Solidarität ebenfalls wach geblieben und hatte liebevoll und mitleidig an Marions und Geoffs schweres Schicksal gedacht.
Heute Nacht jedoch schlief Marion tief und fest. Ihre leisen, gleichmäßigen Atemzüge waren der einzige Laut im Zimmer.