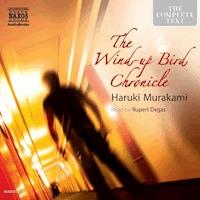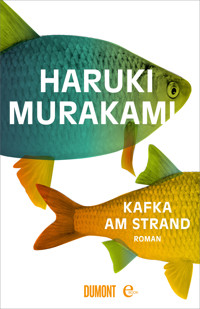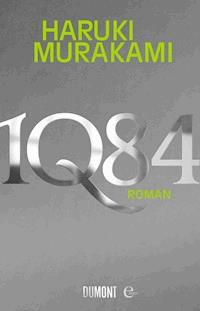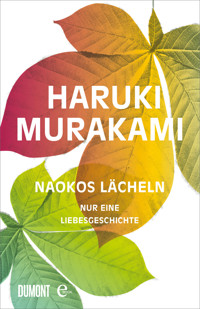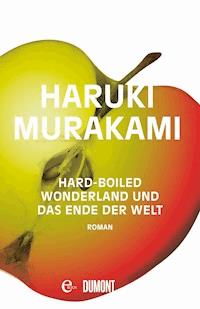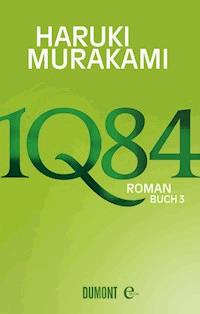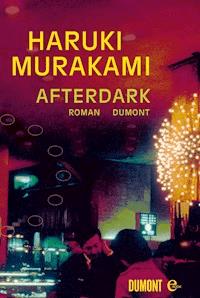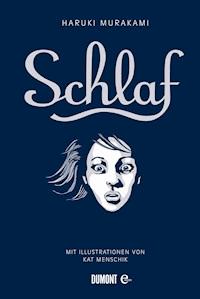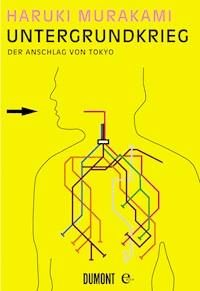9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein unzufriedener Mann von 30 Jahren, gerade ohne Arbeit und von seiner tüchtigen Frau zur Selbsterforschung ermutigt, so einer ist Murakamis Held Toru Okada in diesem schillernden Roman. Wenn er fliegen kann, dann eher wie ein Spielzeugvogel, von wer weiß wem aufgezogen. Vor diesem Mister Aufziehvogel tun sich plötzlich Wirklichkeiten auf, von denen er bisher nichts ahnte. Erotische, ökonomische und politische. Unbekannte dringen zu ihm vor: eine kesse, intelligente 16-Jährige, eine Wahrsagerin, ein alter Offizier, und alle schleppen sie ihre seltsamen Geschichten in Torus stilles Haus – Geschichten, die sich als insgeheim miteinander verbunden erweisen. Selbst über die eigene Ehe, über seine scheinbar so treue Frau drängen sich dem Helden schwindelerregende Vermutungen auf. Unter dem Alltagsleben der Großstadtgesellschaft wirken noch andere Kräfte: geheime, abgründige Begierden, die Historie mit ihren militärischen Untaten aus dem japanisch-chinesischen Krieg; vielleicht gar so Altmodisches wie das Schicksal. Haruki Murakami rührt an beunruhigende Empfindungen, die auch den Europäer am Ende des 20. Jahrhunderts umtreiben. Als dem westlichen Erleben zugewandter Erzähler schon lange international ein Geheimtip, erkundet Haruki Murakami die Seele des globalisierten Menschen. Ein Welterfolg, ein hochorigineller zeitgenössischer Roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1172
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
HARUKI MURAKAMI
MISTER AUFZIEHVOGEL
ROMAN DUMONT
AUS DEM ENGLISCHEN VON
DIE ORIGINALAUSGABE ERSCHIEN 1994 UND 1995 UNTER DEM TITEL NEJIMAKI-DORI KURONIKURU BEI SINCHOSA LTD., TOKYO UND 1997 IN DER ENGLISCHEN ÜBERSETZUNG BEI ALFRED A. KNOPF, INC., NEW YORK © 1997 HARUKI MURAKAMI E-BOOK 2011 © 1998 FÜR DIE DEUTSCHE AUSGABE: DUMONT BUCHVERLAG, KÖLN ALLE RECHTE VORBEHALTEN AUSSTATTUNG UND UMSCHLAG: GROOTHUIS+MALSY UMSCHLAGFOTOGRAFIE: GEOFF SPEAR
MISTER AUFZIEHVOGEL
ERSTES BUCH: DIE DIEBISCHE ELSTER JUNI UND JULI 1984
1
DIENSTAGS-AUFZIEHVOGEL SECHS FINGER UND VIER BRÜSTE
Als das Telefon klingelte, war ich in der Küche, wo ich einen Topf Spaghetti kochte und zu einer UKW-Übertragung der Ouvertüre von Rossinis Die diebische Elster pfiff, was die ideale Musik zum Pastakochen sein dürfte.
Eigentlich wollte ich es klingeln lassen – nicht nur weil die Spaghetti fast fertig waren, sondern auch weil Claudio Abbado die Londoner Symphoniker gerade ihrem musikalischen Höhepunkt entgegenführte. Schließlich mußte ich aber nachgeben. Es hätte auch jemand sein können, der mir von einem möglichen Job erzählen wollte. Ich drehte die Flamme herunter, ging ins Wohnzimmer und hob ab.
»Zehn Minuten, bitte«, sagte eine Frau am anderen Ende.
Ich bin gut darin, Leute an der Stimme zu erkennen, aber diese kannte ich nicht.
»Wie bitte? Wen wollten Sie sprechen?«
»Sie natürlich. Zehn Minuten, bitte. Mehr brauchen wir nicht, um uns zu verstehen.« Ihre Stimme war tief und weich, aber ansonsten ohne besondere Kennzeichen.
»Uns zu verstehen?«
»Gefühlsmäßig.«
Ich beugte mich vor und spähte durch die Küchentür. Der Nudeltopf dampfte munter vor sich hin, und Claudio Abbado dirigierte noch immer Die diebische Elster.
»Tut mir leid, aber ich stecke gerade mitten im Spaghettikochen. Dürfte ich Sie bitten, später noch einmal anzurufen?«
»Spaghetti? Was haben Sie morgens um halb elf Spaghetti zu kochen?«
»Das geht Sie überhaupt nichts an«, sagte ich. »Ich entscheide, was ich esse und wann ich es esse.«
»Da haben Sie natürlich recht. Ich ruf später noch einmal an«, sagte sie, und ihre Stimme klang jetzt kühl und ausdruckslos. Ein kleiner Stimmungswechsel kann bei einer Stimme wahre Wunder bewirken.
»Moment noch«, sagte ich, bevor sie auflegen konnte. »Wenn das irgendein neuer Verkaufsgag ist, können Sie die Sache vergessen. Ich bin arbeitslos. Ich bin an nichts interessiert.«
»Keine Sorge. Ich weiß.«
»Sie wissen? Was wissen Sie?«
»Daß Sie arbeitslos sind. Das ist mir bekannt. Also gehen Sie schon, lassen Sie Ihre kostbaren Spaghetti nicht warten.«
»Wer zum Teufel –«
Sie hängte ein.
So ohne ein Ventil für meine Gefühle, starrte ich den Telefonhörer an, bis mir die Spaghetti wieder einfielen. Ich ging in die Küche zurück, drehte den Gasherd aus und goß den Inhalt des Topfes in ein Sieb. Dank des Anrufs waren die Spaghetti ein bißchen weicher als al dente, aber noch nicht unrettbar dahin. Ich fing an zu essen – und nachzudenken.
Uns verstehen? Uns in zehn Minuten gefühlsmäßig verstehen? Wovon redete die eigentlich? Vielleicht war es nur ein Telefonjux. Oder eine neue Verkaufsmasche. Auf jeden Fall hatte es nichts mit mir zu tun.
Nach dem Lunch legte ich mich wieder mit meinem Leihbücherei-Roman aufs Wohnzimmersofa und warf dem Telefon gelegentliche Seitenblicke zu. Was hätten wir in zehn Minuten voneinander verstehen sollen? Was können zwei Leute in zehn Minuten überhaupt voneinander verstehen? Bei näherer Überlegung schien sie sich, was diese zehn Minuten anging, bemerkenswert sicher gewesen zu sein: Es war das erste, was sie gesagt hatte. Als ob neun Minuten zu kurz und elf zu lang gewesen wären. Wie beim Spaghettikochen.
Ich konnte mich nicht mehr aufs Lesen konzentrieren. Ich beschloß, statt dessen Hemden zu bügeln. Was ich immer tue, wenn ich unruhig bin; eine alte Gewohnheit. Ich unterteile die Arbeit in zwölf exakte Schritte, wobei ich mit dem Kragen (Außenseite) anfange und mit der linken Manschette ende. Die Reihenfolge ist immer dieselbe, und ich zähle mir die einzelnen Schritte vor. Andernfalls wird’s nicht richtig.
Ich bügelte drei Hemden, untersuchte sie auf Kniffe und hängte sie auf. Als ich das Bügeleisen ausgeschaltet und zusammen mit dem Bügelbrett wieder in den Flurschrank geräumt hatte, sah es in mir schon bedeutend ordentlicher aus.
Ich war auf dem Weg in die Küche, um mir ein Glas Wasser zu holen, als wieder das Telefon klingelte. Ich zögerte einen Augenblick, beschloß dann aber abzunehmen. Wenn es dieselbe Frau war, würde ich ihr sagen, ich sei am Bügeln, und auflegen.
Diesmal war es Kumiko. Die Wanduhr zeigte halb zwölf. »Wie geht’s?« fragte sie.
»Gut«, sagte ich, erleichtert, die Stimme meiner Frau zu hören.
»Was machst du so?«
»Grad aufgehört zu bügeln.«
»Ist was nicht in Ordnung?« Ihre Stimme klang leicht angespannt. Sie wußte, was es bedeutete, wenn ich bügelte.
»Nein, nichts. Ich hab nur ein paar Hemden gebügelt.« Ich setzte mich und nahm den Hörer von der linken in die rechte Hand. »Was gibt’s?«
»Kannst du dichten?« fragte sie.
»Dichten?« Dichten? Meinte sie … dichten?
»Ich kenne den Herausgeber einer Mädchenzeitschrift. Die suchen jemand, der aus den Gedichten, die die Leserinnen einsenden, welche für die Veröffentlichung auswählt und wenn nötig redigiert. Und sie wollen, daß der Betreffende jeden Monat selbst ein kurzes Gedicht für die Titelseite schreibt. Für einen so einfachen Job ist die Bezahlung nicht schlecht. Natürlich ist das keine Ganztagsbeschäftigung. Aber sie könnten noch etwas Redaktionsarbeit dazulegen, wenn der Betreffende –«
»Einfach?« unterbrach ich sie. »He, Moment mal. Ich suche eine Stelle als Jurist, nicht als Lyriker.«
»Ich dachte, auf der Oberschule hast du geschrieben.«
»Klar, sicher, für die Schülerzeitung: welche Fußballmannschaft die Meisterschaft gewonnen hat oder daß der Physiklehrer die Treppe runtergefallen und im Krankenhaus gelandet ist – solche Sachen. Keine Gedichte. Ich kann nicht dichten.«
»Schon klar, aber ich rede nicht von großer Dichtung, nur was für Oberschülerinnen. Es brauchen keine Meisterwerke dabei herauszukommen. Das könntest du mit links. Meinst du nicht auch?«
»Schau, ich kann einfach keine Gedichte schreiben – weder mit links noch mit rechts. Das habe ich noch nie gemacht, und ich hab nicht vor, jetzt damit anzufangen.«
»Na schön«, sagte Kumiko mit einem Anflug von Bedauern in der Stimme. »Aber es ist nicht leicht, was im juristischen Bereich zu finden.«
»Ich weiß. Deswegen strecke ich ja auch meine sämtlichen Fühler aus. Ich müßte diese Woche eigentlich was erfahren. Wenn’s nichts wird, überlege ich mir, ob ich nicht etwas anderes tun sollte.«
»Na ja, das war alles. Ach übrigens, was ist heute? Welcher Wochentag?«
Ich dachte einen Augenblick nach und sagte: »Dienstag.«
»Gehst du dann bei der Bank vorbei und zahlst die Gas- und Telefonrechnung?«
»Klar. Ich wollte sowieso grad für heute abend einkaufen gehen.«
»Was soll’s denn geben?«
»Ich weiß noch nicht. Ich entscheide mich beim Einkaufen.«
Sie schwieg kurz. »Wenn ich’s mir überlege«, sagte sie, auf einmal ernsthaft, »eilt’s gar nicht so sehr, daß du einen Job findest.«
Darauf war ich nicht gefaßt gewesen. »Wieso nicht?« fragte ich. Hatte sich die weibliche Weltbevölkerung den heutigen Tag ausgesucht, um mich am Telefon zu verblüffen? »Früher oder später ist mit meinem Arbeitslosengeld Schluß. Ich kann nicht ewig weiter so rumhängen.«
»Stimmt schon, aber mit meiner Gehaltserhöhung und gelegentlichen Nebenjobs und unseren Ersparnissen können wir prima zurechtkommen, wenn wir ein bißchen aufpassen. Es ist nicht wirklich dringend. Geht es dir auf die Nerven, daheim zu bleiben und die Hausarbeit zu erledigen? Ich meine, geht dir dieses Leben so gegen die Natur?«
»Ich weiß nicht«, sagte ich aufrichtig. Ich wußte es wirklich nicht.
»Na, dann denk ein bißchen darüber nach«, sagte sie. »Was anderes, ist der Kater inzwischen zurück?«
Der Kater. Ich hatte den ganzen Vormittag nicht an ihn gedacht. »Nein«, sagte ich. »Noch nicht.«
»Könntest du dich bitte ein wenig in der Nachbarschaft umsehen? Er ist jetzt seit über einer Woche weg.«
Ich gab einen unverbindlichen Grunzlaut von mir und wechselte den Hörer wieder in die linke Hand. Sie fuhr fort:
»Ich bin so gut wie sicher, daß er sich bei dem leerstehenden Haus am anderen Ende der Gasse herumtreibt. Dem mit der Vogelplastik im Garten. Ich hab ihn schon mehrmals da gesehen.«
»Gasse? Seit wann gehst du auf die Gasse? Du hast nie ein Wort gesagt –«
»O je! Ich muß weg. Haufen Arbeit zu erledigen. Denk an den Kater.«
Sie legte auf. Wieder stand ich da und starrte den Hörer an. Dann legte ich ihn auf die Gabel zurück.
Ich fragte mich, was Kumiko auf der Gasse zu suchen gehabt haben mochte. Um von unserem Haus da hinzukommen, mußte man über die Hohlblockmauer klettern. Und war das erst mal geschafft, hatte man überhaupt nichts davon, da zu sein.
Ich holte mir in der Küche ein Glas Wasser und ging dann hinaus auf die Veranda, um nach dem Freßnapf zu sehen. Das Häufchen Sardinen war seit letzten Abend nicht angerührt worden. Nein, der Kater war nicht zurückgekehrt. Ich stand da und sah unseren kleinen Garten an, in den die frühsommerliche Sonne hereinflutete. Nicht, daß unser Garten einer von der Sorte gewesen wäre, bei dessen Betrachtung man sich seelisch erquickt fühlt. Die Sonne kam täglich nur auf einen ganz kurzen Sprung vorbei, deswegen war die Erde immer schwarz und feucht, und das einzige, was wir an Gartenpflanzen besaßen, waren ein paar triste Hortensien, die in einer Ecke vor sich kümmerten – und ich mag keine Hortensien. Nicht weit vom Haus stand eine Baumgruppe, und aus ihr konnte man den mechanischen Ruf eines Vogels hören, der so klang, als zöge er eine Feder auf. Wir nannten ihn den Aufziehvogel. Kumiko hatte ihn so getauft. Wir wußten nicht, wie er wirklich hieß oder wie er aussah, aber das störte den Aufziehvogel nicht. Jeden Tag kam er zur nahen Baumgruppe und zog die Feder unserer ruhigen kleinen Welt auf.
Jetzt mußte ich mich also auf Katerjagd begeben. Ich hatte Katzen immer schon gemocht, und ich mochte diesen bestimmten Kater. Aber Katzen haben ihre eigenen Vorstellungen vom Leben. Sie sind nicht dumm. Wenn eine Katze aufhörte, bei jemandem zu wohnen, dann bedeutete das einfach, daß sie beschlossen hatte, woanders hinzugehen. Sobald sie müde und hungrig war, würde sie schon zurückkommen. Trotzdem aber würde ich mich Kumiko zuliebe auf die Suche nach unserem Kater machen müssen. Ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun.
Meinen Job hatte ich Anfang April aufgegeben – den Juristenjob, den ich seit Ende meines Studiums gehabt hatte. Nicht, daß ich aus einem bestimmten Grund gekündigt hätte. Ich hatte nichts gegen die Arbeit. Sie war nicht gerade fesselnd, aber das Gehalt war in Ordnung und das Betriebsklima angenehm.
Um’s ganz offen zu sagen, war meine Funktion in der Firma die eines graduierten Laufburschen gewesen. Und ich war gut darin. Ich kann wohl sagen, daß ich eine echte Begabung für die Verrichtung von derlei praktischen Aufgaben habe. Ich merke mir Dinge schnell, bin effizient, beklage mich nie und bin ein Realist. Was auch der Grund dafür ist, daß der Seniorpartner (der Vater in dieser Vater-und-Sohn-Anwaltssozietät), als ich sagte, ich wollte kündigen, so weit ging, mir eine kleine Gehaltsaufbesserung anzubieten.
Aber ich kündigte trotzdem. Nicht, daß die Kündigung mir ermöglicht hätte, irgendwelche besonderen Träume oder beruflichen Aussichten zu realisieren. Das letzte, wonach mir beispielsweise der Sinn gestanden hätte, wäre gewesen, mich im Haus einzuschließen und mich auf die Anwaltsprüfung vorzubereiten. Ich war sicherer denn je, daß ich kein Rechtsanwalt werden wollte; aber ich wußte auch, daß ich nicht in dieser Kanzlei und auf diesem Posten bleiben wollte. Wenn ich kündigen wollte, war jetzt der Augenblick, es zu tun. Wenn ich noch länger in der Kanzlei bliebe, würde ich dort für den Rest meines Lebens bleiben. Schließlich war ich schon dreißig.
Ich hatte Kumiko beim Abendessen gesagt, daß ich mit dem Gedanken spielte, meinen Job aufzugeben. »Ich verstehe«, war ihre einzige Reaktion gewesen. Ich wußte nicht, was sie damit meinte, aber eine Zeitlang sagte sie nichts weiter.
Ich blieb auch stumm, bis sie hinzufügte: »Wenn du kündigen möchtest, solltest du kündigen. Es ist dein Leben, und du solltest es so leben, wie du es für richtig hältst.« Nachdem sie das gesagt hatte, vertiefte sie sich darin, mit ihren Eßstäbchen Gräten aus dem Fisch zu zupfen und sie an den Rand des Tellers zu legen.
Kumiko hatte als Redakteurin einer Zeitschrift für gesunde Ernährung ein sehr ordentliches Gehalt, und gelegentlich übernahm sie von befreundeten Redakteuren anderer Zeitschriften Aufträge für Illustrationen, was einen schönen Zusatzverdienst brachte. (Sie hatte auf dem College Design studiert und ursprünglich gehofft, freischaffende Illustratorin zu werden.) Wenn ich kündigte, würde ich außerdem noch eine Zeitlang Arbeitslosenunterstützung beziehen. Was bedeutete, daß wir, selbst, wenn ich daheim blieb und mich nur um den Haushalt kümmerte, noch genug für Extras wie Essengehen und Wäscherechnung haben würden und sich unser Lebensstil kaum ändern würde.
Also hatte ich gekündigt.
Ich war dabei, Lebensmittel in den Kühlschrank zu räumen, als das Telefon klingelte. Das Klingeln schien diesmal einen ungeduldigen Unterton zu haben. Ich hatte gerade eine Packung Tofu aufgerissen und stellte sie behutsam auf den Küchentisch, damit das Wasser nicht überschwappte. Dann ging ich ins Wohnzimmer und nahm ab.
»Inzwischen müßten Sie Ihre Spaghetti aufgegessen haben«, sagte die Frau.
»Sie haben recht. Aber jetzt muß ich die Katze suchen gehen.«
»Das kann bestimmt zehn Minuten warten. Es ist nicht wie Spaghettikochen.«
Aus irgendeinem Grund brachte ich es nicht fertig, einfach aufzulegen; etwas in ihrer Stimme bannte meine Aufmerksamkeit. »Okay, aber nicht mehr als zehn Minuten.«
»Jetzt werden wir es schaffen, uns zu verstehen«, sagte sie mit ruhiger Zuversicht. Ich spürte, wie sie es sich in einem Sessel bequem machte und die Beine kreuzte.
»Da bin ich aber gespannt«, sagte ich. »Was kann man in zehn Minuten schon groß verstehen?«
»Zehn Minuten sind vielleicht länger, als Sie glauben«, sagte sie.
»Sind Sie sicher, daß Sie mich kennen?«
»Aber natürlich. Wir sind uns schon Hunderte von Malen begegnet.«
»Wo? Wann?«
»Irgendwo, irgendwann«, sagte sie. »Aber wenn ich darauf eingehen wollte, würden zehn Minuten niemals genügen. Was zählt, ist die Zeit, die wir jetzt haben. Die Gegenwart. Meinen Sie nicht auch?«
»Vielleicht. Aber ich hätte gern irgendeinen Beweis dafür, daß Sie mich wirklich kennen.«
»Was denn für eine Art von Beweis?«
»Sagen wir, wie alt ich bin.«
»Dreißig«, antwortete sie wie aus der Pistole geschossen. »Dreißig und zwei Monate. Überzeugt?«
Das brachte mich zum Schweigen. Offensichtlich kannte sie mich wirklich, aber an ihre Stimme konnte ich mich beim besten Willen nicht erinnern.
»Jetzt sind Sie dran«, sagte sie mit verführerischer Stimme. »Versuchen Sie, sich ein Bild von mir zu machen. Anhand meiner Stimme. Stellen Sie sich vor, wie ich bin. Mein Alter. Wo ich bin. Was ich anhabe. Los.«
»Ich habe keine Ahnung«, sagte ich.
»Ach, kommen Sie schon«, sagte sie. »Versuchen Sie’s.«
Ich sah auf meine Uhr. Es waren erst eine Minute und fünf Sekunden vergangen. »Ich habe keine Ahnung«, wiederholte ich.
»Dann werde ich Ihnen eine kleine Hilfestellung geben«, sagte sie. »Ich liege auf dem Bett. Ich komme gerade aus der Dusche, und ich habe nichts an.«
Oh, stark. Telefonsex.
»Oder wäre es Ihnen lieber, wenn ich etwas anhätte? Etwas mit Spitzen. Oder Strümpfe. Würde das bei Ihnen besser wirken?«
»Das ist mir scheißegal. Machen Sie, was Sie wollen«, sagte ich. »Ziehen Sie sich was an, bleiben Sie nackt, ganz wie Sie wollen. Tut mir leid, aber ich bin an solchen Telefonspielchen nicht interessiert. Ich hab noch einen Haufen Dinge zu –«
»Zehn Minuten«, sagte sie. »Zehn Minuten werden Sie schon nicht umbringen. Sie werden’s überleben. Beantworten Sie einfach meine Frage. Wollen Sie mich nackt oder mit was an? Ich habe die verschiedensten Dinge, die ich anziehen könnte. Schwarze Spitzenhöschen …«
»Nackt ist okay.«
»Also gut. Sie wollen mich nackt.«
»Ja. Nackt. Gut.«
Vier Minuten.
»Mein Schamhaar ist noch naß«, sagte sie. »Ich habe mich nicht besonders gut abgetrocknet. Ah, ich bin so naß! Warm und feucht. Und weich. Wunderbar weich und schwarz. Berühren Sie mich.«
»Also, es tut mir leid, aber –«
»Und auch da unten. Ganz, ganz unten. Es ist so warm da unten, wie Buttercreme. So warm. Hmmm. Und meine Beine. Was glauben Sie, wie ich die Beine gerade halte? Mein rechtes Knie steht hoch, und mein linkes Bein ist gerade genug abgespreizt. Sagen wir, Fünf-nach-zehn-Stellung.«
Ich konnte an ihrer Stimme erkennen, daß sie kein Theater spielte. Sie hatte die Beine wirklich in Fünf-nach-zehn-Stellung gespreizt, und ihr Geschlecht war warm und feucht.
»Berühren Sie die Schamlippen«, sagte sie. »Laaangsam. Jetzt öffnen Sie sie. Genau so. Langsam, langsam. Liebkosen Sie sie mit den Fingern. Ganz, ganz langsam. Jetzt berühren sie mit Ihrer anderen Hand meine linke Brust. Spielen Sie mit ihr. Streicheln Sie sie. Von unten herauf. Und drücken Sie die Brustwarze ein bißchen zusammen. Jetzt noch einmal. Und noch mal. Und noch mal. Bis ich fast komme.«
Ohne ein Wort zu sagen, legte ich den Hörer auf. Ich streckte mich auf dem Sofa aus, starrte auf die Uhr und stieß einen langen, tiefen Seufzer aus. Unser Gespräch hatte nicht ganz sechs Minuten gedauert.
Zehn Minuten später klingelte das Telefon wieder, aber ich nahm nicht ab. Es klingelte fünfzehnmal. Und als es verstummte, senkte sich eine tiefe, kalte Stille über den Raum.
Kurz vor zwei kletterte ich über die Hohlblockmauer und hinunter in die Gasse – oder das, was wir »die Gasse« nannten. Es war keine Gasse im eigentlichen Sinne des Wortes, aber andererseits gab es wahrscheinlich gar kein Wort für das, was es war. Es war keine »Straße«, kein »Weg«, ja nicht einmal ein »Durchgang«. Strenggenommen sollte ein »Durchgang« ein längerer, begehbarer Zwischenraum mit einem Ein- und einem Ausgang sein, der einen, wenn man ihm folgt, irgendwohin führt. Unsere »Gasse« hatte aber weder Ein- noch Ausgang. Man konnte sie nicht einmal als Sackgasse bezeichnen: eine Sackgasse hat zumindest ein offenes Ende. Die Gasse war an beiden Enden zu. Die Leute des Viertels nannten sie nur in Ermangelung eines treffenderen Ausdrucks »die Gasse«. Sie war vielleicht zweihundert Meter lang und schlängelte sich zwischen den Gärten der Häuser hindurch, die sie an beiden Seiten säumten. Nirgendwo breiter als einen Meter, wies sie mehrere Stellen auf, an denen man sich seitwärts durchquetschen mußte, weil Zäune in den Weg hineinragten oder allerlei Gerümpel, das die Leute dorthin geworfen hatten, den Weg versperrte.
Von dieser Gasse erzählte man sich – ich hatte die Geschichte von meinem Onkel gehört, der uns unser Haus für einen lächerlich geringen Betrag vermietete –, sie sei ursprünglich an beiden Enden offen gewesen und habe tatsächlich als Verbindungsweg zwischen zwei Straßen gedient. Aber Mitte der fünfziger Jahre waren im Zuge des lebhaften Wirtschaftswachstums auf den leerstehenden Grundstükken beidseits des Durchgangs reihenweise neue Häuser entstanden und hatten diesen immer mehr zusammengedrückt, bis von ihm nicht viel mehr als ein schmaler Pfad übriggeblieben war. Den Leuten war es nicht recht, daß Fremde so nah an ihren Häusern und Gärten vorbeigingen, und so dauerte es nicht lange, bis ein Ende des Weges mit einem eher bescheidenen Zaun abgesperrt – oder besser gesagt, abgeschirmt wurde. Dann beschloß ein Anwohner, sein Grundstück zu erweitern, und riegelte sein Ende der Gasse mit einer Mauer aus Hohlblocksteinen ab. Gleichsam als Reaktion darauf entstand am entgegengesetzten Ende ein Stacheldrahtverhau, so daß nicht einmal mehr Hunde durchkamen. Keiner der Nachbarn beschwerte sich, da keiner von ihnen die Gasse als Durchgang benutzte und sich alle sogar über diesen zusätzlichen Schutz gegen Einbrecher freuten. So endete die Gasse als eine Art verlassener, ausgetrockneter Kanal: kaum mehr als eine Pufferzone zwischen zwei Häuserzeilen. Spinnen spannten im hohen Bewuchs ihre klebrigen Netze aus.
Warum hatte Kumiko einen solchen Ort aufgesucht? Ich selbst war diese »Gasse« lediglich zweimal abgegangen, und Kumiko fürchtete sich normalerweise vor Spinnen. Ach, zum Teufel – wenn Kumiko sagte, ich sollte auf die Gasse gehen und nach dem Kater suchen, dann würde ich eben auf die Gasse gehen und nach dem Kater suchen. Über alles weitere konnte ich nachdenken, wenn es soweit war. Ein paar Schritte im Freien zu tun war auf alle Fälle erheblich besser, als zu Haus herumzusitzen und darauf zu warten, daß das Telefon klingelte.
Der grelle frühsommerliche Sonnenschein übersprenkelte den Boden mit den harten Schatten der Äste, die sich über die Gasse reckten. So ohne Wind, der die Äste bewegt hätte, sahen die Schatten wie bleibende Verfärbungen aus, Muster, die sich unauslöschlich in das Pflaster eingezeichnet hatten. An diesen Ort schienen keinerlei Geräusche zu dringen. Fast konnte ich die Grashalme im Sonnenlicht atmen hören. Ein paar Wölkchen schwebten am Himmel, scharf und klar umrissen wie die Wolken auf mittelalterlichen Holzschnitten. Ich sah alles mit einer so unvorstellbaren Klarheit, daß sich mein Körper dagegen verschwommen und entgrenzt und flüssig anfühlte … und heiß!
Ich trug ein T-Shirt, eine dünne Baumwollhose und Tennisschuhe, aber wie ich so in der Sommersonne ging, spürte ich, daß sich unter meinen Achseln und in der Vertiefung meiner Brust ein dünner Schweißfilm bildete. T-Shirt und Hose waren in einem Karton voll Sommersachen eingepackt gewesen, und als ich sie am Morgen herausgeholt hatte, war mir der scharfe Geruch von Mottenkugeln in die Nase gestiegen.
Die Häuser, die die Gasse säumten, fielen unter zwei klar unterscheidbare Kategorien: ältere Häuser und solche, die in jüngerer Zeit gebaut worden waren. Insgesamt waren die neueren Häuser kleiner und hatten entsprechend kleinere Gärten. Oft ragten die Trockenstangen in die Gasse hinein, so daß ich gelegentlich gezwungen war, mich zwischen Vorhängen von Handtüchern und Laken und Unterhemden hindurchzuschlängeln. Über manche Gartenmauern drangen deutlich die Geräusche laufender Fernsehgeräte und Klosettspülungen und der Geruch köchelnder Currygerichte.
Die älteren Häuser dagegen erweckten kaum einen Eindruck von Bewohntsein. Sie waren durch wohlplazierte Sträucher und Hecken abgeschirmt, zwischen denen ich flüchtige Ausblicke auf gepflegte Gärten erhaschte.
In der Ecke eines Gartens stand ein alter, brauner, entnadelter Weihnachtsbaum. Ein anderes Grundstück war zur Enddeponie für alle nur erdenklichen Spielsachen geworden, offenbar die Überbleibsel verschiedener Kindheiten. Es gab Dreiräder und Wurfringe und Plastikschwerter, Gummibälle und Schildkrötenfiguren und kleine Baseballschläger. Ein Garten hatte einen Basketballkorb vorzuweisen und ein anderer einen Keramiktisch, um den schöne Gartenstühle gruppiert waren. Die weißen Stühle waren mit Schmutz überkrustet, als seien sie seit Monaten oder sogar Jahren nicht mehr benutzt worden. Die Tischplatte war mit lavendelfarbenen Magnolienblättern bedeckt, die der Regen niedergeschlagen hatte.
Durch eine Windfangtür aus Aluminium hatte ich einen guten Einblick in ein Wohnzimmer. Ich sah eine ledergepolsterte Sitzgarnitur, einen großen Fernseher, ein Sideboard (auf dem ein Aquarium mit tropischen Fischen und zwei nicht näher erkennbare Trophäen standen) und eine dekorative Stehlampe. Der Raum sah aus wie die Kulisse eines TV-Films. Ein großer Teil eines weiteren Gartens wurde von einer riesigen Hundehütte beansprucht, aber vom Hund selbst war nichts zu sehen, und die Tür der Hütte stand offen. Das Gitter der Tür war nach außen ausgebeult, als habe sich jemand monatelang dagegengelehnt.
Das leerstehende Haus, von dem Kumiko gesprochen hatte, kam direkt nach dem Grundstück mit der riesigen Hundehütte. Ein Blick genügte, um zu erkennen, daß es unbewohnt war – und das schon seit einiger Zeit. Es war ein zweigeschossiges, verhältnismäßig neues Gebäude, aber die Fensterläden sahen stark verwittert aus, und die Gitter an den Fenstern des ersten Stocks waren mit Roststellen übersät. Zum Haus gehörte ein heimeliger kleiner Garten, in dem tatsächlich die Steinplastik eines Vogels stand. Die Plastik ruhte auf einem brusthohen Sockel und war von dichtem Unkraut umgeben. Hohe Goldrautenstengel reichten bis fast an die Füße des Vogels. Das Tier – ich hatte keine Ahnung, was für eine Art Vogel es darstellen sollte – hatte die Flügel ausgebreitet, als wollte es diese ungastliche Stätte so schnell wie möglich hinter sich lassen. Abgesehen von der Statue war der Garten vollkommen schmucklos. An der Hausmauer stand ein Stapel von alternden Plastikgartenstühlen, und daneben trug ein Azaleenbusch seine Blüten zur Schau, deren leuchtend rote Farbe seltsam unwirklich aussah. Ansonsten überall Unkraut.
Ich lehnte mich gegen den brusthohen Maschendrahtzaun und betrachtete für eine Weile den Garten. Er hätte eigentlich ein wahres Paradies für Katzen sein müssen, aber momentan war von Katzen nichts zu sehen. Auf der Fernsehantenne hockte eine einsame Taube und untermalte die Szene mit ihrem eintönigen Ruf. Der Schatten des steinernen Vogels fiel auf das umgebende Unkraut und zersprang in tausend Scherben.
Ich holte ein Zitronenbonbon aus der Tasche, wickelte es aus und steckte es mir in den Mund. Ich hatte meine Kündigung zum Anlaß genommen, das Rauchen aufzugeben, dafür hatte ich jetzt immer eine Tüte Zitronenbonbons bei mir. Kumiko sagte, ich sei nach den Dingern süchtig und warnte mich, daß ich bald den Mund voll Karies haben würde, aber ich brauchte nun einmal meine Zitronenbonbons. Während ich dastand und den Garten betrachtete, setzte die Taube auf der Fernsehantenne ihr regelmäßiges Gegurre fort, wie ein Buchhalter, der ein Bündel Rechnungen abstempelt. Ich weiß nicht, wie lange ich so gegen den Zaun gelehnt dastand, aber ich erinnere mich, mein Zitronenbonbon auf den Boden gespuckt zu haben, als es mir, halb aufgelöst, den Mund mit seiner klebrigen Süße füllte. Ich hatte gerade den Blick auf den Schatten des Steinvogels gerichtet, als ich spürte, daß mich jemand von hinten anrief.
Ich drehte mich um und sah im Garten auf der anderen Seite der Gasse ein Mädchen stehen. Sie war klein und hatte das Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie trug eine dunkle Sonnenbrille mit bernsteinfarbener Fassung und ein hellblaues ärmelloses T-Shirt. Die Regenzeit war gerade erst vorbei, aber es war ihr gelungen, ihren schlanken Armen einen hübschen gleichmäßigen Goldton zu verschaffen. Sie hatte eine Hand in die Tasche ihrer Shorts gesteckt. Die andere ruhte auf dem Querstab eines hüfthohen Bambus-Törchens, das sicher keine allzu stabile Stütze abgab. Wir waren keinen Meter voneinander entfernt.
»Heiß«, sagte sie zu mir.
»Stimmt, ja«, antwortete ich.
Nach diesem kurzen Meinungsaustausch stand sie einfach so da und sah mich an. Dann holte sie eine Schachtel Hope ohne Filter aus der Hosentasche, zog eine Zigarette heraus und steckte sie sich zwischen die Lippen. Sie hatte einen kleinen Mund mit einer leicht aufgeworfenen Oberlippe. Sie riß ein Streichholz an und zündete sich die Zigarette an. Als sie den Kopf zur Seite neigte, schwang ihr Haar zurück und legte ein schön geformtes Ohr bloß, so glatt wie gerade erst gemacht, von einer flaumigen Lichtkontur umgeben.
Sie schnippte das Streichholz fort und stieß aus geschürzten Lippen Rauch hervor. Dann sah sie mich an, als habe sie in der Zwischenzeit vergessen, daß ich da war. Ihre Augen konnte ich durch die dunklen, spiegelnden Gläser ihrer Sonnenbrille nicht erkennen.
»Wohnen Sie hier in der Gegend?« fragte sie.
»M-hm.« Ich wollte in die Richtung unseres Hauses zeigen, aber ich hatte auf dem Weg hierher so oft die Richtung gewechselt, daß ich nicht mehr genau wußte, wo ich war; also deutete ich schließlich aufs Geratewohl.
»Ich suche meine Katze«, erklärte ich und wischte mir eine verschwitzte Handfläche an der Hose ab. »Sie ist seit einer Woche verschwunden. Jemand hat sie irgendwo hier gesehen.«
»Was ist das für eine Katze?«
»Ein großer Kater. Braun getigert. Schwanzspitze leicht gebogen.«
»Name?«
»Noboru. Noboru Wataya.«
»Nein, nicht Ihr Name. Der vom Kater.«
»Das ist der Name meines Katers.«
»Ah! Sehr eindrucksvoll!«
»Na ja, also eigentlich ist das der Name meines Schwagers. Der Kater erinnert uns irgendwie an ihn. Wir haben den Kater nach ihm getauft, nur zum Spaß.«
»Inwiefern erinnert Sie der Kater an ihn?«
»Ich weiß nicht. Nur so im allgemeinen. Seine Art zu gehen. Und er hat so einen ausdruckslosen Blick.«
Jetzt lächelte sie zum erstenmal, wodurch sie ein ganzes Stück kindlicher aussah, als sie anfangs gewirkt hatte. Sie konnte nicht älter als fünfzehn oder sechzehn sein. Durch ihre leichte Kräuselung beschrieb ihre Oberlippe eine seltsame Aufwärtskurve. Mir war, als hörte ich eine Stimme, »Berühren Sie mich« – die Stimme der Frau am Telefon. Ich wischte mir mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn.
»Ein braun getigerter Kater mit gebogenem Schwanz«, sagte das Mädchen. »Hmm. Hat er ein Halsband oder so?«
»Ein schwarzes Flohhalsband.«
Sie stand zehn oder fünfzehn Sekunden nachdenklich da, die Hand noch immer auf das Gartentor gestützt. Dann ließ sie die halb gerauchte Zigarette fallen und zertrat sie unter ihrer Sandale.
»Vielleicht habe ich wirklich eine solche Katze gesehen«, sagte sie. »Ob sie einen gebogenen Schwanz hatte, weiß ich nicht, aber es war eine braune Tigerkatze, groß, und ich glaube, sie hatte ein Halsband.«
»Wann hast du sie gesehen?«
»Ja, wann habe ich sie gesehen? Hmm. Höchstens drei, vier Tage her. Unser Garten ist so eine Art Durchgangsstraße für die Katzen der Umgegend. Sie ziehen hier alle durch, von den Takitanis rüber zu den Miyawakis.«
Sie deutete auf das unbewohnte Haus, wo der steinerne Vogel noch immer seine Flügel ausbreitete, die hochaufgeschossene Goldraute noch immer die Frühsommersonne einfing und die Taube auf der Fernsehantenne noch immer monoton vor sich hin gurrte.
»Ich hab eine Idee«, sagte sie. »Warum warten Sie nicht hier? Alle Katzen kommen früher oder später auf dem Weg zu den Miyawakis bei uns durch. Und wenn jemand Sie hier so herumlungern sieht, ruft er bestimmt noch die Bullen. Wär nicht das erste Mal.«
Ich zögerte.
»Keine Sorge«, sagte sie. »Außer mir ist niemand da. Wir können uns in die Sonne setzen und zusammen darauf warten, daß der Kater aufkreuzt. Ich werde Ihnen helfen. Ich hab ausgezeichnete Augen.«
Ich sah auf meine Uhr. Zwei Uhr sechsundzwanzig. Das einzige, was ich bis zum Dunkelwerden noch zu erledigen hatte, war, die Wäsche hereinzuholen und das Abendessen vorzubereiten.
Ich ging durch das Tor hinein und folgte dem Mädchen über den Rasen. Sie zog das rechte Bein leicht nach. Sie machte ein paar Schritte, blieb stehen und drehte sich nach mir um.
»Ich bin von einem Motorrad hinten aus dem Sattel geworfen worden«, sagte sie, als sei es kaum der Rede wert.
Dort, wo der Rasen endete, ragte eine große Eiche empor. Unter dem Baum standen zwei stoffbespannte Liegestühle. Auf einem von beiden war ein blaues Badetuch ausgebreitet, auf dem anderen lagen eine unangebrochene Schachtel Hope ohne, ein Aschenbecher und Feuerzeug, eine Zeitschrift und ein riesiger Ghetto-Blaster. Der Ghetto-Blaster spielte in niedriger Lautstärke Hardrock. Sie schaltete die Musik aus und räumte den Liegestuhl für mich frei, indem sie alles ins Gras fallen ließ. Vom Liegestuhl aus konnte ich in den Garten des leerstehenden Hauses sehen – auf den steinernen Vogel, die Goldraute, den Maschendrahtzaun. Das Mädchen hatte mich wahrscheinlich, so lang ich dagewesen war, beobachtet.
Der Garten dieses Hauses war sehr groß. Er hatte einen breiten, abschüssigen Rasen, auf dem verstreut Gruppen von Bäumen standen. Links von den Liegestühlen bot ein ziemlich großer, betonierter Teich seinen leeren Bauch der prallen Sonne dar. Nach der grünlichen Färbung des Betons zu urteilen, war schon seit einiger Zeit kein Wasser mehr darin gewesen. Wir saßen mit dem Rücken zum Haus, das durch eine Zeile von Bäumen hindurchsah. Das Haus war weder groß noch besonders aufwendig gebaut. Nur der Garten vermittelte einen Eindruck von Größe, und er war sehr gepflegt.
»Was für ein großer Garten«, sagte ich, während ich mich umsah. »Muß ganz schöne Mühe machen, ihn in Ordnung zu halten.«
»Muß wohl.«
»Als Junge habe ich für eine Gärtnerei gearbeitet, Rasen gemäht.«
»Ah ja?« Sie interessierte sich offenbar nicht für Rasen.
»Bist du hier immer allein?« fragte ich.
»Ja. Immer. Außer morgens und abends, da kommt ein Dienstmädchen. Tagsüber bin nur ich da. Allein. Möchten Sie was Kaltes zu trinken? Wir haben Bier.«
»Nein, danke.«
»Wirklich nicht? Nur keine Hemmungen.«
Ich schüttelte den Kopf. »Gehst du nicht zur Schule?«
»Gehen Sie nicht arbeiten?«
»Hab keine Arbeit.«
»Job verloren?«
»So ungefähr. Ich hab vor ein paar Wochen gekündigt.«
»Was war das für ein Job?«
»Ich war Laufbursche in einer Anwaltskanzlei. Ich mußte Dokumente von verschiedenen Behörden holen, Material ordnen, nach Präzedenzfällen suchen, Prozesse vorbereiten – solche Sachen eben.«
»Aber Sie haben gekündigt.«
»Ja.«
»Hat Ihre Frau einen Job?«
»Hat sie.«
Die Taube von gegenüber hatte offenbar ihr Gegurre eingestellt und sich anderswohin verfügt. Plötzlich merkte ich, daß mich tiefe Stille umgab.
»Direkt da drüben ist die Stelle, wo die Katzen durchziehen«, sagte sie und deutete zum Rand des Rasens. »Sehen Sie den Müllverbrenner im Garten der Takitanis? Sie kommen an der Stelle unter dem Zaun durch, laufen durchs Gras, unter dem Tor raus und dann über den Weg zum Garten gegenüber. Sie nehmen immer dieselbe Route.«
Sie schob sich die Sonnenbrille in die Stirn, spähte aus zusammengekniffenen Augen über den Rasen hinweg, nahm dann die Brille wieder herunter und stieß dabei eine Rauchwolke aus. In der Zwischenzeit sah ich, daß sie neben dem linken Auge eine Schnittwunde von vielleicht fünf Zentimetern Länge hatte – eine Wunde, die wahrscheinlich eine bleibende Narbe hinterlassen würde. Die dunkle Sonnenbrille hatte wahrscheinlich den Zweck, die Verletzung zu verbergen. Das Gesicht des Mädchens war nicht eigentlich schön, aber es hatte etwas Anziehendes, wahrscheinlich durch die lebhaften Augen und die ungewöhnliche Form der Lippen.
»Haben Sie schon von den Miyawakis gehört?« fragte sie.
»Nein, nichts«, sagte ich.
»Das sind die, die früher in dem leerstehenden Haus wohnten. Eine sehr noble Familie. Sie hatten zwei Töchter, beide in einer privaten Mädchenschule. Herr Miyawaki war Besitzer von ein paar Familienrestaurants.«
»Warum sind sie ausgezogen?«
»Vielleicht hatte er Schulden. Es sah fast so aus, als würden sie weglaufen – haben sich eines Nachts einfach davongeschlichen. Vor ungefähr einem Jahr, würd ich sagen. Haben das Feld geräumt und das Haus dem Schimmel und den Katzen überlassen. Meine Mutter beklagt sich andauernd.«
»Sind da drüben wirklich so viele Katzen?«
Die Zigarette zwischen den Lippen, hob das Mädchen die Augen zum Himmel.
»Von jeder Sorte. Welche mit Haarausfall, welche mit nur einem Auge … und da, wo das andere Auge war, einem Klumpen von blutigem Fleisch. Kotz!«
Ich nickte.
»Ich hab eine Verwandte, die sechs Finger an jeder Hand hat. Sie ist nur ein bißchen älter als ich. Neben dem kleinen Finger hat sie noch so ein Extradings, wie einen Babyfinger. Sie kann ihn aber so weggeklappt halten, daß die meisten Leute gar nichts davon merken. Sie ist wirklich hübsch.«
Ich nickte wieder.
»Glauben Sie, das liegt in der Familie? Daß es, wie sagt man … zur Abstammung gehört?«
»Ich weiß nicht viel über Erbanlagen.«
Sie hörte auf zu reden. Ich lutschte an meinem Zitronenbonbon und starrte unverwandt auf den Katzenpfad. Bislang hatte sich nicht eine einzige Katze blicken lassen.
»Wollen Sie wirklich nichts trinken?« fragte sie. »Ich hole mir eine Coke.«
Ich sagte, ich hätte keinen Durst.
Sie stand von ihrem Liegestuhl auf und verschwand, ihr schlimmes Bein leicht nachziehend, zwischen den Bäumen. Ich hob ihre Zeitschrift vom Gras auf und blätterte ein wenig darin herum. Zu meiner großen Überraschung sah ich, daß es ein Herrenmagazin war, eins von den Hochglanz-Monatsheften. Die Frau auf dem Aufklappfoto trug ein dünnes Höschen, durch das man den Schlitz und die Schamhaare sah. Sie saß auf einem Hocker und hielt die Beine in einem abenteuerlichen Winkel gespreizt. Seufzend legte ich das Heft zurück, verschränkte die Hände auf der Brust und konzentrierte mich wieder auf den Katzenpfad.
Es verging sehr viel Zeit, bis das Mädchen, mit einer Coke in der Hand, zurückkam. Die Hitze machte mir allmählich zu schaffen. So in der prallen Sonne, spürte ich, wie mein Gehirn zunehmend eintrübte. Das letzte, wozu ich jetzt Lust hatte, war nachzudenken.
»Sagen Sie mir eins«, nahm sie ihr Geplauder von vorhin wieder auf. »Wenn Sie in ein Mädchen verliebt wären und es stellte sich raus, daß sie sechs Finger hat, was würden Sie tun?«
»Sie an den Zirkus verkaufen«, antwortete ich.
»Ernsthaft?«
»Nein, natürlich nicht«, sagte ich. »Das sollte ein Witz sein. Ich glaube nicht, daß mich das stören würde.«
»Selbst wenn Ihre Kinder das erben könnten?«
Ich dachte einen Augenblick darüber nach.
»Nein, ich glaube wirklich nicht, daß mich das stören würde. Was würde ein Extrafinger schon ausmachen?«
»Und was, wenn sie vier Brüste hätte?«
Auch darüber dachte ich kurz nach.
»Ich weiß nicht.«
Vier Brüste? Das konnte ja ewig so weitergehen. Ich beschloß, das Thema zu wechseln.
»Wie alt bist du?« fragte ich.
»Sechzehn«, sagte sie. »Gerade geworden. Erstes Jahr Oberschule.«
»Fehlst du da schon lange?«
»Wenn ich zuviel laufe, tut mir das Bein weh. Und ich habe diese Narbe am Auge. Meine Schule ist sehr streng. Die würden wahrscheinlich ganz schön nerven, wenn sie herausbekämen, daß ich vom Motorrad gefallen bin. Also bin ich einfach ›krank‹. Ich könnte ein ganzes Jahr aussetzen. Ich hab’s nicht eilig, in die nächste Klasse zu kommen.«
»Kann ich mir vorstellen«, sagte ich.
»Aber was Sie vorhin gesagt haben, daß Sie nichts dagegen hätten, ein Mädchen mit sechs Fingern zu heiraten, aber eins mit vier Brüsten schon …«
»Das habe ich nicht gesagt. Ich hab gesagt, ich weiß es nicht.«
»Warum wissen Sie’s nicht?«
»Ich weiß nicht – es ist schwer, sich so was vorzustellen.«
»Können Sie sich jemand mit sechs Fingern vorstellen?«
»Klar, ich denk schon.«
»Also warum nicht mit vier Brüsten? Wo ist da der Unterschied?«
Ich dachte wieder einen Augenblick darüber nach, aber mir fiel keine Antwort ein.
»Stelle ich zu viele Fragen?«
»Sagen das die Leute zu dir?«
»Ja, manchmal.«
Ich wandte mich wieder zum Katzenpfad. Was zum Teufel hatte ich hier eigentlich verloren? Während der ganzen Zeit hatte sich nicht eine Katze blicken lassen. Die Hände noch immer auf der Brust verschränkt, machte ich die Augen für vielleicht dreißig Sekunden zu. Ich spürte, wie sich an verschiedenen Stellen meines Körpers Schweiß bildete. Die Sonne ergoß sich in mich mit einer seltsamen Schwere. Jedesmal, wenn das Mädchen ihr Glas bewegte, klirrte das Eis darin wie eine Kuhglocke.
»Schlafen Sie ruhig, wenn Sie möchten«, flüsterte sie. »Ich weck Sie, wenn eine Katze aufkreuzt.«
Ohne die Augen zu öffnen, nickte ich schweigend.
Die Luft stand. Es war vollkommen still. Die Taube war längst verschwunden. Ich mußte unentwegt an die Frau am Telefon denken. Kannte ich sie wirklich? Weder ihre Stimme noch ihre Art zu sprechen hatten sich im entferntesten vertraut angehört. Aber daß sie mich kannte, stand außer Zweifel. Es hätte genausogut eine Szene von De Chirico sein können: der lange Schatten der Frau, der sich quer über eine leere Straße legte und sich mir entgegenreckte, aber die Frau selbst ganz woanders, an einem Ort weit jenseits der Grenzen meines Bewußtseins. Eine Glocke läutete und läutete unaufhörlich neben meinem Ohr.
»Schlafen Sie?« fragte das Mädchen mit einem so winzigen Stimmchen, daß ich nicht sicher war, ob ich es auch wirklich hörte.
»Nein, ich schlafe nicht«, sagte ich.
»Kann ich näher ran? Es ist … einfacher, wenn ich weiter so leise spreche.«
»Mir recht«, sagte ich, die Augen noch immer geschlossen.
Sie rückte ihren Liegestuhl näher, bis er mit einem trockenen hölzernen Klack gegen meinen stieß.
Merkwürdig, die Stimme des Mädchens klang völlig verschieden, je nachdem ob ich die Augen offen oder geschlossen hatte.
»Kann ich reden? Ich bin ganz leise, und Sie brauchen nicht zu antworten. Sie dürfen sogar einschlafen. Das stört mich nicht.«
»Okay«, sagte ich.
»Wenn Leute sterben, das ist schick.«
Ihr Mund war jetzt dicht neben meinem Ohr, so daß die Worte sich zusammen mit ihrem warmen, feuchten Atem in mich einschlichen.
»Wieso das?« fragte ich.
Sie legte mir einen Finger auf die Lippen, wie um sie zu versiegeln.
»Keine Fragen«, sagte sie. »Und die Augen zulassen. Okay?«
Mein Nicken war so sparsam wie ihre Stimme.
Sie nahm den Finger von meinen Lippen und legte ihn auf mein Handgelenk.
»Ich wollte, ich hätte ein Skalpell. Ich würde das Ding aufschneiden und reingukken. Nicht die Leiche … den Klumpen Tod. Es muß bestimmt so was geben. Etwas Rundes und Glibbriges, wie ein Softball, mit einem harten kleinen Kern von toten Nerven. Ich möchte das aus einem Toten rausholen und aufschneiden und reingucken. Ich frag mich immer, wie es wohl aussieht. Vielleicht ist es ganz hart, wie Zahnpasta, die in der Tube eingetrocknet ist. So muß es sein, meinen Sie nicht? Nein, nicht antworten. Es ist an der Außenseite glibbrig, und je tiefer man kommt, desto härter wird es. Ich möchte die Haut aufschneiden und das glibbrige Zeug rausholen, mich mit einem Skalpell und so was wie einem Spatel durcharbeiten, und je näher man an das Zentrum kommt, desto härter wird das Glibberzeugs, bis man diesen winzigen Kern erreicht. Er ist sooo winzig, wie eine kleine Kugellagerkugel, und richtig hart. So muß er sein, meinen Sie nicht?«
Sie räusperte sich ein paarmal.
»Ich denke neuerdings an nichts anderes. Muß daran liegen, daß ich jeden Tag so viel Zeit totzuschlagen habe. Wenn man nichts zu tun hat, kriegt man auf die Dauer richtig unheimlich abgefahrene Gedanken – so abgefahren, daß man ihnen gar nicht bis zu Ende folgen kann.«
Sie nahm den Finger von meinem Handgelenk und trank den Rest ihrer Cola aus. Am Klang der Eiswürfel erkannte ich, daß das Glas leer war.
»Machen Sie sich keine Gedanken wegen des Katers – ich halt nach ihm Ausschau. Ich sag’s Ihnen schon, wenn Noboru Wataya aufkreuzt. Lassen Sie die Augen zu. Ich bin sicher, daß Noboru Wataya hier irgendwo in der Gegend herumspaziert. Er wird jeden Augenblick hier sein. Er ist schon auf dem Weg hierher. Ich weiß, daß er schon auf dem Weg ist: durch das Gras, unter dem Zaun durch, kleine Pause hier und da, um an den Blumen zu schnuppern – langsam, aber sicher kommt Noboru Wataya immer näher. Denken Sie so an ihn, stellen Sie ihn sich so vor.«
Ich versuchte, mir den Kater bildlich vorzustellen, aber das Beste, was ich zustande brachte, war eine verschwommene Gegenlichtaufnahme. Das Sonnenlicht, das durch meine Augenlider drang, verwirrte und verwischte meine innere Dunkelheit, was es mir unmöglich machte, eine genaue Vorstellung des Katers heraufzubeschwören. Was ich statt dessen produzierte, war ein mißglücktes Portrait, eine seltsame, verzerrte Kollage, die in bestimmten Details eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Original aufwies, an der aber die wichtigsten Merkmale fehlten. Ich konnte mir nicht einmal vergegenwärtigen, wie der Kater aussah, wenn er ging.
Das Mädchen legte wieder den Finger auf mein Handgelenk und zeichnete mit der Spitze ein seltsames Diagramm von unklarer Form. Gleichsam als Reaktion darauf begann sich eine neuartige – von der Dunkelheit, die ich bis zu diesem Moment gewahrt hatte, qualitativ verschiedene – Finsternis in mein Bewußtsein zu graben. Ich war wahrscheinlich am Einschlafen; ich wollte es nicht, aber ich konnte mich in keiner Weise dagegen wehren. Mein Körper fühlte sich wie ein Leichnam an – der Leichnam eines anderen –, der in der Stoffbespannung des Liegestuhls versank.
In der Finsternis sah ich die vier Beine Noboru Watayas, vier lautlose braune Beine auf vier weichen Pfoten mit schwellenden gummiartigen Ballen, Beine, die unhörbar irgendwo die Erde beschritten.
Aber wo?
»Zehn Minuten, länger wird’s nicht dauern«, sagte die Frau am Telefon. Nein, sie mußte sich irren. Manchmal sind zehn Minuten keine zehn Minuten. Sie können sich in die Länge ziehen oder zusammenschrumpfen. Das wußte ich ganz sicher.
Als ich aufwachte, war ich allein. Das Mädchen war verschwunden. Ihr Liegestuhl berührte noch immer meinen; das Handtuch und die Zigaretten und das Magazin lagen noch da, aber das Glas und der Ghetto-Blaster waren weg.
Die Sonne stand jetzt schon im Westen, und der Schatten eines Astes der Eiche war mir über die Knie gekrochen. Meine Uhr zeigte Viertel nach vier. Ich richtete mich auf und sah mich um. Breiter Rasen, trockener Teich, Zaun, steinerner Vogel, Goldraute, Fernsehantenne. Vom Kater weiterhin keine Spur. Ebensowenig vom Mädchen.
Ich richtete die Augen auf den Katzenpfad und wartete darauf, daß das Mädchen wiederkäme. Zehn Minuten verstrichen, und weder der Kater noch das Mädchen ließen sich blicken. Nichts rührte sich. Ich hatte das Gefühl, während des Schlafes entsetzlich gealtert zu sein.
Ich stand auf und sah zum Haus hinüber, aber nichts deutete auf die Anwesenheit von Menschen hin. Das Giebelfenster reflektierte den Glanz der westlichen Sonne. Ich gab es auf zu warten und ging über den Rasen zurück auf die Gasse und machte mich auf den Heimweg. Ich hatte den Kater nicht gefunden, aber ich hatte getan, was ich konnte.
Zu Hause holte ich die Wäsche herein und bereitete ein einfaches Abendessen vor. Um halb sechs klingelte das Telefon zwölfmal, aber ich nahm nicht ab. Noch lange nachdem das Klingeln verstummt war, hielt sich der Klang der Glocke im abendlichen Düster des Zimmers wie in der Luft schwebender Staub. Mit den Spitzen ihrer harten Krallen klickte die Tischuhr auf ein durchsichtiges Brett, das im Raum schwebte.
Warum konnte ich nicht ein Gedicht über den Aufziehvogel schreiben? Die Idee sagte mir zu, aber die erste Zeile wollte und wollte nicht kommen. Wie hätte auch ein Gedicht über einen Aufziehvogel Oberschülerinnen gefallen können?
Kumiko kam erst um halb acht nach Haus. Seit einem Monat kam sie immer später und später. Es war keine Seltenheit, daß es nach acht, manchmal sogar nach zehn wurde. Jetzt, wo ich zu Hause war und das Essen vorbereitete, brauchte sie sich nicht mehr so zu beeilen. Sie hatten sowieso zuwenig Mitarbeiter, und vor kurzem hatte sich einer ihrer Kollegen auch noch krank gemeldet.
»Tut mir leid«, sagte sie. »Die Arbeit wurde einfach nicht fertig, und dieses Teilzeitmädchen ist absolut unbrauchbar.«
Ich ging in die Küche und machte mich ans Kochen: in Butter sautierten Fisch, Salat und Miso-Suppe. Kumiko saß am Küchentisch und relaxte.
»Wo warst du um halb sechs?« fragte sie. »Ich hab versucht, dich anzurufen, um zu sagen, daß es spät werden würde.«
»Die Butter war alle. Ich bin noch rasch in den Laden gegangen«, log ich.
»Warst du auf der Bank?«
»Klar.«
»Und der Kater?«
»Hab ihn nicht gefunden. Ich bin zum leerstehenden Haus gegangen, wie du gesagt hattest, aber da war keine Spur von ihm zu sehen. Ich wette, er ist noch weiter gelaufen.«
Sie sagte nichts.
Als ich nach der abendlichen Dusche aus dem Badezimmer herauskam, saß Kumiko bei ausgeschaltetem Licht im Wohnzimmer. So im Dunkeln zusammengekauert, sah sie in ihrem grauen Hemd wie ein Gepäckstück aus, das man am falschen Ort abgestellt hatte.
Ich setzte mich Kumiko gegenüber auf das Sofa und frottierte mir mit einem Handtuch die nassen Haare.
Mit kaum hörbarer Stimme sagte sie: »Ich bin sicher, der Kater ist tot.«
»Sei nicht albern«, erwiderte ich. »Ich bin sicher, der amüsiert sich irgendwo königlich. Sobald er Hunger hat, kommt er wieder nach Hause. Das ist doch schon mal passiert, weißt du noch? Als wir in Koenji wohnten …«
»Diesmal ist es anders«, sagte sie. »Diesmal irrst du dich. Ich weiß es. Der Kater ist tot. Er verwest irgendwo in einem Grastuff. Hast du dich auf dem Grundstück auch genau umgesehen?«
»Nein. Das Haus mag leer stehen, aber es gehört irgend jemandem. Ich kann da nicht einfach reinspazieren.«
»Wo hast du dann nach dem Kater gesucht? Ich wette, du hast es nicht mal versucht. Deswegen hast du ihn nicht gefunden.«
Ich seufzte und rubbelte mir wieder das Haar mit dem Handtuch. Ich wollte etwas sagen, aber dann merkte ich, daß Kumiko weinte. Das war verständlich: Kumiko liebte den Kater. Er war seit kurz nach unserer Heirat bei uns gewesen. Ich warf mein Handtuch im Bad in den Wäschekorb und ging dann in die Küche, um mir ein kaltes Bier zu holen. Was für ein idiotischer Tag das gewesen war – ein idiotischer Tag eines idiotischen Monats eines idiotischen Jahres.
Noboru Wataya, wo bist du? Hat der Aufziehvogel vergessen, dich aufzuziehen?
Die Worte kamen mir wie Zeilen eines Gedichts in den Sinn.
Noboru Wataya,
Wo bist du?
Hat der Aufziehvogel vergessen,
Dich aufzuziehn?
Ich hatte mein Bier zur Hälfte ausgetrunken, als das Telefon zu klingeln anfing.
»Nimmst du ab?« rief ich in die Dunkelheit des Wohnzimmers.
»Ich nicht«, sagte sie. »Nimm du ab.«
»Ich hab keine Lust.«
Das Telefon klingelte immer weiter, rührte den Staub auf, der in der Dunkelheit schwebte. Keiner von uns beiden sagte ein Wort. Ich trank mein Bier, und Kumiko weinte lautlos weiter. Ich zählte zwanzig Klingelzeichen und gab es dann auf. Es hatte keinen Sinn, ewig weiterzuzählen.
2
VOLLMOND UND SONNENFINSTERNIS VON PFERDEN, DIE IN DEN STÄLLEN STERBEN
Und ist es für einen Menschen überhaupt möglich, einen anderen vollkommen zu verstehen?
Wir können unendlich viel Zeit und Energie in den ernsthaften Versuch investieren, einen anderen Menschen kennenzulernen, aber wie weit können wir uns dessen innerstem Wesen, dessen Essenz letzten Endes nähern? Wir reden uns ein, den anderen gut zu kennen, aber wissen wir wirklich – von wem auch immer – etwas, was von Bedeutung wäre?
Eine Woche, nachdem ich meine Stelle in der Anwaltskanzlei aufgegeben hatte, fing ich an, ernsthaft über solche Dinge nachzudenken. Bis dahin hatte ich mich niemals – mein ganzes Leben lang nicht – mit derlei Fragen beschäftigt. Und warum nicht? Wahrscheinlich, weil ich schon alle Hände voll damit zu tun gehabt hatte zu leben. Ich war einfach zu beschäftigt gewesen, um über mich selbst nachzudenken.
Der Auslöser war ein triviales Ereignis, wie eben die meisten wichtigen Dinge auf der Welt geringfügige Anfänge haben. Eines Morgens, nachdem Kumiko, wie an jedem Arbeitstag, das Frühstück hinuntergeschlungen hatte und aus dem Haus gehetzt war, steckte ich die Wäsche in die Waschmaschine, machte das Bett, spülte das Geschirr und ging mit dem Staubsauger durch die Wohnung. Dann setzte ich mich mit dem Kater auf die Veranda und sah die Stelleninserate und die Sonderangebote durch. Als es Mittag wurde, aß ich und ging dann zum Supermarkt. Dort kaufte ich Lebensmittel für das Abendessen und, aus einem Regal mit Sonderangeboten, Waschmittel, Reinigungstücher und Toilettenpapier. Wieder zu Hause, bereitete ich das Abendessen vor und legte mich dann, bis Kumiko zurückkäme, mit einem Buch auf das Sofa.
Neuerdings ohne Anstellung, fand ich dieses Leben durchaus erfrischend. Nicht mehr in überfüllten U-Bahn-Zügen pendeln müssen, keine Leute mehr sehen müssen, die ich nicht sehen wollte. Und das Allerbeste war, ich konnte jedes mir passende Buch lesen, wann immer ich wollte. Ich hatte keine Ahnung, wie lange dieses entspannte Leben so weitergehen würde, aber einstweilen wenigstens, nach der ersten Woche, genoß ich es, und ich gab mir alle Mühe, nicht an die Zukunft zu denken. Dies war der einzige richtige, große Urlaub meines Lebens. Irgendwann mußte er zwangsläufig zu Ende gehen, aber bis dahin war ich fest entschlossen, ihn zu genießen.
An diesem bestimmten Abend gelang es mir allerdings nicht, mich ganz der Freude des Lesens hinzugeben, weil Kumiko sich verspätete. Sie war früher nie später als halb sieben von der Arbeit zurückgekommen, und wenn sie voraussah, daß es auch nur zehn Minuten später werden würde, informierte sie mich immer rechtzeitig. So war sie eben: fast zu gewissenhaft. Aber dieser Tag war eine Ausnahme. Sie war nach sieben noch immer nicht da, und es kam auch kein Anruf. Das Fleisch und die Gemüse waren so weit fertig, daß ich mich in dem Augenblick, da Kumiko nach Haus kam, ans Kochen machen konnte. Nicht, daß ich ein besonders lukullisches Mahl geplant hätte: Ich würde dünne Scheibchen Rindfleisch mit Zwiebeln, grünen Paprikas und Sojabohnensprossen anbraten, leicht salzen, pfeffern und mit Sojasoße und einem Schluck Bier ablöschen – ein Rezept aus meiner Junggesellenzeit. Der Reis war gar, die Miso-Suppe war warm, und die Gemüse waren geschnitten und in verschiedenen Häufchen auf einem großen Teller angerichtet, bereit für den Wok. Es fehlte nur noch Kumiko. Ich war hungrig genug, um mit dem Gedanken zu spielen, mir meine eigene Portion zu kochen und allein zu essen, aber so weit wollte ich denn doch nicht gehen. Es wäre einfach nicht anständig gewesen.
Ich saß am Küchentisch, nippte an einem Bier und knabberte ein paar leicht angeweichte Kräcker, die ich ganz hinten im Schrank gefunden hatte. Ich sah dem kleinen Zeiger der Uhr zu, wie er auf die Halbachtstellung zukroch und sie dann langsam hinter sich ließ.
Es war nach neun, als sie endlich ankam. Sie sah erschöpft aus. Ihre Augen waren blutunterlaufen: ein schlechtes Zeichen. Wenn sie rote Augen hatte, war immer etwas Schlimmes passiert.
Okay, sagte ich zu mir, bleib cool, mach kein Aufhebens und keine Szenen. Reg dich nicht auf.
»Es tut mir furchtbar leid«, sagte Kumiko. »Mit der Arbeit war es heute wie verhext. Ich wollte dich anrufen, aber ständig ist etwas anderes dazwischengekommen.«
»Macht nichts, ist schon in Ordnung, mach dir nichts draus«, sagte ich, so leichthin wie möglich. Und ich nahm es ihr auch wirklich nicht übel. Ich hatte es schon oft genug selbst erlebt. Arbeiten gehen kann ganz schön hart sein – es ist etwas grundlegend anderes, als zwei Straßen weiter zu gehen, um einer kranken Großmutter die schönste Rose aus dem Garten zu bringen und ihr bis zum Abend Gesellschaft zu leisten. Manchmal muß man mit unangenehmen Leuten unerfreuliche Dinge tun und kommt wirklich beim besten Willen nicht dazu, zu Hause anzurufen. Es würde nicht mehr als dreißig Sekunden erfordern zu sagen: »Heute komme ich später«, und es stehen überall Telefone herum, aber man schafft es einfach nicht.
Ich machte mich ans Kochen: schaltete den Gasherd ein, goß Öl in den Wok. Kumiko nahm sich ein Bier aus dem Kühlschrank und ein Glas aus dem Regal, warf einen kurzen prüfenden Blick auf die Dinge, die ich gleich in die Pfanne schütten würde, und setzte sich wortlos an den Küchentisch. Ihrer Miene nach zu urteilen, schmeckte ihr das Bier nicht.
»Du hättest ohne mich essen sollen«, sagte sie.
»Schon gut. Ich war nicht so hungrig.«
Während ich das Fleisch und das Gemüse anbriet, ging Kumiko sich frischmachen. Ich hörte, wie sie sich das Gesicht wusch und die Zähne putzte. Als sie kurz darauf aus dem Badezimmer kam, hielt sie etwas in der Hand. Es waren das Toilettenpapier und die Papiertücher, die ich im Supermarkt gekauft hatte.
»Warum hast du denn das Zeug gekauft?« fragte sie in entnervtem Ton.
Den Wok in der Hand, sah ich sie an. Dann sah ich auf die Schachtel mit den Tüchern und die Packung Toilettenpapier. Ich hatte nicht die blasseste Ahnung, worauf sie hinauswollte.
»Wieso? Das sind Papiertücher und Klopapier. Wir brauchen die Sachen. Nicht unbedingt sofort, aber sie werden schon nicht verschimmeln, wenn sie ein Weilchen herumstehen.«
»Nein, natürlich nicht. Aber warum mußtest du unbedingt blaue Tücher und geblümtes Klopapier kaufen?«
»Ich kann dir nicht ganz folgen«, sagte ich und bemühte mich, ruhig zu bleiben. »Sie waren im Angebot. Von blauen Papiertüchern wirst du schon keine blaue Nase kriegen. Wo ist das Problem?«
»Es ist ein Problem. Ich hasse blaue Papiertücher und geblümtes Klopapier. Wußtest du das nicht?«
»Nein, wußte ich nicht«, sagte ich. »Warum haßt du sie denn?«
»Woher soll ich denn wissen, warum ich sie hasse? Ich tu’s eben. Du haßt Telefonschoner und Thermosflaschen mit Blümchenmuster und Bellbottom-Jeans mit Nieten, und wenn ich mir die Nägel maniküren lasse. Du kannst genausowenig sagen, warum. Es ist einfach eine Frage des Geschmacks.«
Zufällig hätte ich ihr durchaus meine Gründe für jede dieser Abneigungen auseinandersetzen können, aber natürlich tat ich es nicht. »Na gut«, sagte ich. »Es ist einfach eine Frage des Geschmacks. Aber willst du mir etwa sagen, du hättest in den sechs Jahren unserer Ehre nicht ein einziges Mal blaue Papiertücher oder geblümtes Klopapier gekauft?«
»Niemals. Nicht ein Mal.«
»Wirklich?«
»Ja, wirklich. Die Reinigungstücher, die ich kaufe, sind entweder weiß oder gelb oder rosa. Und ich kaufe absolut nie gemustertes Klopapier. Ich finde es schlicht erschütternd, daß du so lange mit mir zusammenleben kannst, ohne das zu wissen.«
Ich war nicht minder erschüttert, erfahren zu müssen, daß ich in sechs langen Jahren kein einziges Mal blaue Papiertücher oder geblümtes Klosettpapier benutzt hatte.
»Und wo wir schon dabei sind, will ich dir noch eins sagen«, fuhr sie fort. »Ich verabscheue pfannengerührtes Rindfleisch mit grünen Paprikaschoten. Wußtest du das?«
»Nein, das ist mir neu«, sagte ich.
»Nun, es ist aber so. Und frag mich nicht, warum. Ich kann den Geruch der beiden Dinge, die zusammen in derselben Pfanne braten, einfach nicht ausstehen.«
»Willst du damit sagen, daß du in sechs Jahren kein einziges Mal Rindfleisch und grüne Paprikas zusammen gekocht hast?«
Sie schüttelte den Kopf. »Grüne Paprikas esse ich im Salat. Rind brate ich mit Zwiebeln. Aber ich habe noch niemals Rindfleisch und grüne Paprikas zusammen in einem Topf zubereitet.«
Ich stieß einen tiefen Seufzer aus.
»Hast du dich nie darüber gewundert?« fragte sie.
»Darüber gewundert? Es ist mir überhaupt nie aufgefallen«, sagte ich und dachte einen Augenblick lang nach, ob ich seit unserer Heirat nicht doch wenigstens einmal etwas Pfannengerührtes mit Rindfleisch und grünen Paprikaschoten gegessen hatte. Natürlich konnte ich mich unmöglich daran erinnern.
»Du lebst schon so lange mit mir zusammen«, sagte sie, »aber du nimmst mich kaum wahr. Der einzige Mensch, an den du jemals denkst, bist du.«
»Also jetzt Moment mal«, sagte ich, schaltete das Gas aus und stellte den Wok auf dem Herd ab. »Laß uns jetzt bitte nicht übertreiben. Vielleicht hast du recht. Vielleicht habe ich Dingen wie Papiertaschentüchern und Klopapier und Rindfleisch und grünen Paprikaschoten bislang wirklich nicht genügend Beachtung geschenkt. Aber das bedeutet noch lange nicht, daß ich dich nicht wahrgenommen hätte. Es ist mir absolut scheiß-egal, welche Farbe meine Papiertücher haben. Schön, mit schwarzen hätte ich wohl gewisse Probleme, aber weiß, blau – es spielt einfach keine Rolle. Das gleiche mit Rind und grünen Paprikas. Zusammen, getrennt, wen schert’s? Der Akt des Pfannenrührens von Rindfleisch und grünen Paprikas könnte vom Antlitz der Erde verschwinden, und es wäre mir egal. Es hat nichts mit dir zu tun, mit deiner Essenz, mit Kumikos Kumiko-Sein. Oder habe ich unrecht?«
Anstatt mir zu antworten, putzte sie ihr Bier in zwei langen Zügen weg und starrte die leere Flasche an.
Ich kippte den Inhalt des Wok in den Mülleimer. Soviel zum Thema Rindfleisch und grüne Paprikas und Zwiebeln und Sojasprossen. Absurd. Nahrung in der einen Minute, Abfall in der nächsten. Ich machte ein Bier auf und trank aus der Flasche.
»Warum hast du das getan?« fragte sie.
»Wenn es dir so zuwider ist –«
»Du hättest es doch essen können.«
»Auf einmal war mir nicht mehr nach Rindfleisch mit grünen Paprikas.«
Sie zuckte die Achseln. »Ganz wie du möchtest.«
Sie legte die Arme auf den Tisch und vergrub ihr Gesicht darin. Eine Zeitlang blieb sie so sitzen. Ich konnte sehen, daß sie nicht weinte und auch nicht schlief. Ich warf einen Blick auf den leeren Wok, der auf dem Herd stand, warf einen Blick auf Kumiko und trank mein Bier aus. Verrückt. Wen scheren Klopapier und grüne Paprikas?
Aber ich ging hinüber und legte ihr die Hand auf die Schulter. »Okay«, sagte ich. »Jetzt verstehe ich. Ich werde nie wieder blaue Papiertücher oder geblümtes Klopapier kaufen. Versprochen. Ich werde das Zeug morgen zum Supermarkt zurückbringen und es umtauschen. Wenn sie es mir nicht umtauschen wollen, werde ich es im Garten verbrennen. Ich werde die Asche ins Meer streuen. Und nie wieder Rindfleisch mit grünen Paprikas. Nie wieder. Der Geruch ist bald verflogen, und wir brauchen nie wieder daran zu denken. Okay?«
Aber sie sagte noch immer nichts. Ich wäre am liebsten ein Stündchen spazierengegangen und hätte sie bei meiner Rückkehr vergnügt und munter vorgefunden, aber ich wußte, daß ich mir da keine Hoffnungen zu machen brauchte. Diese Sache würde ich selbst in Ordnung bringen müssen.
»Schau, du bist müde«, sagte ich. »Ruh dich ein bißchen aus, und dann gehen wir eine Pizza essen. Wann haben wir das letzte Mal Pizza gegessen? Sardellen und Zwiebeln. Wir teilen uns eine. Es treibt uns schon nicht in den Ruin, ab und zu mal essenzugehen.«
Das zog auch nicht. Sie preßte ihr Gesicht weiter gegen ihre Arme.
Ich wußte nicht, was ich sonst noch hätte sagen sollen. Ich setzte mich hin und starrte sie über den Tisch hinweg an. Aus ihrem kurzen schwarzen Haar schaute ein Ohr hervor. Daran hing ein Ohrring, den ich noch nie gesehen hatte, klein, aus Gold, in Form eines Fisches. Wo konnte sie so ein Ding nur gekauft haben? Ich hätte furchtbar gern eine geraucht. Ich stellte mir vor, wie ich Zigaretten und Feuerzeug aus der Tasche zog, mir eine Filterzigarette zwischen die Lippen steckte und sie anzündete. Ich tat einen tiefen Lungenzug Luft. Der intensive Geruch von pfannengerührtem Rindfleisch mit Gemüse machte mir schwer zu schaffen. Ich war ausgehungert.
Mein Blick blieb am Wandkalender hängen. Es war ein Kalender, der die Mondphasen angab. Der Vollmond rückte näher. Natürlich: Kumikos Periode stand kurz bevor.
Erst nach meiner Heirat war mir wirklich zu Bewußtsein gekommen, daß ich ein Bewohner der Erde war, des dritten Planeten des Sonnensystems. Ich lebte auf der Erde, die Erde kreiste um die Sonne, und um die Erde wiederum kreiste der Mond. Und ob’s mir gefiel oder nicht, würde das in alle Ewigkeit (oder was man gemessen an meiner Lebensspanne »Ewigkeit« nennen konnte) so weitergehen. Was mich zu dieser Erkenntnis und diesem Bewußtsein führte, war die absolute Präzision von Kumikos neunundzwanzigtägigem Menstruationszyklus. Er stimmte vollkommen mit dem Zu- und Abnehmen des Mondes überein. Und ihre Periode war immer problematisch. Ein paar Tage, bevor es losging, wurde sie regelmäßig launisch, ja sogar depressiv. So wurde ihr Zyklus zu meinem Zyklus. Ich mußte aufpassen, daß ich nicht zur falschen Zeit des Monats unnötig Schwierigkeiten machte. Vor unserer Ehe hatte ich von den Mondphasen kaum etwas mitgekriegt. Es war wohl gelegentlich vorgekommen, daß ich den Mond am Himmel sah, aber welche Gestalt er zum jeweiligen Zeitpunkt hatte, war für mich nie von Bedeutung gewesen. Jetzt war die Gestalt des Mondes etwas, was ich unentwegt mit mir herumtrug.
Vor Kumiko war ich mit einer Reihe anderer Frauen zusammengewesen, und natürlich hatte jede von ihnen ihre Periode gehabt. Bei manchen war sie problematisch gewesen, bei manchen unkompliziert, bei manchen war sie nach drei Tagen vorbei, bei anderen dauerte sie eine Woche, bei manchen kam sie pünktlich, bei anderen konnte sie sich zehn Tage verspäten und mir einen Heidenschrecken einjagen; manche Frauen wurden unausstehlich, andere zeigten kaum eine Wirkung. Bis ich Kumiko heiratete, hatte ich allerdings noch nie mit einer Frau zusammengelebt. Bis dahin war der einzige natürliche Zyklus, den ich bewußt zur Kenntnis genommen hatte, der Wechsel der Jahreszeiten gewesen. Im Winter holte ich meinen Mantel aus dem Schrank, im Sommer war es Zeit für Sandalen. Durch die Heirat erhielt ich nicht nur eine Lebensgefährtin, sondern auch einen neuen Begriff von Zyklizität: die Phasen des Mondes. Nur einmal hatte sie, ein paar Monate lang, ihren regelmäßigen Zyklus durchbrochen, und da war sie schwanger gewesen.
»Es tut mir leid«, sagte sie und hob das Gesicht. »Ich wollte es nicht an dir auslassen. Ich bin müde, und ich bin schlecht gelaunt.«
»Ist schon in Ordnung«, sagte ich. »Mach dir keine Gedanken darüber. Du sollst es an jemandem auslassen, wenn du müde bist. Dann fühlst du dich besser.«
Kumiko atmete langsam, tief ein, hielt eine Weile die Luft an und atmete dann aus.
»Was ist mit dir?« fragte sie.
»Was ist mit mir?«
»Du läßt es nie an irgend jemandem aus, wenn du müde bist. Ich schon. Woran liegt das?«
Ich schüttelte den Kopf. »Das ist mir noch nie aufgefallen«, sagte ich. »Komisch.«
»Vielleicht hast du so einen tiefen Brunnen in dir, und du schreist da ›Der König hat Eselsohren!‹ hinein, und dann ist alles in Ordnung.«
Ich dachte eine Weile darüber nach. »Vielleicht ist das so«, sagte ich.
Kumiko sah wieder die leere Bierflasche an. Sie starrte auf das Etikett und dann auf die Öffnung, und dann drehte sie den Hals zwischen den Fingern.
»Ich bekomme bald meine Periode«, sagte sie. »Das ist wohl der Grund, warum ich so schlecht gelaunt bin.«
»Ich weiß«, sagte ich. »Mach dir darüber keine Gedanken. Du bist nicht die einzige. Massenhaft Pferde sterben, wenn der Mond voll ist.«
Sie nahm die Hand von der Flasche und sah mich mit offenem Mund an.
»Also, wo hast du das auf einmal her?«
»Das habe ich neulich in der Zeitung gelesen. Ich wollte es dir eigentlich erzählen, aber dann hab ich’s vergessen. Es war ein Interview mit irgendeinem Tierarzt. Offenbar werden Pferde unglaublich stark von den Mondphasen beeinflußt – und zwar körperlich wie seelisch. Wenn sich der Vollmond nähert, fangen ihre Gehirnwellen an, verrückt zu spielen, und alle möglichen körperlichen Symptome treten auf. In der Vollmondnacht selbst werden dann viele Pferde regelrecht krank, und ein unheimlich hoher Prozentsatz von ihnen stirbt. Warum das so ist, weiß keiner genau, aber die Statistiken beweisen, daß es so ist. In Vollmondnächten kommt kein Pferdearzt zum Schlafen. Da ist dauernd was los.«
»Interessant«, sagte Kumiko.
»Noch schlimmer ist allerdings eine Sonnenfinsternis – für Pferde eine absolute Katastrophe. Du kannst dir nicht im Traum vorstellen, wie viele Pferde am Tag einer totalen Sonnenfinsternis sterben. Aber egal, ich will damit nur sagen, daß genau in dieser Sekunde überall auf der Welt Pferde sterben. Verglichen damit ist es wahrlich keine Tragödie, wenn du deine Frustrationen an jemand anderem ausläßt. Also mach dir darüber keine Gedanken. Denk an die sterbenden Pferde. Stell dir vor, wie sie in irgendeiner Scheune unter dem Vollmond auf dem Stroh liegen und mit Schaum vor dem Maul röchelnd verenden.«
Einen Augenblick lang schien sie sich das wirklich vorzustellen.
»Das muß der Neid dir lassen«, sagte sie mit einem Anflug von Resignation, »du könntest wahrscheinlich jedem alles schmackhaft machen.«
»Also schön«, sagte ich. »Dann zieh dich um und laß uns eine Pizza essen gehen.«