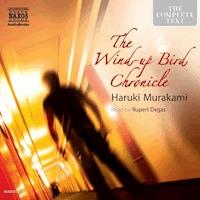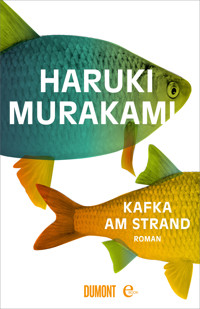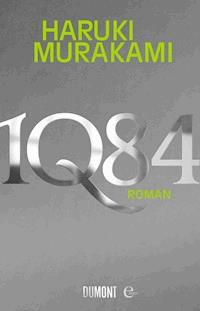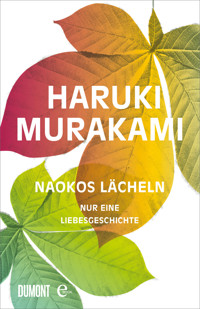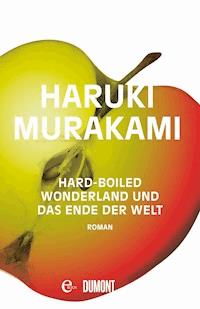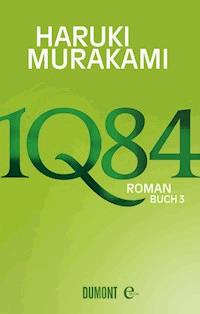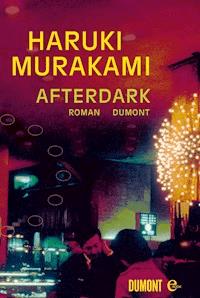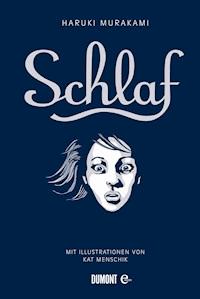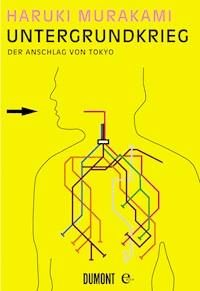8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein verführerischer Thriller, eine schillernd surreale Erzählung und eine geistreiche Gegenwartssatire. Ein großstädtischer Junggesellen-Nomade ist Haruki Murakamis erzählender Held. Sein Leben ist aus der Spur geraten: 34-jährig, geschieden, ein Freund gestorben, von einer Frau ohne Erklärung verlassen. Wiederkehrende Träume und die Erinnerungen an Kiki, die »professionelle Traumfrau« und mysteriös verschwundene Geliebte, führen von Tokyo nach Sapporo ins Dolphin Hotel, eine ehemals schäbig-schrille Absteige, die zum glitzernden Luxuspalast geworden ist. Hier begann alles, hier wird alles enden – denn verborgen haust hier der Schafsmann: ein weise-orakelnder Alter, Schutzengel und Schatten des Erzählers. Seine sanfte Botschaft lautet: Tanz, tanz, tanz. »So gut du kannst. Du hast keine andere Wahl.« Auf der Suche nach einem neuen Leben verwickelt sich Haruki Murakamis Erzähler in seltsame Ereignisse. Er lernt die »Hotelfee« vom Empfang kennen, spürt einen ehemaligen Schulfreund auf, der zum Filmstar geworden, wird in ominöse Mordfälle hineingezogen und zum Beschützer der jungen Yuki, die ein Geheimnis mit ihm teilt. ›Tanz mit dem Schafsmann‹ ist ein virtuos und spannend aus reichen Lebensgeschichten verwobener Roman über die Lebenskonfusionen der westlichen Welt – wehmütig und übermütig, ausgelassen und klug.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 688
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
HARUKI MURAKAMI
TANZ MIT DEM SCHAFSMANN
ROMAN DUMONT
AUS DEM JAPANISCHEN VON
SABINE MANGOLD
DIE JAPANISCHE ORIGINALAUSGABE ERSCHIEN 1988 UNTER DEM TITEL
DANSU, DANSU, DANSU BEI KODANSHA LTD., TOKYO
© 1988 HARUKI MURAKAMI
EBOOK 2011
© 2002 FÜR DIE DEUTSCHE AUSGABE: DUMONT BUCHVERLAG, KÖLN
ALLE RECHTE VORBEHALTEN
AUSSTATTUNG UND UMSCHLAG: GROOTHUIS & CONSORTEN, HAMBURG
SATZ: GREINER & REICHEL, KÖLN
DATENKONVERTIERUNG: CPI – CLAUSEN & BOSSE, LECK
ISBN EBOOK: 978-3-8321-8595-4
WWW.DUMONT-BUCHVERLAG.DE
TANZ MIT DEM SCHAFSMANN
1
Ich träume oft vom Hotel Delfin.
Im Traum bin ich ein Teil davon. Und zwar als eine Art Dauerzustand. Der Traum suggeriert das ganz deutlich. Das Hotel Delfin ist verzerrt und schmal wie ein Schlauch. Es wirkt eher wie eine lange, überdachte Brücke. Eine Brücke, die sich von uralten Zeiten bis in die Endzeit des Universums erstreckt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und mittendrin bin ich. Jemand weint. Weint um mich.
Das Hotel umhüllt mich. Ich kann seinen Puls fühlen, seine Temperatur spüren. Im Traum bin ich ein Teil des Hotels.
Das ist mein Traum.
Ich wache auf. Wo bin ich? Ich denke es nicht nur, sondern stelle mir die Frage laut: »Wo bin ich?« Eine sinnlose Frage. Als wüsste ich es nicht: Ich bin hier. Mitten im Leben. In meinem Alltag, mit allen Dingen, die zu mir, einer realen Existenz, gehören. Nicht, dass ich mich daran erinnern könnte, all den Situationen und Ereignissen, bei denen ich eine Rolle gespielt habe, jemals zugestimmt zu haben. Hin und wieder ist da eine Frau, die neben mir schläft. Doch meistens bin ich allein. Es gibt lediglich die Autobahn direkt vor meinem Fenster, ein Glas – mit einem Restschluck Whiskey – an meinem Bett und das feindselige – oder vielleicht auch nur gleichgültige – diesige Morgenlicht. Manchmal regnet es. Dann bleibe ich im Bett und träume vor mich hin. Und kippe den Rest Whiskey. Ich schaue den Regentropfen zu, die von der Traufe rinnen, und denke dabei an das Hotel Delfin. Irgendwann räkele ich mich, langsam und wohlig. Das genügt mir, um mich zu vergewissern, dass ich einfach nur ich bin und nicht Teil von etwas anderem. Aber das Gefühl im Traum hat sich noch nicht verflüchtigt. Es ist so plastisch, dass ich meine Hand danach ausstrecken und es berühren könnte. Dann würde das gesamte Bild, in dem ich mich befinde, in Bewegung geraten. Wenn ich angestrengt lausche, kann ich hören, wie sich langsam eine Reihe von Szenen abzuspielen beginnt. Eine nach der anderen, in Kaskaden. Ich lausche aufmerksam. Höre, wie jemand leise, kaum wahrnehmbar weint, ein Schluchzen irgendwoher aus dunkler Tiefe. Jemand weint um mich.
Das Hotel Delfin existiert wirklich. Es befindet sich in einem unscheinbaren Winkel von Sapporo. Vor einigen Jahren habe ich eine Woche dort übernachtet. Wenn ich mich recht entsinne, war es vor vier Jahren. Nein, vor viereinhalb, um genau zu sein. Ich war noch in den Zwanzigern. Die Woche dort verbrachte ich mit einem Mädchen. Sie war es, die das Hotel ausgesucht hatte. Da übernachten wir. Sie hatte darauf bestanden. Sonst wäre ich nicht auf den Gedanken gekommen, in einem solchen Kasten abzusteigen. Das Hotel war eine schäbige Bruchbude. Während unseres gesamten Aufenthalts haben wir, soweit ich mich erinnere, keinen anderen Gast gesehen. Ein paar Figuren lungerten zwar in der Lobby herum, aber wer weiß, ob sie tatsächlich Gäste waren. Es fehlten immer einige Schlüssel an der Rezeption, was die Vermutung nahe legte, dass außer uns noch andere hier logierten. Falls überhaupt, konnten es nicht viele sein. Wenn irgendwo in der Großstadt ein Schild mit der Aufschrift Hotel aushängt und die Telefonnummer im Branchenbuch steht, sollte man eigentlich davon ausgehen können, dass sich Gäste einfinden. Doch falls es noch andere außer uns gab, dann mussten sie extrem schüchtern und leise sein. Man hörte weder den geringsten Mucks, noch gab es irgendein sichtbares Zeichen ihrer Anwesenheit – außer der täglich wechselnden Anordnung der Schlüssel am Bord. Vielleicht waren es Schattengestalten, die mit angehaltenem Atem an den Korridorwänden entlangschlichen. Gelegentlich hörten wir das quietschende Rumpeln des Aufzugs, doch sobald er stoppte, herrschte wieder bleierne Stille.
Ein ziemlich skurriles Hotel.
Es kam mir vor wie eine Sackgasse der Evolution, wie ein genetischer Rückschritt. Eine Missgeburt der Natur, die einige Organismen irreversibel auf die falsche Fährte gebracht hatte. Der evolutionäre Vektor war aufgehoben. Verwaiste Lebensformen kauerten im Dämmerlicht der Geschichte, im Tal der ertrunkenen Zeit. Und niemand war dafür verantwortlich. Keiner trug die Schuld, keiner würde sie erlösen.
Man hätte das Hotel niemals an diese Stelle bauen dürfen. Das war der Kardinalfehler, der alles Weitere zum Scheitern verurteilte. Wie ein von oben falsch geknöpftes Hemd. Jeder Versuch, die Dinge ins Lot zu bringen, führt lediglich zu einer feinen, aber nicht unbedingt eleganten Unordnung. Alles wirkt leicht verzerrt, sodass man seinen Kopf jedesmal um einige Grade zur Seite neigen muss, will man irgendwas anschauen. Die Verrenkung geht nie so weit, dass man ernstlich Schaden nehmen oder komisch wirken würde. Aber wer weiß? Wenn man lange genug hier zubrächte, würde man sich vielleicht daran gewöhnen. Eine ganz unauffällige Anomalie. Nur wird man die normale Welt dann nie wieder betrachten können, ohne den Kopf zu verdrehen.
Das also war das Hotel Delfin. Von Normalität keine Spur. Eine Konfusion jagte die nächste, bis der Sättigungsgrad erreicht war, um bald darauf vom Strudel der Zeit mitgerissen zu werden. Ein Blick genügte, und man war im Bilde. Ein erbärmliches Hotel. Erbärmlich wie ein dreibeiniger schwarzer Hund, der triefend im Dezemberregen steht. Heruntergekommene Hotels gibt es überall, ohne Frage, aber das Delfin stellte eine Klasse für sich dar. Dieses Hotel war von Grund auf erbärmlich. Es übertraf sich selbst.
Außer jenen arglosen Menschenseelen, die sich dorthin verirrten, würde natürlich niemand freiwillig dort absteigen. Doch zwischen seinem Namen (ich würde zu DELFIN eher ein schneeweißes Kurhotel im Zuckerbäckerstil an der Ägäis assoziieren) und dem tatsächlichen Eindruck, den es vermittelt, klaffte ein himmelweiter Unterschied. Ohne das Schild draußen am Portal wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, dass es sich um ein Hotel handelte. Und auch mit dem Schild sah es kaum danach aus. Es wirkte eigentlich mehr wie ein Museum. Ein Kuriositätenkabinett, in das sich Leute mit skurrilen Vorlieben hineinstehlen, um sonderbare Ausstellungsstücke zu betrachten.
Dieser Vergleich, der sich einem bei seinem Anblick aufdrängen mochte, war keinesfalls so abwegig. Ein Teil des Hotels ähnelte tatsächlich einem Museum. Ich frage mich allerdings, wer freiwillig in solch einem Loch absteigen würde, das ein Sammelsurium von Dingen beherbergt: ausgestopfte Schafe und muffige Felle in düsteren Korridoren, schimmlige Akten und verblichene Fotografien. Ein Hotel voll unerfüllter Träume, die wie verkrusteter Schlamm in den Ecken klebten.
Sämtliche Möbel waren verschlissen, jeder Tisch wackelte, kein Schloss funktionierte. Abgewetzte Korridore in trüber Beleuchtung. Die Stöpsel in den Waschbecken so verzogen, dass das Wasser im Nu durchsickerte. Das Zimmermädchen, eine Tonne, die auf Elefantenbeinen durch die Korridore walzte und unheilvoll hustete. Dann der traurig blickende Besitzer mittleren Alters, dem zwei Finger fehlten und der seinen Platz an der Rezeption nie zu verlassen schien. Ein Typ, dem man sofort ansah, dass ihm immer alles schief ging. Ein Musterexemplar seiner Gattung: nach einem Tag Einweichen in verdünnter blauer Tinte hervorgezogen, in seiner Existenz stigmatisiert von Misserfolg, Versagen, Niederlagen. Man könnte ihn in eine Vitrine mit der Aufschrift Homo nihilsuccessus sperren und in einer Naturkundeklasse ausstellen. So ziemlich jeden würde der Anblick dieser Kreatur mehr oder weniger bedrücken, wenn nicht gar empören. Man könnte auch regelrecht zornig werden. Wer also würde schon freiwillig in einem solchen Hotel absteigen?
Nun, wir hatten uns dort einquartiert. Da übernachten wir, hatte sie gesagt. Und auf einmal war sie verschwunden. Hatte mich einfach sitzen lassen. Es war der Schafsmann, der mir die Nachricht überbrachte. Sie ist weg, hatte er mir gesagt. Ihm war bekannt, dass sie weg musste. Inzwischen ist mir das auch klar. Sie hatte mich absichtlich hierhergelotst. Als wäre es ihr Ziel, ihre Bestimmung gewesen. So wie die Moldau ins Meer fließt. Die Assoziation kam mir beim Anblick der Regentraufe. Schicksal.
Als ich anfing, vom Hotel Delfin zu träumen, kam sie mir als Erstes in den Sinn. Sie sucht nach mir, dachte ich unwillkürlich. Weshalb sollte ich sonst diesen Traum haben, immer und immer wieder?
Sie. Ich kenne nicht einmal ihren Namen. Obwohl wir monatelang zusammengelebt hatten. Ich weiß eigentlich überhaupt nichts von ihr, außer dass sie zum Personal eines exklusiven Callgirlclubs gehörte. Eines Etablissements nur für Mitglieder, Personen mit untadeligem Ruf. Sie war eine Edelnutte. Nebenbei hatte sie noch eine Reihe anderer Jobs. Während der normalen Geschäftszeiten arbeitete sie als Korrektorin bei einem kleinen Verlag und war außerdem Ohren-Fachmodell für Werbefotos. Mit anderen Worten, sie führte ein ziemlich geschäftiges Leben. Natürlich hatte sie auch einen Namen, wohl sogar eine ganze Reihe. Und deshalb wiederum keinen richtigen. Was immer sie bei sich hatte – und das war so gut wie nichts –, es stand kein Name darauf. Sie hatte weder einen Bahnausweis – noch einen Führerschein oder eine Kreditkarte. Lediglich ein kleines Notizbuch, in das jedoch nur unleserliche Hieroglyphen hineingekritzelt waren. Es gab keinen Anhaltspunkt für ihre Identität. Nutten mögen Namen haben, aber sie leben in einer Welt, die davon nichts zu wissen braucht.
Ich wusste jedenfalls so gut wie nichts über sie. Weder ihren Geburtsort noch ihr wahres Alter oder ihren Geburtstag. Auch nichts über ihren schulischen und familiären Hintergrund. Null. Unvorhersehbar wie ein Regenschauer war sie aufgetaucht und wieder verschwunden, nur um Erinnerungen zurückzulassen.
Doch jetzt nimmt die Erinnerung an sie eine neue Wirklichkeit an. Eine fühlbare Wirklichkeit, die wachgerufen wird durch das Hotel Delfin. Ja, sie hält erneut nach mir Ausschau, verlangt nach mir. Und nur indem ich noch einmal ein Bestandteil des Hotels Delfin werde, kann ich ihr wieder begegnen. Offensichtlich ist sie es, die um mich weint.
Während ich die Regentropfen beobachte, denke ich darüber nach, dass ich in etwas enthalten sein soll. Und auch darüber, dass jemand um mich weint. In einer Welt, die schrecklich weit entfernt liegt. Als handelte es sich um Ereignisse auf dem Mond. Letztendlich war es ein Traum. Egal, wie weit ich meine Hand ausstrecke, egal wie schnell ich laufe, ich werde wohl nie dort ankommen.
Weshalb sollte jemand um mich weinen?
Dennoch, sie verlangt nach mir. Irgendwo im Hotel Delfin. Und in einem Winkel meines Herzens wünsche ich es mir ja selbst – Teil dieses Orts zu werden, Teil dieses skurrilen, verhängnisvollen Schauplatzes.
Es ist allerdings nicht so leicht, wieder ins Hotel Delfin zu gelangen. Einfach nur telefonisch ein Zimmer zu bestellen, in ein Flugzeug zu steigen und nach Sapporo zu fliegen – damit ist es nicht getan. Das Hotel ist eben nicht nur ein Ort, sondern zugleich ein Zustand. Ein Zustand in Form eines Hotels. Dorthin zurückzukehren bedeutet, sich erneut mit den Schatten der Vergangenheit zu konfrontieren. Allein die Aussicht darauf deprimiert mich. Ich habe in den letzten vier Jahren alles getan, um diesen schaurigen, düsteren Schatten loszuwerden, ihm zu entkommen. Die Rückkehr zum Hotel Delfin heißt, alles im Stich zu lassen, was ich in diesem Zeitraum gehortet habe. Nicht dass ich Großartiges erreicht hätte, um Himmels willen. Wie man es auch betrachtet, das meiste davon ist ohnehin nur provisorischer, der Bequemlichkeit dienender Kram. Nun gut, ich habe für mich das Beste daraus gemacht. Mit etwas Gerümpel habe ich es geschafft, auf geschickte Weise eine Verbindung zur Realität herzustellen und mir ein neues Leben aufzubauen, das auf ganz anspruchslosen Wertvorstellungen meinerseits beruht. Sollte ich das alles zum Fenster hinausschmeißen? Und tatsächlich noch einmal bei null anfangen?
Doch letzten Endes hat alles dort begonnen. Das ist mir inzwischen klar geworden. Also muss die Geschichte wieder dort beginnen.
Ich rollte mich auf den Rücken, starrte an die Decke und seufzte. Ach, gib’s auf, dachte ich. Gib’s auf, grübeln hilft nicht. Es liegt nicht in deiner Hand, mein Junge. Was immer du dir zusammenspinnst, du musst dort wieder anfangen. Es ist bereits besiegelt. Unausweichlich.
Ich möchte etwas über mich erzählen.
Mich vorstellen, sozusagen.
Das war früher in der Schule so Brauch. Wenn sich eine neue Klasse formierte, bin ich, sobald ich an der Reihe war, brav nach vorne gegangen und habe vor der versammelten Mannschaft so allerlei über mich preisgegeben. Ich hasste das. Außerdem sah ich überhaupt keinen Sinn darin. Was wusste ich schon über mich? War jenes Ich, das mir über mein Bewusstsein zugänglich war, mein wirkliches Ich? War mein Selbstbild nicht nach eigenem Gutdünken zurechtgestutzt und völlig verzerrt wahrgenommen? Genauso unecht wie der Klang der eigenen Stimme bei einer Tonbandaufnahme? Es war mir immer suspekt gewesen. Jedes Mal wenn ich mich vorstellen, den anderen etwas über mich erzählen sollte, kam es mir vor, als würde ich mein eigenes Zeugnis nach Belieben ummodeln. Ich war meiner selbst nie sicher gewesen. Deshalb hatte ich stets darauf geachtet, nur objektive Fakten, die keiner Erläuterung und Sinngebung bedurften, zu berichten. (Ich habe einen Hund. Ich schwimme. Ich mag keinen Käse. Und so weiter.) Dabei hatte ich immer das Gefühl, fiktiven Menschen fingiertes Zeug zu erzählen. Und wenn ich mir die Geschichten von andern anhörte, erschien es mir, als würde jeder über eine fremde Person sprechen. Wir erhalten uns am Leben, indem wir in einer eingebildeten Welt eingebildete Luft atmen.
Trotzdem werde ich etwas über mich erzählen. Alles beginnt damit, dass ich etwas über mich erzähle. Der erste Schritt sozusagen. Ob es stimmt oder nicht, darüber kann man später befinden. Entweder ich oder jemand anders. Jedenfalls ist es jetzt an der Zeit, etwas über mich zu erzählen. Außerdem muss ich das üben.
Inzwischen schmeckt mir Käse. Ich weiß nicht, seit wann, aber irgendwann war es eben so. Mein Hund war in dem Jahr, als ich auf die Mittelschule kam, an einer Lungenentzündung, die er sich im Regen geholt hatte, gestorben. Seitdem habe ich keinen mehr. Schwimmen tue ich immer noch gern.
Das wär’s.
Doch so einfach ist die Angelegenheit nicht erledigt. Wenn man etwas vom Leben verlangt (gibt es überhaupt Menschen, die nichts fordern?), verlangt das Leben auch weitere Fakten von einem selbst. Um eine klare Figur zeichnen zu können, braucht man viel mehr Anhaltspunkte. Sonst bekommt man kein Feedback.
Wegen unvollständiger Angaben nicht zu beantworten. Bitte drücken Sie die Löschtaste!
Ich drücke die Löschtaste. Der Bildschirm ist leer. Im Klassenzimmer schmeißen sie Sachen nach mir. Los, erzähl! Wir wollen mehr hören. Raus mit der Sprache! Der Lehrer runzelt die Stirn. Mir fehlen die Worte. Wie versteinert stehe ich am Pult.
Also erzähle ich. Sonst kann nichts beginnen. Und auch noch möglichst lang und breit. Ob es stimmt oder nicht, darüber kann man sich später den Kopf zerbrechen.
Manchmal hat sie bei mir übernachtet. Morgens haben wir gemeinsam gefrühstückt. Dann ist sie zur Arbeit gefahren. Auch sie hat eigentlich keinen Namen. Was einfach daran liegt, dass sie in dieser Geschichte keine Hauptfigur ist. Sie wird gleich wieder verschwinden. Um also keine Verwirrung zu stiften, lasse ich ihren Namen fort. Dennoch liegt es mir fern, ihre Existenz zu entwerten. Ich habe sie sehr gemocht und tue es noch immer, auch nachdem sie fort ist.
Wir waren sozusagen befreundet. Zumindest hielt ich es bei ihr für möglich, sie als die einzige Vertraute zu betrachten. Außer mir gab es noch einen anderen, einen richtigen Liebhaber. Sie war beim Fernmeldeamt beschäftigt, wo sie per Computer Telefonrechnungen erstellte. Ich habe mich nie ausführlich nach ihrer Tätigkeit erkundigt, und auch sie hat nicht weiter davon gesprochen, aber im Großen und Ganzen war das ihr Job. Für jeden Privatanschluss die anfallenden Telefongebühren ermitteln und Rechnungen erstellen. Deshalb hatte ich jedes Mal wenn ich die monatliche Abrechnung im Briefkasten fand, das Gefühl, einen persönlichen Brief zu erhalten. Sie hatte damit aber nichts zu tun. Sie schlief mit mir. Etwa zwei, drei Mal im Monat. Sie hielt mich für einen Mondmenschen. »Na, willst du nicht zum Mond zurück?«, neckte sie mich kichernd, wenn wir nackt im Bett kuschelten und sie ihre Brüste an meinen Bauch schmiegte. Oft haben wir bis in die Morgenstunden so herumgealbert. Draußen toste unentwegt die Autobahn. Im Radio lief ein monotones Stück von Human League. Human League. Idiotischer Name! Wer denkt sich bloß so einen Schwachsinn aus. Früher haben sich die Bands seriösere Namen gegeben: Imperials, Supremes, Flamingos, Impressions, Doors, Four Seasons, Beach Boys.
Sie lachte mich dann immer aus. Ich würde mich schon ändern. Fragt sich nur, in welcher Hinsicht. Ich selbst hielt mich für einen ganz manierlichen Menschen mit ganz manierlichen Ansichten. Human League.
»Ich mag dich«, sagte sie. »Manchmal bin ich richtig verrückt nach dir. Zum Beispiel wenn ich bei der Arbeit bin.«
»Hm«, sage ich.
»Na ja, manchmal«, betont sie nachträglich. Eine halbe Minute später ist der Human League-Song zu Ende. Es folgt ein Stück von einer Gruppe, deren Name mir nichts sagt.
»Das ist genau dein Schwachpunkt«, fährt sie fort. »Ich verbringe gerne Zeit mit dir, aber ich kann mir nicht vorstellen, jeden Tag von morgens bis abends mit dir zusammenzuleben. Weshalb wohl?«
»Hm«, mache ich.
»Ich will nicht sagen, dass ich es beklemmend finde, mit dir zusammen zu sein. Aber manchmal, weißt du, habe ich das Gefühl, dass die Luft immer dünner wird. Wie auf dem Mond.«
»Das sind eben die ersten Schrittchen …«
»Hör mal, ich sage das nicht aus Spaß.« Sie richtet sich auf und schaut mich an. »Ich sage es dir zuliebe. Gibt es sonst noch jemanden, der etwas dir zuliebe sagt? Na? Sag schon, gibt es jemanden?«
»Nein«, erwidere ich aufrichtig. Es gibt niemanden.
Sie legt sich wieder hin und drückt ihre Brüste sanft an meine Seite. Ich streichele ihren Rücken. »Jedenfalls wird die Luft manchmal dünn wie auf dem Mond, wenn ich mit dir zusammen bin.«
»Die Luft auf dem Mond ist nicht dünn«, erkläre ich ihr. »Auf der Mondoberfläche existiert überhaupt keine Luft. Deshalb …«
»Sie ist aber dünn«, sagt sie leise. Ich bin mir nicht sicher, ob sie meine Bemerkung ignoriert oder einfach nicht gehört hat. Ihre leise Stimme macht mich nervös. Ich weiß nicht, wieso, aber etwas darin irritiert mich. »Manchmal wird sie plötzlich dünn. Als ob du eine ganz andere Luft atmest als ich. Ich merke das.«
»Die Angaben sind unvollständig«, sage ich.
»Willst du damit sagen, ich wüsste nichts über dich?«
»Ich weiß ja nicht mal selbst gut über mich Bescheid«, erwidere ich. »Ehrlich! Das meine ich jetzt nicht im philosophischen Sinne, eher praktisch. Insgesamt sind die Angaben unvollständig.«
»Aber du bist doch schon dreiunddreißig, oder?«, entgegnet sie. Sie selbst ist sechsundzwanzig.
»Vierunddreißig«, verbessere ich. »Vierunddreißig Jahre und zwei Monate.«
Sie schüttelt den Kopf. Dann steht sie auf, geht zum Fenster und zieht die Vorhänge auf. Draußen ist die Autobahn zu sehen. Über der Straße taucht weiß wie ein Knochen der morgendliche Sechs-Uhr-Mond auf. Sie trägt einen Pyjama von mir.
»Kehr auf deinen Mond zurück«, sagt sie und deutet zum Himmel.
»Ein bisschen kalt, was?«, sage ich.
»Kalt? Auf dem Mond?«
»Nein, dir. Es ist Februar.« Sie lehnt sich aus dem offenen Fenster und haucht ihren weißen Atem hinaus. Als ich sie darauf aufmerksam mache, beginnt sie sichtlich zu frieren.
Sie kriecht schnell ins Bett zurück. Ich nehme sie in die Arme. Der Pyjama fühlt sich eiskalt an. Sie presst ihre Nasenspitze gegen meinen Hals. Auch die ist eiskalt. »Ich mag dich sehr«, sagt sie.
Ich möchte antworten, finde jedoch nicht die richtigen Worte. Ich empfinde Zuneigung für sie. Im Bett kann ich wundervolle Stunden mit ihr verbringen. Mir gefällt es, ihren Körper zu wärmen und über ihr Haar zu streichen. Ihren sanften Atem beim Schlafen zu hören und sie morgens zu verabschieden, wenn sie zur Arbeit geht. Die von ihr – wie ich glaube – erstellte Telefonrechnung zu erhalten und sie in meinem großen Pyjama zu sehen. Doch wenn es darauf ankommt, etwas zu sagen, fehlen mir die passenden Worte. Natürlich kann ich nicht sagen, ich liebe dich. Und genauso wenig, ich mag dich.
Wie soll ich es also ausdrücken?
Jedenfalls bringe ich kein Wort über die Lippen. Mir fällt einfach nichts Passendes ein. Ich merke, dass es sie verletzt, wenn ich nichts sage. Sie versucht es zwar zu verbergen, aber ich merke es. Merke, wie es über ihre samtene Haut, über ihr Rückgrat läuft. Ganz deutlich. Wir liegen eine Weile eng umschlungen und schweigen. Hören Songs, deren Titel wir nicht kennen. Sie legt verstohlen ihre Hand auf meinen Schoß.
»Du solltest eine Frau vom Mond heiraten und hübsche Mondkinder mit ihr zeugen«, sagt sie zärtlich. »Das wäre das Beste für dich.«
Durch das offen stehende Fenster kann man den Mond sehen. Während ich sie umarme, blicke ich ihn unverwandt an. Hin und wieder donnert ein schwer beladener Fernlaster über die Autobahn. Es dröhnt unheilvoll wie eine berstende Eisscholle. Was transportieren die nur?, frage ich mich.
»Gibt’s was zum Frühstück?«, erkundigt sie sich.
»Das Übliche. Schinken, Eier, Toast. Außerdem gibt es noch einen Rest Kartoffelsalat von gestern Mittag. Und natürlich Kaffee. Ich mache dir Milch warm, für Café au lait«, sage ich.
»Au prima!«, sagt sie lächelnd. »Du machst Eier mit Schinken, Kaffee und Toast für mich?«
»Natürlich. Mit Vergnügen.«
»Weißt du, was ich am liebsten mag?«, fragt sie mich. »Ehrlich gesagt, nein. Keine Ahnung.«
»Also am liebsten mag ich Folgendes«, sagt sie und schaut mir dabei in die Augen. »Kalte Wintermorgen sind mir ein Greuel. Ich will dann gar nicht aus den Federn. Aber wenn ich den Kaffeeduft und die brutzelnden Eier mit Schinken rieche und das Schnappen des Toasters höre, bin ich nicht mehr zu bremsen und schwuppdiwupp aus dem Bett.«
»Na schön. Probieren wir’s aus«, sage ich lachend.
Ich bin kein verschrobener Typ.
Da bin ich mir ganz sicher.
Vielleicht kann man mich nicht gerade als durchschnittlich bezeichnen, aber verschroben bin ich nicht.
Eigentlich bin ich ein grundanständiger Kerl. Extrem geradlinig. Geradlinig wie ein Pfeil. Mein Dasein ist notwendig und äußerst natürlich. Eine selbstverständliche Tatsache, wenn man so will. Es kümmert mich wenig, wie andere meine Existenz empfinden. Was andere von mir halten, ist ein Problem, das nichts mit mir zu tun hat. Es ist vielmehr deren Problem, nicht meines.
Manche halten mich für einfältiger, als ich wirklich bin. Andere wiederum für berechnender. Doch das ist mir egal. Der Komparativ als ich wirklich bin bezeichnet lediglich eine Nuance meines Selbstbildes. Für gewisse Leute bin ich möglicherweise wirklich einfältig oder wirklich berechnend. Mir ist das ziemlich egal. Das ist nicht weltbewegend. Es gibt meines Erachtens keine Missverständnisse. Nur unterschiedliche Auffassungen.
Auf der anderen Seite kenne ich aber auch Personen – Männer und Frauen –, die sich von meiner Redlichkeit angezogen fühlen. Es sind äußerst wenige, aber es gibt sie. Zweifellos. Wie Planeten kreisen wir im dunklen All, naturgemäß voneinander angezogen, um dann wieder auseinander zu driften. Sie kommen zu mir, gehen eine Beziehung mit mir ein, bis sie mich eines Tages wieder verlassen. Sie werden Freunde, Geliebte und vielleicht sogar Ehepartner. Manchmal werden sie auch zu Gegnern. Aber was immer sie sind, irgendwann gehen sie fort. Sie sind resigniert, verzweifelt oder stumm (selbst wenn man den Hahn aufdreht, kommt nichts heraus), und dann gehen sie fort. In meinem Zimmer gibt es zwei Türen. Einen Eingang und einen Ausgang. Sie sind nicht austauschbar. Durch den Eingang kann man nicht hinaus, durch den Ausgang nicht hinein. Das ist so festgelegt. Die Leute kommen durch den Eingang herein und gehen durch den Ausgang hinaus. Es gibt viele Arten zu kommen und zu gehen. Dennoch, irgendwann verlassen mich alle. Manche gehen, um neue Möglichkeiten auszuprobieren, andere, um Zeit zu sparen. Manche sind gestorben. Keiner ist da geblieben. Es gibt niemanden hier im Zimmer. Außer mir. Ich nehme permanent ihre Abwesenheit wahr. Von allen, die mich verlassen haben. Ihre gesprochenen Worte, ihre Atemzüge, ihre gesummten Lieder schweben durchs Zimmer wie Staubflocken in den Ecken.
Ich habe das Gefühl, dass ihr Bild von meiner Person doch ziemlich präzise war. Eben deshalb kamen sie geradewegs zu mir, um mich schließlich wieder zu verlassen. Sie erkannten meine Anständigkeit, erkannten meine typische Aufrichtigkeit – ein anderer Ausdruck fällt mir leider nicht ein –, mit der ich meine Anständigkeit zu bewahren suchte. Sie wollten mir etwas sagen, mein Herz öffnen. Es waren meist sehr warmherzige Menschen. Doch ich konnte ihnen nichts geben. Und selbst wenn, dann reichte das nicht aus. Ich habe mich immer bemüht, ihnen mein Möglichstes zu geben. Was ich konnte, habe ich getan. Ich habe auch an sie Erwartungen gestellt. Und am Ende ist es doch schief gelaufen. Sie haben mich verlassen. Das war natürlich bitter.
Aber noch bitterer war, dass sie beim Hinausgehen viel trauriger aussahen als beim Hereinkommen. Das ist mir nicht entgangen. Es mag komisch klingen, doch sie wirkten oft weitaus kaputter als ich. Wieso eigentlich? Und weshalb bleibe ich immer übrig? Mit dem Schatten eines Geschädigten. Schwer zu sagen, woran es lag.
Die Angaben sind unvollständig.
Deshalb kommt nie eine Antwort zurück.
Etwas fehlt.
Als ich eines Tages nach einem Geschäftstermin nach Hause kam, fand ich eine Postkarte in meinem Briefkasten. Abgebildet war ein Astronaut, der in einem Weltraumanzug auf dem Mond umherspazierte. Es stand zwar kein Absender darauf, aber ich wusste sofort, von wem die Karte stammte.
»Wir sollten uns besser nicht mehr sehen«, schrieb sie. »Ich werde wahrscheinlich in Kürze einen Erdbewohner heiraten.«
Ich hörte, wie die Tür ins Schloss fiel.
Wegen unvollständiger Angaben nicht zu beantworten. Bitte drücken Sie die Löschtaste!
Der Bildschirm ist leer.
Wie lange soll das noch so weitergehen? Ich bin bereits vierunddreißig. Wie lange noch? Ich war traurig. Es war ganz klar meine Schuld. Dass sie sich von mir trennen würde, war gewissermaßen vorprogrammiert. Das war mir von Anfang an klar. Sie wusste es, ich wusste es. Und trotzdem hatten wir offenbar ein kleines Wunder erwartet. In der Hoffnung, dass sich bei der geringsten Gelegenheit eine grundlegende Wandlung vollziehen würde. Was natürlich nicht geschehen ist. Und dann ging sie fort. Ich fühlte mich zwar einsam, nachdem sie aus meinem Leben verschwunden war, doch es war die gleiche Einsamkeit, die ich auch schon vorher erlebt hatte. Ich konnte sicher sein, dass ich diese Einsamkeit gut überstehen würde.
Ich gewöhne mich allmählich daran.
Dieser Gedanke bereitete mir Unbehagen. Als würde aus meinen Eingeweiden eine schwarze Flüssigkeit bis zur Kehle hochquellen. Ich trat vor den Badezimmerspiegel. Das da also bin ich. Das bist du. Du hast dich selbst ruiniert. Du hast dich weit mehr kaputt gemacht, als du glaubst.
Ich wirkte viel schmuddeliger und älter als sonst. Ich wusch mir gründlich das Gesicht und rieb es mit einer Lotion ein. Ebenso gründlich schrubbte ich meine Hände, nahm ein frisches Handtuch und trocknete mich ab. Anschließend ging ich in die Küche, trank ein Bier und räumte dabei den Kühlschrank auf. Schmiss verschrumpelte Tomaten weg, stellte die Bierdosen ordentlich nebeneinander und die Behälter um und machte eine Einkaufsliste.
Als es bereits dämmerte, betrachtete ich gedankenverloren den Mond und fragte mich, wie lange es noch so weitergehen sollte. Irgendwann würde ich wieder zufällig einer neuen Frau begegnen. Wir würden einander anziehen, naturgemäß, wie Planeten. Vergeblich Wunder erwarten, die Zeit verschlingen, uns gegenseitig seelisch zermürben und dann auseinander gehen.
Wie lange sollte das so weitergehen?
2
Eine Woche, nachdem ich ihre Postkarte mit der Mondlandschaft erhalten hatte, musste ich beruflich nach Hokkaido. Wie üblich nichts Berauschendes, aber in meiner Situation konnte ich es mir nicht erlauben, wählerisch zu sein. Die Aufträge, die ich bekomme, unterscheiden sich sowieso nur geringfügig. Glücklicherweise – oder auch nicht – ist es ja im Allgemeinen so. Je weiter am Rande man sich befindet, umso weniger fallen Qualitätsunterschiede auf. Genau wie bei Frequenzen: Von einem bestimmten Punkt an lässt sich kaum noch sagen, welcher von zwei benachbarten Tönen höher klingt. Bis man sie nicht mehr auseinander halten und schließlich überhaupt nicht mehr hören kann.
Mein Auftrag war ein Artikel für ein Frauenmagazin: Feinschmecker-Restaurants in Hakodate. Zusammen mit einem Fotografen sollte ich ein paar Lokale abklappern. Ich war für die Story zuständig, er lieferte die Aufnahmen. Der gesamte Beitrag sollte fünf Seiten füllen. Das Frauenmagazin wollte einen solchen Artikel, und irgendjemand musste ihn eben schreiben. Genauso wie Müll oder Schnee beseitigt werden müssen. Egal, ob einem das gefällt oder nicht. Dreieinhalb Jahre lang habe ich triviale Kulturarbeit dieser Art geleistet. Kulturelles Schneeschaufeln, sozusagen.
Nachdem ich mich aus gewissen Gründen von meinem Geschäftspartner, mit dem ich eine Zwei-Mann-Agentur betrieb, getrennt hatte, ließ ich mich ein halbes Jahr nur treiben. Ich verspürte überhaupt keine Motivation, etwas zu tun. Im Herbst des Vorjahres war allerhand passiert in meinem Leben. Ich hatte mich scheiden lassen. Ein Freund war gestorben, unter merkwürdigen Umständen. Eine Frau hatte mich verlassen, ohne Erklärung. Ich begegnete eigenartigen Typen, fand mich in seltsame Ereignisse verwickelt. Und als alles vorbei war, umgab mich eine tiefe Stille, tiefer, als ich es je erlebt hatte. Eine gähnende Leere machte sich in meinem Apartment breit. Abwesenheit im kondensierten Zustand. Sechs Monate lang igelte ich mich zu Hause ein. Tagsüber verließ ich so gut wie nie die Wohnung, es sei denn, um das absolute Minimum an Einkäufen zu erledigen, die zum Überleben nötig waren. Mit dem ersten Morgengrauen wagte ich mich nach draußen und streunte ziellos durch das menschenleere Viertel. Sobald es belebter wurde auf den Straßen, zog ich mich in meine Behausung zurück und legte mich schlafen. Spätabends stand ich auf, bereitete mir einen Imbiss, fütterte den Kater. Dann setzte ich mich auf den Boden und grübelte zum x-ten Male über all das nach, was mir passiert war, versuchte es zu ordnen. Ich variierte die Reihenfolge der Ereignisse, erwog sämtliche Alternativen, überlegte, was ich richtig und was ich falsch gemacht hatte. Das zog sich bis zum Morgengrauen hin, bis ich dann wieder die Wohnung verließ, um durch die ausgestorbenen Straßen zu irren.
Ein halbes Jahr lang war das mein täglicher Trott gewesen. Von Januar bis Juni 1979. Ich hatte kein einziges Buch gelesen, nicht eine Zeitung aufgeschlagen. Ich hörte keine Musik. Sah nicht fern, schaltete kein Radio an. Sah niemanden, sprach mit niemandem. Ich trank kaum. Mir stand einfach nicht der Sinn danach. Ich hatte keine Ahnung, was draußen in der Welt vor sich ging, wer berühmt geworden war, wer gestorben war. Nicht etwa, dass ich Informationen kategorisch ablehnte, ich hatte einfach nur kein Bedürfnis, irgendetwas zu erfahren. Obgleich ich natürlich merkte, dass die Welt sich weiterdrehte. Auch wenn ich reglos in meinem Apartment hockte, spürte ich es auf der Haut. Wie eine lautlose Brise, die an mir vorbeiwehte. Auf dem Boden sitzend, beschwor ich im Geiste die Vergangenheit herauf. Es klingt komisch, aber ich tat nichts anderes, Tag für Tag für Tag, ein halbes Jahr lang. Und dennoch empfand ich dabei weder Überdruss noch Langeweile. All das, womit ich fertig werden musste, schien mir so gewaltig, so komplex zu sein. Gewaltig, aber vor allem wirklich. Zum Anfassen real. Wie ein nächtlich angestrahltes Monument. Ein Monument, das einzig und allein für mich da stand. Ich untersuchte das gesamte Geschehen unter allen möglichen Blickwinkeln. Die Ereignisse hatten mir natürlich ziemlich übel mitgespielt. Es war kein geringer Schaden. Viel Blut war geflossen, lautlos. Mit der Zeit ließen einige Qualen nach, andere kamen erst später hoch. Und dennoch hatte ich mich dieses halbe Jahr nicht verkrochen, um meine Wunden zu lecken. Es war auch keine autistische Ablehnung der Außenwelt. Ich brauchte einfach Zeit. Ich brauchte ein halbes Jahr, um all das, was mit den Ereignissen zusammenhing, konkret – im praktischen Sinne – auf die Reihe zu kriegen. Um es zu überprüfen. Nein, es war keine autistische Anwandlung, keine strikte Absage an die Welt. Einfach nur eine Frage der Zeit. Ich brauchte pure, physische Zeit, um wieder auf die Beine zu kommen.
Welchen Sinn es hatte, mich wieder aufzubauen, und welche Richtung ich danach ansteuern sollte, so weit dachte ich gar nicht. Das war ein völlig anderes Thema. Darüber konnte ich mir später den Kopf zerbrechen. Zunächst ging es nur darum, mein Gleichgewicht wiederherzustellen.
Sogar mit meinem Kater sprach ich kaum ein Wort.
Ein paarmal klingelte das Telefon. Ich ließ es klingeln.
Wenn jemand an die Tür klopfte, machte ich nicht auf.
Es kamen auch einige Briefe. Mein Expartner schrieb mir, er mache sich Sorgen um mich, da er nicht wisse, wo ich steckte, was ich tat. Deshalb versuche er, mich erst einmal über diese Anschrift zu erreichen. Ob er irgendetwas für mich tun könne? Sein Geschäft liefe ganz gut. Er erwähnte Neuigkeiten über gemeinsame Freunde. Ich musste den Brief mehrmals lesen, bis ich begriff, was darin stand. Bestimmt vier, fünf Mal. Dann legte ich ihn in die Schreibtischschublade.
Meine Exfrau schrieb mir ebenfalls. Es ging um irgendwelche konkreten Dinge. Auch ihr Ton war ganz und gar pragmatisch. Am Schluss erwähnte sie, dass sie wieder heiraten würde. Jemanden, den du nicht kennst, schrieb sie. Und vermutlich auch nie kennen lernen wirst, hätten ihre schroffen Zeilen weiter lauten können. Was übrigens bedeutete, dass sie sich von dem Typen getrennt hatte, mit dem sie zum Zeitpunkt unserer Scheidung zusammen gewesen war. Na ja, kein Wunder, dachte ich. Ich kannte ihn recht gut, eine Kanone war er nicht gerade. Er spielte Jazzgitarre, war jedoch nicht sonderlich begabt. Auch als Mensch war er ziemlich fade. Mir war schleierhaft, was sie an ihm fand – aber das war schließlich deren Problem. Um mich mache sie sich keine Sorgen, schrieb sie. Sie sei überzeugt, es würde mir gut gehen, egal, was ich anpackte. Sie spare sich die Sorgen lieber für diejenigen auf, die zukünftig in meinen Bannkreis gerieten. Darüber mache sie sich in letzter Zeit ziemlich viele Gedanken.
Ich las den Brief mehrmals und legte ihn dann ebenfalls in die Schublade.
So floss die Zeit dahin.
Finanziell gab es keine Probleme. Ich hatte genug Ersparnisse, um ein halbes Jahr davon zu leben, und über später zerbrach ich mir jetzt nicht den Kopf. Der Winter war vorbei, der Frühling hielt Einzug. Ein warmes, friedliches Licht durchflutete mein Zimmer. An dem Einfallswinkel der Sonnenstrahlen konnte ich ablesen, wie der Sonnenstand sich allmählich veränderte. Der Frühling weckte alte Erinnerungen. An Menschen, die mich verlassen hatten oder gestorben waren. Ich dachte an die Zwillinge. Ich hatte mit den beiden Frauen eine Weile zusammengelebt. 1973, glaube ich. Damals wohnte ich neben einem Golfplatz. Bei Sonnenuntergang sind wir immer über den Zaun geklettert, um auf dem Gelände umherzuschweifen und liegen gelassene Golfbälle aufzulesen. Die Abenddämmerung im Frühling erinnerte mich an solche Szenen. Wohin sind sie alle entschwunden?
Eingang und Ausgang.
Mir fiel die Bar ein, in der ich früher mit dem inzwischen verstorbenen Freund verkehrt hatte. Wir sind dort oft versackt. Im Nachhinein betrachtet, war es die substantiellste Zeit meines bisherigen Lebens gewesen. Komisch. Ich erinnere mich auch an die Musik von damals. Wir waren noch Studenten. Haben dort Bier getrunken, Zigaretten geraucht. Wir brauchten diesen Ort. Um Gespräche zu führen. Worüber wir uns unterhalten haben, weiß ich nicht mehr. Nur noch, dass wir reichlich Gesprächsstoff hatten.
Und nun ist er tot.
Er hatte sich viel aufgehalst und ist dann gestorben.
Eingang und Ausgang.
Der Frühling machte sich deutlich bemerkbar. Der Wind roch anders. Sogar die nächtliche Dunkelheit änderte ihre Nuance. Geräusche wechselten ihre Klangfarbe. Der Frühsommer kündigte sich bereits an.
Ende Mai starb mein Kater. Plötzlich und unerwartet, ohne Vorzeichen. Ich wachte eines Tages auf und fand ihn zusammengekauert in der Küchenecke, tot. Vermutlich hatte er nicht viel gemerkt. Der Kadaver war starr wie ein kaltes Brathähnchen, das Fell wirkte noch schmutziger als zu Lebzeiten. Sein Name war Sardine. Er konnte nicht gerade von sich behaupten, ein glückliches Leben hinter sich zu haben. Von niemandem wirklich geliebt, hatte auch er vermutlich niemanden wirklich geliebt. Wie resigniert er einen immer angeschaut hatte, als wollte er sagen: Was habe ich noch zu verlieren? Solch einen Blick findet man wohl selten bei Katzen. Na ja, nun war er tot. Einmal tot, hat man wenigstens nichts mehr zu verlieren. Das ist der Vorzug am Totsein.
Ich stopfte den Kadaver in eine SEIBU-Papiertüte, die ich auf dem Rücksitz meines Wagens verstaute, und fuhr zu einer Eisenwarenhandlung, um eine Schaufel zu besorgen. Nach langer Zeit schaltete ich wieder einmal das Radio ein und hörte Rock, während ich westwärts fuhr. Es lief hauptsächlich öde Popmusik: Fleetwood Mac, ABBA, Melissa Manchester, Bee Gees, KC and the Sunshine Band, Donna Summer, Eagles, Boston, Commodores, John Denver, Chicago, Kenny Loggins … Eine Musik wie Schaum, die sich aufplusterte und wieder verschwand. Der reinste Schrott! Müllreife Massenware, um Teenagern ihr bisschen Kleingeld aus der Tasche zu ziehen.
Plötzlich verspürte ich Wehmut.
Die Zeiten haben sich eben geändert. Nicht mehr und nicht weniger.
Ich versuchte mich an hohles Zeug zu erinnern, das wir als Teenager gehört hatten: Nancy Sinatra. Schrott. The Monkees – oh Graus. Selbst Elvis hatte eine Menge Schund fabriziert. Wen gab’s noch? Trini Lopez. Pat Boone. Die meisten Stücke von ihm erinnerten mich an Gesichtsseife. Fabian, Bobby Rydall, Annette. Und nicht zu vergessen: Herman’s Hermits. Eine echte Katastrophe.
Alles, was mir in den Sinn kam, waren schwachsinnige englische Bands, die wie Pilze aus dem Boden geschossen waren.
Lange Mähnen und ausgeflippte Klamotten. Welche fallen mir denn noch ein? Honeycombs, Dave Clark Five, Gerry & The Pacemakers, Freddy & The Dreamers und so weiter und so fort.
Jefferson Airplane – steife Leichen. Tom Jones – wenn ich nur den Namen höre, werde ich starr vor Entsetzen. Engelbert Humperdinck, der hässliche Klon von Tom Jones. Herp Albert & The Tijuana Brass, bei denen jedes Stück nach Kaufhausgedudel klingt. Simon & Garfunkel, die beiden Scheinheiligen. Und Jackson Five, voll neurotisch.
Alles Mist.
Es hat sich nichts geändert. Immer und immer wieder das Gleiche. Nur die Jahreszahlen wechseln, und die Interpreten werden ausgetauscht. Solch schwachsinnige Wegwerfmusik gab es zu allen Zeiten und wird es immer geben. So sicher wie der Mond die Gezeiten bestimmt. Völlig gedankenverloren hatte ich bereits eine ziemliche Strecke zurückgelegt. Irgendwann lief Brown Sugar von den Stones. Ich musste lächeln. Supersong. Die Musik taugte was. Brown Sugar – wenn mich nicht alles täuscht, war der Song 1971 in den Hitparaden gewesen. Aber ganz sicher war ich mir da nicht. Könnte auch 1972 gewesen sein. Na ja, ist ja auch egal. Warum versuche ich mich überhaupt so pedantisch an die Jahreszahlen zu erinnern? Spielt doch sowieso keine Rolle.
Etwas weiter in den Bergen fuhr ich von der Autobahn runter und suchte ein geeignetes Wäldchen für das Begräbnis. In geraumem Abstand zur Straße buddelte ich ein Loch von einem Meter Tiefe, in dem ich die SEIBU-Papiertüte mit Sardine vergrub. Ich warf Erde auf das Grab. Tut mir leid, so läuft das nun einmal bei uns, verabschiedete ich mich von dem kleinen Kerl. Während ich ihn beerdigte, zwitscherten die ganze Zeit Vögelchen. Wie das obere Register eines Flötenkonzerts.
Nachdem ich das Grab zugeschüttet hatte, warf ich die Schaufel in den Kofferraum und fuhr zurück auf die Autobahn. Ich dachte an nichts, lauschte nur der Musik. Rod Stewart … J. Geils-Band. Dann kündigte der DJ einen Oldie an: Born to lose von Ray Charles. Ein melancholischer Song: Born to lose … and now I’m losing you. Das Lied machte mich richtig traurig. Mir war zum Heulen zumute. Manchmal reicht eine Kleinigkeit, um einen an der empfindlichsten Stelle im Herzen zu treffen. Ich hielt an einer Raststätte und schaltete das Radio aus. Nachdem ich im Restaurant ein Gurkensandwich und Kaffee bestellt hatte, ging ich erst mal auf die Toilette, um mir den Dreck von den Händen zu waschen. Ich nahm nur einen lustlosen Bissen von dem Sandwich, trank jedoch zwei Tassen Kaffee.
Was mochte der Kater wohl gerade in diesem Moment tun? Da unten im Dunkeln. Das Aufklatschen der Erde auf der Papiertüte hallte noch in meinem Kopf. Doch das ist der Gang der Dinge. Für mich nicht anders als für dich, Kumpel.
Ich brachte etwa eine Stunde in dem Restaurant zu und starrte gedankenverloren auf mein Sandwich. Bis eine Kellnerin im violetten Dress kam und mich zaghaft fragte, ob sie abräumen könne.
Na dann, dachte ich. Höchste Zeit für mich, ins wirkliche Leben zurückzukehren.
3
Es bedarf keiner großen Anstrengung, um in dem riesigen Ameisenhaufen einer hochkapitalistischen Gesellschaft Arbeit zu finden. Sofern man nicht allzu anspruchsvoll ist.
Als ich noch mein eigenes Büro besaß, war ich mit editorischer Arbeit beschäftigt, schrieb aber auch selbst allerhand. Dabei lernte ich einige Leute aus dieser Branche kennen. Als freischaffender Autor meinen Lebensunterhalt zu verdienen war nicht so schwierig. Ich war ohnehin ein bescheidener Mensch.
Ich kramte mein Adressbuch hervor und telefonierte umher, um mich direkt nach Aufträgen zu erkundigen. Ich erzählte, dass ich aus bestimmten Gründen eine Weile pausiert hätte, jetzt aber wieder Arbeit annähme. Prompt bekam ich einige Angebote, wenn auch nicht besonders interessante. Meistens handelte es sich um Lückenfüller für PR-Magazine und Firmenbroschüren. Ganz vorsichtig ausgedrückt, war die Hälfte der von mir verfassten Manuskripte ohne Sinn und Zweck, wertloses Zeug, das niemandem etwas nützte. Die reinste Verschwendung von Papier und Tinte. Aber ich erledigte die Arbeit gewissenhaft, beinahe mechanisch, ohne nachzudenken. Zuerst war die Arbeitsbelastung geringfügig, nur ein paar Stunden am Tag. Anschließend schlenderte ich draußen herum oder sah mir einen Film an. Ich habe eine Menge Filme gesehen. In den ersten drei Monaten nahm ich das alles sehr gelassen hin. Ich war erleichtert, mich langsam wieder in der Gesellschaft eingefunden zu haben.
Zu Anfang des Herbstes begann sich die Situation auf einmal zu ändern. Die Aufträge nahmen schlagartig zu. Das Telefon klingelte unentwegt, mein Briefkasten quoll über. Ich musste andauernd zu Besprechungen oder zu irgendwelchen Geschäftsessen. Man behandelte mich zuvorkommend und versprach mir noch mehr Arbeit.
Das hatte einen einfachen Grund. Ich war nie sehr wählerisch bei dem, was ich tat. Ich war mit allem einverstanden, hielt meine Termine ein, beklagte mich nie, schrieb lesbar. Kurzum, ich war ein gewissenhafter Mensch. Wo andere Kollegen schluderten, leistete ich manierliche Arbeit. Ich verzog nie eine Miene, auch nicht, wenn das Honorar niedrig war. Wenn nachts um halb drei ein Anruf kam, ob ich bis sechs Uhr morgens zwanzig Seiten (zum Thema Vorteile analoger Uhren oder Der Charme von Frauen in den Vierzigern oder Die Schönheit von Helsinki, wo ich natürlich nie gewesen bin) abliefern könne, war ich schon um halb sechs damit fertig. Und wenn sie mich um eine Überarbeitung baten, hatte ich das bis sechs Uhr erledigt. Kein Wunder, dass ich einen guten Ruf hatte.
Es war wie Schneeschaufeln.
Wenn es schneite, leistete ich hocheffiziente Räumarbeit.
Ohne ein Fünkchen Ehrgeiz, ohne die geringste Erwartung. Es ging mir lediglich darum, Dinge systematisch zu erledigen, eins nach dem anderen. Manchmal fragte ich mich natürlich, ob ich mein Leben nicht damit verplemperte. Aber abgesehen davon, so lautete dann mein Fazit, hatte ich kein Recht, mich darüber aufzuregen, dass Papier und Tinte verschwendet wurden. Wir leben schließlich in einer hochkapitalistischen Gesellschaft. Verschwendung gilt hier als höchste Tugend. Politiker nennen es »Verfeinerung des einheimischen Konsums«. Ich hingegen nenne es sinnlose Verschwendung. Die Auffassungen unterscheiden sich eben. Doch trotz dieser Differenzen ist es nun einmal die Gesellschaft, in der wir leben. Wenn mir das nicht passt, kann ich ja auswandern, nach Bangladesch oder in den Sudan.
Ich brannte nicht gerade darauf, in Bangladesch oder im Sudan zu leben.
Also erledigte ich stillschweigend meine Arbeit.
Inzwischen ging es nicht mehr nur um Werbetexte, sondern ich bekam auch Aufträge von Zeitschriften. Komischerweise meist von Frauenmagazinen. Ich führte Interviews, verfasste unbedeutende Reportagen. Verglichen mit der PR-Arbeit war das hier noch unbefriedigender. Die Art der Magazine brachte es mit sich, dass meine Interviewpartner meistens Leute aus dem Showbusiness waren. Egal was ich sie fragte, ich erhielt nur stereotype Antworten. Man wusste schon im Voraus, was kam. Im schlimmsten Fall bestand der Manager darauf, die Fragen vorgelegt zu bekommen. Also kam ich grundsätzlich mit einem geschriebenen Konzept. Als ich eine siebzehnjährige Sängerin etwas fragte, das nicht auf der Liste stand, schaltete sich der Manager sogleich entrüstet ein: »Das war nicht vereinbart, sie muss darauf nicht antworten.« Na toll. Das war ja richtig besorgniserregend. Ich fragte mich, ob das Mädchen ohne den Beistand ihres Managers wohl sagen durfte, welcher Monat auf Oktober folgt. Und so was nannte sich nun Interview. Ich tat jedenfalls mein Bestes. Für jedes Gespräch bereitete ich mich gründlich vor, sondierte Quellen und überlegte mir Fragen, die sonst niemand stellen würde. Ich gab mir Mühe, den Artikel geschickt aufzubauen. Nicht etwa, dass diese Anstrengungen besondere Beachtung fanden, ein Wort des Lobes hörte ich eigentlich nie. Ich legte mich einzig und allein so ins Zeug, um mir selbst eine Freude zu machen. Reine Selbstdisziplin. Um meine aus der Übung gekommenen Finger und meinen Kopf mit praktischen – und nach Möglichkeit harmlosen – Arbeiten zu trainieren.
Soziale Rehabilitation.
Ich war so beschäftigt wie nie zuvor im Leben. Nicht nur mit doppelten und dreifachen Mengen an regulärer Arbeit, sondern häufig auch mit Überraschungsaufträgen. Unfehlbar erreichten mich all die unbequemen Jobs, für die sich sonst niemand fand. Meine Rolle in dieser Gesellschaft ähnelte einem Schrottplatz am Rande der Stadt. Alles, was irgendwie Unannehmlichkeiten bereitete, wurde bei mir abgeladen. In tiefster Nacht, wenn alles fest schlief. So wiesen meine Bankkonten bald astronomische Summen auf, zumal ich keine Zeit hatte, das Geld auszugeben. Als ein Bekannter mir ein billiges Angebot machte, entledigte ich mich meiner alten Karre, die mir ohnehin nur Probleme bereitete, und kaufte seinen Subaru Leone, das vorletzte Modell. Er hatte nur wenige Kilometer auf dem Tacho, besaß eine Stereoanlage und Air-Conditioning. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen solchen Wagen fuhr. Außerdem nahm ich mir ein Apartment in Shibuya, näher zur Innenstadt. Es war ein bisschen laut – die Autobahn führte direkt an meinem Fenster vorbei –, aber man gewöhnte sich daran. Ansonsten war es ganz akzeptabel.
Ich schlief mit ein paar Frauen, die ich über die Arbeit kennen gelernt hatte.
Soziale Rehabilitation.
Ich wusste genau, mit welchen Mädchen ich schlafen sollte. Auch, mit welchen ich schlafen konnte. Vielleicht sogar, welche ich unbedingt meiden sollte. Mit zunehmendem Alter entwickelte ich dafür einen Instinkt. Ich wusste auch, wann die Zeit reif war, Schluss zu machen. Sodass man im Guten auseinander ging. Ganz reibungslos. Niemand war gekränkt, auch ich nicht. Das Einzige, was mir dann fehlte, war das Herzflimmern.
Die intensivste Beziehung hatte ich zu jener Frau, die beim Fernmeldeamt arbeitete. Ich hatte sie auf einer Silvesterparty kennen gelernt. Wir waren beide ziemlich beschwipst, flirteten miteinander, verstanden uns gut und landeten dann in meinem Apartment. Sie war intelligent und hatte tolle Beine. Mit meinem neuen Gebrauchtwagen machten wir allerlei Ausflüge. Sie rief an, wenn sie Lust hatte, vorbeizukommen und die Nacht mit mir zu verbringen. Sie war die Einzige, auf die ich mich jemals eingelassen hatte. Wir wussten beide, dass diese Art von Beziehung zu nichts führte. Es war wie eine Art Gnadenfrist des Lebens, die wir miteinander teilten. Seit langer Zeit kehrte wieder Frieden in meine Seele ein. Wir schmusten und wisperten miteinander. Ich kochte für sie, wir tauschten Geburtstagsgeschenke aus. Wir gingen in Jazzclubs und tranken Cocktails. Wir stritten nicht, kein einziges Mal. Jeder wusste genau, was er von dem anderen wollte. Und so endete es auch. Eines Tages hörte es ganz plötzlich auf, wie ein Film, der von der Spule hopst.
Ich empfand eine unerwartete Leere, nachdem sie fortgegangen war. Eine Weile fühlte ich mich ganz hohl. Denn schließlich war es nie ich, der fortging, sondern es waren stets die anderen. Immer wieder werde ich verlassen, um mit einer verlängerten Galgenfrist zurückzubleiben. Ein unwirkliches Leben, das dennoch real ist.
Doch das war nicht der Hauptgrund für mein Gefühl der Leere.
Das eigentliche Problem war, dass ich sie nicht wirklich begehrt hatte. Ich mochte sie, war gern mit ihr zusammen. Wenn sie bei mir war, verbrachten wir eine angenehme Zeit. Sie weckte in mir zärtliche Gefühle. Doch der springende Punkt war, ich begehrte sie nicht. Schon drei Tage, nachdem sie fortgegangen war, war mir das endgültig klar. Letztendlich befand ich mich tatsächlich auf dem Mond, wenn ich mit ihr zusammen war. Während ich ihre Brüste an meinem Körper spürte, sehnte ich mich in Wirklichkeit nach etwas anderem.
Es dauerte vier Jahre, bis ich mein inneres Gleichgewicht wiederfand. Gewissenhaft erledigte ich jeden einzelnen Auftrag, und die Leute fassten Vertrauen zu mir. Nicht viele, aber einige fanden mich sogar sympathisch. Das reichte natürlich nicht aus. Nicht im Geringsten. Im Grunde hatte ich meine ganze Zeit damit verbracht, am Ende doch wieder am Ausgangspunkt zu landen.
Na schön, dachte ich, vierunddreißig und alles fängt wieder bei null an. Wie sollte ich es denn sonst anstellen? Was sollte ich als Nächstes tun?
Es erforderte nicht viel Überlegung. Ich wusste es bereits. Die Antwort schwebte über meinem Haupt wie eine düstere, schwere Wolke. Ich musste endlich zur Tat schreiten, anstatt die Sache Tag für Tag aufzuschieben. Ich musste zum Hotel Delfin. Wo alles begonnen hatte.
Vor allem musste ich sie dort treffen. Die Frau, die mich zum ersten Mal dorthin lotste, jenes exklusive Callgirl. Denn Kiki verlangte das jetzt von mir. (Anmerkung für den Leser: Einen Namen muss ich ihr schließlich geben, wenn auch nur einen vorläufigen. Sie heißt also Kiki – KIKI in Katakana-Schrift. Dass sie so heißt, erfuhr ich übrigens erst hinterher. Die näheren Umstände hierzu werde ich später erläutern, der Name sei jedoch jetzt schon verraten: Kiki. Zumindest war das der Name, den sie in ihrem bizarren Gewerbe trug.) Kiki besaß den Schlüssel für den Anlasser. Ich musste sie noch einmal zurückrufen. In dieses Zimmer, wohin niemand zurückgekehrt ist. Ich wusste nicht, ob es klappen würde. Aber auf keinen Fall konnte ich es unversucht lassen. Denn dort würde ein neuer Zyklus beginnen.
Ich packte meine Sachen, erledigte meine restliche Arbeit mit doppelter Geschwindigkeit und sagte weitere Aufträge ab, die ich mir im Terminkalender für den nächsten Monat vorgemerkt hatte. Am Telefon erklärte ich allen, ich müsse Tokyo für einen Monat aus familiären Gründen verlassen. Ein paar Redakteure regten sich auf, doch schließlich war es das erste Mal, dass ich sie hängen ließ. Außerdem hatte ich ihnen zum Umdisponieren genügend Zeit gelassen. Am Ende waren alle einverstanden. In einem Monat sei ich ja wieder da, versprach ich ihnen. Dann flog ich nach Hokkaido. Das war Anfang März 1983. Es wurde natürlich nichts daraus, dass ich nach einem Monat vom Kriegsschauplatz heimkehrte.
4
Ich mietete für zwei Tage ein Taxi und fuhr mit dem Fotografen durch das verschneite Hakodate, wo wir ein Restaurant nach dem anderen inspizierten.
Meine Recherchen waren stets systematisch und effizient. Das Wichtigste bei diesem Job sind die Vorarbeiten und ein genau festgelegter Zeitplan. Damit ist quasi alles getan. Für Leute wie mich, die das Material im Vorfeld gründlich sichten, gibt es Organisationen, die einem die Recherche abnehmen. Eine Mitgliedschaft mit Jahresbeitrag reicht aus, und sie besorgen einem fast alles. Für eine Studie über Restaurants in Hakodate zum Beispiel können sie eine Menge Informationen beisteuern; sie benutzen Großrechner und holen sich aus dem Informationslabyrinth die notwendigen Details. Die Ausdrucke werden einem dann sortiert ins Haus geliefert. Zugegeben, das kostet eine Stange Geld, aber die Zeitersparnis ist den Preis wert.
Zusätzlich suche ich noch selbst nach Informationen. Es gibt Fachbüchereien mit Schwerpunkt Reiseliteratur sowie Bibliotheken, die lokale Zeitungen und regionale Veröffentlichungen archivieren. Aus dieser Materialflut suche ich mir die vielversprechendsten Objekte heraus und erkundige mich telefonisch nach den Öffnungszeiten und Ruhetagen. Allein durch diese Vorbereitung erspare ich mir eine Menge Theater vor Ort. Dann zeichne ich eine Kalendertabelle in mein Notizbuch und trage die Termine für unsere täglichen Vorhaben ein. Auf dem Stadtplan markiere ich die Route. Unwägbarkeiten werden so auf ein Minimum reduziert.
Sofort nach unserer Ankunft in Hakodate klappern wir die Restaurants der Reihe nach ab. Es sind etwa dreißig. Wir nehmen stets nur ein paar Bissen zu uns, gerade so viel, um den Geschmack zu kosten, und lassen den Rest auf dem Teller. Verfeinerung des Konsums. In dieser Phase arbeiten wir noch inkognito, machen also keine Fotos. Erst nachdem wir das Lokal verlassen haben, sprechen wir über das Essen und beurteilen es auf einer Skala von eins bis zehn. Wenn das Restaurant gut ist, bleibt es auf der Liste, sonst wird es gestrichen. Wir rechnen damit, dass mindestens die Hälfte ausscheidet. Parallel dazu nehmen wir Kontakt zu Lokalblättchen auf und ergänzen unsere Liste mit deren Vorschlägen. Nachdem wir auch diese geprüft haben, sieben wir aus und wählen unsere Favoriten. Ich rufe dort an, nenne den Namen des Magazins und vereinbare einen Termin für eine Fotoreportage. Dazu brauchen wir insgesamt zwei Tage. Nachts im Hotelzimmer schreibe ich bereits den größten Teil des Artikels.
Am nächsten Tag spreche ich, während der Fotograf Aufnahmen von den Speisen und gedeckten Tischen macht, mit dem Wirt. Aber nur kurz. In drei Tagen ist alles unter Dach und Fach. Natürlich gibt es Kollegen, die noch flotter sind, aber sie machen keine Recherchen. Sie wählen eine Handvoll renommierter Lokale aus, klappern sie ab, oft sogar ohne einen Bissen zu kosten, und schreiben daraufhin ihren Kommentar. So kann man es natürlich auch machen. Offen gesagt, glaube ich nicht, dass es viele Leute gibt, die es so genau nehmen wie ich. Wenn man es zu ernst nimmt, artet es in reinste Knochenarbeit aus, und wenn man zu lax damit umgeht, ist es Schluderei. Aber ob man sich nun Mühe gibt oder nicht, im Endeffekt bemerkt kaum jemand den Unterschied. Zumindest oberflächlich betrachtet. Bei genauerem Hinsehen entdeckt man die feinen Nuancen schon.
Es ist nicht meine Absicht, damit zu prahlen.
Ich wollte lediglich einen groben Eindruck von meinem Job vermitteln, von der Art Verschwendung, mit der ich zu tun habe.
Ich hatte mit dem Fotografen schon öfter zusammengearbeitet und kam gut mit ihm klar. Wir sind ein gutes Team. Richtige Profis. Unsere Aufträge erledigen wir flink und effizient wie Leichenbestatter in weißen Handschuhen, großem Hygienemundschutz und makellosen Tennisschuhen. Ohne überflüssige Worte respektieren wir uns gegenseitig. Wobei wir uns durchaus darüber im Klaren sind, dass unser Tun bedeutungslos ist und nur dem Broterwerb dient. Dennoch leisten wir manierliche Arbeit, egal worum es geht. In diesem Sinne sind wir echte Profis. Bereits in der dritten Nacht stellte ich das Manuskript fertig.
Der vierte Tag war freigehalten, für alle Fälle.
Da die Arbeit nun beendet war und wir nichts mehr zu tun hatten, mieteten wir ein Auto und fuhren ins Umland zum Skilaufen. Am Abend saßen wir über einem köchelnden Eintopf und tranken gemütlich Sake. Einen Tag ausspannen. Ich übergab dem Fotografen mein Manuskript, und das war’s. Meine Arbeit war damit erledigt, von jetzt an mussten sich andere damit befassen. Bevor ich mich schlafen legte, rief ich noch die Auskunft in Sapporo an und erkundigte mich nach der Nummer vom Hotel Delfin. Und schon hatte ich sie. Ich saß auf dem Bett und seufzte. Es existierte also noch, hatte sich nicht unterkriegen lassen. Welche Erleichterung! Das Gegenteil hätte mich keineswegs überrascht, bei einem derart skurrilen Hotel. Ich holte tief Luft, wählte die Nummer – und sofort hob jemand ab. Als ob man auf dieses Klingeln gewartet hätte. Ich war perplex. Das ging mir ein bisschen zu glatt.
»Dolphin Hotel, hallo?«, meldete sich eine sanfte Stimme.
Es war die Stimme einer Frau. Eine Frau? Wieso das? Soweit ich mich erinnern konnte, hatte ich an der Rezeption nie ein weibliches Wesen erblickt. Sicherheitshalber überprüfte ich die Adresse. Ja, es war die altbekannte Anschrift. Vielleicht hatte man eine junge Frau eingestellt, die Nichte des Direktors oder so. Also nichts Ungewöhnliches. Ich sagte ihr, dass ich gern ein Zimmer reservieren würde.
»Vielen Dank«, sagte sie patent. »Einen Moment bitte, ich verbinde Sie mit unserer Zimmerreservierung.«
Unsere Zimmerreservierung? Jetzt war ich völlig platt. Das überstieg mein Fassungsvermögen. Was zum Teufel war mit dem alten Laden geschehen?
»Zimmerreservierung. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Was kann ich für Sie tun?« Diesmal meldete sich ein junger Mann. Die flinke, zuvorkommende Stimme eines professionellen Hotelangestellten. Komisch, komisch. Ich reservierte ein Zimmer für drei Nächte, nannte meinen Namen und meine Tokyoter Telefonnummer.
»Geht in Ordnung. Für drei Nächte, ab morgen. Ein Einzelzimmer steht für Sie bereit«, bestätigte er.
Mir fiel nichts anderes ein, als mich zu bedanken. Irritiert legte ich auf. Jetzt verstand ich überhaupt nichts mehr. Wie hypnotisiert starrte ich auf das Telefon. Als wartete ich darauf, dass gleich jemand zurückriefe, um mich aufzuklären. Aber nichts dergleichen geschah. Ach, es wird sich schon alles zeigen, beruhigte ich mich. Sobald ich an Ort und Stelle wäre. Ich musste nur hingehen. Jedenfalls konnte ich mich nicht davor drücken. Denn eine Alternative gab es nicht.
Ich rief die Hotelrezeption an und erkundigte mich nach dem Zugfahrplan nach Sapporo. Es gab einen Express am Vormittag, der mir sehr gelegen kam. Dann bestellte ich beim Zimmerservice eine kleine Flasche Whiskey mit Wasser. Ich schaltete den Fernseher ein und schaute mir noch einen Film im Spätprogramm an. Es lief ein Western mit Clint Eastwood. Clint lächelte nicht ein einziges Mal. Auch kein verlegenes Grinsen. Einige Male versuchte ich ihm eins zu entlocken, indem ich ihm zulächelte, doch er blieb eisern und verzog keine Miene. Als der Film zu Ende war, hatte ich meine Ration Whiskey intus. Ich löschte das Licht und schlief durch bis zum Morgen. Traumlos.
Ich schaute aus dem Zugfenster und sah nur Schnee. Es war ein klarer, sonniger Tag. Das grelle Weiß blendete mich. Von den Mitreisenden schaute sonst niemand aus dem Fenster. Sie wussten alle, dass es draußen nur Schnee zu sehen gab.
Da ich noch nicht gefrühstückt hatte, ging ich kurz vor Mittag in den Speisewagen. Ich bestellte ein Bier und ein Omelett. Mir gegenüber saß ein Mann in den Fünfzigern in Anzug und Krawatte, der ebenfalls Bier trank und dazu ein Schinkensandwich aß. Er sah aus wie ein Maschinenbauingenieur und war auch einer, wie sich herausstellte. Er sprach mich zuerst an und erzählte mir, dass er Flugzeuge der Selbstverteidigungsstreitkräfte wartete. Dann erläuterte er mir ausführlich, wie sowjetische Kampfmaschinen und Bomber illegal in unseren Luftraum eindringen, was ihn jedoch nicht sonderlich zu bekümmern schien. Schon eher besorgt zeigte er sich über die Wirtschaftlichkeit von F4 Phantomjets. Er beklagte sich darüber, welche Unmengen an Treibstoff sie bei einem Manöver fraßen. Die reinste Verschwendung. »Wenn die Japaner sie hergestellt hätten, wären sie weitaus wirtschaftlicher. Und genauso leistungsfähig wie die F4. Wir könnten ohne weiteres Kosten sparende Kampfflugzeuge bauen, auf der Stelle.«
Daraufhin belehrte ich ihn, dass besagte Verschwendung eine Errungenschaft der hochkapitalistischen Gesellschaft sei. Die Tatsache, dass Japan von den USA Phantomjets kaufe und Unmengen an Treibstoff bei Manövern vergeude, gebe der Weltwirtschaft doch einen zusätzlichen Impuls, wodurch der Kapitalismus wiederum einen höheren Grad erreiche. Würde man der Verschwendung Einhalt gebieten, wäre eine Wirtschaftskrise die Folge und die globale Ökonomie würde zusammenbrechen. Verschwendung ist der Treibstoff, der Widersprüche erzeugt, und Widersprüche kurbeln die Wirtschaft an, und eine angekurbelte Wirtschaft führt wiederum zu mehr Verschwendung.
Mag schon sein, räumte der Ingenieur ein, aber da er als Kriegskind eine Zeit extremer Entbehrungen habe durchmachen müssen, könne er die neue soziale Struktur nur schwer begreifen. »Unsere Generation ist aus einem anderen Holz geschnitzt als ihr jungen Leute. Wir sind solche komplizierten Gedankengänge nicht gewohnt«, sagte er mit gequältem Lächeln. Ich konnte auch von mir nicht behaupten, dass mir diese Dinge geläufig waren, aber da ich befürchtete, die Konversation könnte sich noch weiter so hinschleppen, hielt ich vorsichtshalber den Mund. Nein, ich war nicht vertraut mit diesen Dingen. Ich war lediglich in der Lage, sie zu begreifen, zu akzeptieren. Zwischen diesen beiden Auffassungen gab es einen entscheidenden Unterschied. Doch ich ließ es dabei bewenden, aß mein Omelett auf und verabschiedete mich von dem Herrn.
Ich döste ein, und als ich nach einer halben Stunde wieder aufwachte, las ich während der restlichen Zugfahrt in der Jack-London-Biographie, die ich in einem Buchladen am Bahnhof in Hakodate erstanden hatte. Verglichen mit dem bewegten Leben dieses Schriftstellers wirkte meines verschlafen wie das eines Eichhörnchens, das in einer hohlen Eiche auf einer Walnuss dösend auf den Frühling wartete. Zumindest zeitweilig kam es mir so vor. Aber so sind Biographien nun einmal. Wer wäre denn auch am friedvollen Leben und Streben eines gewöhnlichen Angestellten der Stadtbücherei von Kawasaki interessiert? Kurzum, wir brauchen etwas zum Kompensieren.
In Sapporo angekommen, beschloss ich, einen gemütlichen Spaziergang zum Hotel zu machen. Es war ein windstiller, ruhiger Nachmittag, und ich hatte nur eine Schultertasche zu tragen. Die Luft war klirrend kalt. Am Straßenrand türmten sich schmuddelige Schneehaufen. Die Fußgänger kämpften sich durch den vereisten Matsch und achteten darauf, wo sie hintraten. Ein Schwarm Oberschülerinnen mit rosigen Wangen kam schnatternd vorbei; sie stießen Atemwölkchen aus, wie Sprechblasen. Ich schlenderte weiter und schaute mir das bunte Treiben an. Es war viereinhalb Jahre her, seit ich das letzte Mal in Sapporo gewesen war. Mir kam es viel länger vor.
Unterwegs machte ich Halt in einem Café und bestellte mir einen heißen, starken Kaffee mit Brandy. Alle Leute um mich herum gingen völlig selbstverständlich ihren Tätigkeiten nach, wie es sich in einer Stadt gehört. Liebespaare flüsterten miteinander, zwei Geschäftsmänner saßen über Zahlenkolonnen gebeugt, Studenten planten ihre nächsten Skiferien und diskutierten über das neue Police-Album. Wir hätten in irgendeiner japanischen Stadt sein können. Verlegte man diese Café-Szene nach Jokohama oder Fukuoka, es würde gar nicht auffallen. Trotzdem – oder gerade weil es überall gleich wirkte – fühlte ich mich schrecklich einsam, als ich in diesem Café vor meinem Getränk hockte. Ich war der einzige Außenseiter. Weder gehörte ich zu dieser Stadt noch zu diesem normalen Alltag.
Genauso wenig hatte ich natürlich in irgendeinem Café in Tokyo etwas verloren, aber dort fühlte ich mich nie so abgekapselt wie hier. Ich konnte meinen Kaffee trinken, ein Buch lesen, ganz normal meine Zeit verbringen, weil ich einfach, ohne groß nachdenken zu müssen, ein Teil des alltäglichen Lebens war.
Hier in Sapporo hingegen fühlte ich mich, wie gesagt, schrecklich isoliert. Ausgesetzt auf einer Polarinsel. Die Szenerie ist identisch. Egal wo ich bin, immer das gleiche Bild. Aber wenn ich unter die Oberfläche schaue, hat dieses Fleckchen Erde hier keine Verbindung zu anderen Orten, die ich kenne. So kommt es mir zumindest vor. Ähnlich, und doch ganz anders. Wie ein fremder Planet. Sprache, Kleidung, Mimik sind zwar wie bei uns, und doch stimmt etwas nicht. Ein Ort, an dem bestimmte Funktionen und Mechanismen überhaupt nicht gelten. Man muss sich praktisch jedes Mal aufs Neue vergewissern, welche nun Gültigkeit besitzen und welche nicht. Bei dem geringsten Faux pas würde sofort jeder merken, dass ich von einem anderen Stern komme. Sie würden sich erheben und mit dem Finger auf mich zeigen: Du bist anders. Dubistandersdubistandersdubistanders.
Gedankenverloren nippte ich an meinem Kaffee. Hirngespinste.
Es stimmte allerdings – ich war einsam. Mit niemandem verbunden. Das ist mein Problem. Ich gewinne mich mehr und mehr zurück. Aber ich bin mit niemandem verbunden.
Wann habe ich zuletzt ernsthaft einen Menschen geliebt?
Vor einer Ewigkeit. Zwischen einer Eiszeit und der nächsten. In einer fernen Vergangenheit. Vielleicht in der Jura-Periode. So lange mag das her sein. Und alles ist untergegangen. Dinosaurier, Mammuts, Säbelzahntiger. Auch die im Miyashita-Park detonierte Gasbombe. Dann schlug die Stunde der hochkapitalistischen Gesellschaft. Und in der bin ich mutterseelenallein zurückgeblieben.
Ich zahlte und ging. Ohne weiter nachzudenken, steuerte ich das Hotel an. Ich kannte den Weg nicht mehr so genau und hatte die leise Befürchtung, ich könnte es verfehlen. Doch meine Besorgnis war umsonst. Ich entdeckte es augenblicklich. Es hatte sich in einen sechsundzwanzigstöckigen, glitzernden Wolkenkratzer verwandelt: eine stromlinienförmige Symphonie aus Glas und Stahl im Bauhaus-Stil. Mit flatternden Fahnen aller Nationen entlang der Auffahrt. Taxis herbeiwinkende Türsteher in adretten Uniformen und ein gläserner Fahrstuhl, der zu einem Dachrestaurant hochglitt … Wem hätte das entgehen können? Auf den Marmorsäulen, die den Eingang flankierten, war das Bild eines Delfins eingraviert, unter dem die Inschrift stand: DOLPHIN HOTEL.
Ich stand wie angewurzelt davor und starrte mit offenem Mund an der Fassade hinauf. Als ich die Fassung wiedergewonnen hatte, stieß ich einen tiefen, langen Seufzer aus, der gut bis zum Mond hätte reichen können. Zu sagen, »ich war maßlos überrascht«, wäre maßlos untertrieben.
5
Ich konnte nicht ewig hier herumstehen und die Fassade anglotzen. Was immer das für ein Gebäude war, die Adresse stimmte, der Name ebenfalls. Außerdem hatte ich ein Zimmer reserviert. Also nichts wie rein.
Ich ging die leicht geschwungene Auffahrt hoch und trat durch die funkelnde Drehtür ein. Das Foyer war geräumig wie eine Turnhalle, die Decke schwebte hoch über dem Treppenhaus. Durch eine Glaswand, so hoch wie der Raum, flutete Sonnenlicht herein. In der Halle standen protzige Designersofas, zwischen denen großzügig Kübel mit Zimmerpflanzen verteilt waren. Ganz hinten befand sich ein nobles Café. Vermutlich eins von der Sorte, wo sie einem, wenn man ein Sandwich bestellt, vier Häppchen auf einem Silbertablett servieren. Angeordnet wie Visitenkarten und künstlerisch garniert mit Kartoffelchips und Delikatessgürkchen. Noch einen Kaffee dazu, und man bezahlt so viel wie für ein bescheidenes Mittagsmahl, von dem eine vierköpfige Familie satt werden würde. An der Wand prangte ein riesiger Ölschinken, mindestens drei Tatamimatten groß. Das Bild sollte offenbar eine Sumpflandschaft in Hokkaido darstellen. Imposant, schon allein wegen des Formats.
In der Halle herrschte Gedränge. Es bahnte sich offensichtlich eine Feier an. Elegant gekleidete Männer mittleren Alters belagerten die Sofas, nickend und großmütig lächelnd. Alle hatten auf gleiche Weise die Kinnlade vorgeschoben und die Beine übereinander geschlagen. Womöglich eine Zusammenkunft von Ärzten oder Hochschulprofessoren, überlegte ich. Abseits davon – oder vielleicht gehörten sie ja auch dazu – eine Gruppe formell gekleideter junger Frauen, die Hälfte davon im Kimono, die anderen im Kleid. Ein paar Ausländer mengten sich auch darunter. Ein typischer Geschäftsmann in dunklem Anzug, mit dezenter Krawatte und Aktenkoffer in der Hand, schien auf jemanden zu warten.
Kurzum, das Geschäft florierte im neuen Dolphin Hotel.