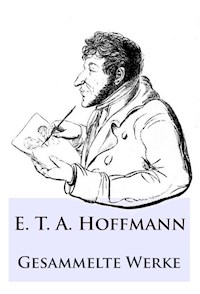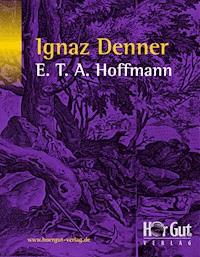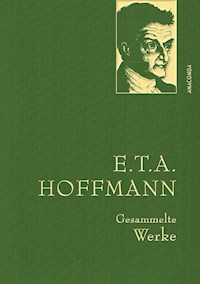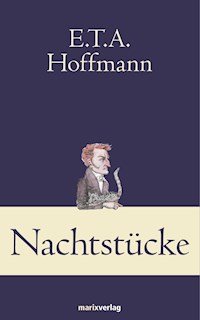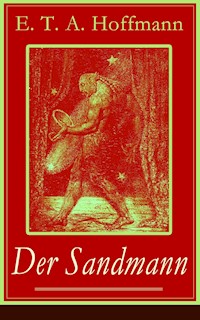Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: marixverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Autor:innenreihe
- Sprache: Deutsch
Im Mittelpunkt dieser Werkauswahl stehen die Erzählungen, Märchen und beiden Romane des romantischen Universalkünstlers Hoffmann. Der Musiker und Komponist ist auch in etlichen seiner Werke präsent. Ein prägendes Charakteristikum seiner Texte ist der nahtlose Übergang vom prosaischen Alltag hin zum Fantastischen. Seine Helden schweben nie nur in poetisch-magischen Räumen, stehen vielmehr auch im wirklichen Leben. Im Mittelpunkt vieler seiner Werke stehen oft idealistische Künstler, die am Alltag, an Nichtanerkennung und unerfüllter Liebe scheitern und dem Wahnsinn verfallen. Komik, Ironie, Groteske aber auch schauerliches Grauen bietet der Autor seinen Lesern, denen er zudem seine Auseinandersetzungen mit der zeitgenössischen Medizin und den Naturwissenschaften zumutet. Dieses Lesebuch bietet einen chronologischen Querschnitt durch das fantastische Prosawerk E.T.A. Hoffmanns und mit den ausgewählten Abbildungen wird auch der bedeutende Karikaturist gewürdigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
E.T.A. Hoffmann
Mit dem Kopf im Himmelund den Füßenauf dem Boden
Texte eines Universalkünstlers
Herausgegeben von Jörg Petzel und Bernd Hesse
Selbstporträt E.T.A. Hoffmanns
Inhalt
Einleitung
Ritter Gluck
Johannes Kreisler’s, des Kapellmeisters, musikalische Leiden
Beethovens Instrumentalmusik
Der goldene Topf
Die Elixiere des Teufels
Der Sandmann
Nußknacker und Mausekönig
Die Serapions-Brüder
Das Fräulein von Scuderi
Klein Zaches genannt Zinnober
Lebens-Ansichten des Katers Murr
Meister Floh
Des Vetters Eckfenster
Zeittafel
Literaturverzeichnis
Abbildungsnachweis
Danksagung
Einleitung
Hoffmanns Leben war das eines stets rastlos Suchenden, zwischen den Polen seines künstlerisch kompromisslosen Strebens und seiner konservativen richterlichen Amtsausübung Schwankenden, das Leben eines mit tiefer Leidenschaft Liebenden und an unerfüllter Liebe Leidenden, auf Unverständnis Stoßenden, der von Schmerz und Sehnsucht erfüllt war und im bürgerlichen Dasein gerade so viel Halt erfuhr, dass ihm das Leben nicht entglitt.
Ins Leben geworfen wurde Hoffmann am 24. Januar 1776 in der Französischen Gasse in Königsberg als Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann. Als er die Verantwortung für sein Leben in die eigenen Hände genommen hatte, entschied er sich 1805 aus Verehrung für Mozart dafür, den Vornamen Wilhelm durch Amadeus zu ersetzen. Mozart lernte er jedoch nie persönlich kennen. Umso größer war für Hoffmann später die Freude, als dessen Sohn auf einer Europa-Tournee in Berlin weilte und er sich in fröhlich beschwingter Runde als Gastgeber würdig erweisen konnte.
Noch war Hoffmann nicht der erfolgreiche Schriftsteller, Komponist, Musikkritiker, Zeichner und Jurist, als der er heute bekannt ist. Noch war ihm nicht bewusst, konnte er nicht wissen, welche Schicksalsschläge ihn treffen, an welchen Umständen er wachsen und welche ihn schier an den Rand der Verzweiflung treiben würden.
Seine Kindheits- und Jugendjahre waren alles andere als unbeschwert. Die Mutter stammte aus der in Königsberg angesehenen Juristenfamilie Doerffer. Der Vater, ebenfalls Jurist, entstammte einer Familie, deren Vorfahren väterlicherseits meist Pfarrer waren, die Theologie an der Königsberger Universität studiert hatten. Nachdem der Vater zum Hofgerichts-Advokaten avancierte, entsprach er für die Familie der Ehefrau den gesellschaftlichen Ansprüchen. Die Familienverhältnisse der Hoffmanns waren zerrüttet: Die Mutter kränkelte, wurde als schwermütig oder gar hysterisch beurteilt und litt unter dem geistvollen, aber trinkenden Vater. Aus der Ehe stammten neben Ernst zwei ältere Brüder, von denen der eine noch als Kind verstarb und der andere nach der Scheidung der Eltern mit dem Vater nach Insterburg zog.
Die Mutter kehrte nach der Trennung mit dem dreijährigen Ernst in den Schoß ihrer Familie zurück. Zum Hausstand des Doerfferschen Hauses gehörten neben ihnen Hoffmanns Großmutter, sein Onkel Otto und die unverheirateten Tanten Johanna Sophia und Charlotte Wilhelmine, die mehr Einfluss auf sein Leben haben sollten, als es nach ihrer Rolle im Hause den Anschein hatte. Je älter Hoffmann wurde, desto mehr litt er unter dem Regime des wegen Unvermögens als Justizrat früh aus dem Dienst entlassenen Onkels, den er auch »O-weh-Onkel« nannte und mit dem er sich ein Zimmer teilen musste. Schon die eigene Familie betrachtete mit Argwohn die Ähnlichkeit des jungen Hoffmanns mit dem unsteten, künstlerisch begabten, sich den äußeren Zwängen nicht beugen wollenden Vater. Hoffmann erschien das eintönige und anspruchslose Dasein des Onkels als ein Dahinvegetieren zwischen Mahlzeiten und Schlafen, gelegentlich unterbrochen von Hausmusik und Literatur zur Erbauung. Möglicherweise schwang in der Kritik gegenüber dem Onkel auch Hoffmanns jugendliche Rigorosität mit, wonach sich der Sinn des Lebens nur in tiefem, künstlerischem Schöpfertum widerspiegele. Otto Doerffer war es aber auch, der sich um die musische Erziehung des Neffen bemühte. Schon als kleiner Junge hatte Hoffmann diszipliniert den längsten Stücken der Hausmusik zu folgen, die der Onkel mit Musikfreunden unternahm. Wovon der Onkel nichts ahnte, das war die Schärfe der Beobachtung durch den kleinen Neffen, der in späteren Erzählungen den beim Spiel bis zur körperlichen Erregung gesteigerten Enthusiasmus der Musiker nachzeichnete. Der Junge spielte bald Klavier, Violine und Harfe. Daneben wurde er im Gesang ausgebildet. Gerne spielte er »auf einem alten Flügel phantasierend oder eigene Kompositionen versuchend«. Jedoch hatte Kunst in der Familie lediglich zur Bildung, Erbauung und Zerstreuung Platz. Dies ähnelt der Situation, die Hoffmann in Ritter Gluck seinem Ich-Erzähler in den Mund legt: »Ich lernte ehemals Klavierspielen und Generalbass, wie eine Sache, die zur guten Erziehung gehört …«
Die Vorstellung, Kunst als etwas anderes als ein Amüsement zu begreifen, mit und in ihr zu leben, eine alles verzehrende Leidenschaft für sie zu empfinden, die eigenen Kunstfertigkeiten zur Vervollkommnung zu treiben und darin völlig aufzugehen, war der Familie fremd.
Zu Theodor Gottlieb von Hippel, dem Neffen des gleichnamigen Stadtpräsidenten von Königsberg, entwickelte Hoffmann eine tiefe und unzertrennliche Freundschaft, die wie jede dauerhafte Beziehung von Zuneigung, gemeinsamen Interessen und gegenseitigem Verständnis, aber auch von gelegentlichen Missverständnissen und Unstimmigkeiten geprägt war. Und auch in der Einschätzung dieser Beziehung sollte die Familie im Weiteren noch einem Fehlurteil unterliegen. Selbst die Spiele mit Hippel standen unter der gestrengen Aufsicht der Familie. Die Jungen fanden für den »O-weh-Onkel« immer neue Namen; nach der Lektüre von Shakespeares Heinrich IV. und Die lustigen Weiber von Windsor sprang den Jungen die Ähnlichkeit des Onkels mit Falstaff ins Auge, weshalb für ihn auch Namen wie »Sir Ott« und der »dicke Sir« gefunden wurden. Neben Shakespeare war für Hoffmann auch die Lektüre der Werke unter anderem von Jean Paul, Sterne, Rousseau und Schiller prägend.
Peinlich genau plante Sir Ott zur Wahrung des bürgerlichen Scheins den Besuch bei Honoratioren der Stadt. Diese Tage, es war immer ein Mittwoch, boten die Möglichkeit, dem Drang, sich selbst auszuprobieren, wilde Musik zu spielen und herumzutoben, nachzugeben. Dem Urteile des Freundes Hippel zufolge war Hoffmanns Musik »genial, kühn, aber oft bizarr«.
Einzig die Tante, Johanna Sophia Doerffer, war aufgrund ihres geistreichen Wesens in der Lage, Hoffmanns Naturell zu erfassen. Die andere Tante, Charlotte Wilhelmine, war 1779 im Alter von dreiundzwanzig Jahren an Pocken verstorben. Bei Sophia fand der Junge den Halt und das Verständnis, die die Mutter wohl aufgrund ihres labilen Gesundheitszustandes nicht in der Lage war, dem Jungen zu bieten. Als Hoffmann heranwuchs, blieb sie die Vertraute auch seiner Schwächen. In der Jugendgeschichte des Kapellmeisters Kreisler in den Lebens-Ansichten des Katers Murr setzte er seinen Tanten ein rührendes Denkmal, indem er der dortigen Tante »Füßchen« (Kindersprache für Sophiechen) den Namen auf die jüngere Tante übertragen hatte. Hippel wunderte sich noch Jahre später in seinen Erinnerungen darüber, dass er Hoffmanns Mutter und Tante – er wusste wohl nichts von der Existenz der Tante Charlotte – in all den Jahren, in denen er im Doerfferschen Haus ein- und ausgegangen war, vielleicht drei- oder viermal zu Gesicht bekommen hatte. Der Lebensmittelpunkt der Damen war ihr Zimmer.
Hoffmann saß in der Königsberger Burgschule neben seinem Freund Hippel, der zwar ein wenig älter war als er, aber wegen der Zusammenfassung der Jahrgänge in demselben Raum unterrichtet wurde. In der Schule fiel der Junge kaum auf. Der quirlige Bursche, der schon in der Schulzeit die Gabe entwickelte, mit seinem beißenden Spott zu treffen, schien den Mitschülern wohl suspekt. Hippel, der bei seinem Onkel, dem Königsberger Stadtpräsidenten und Freund Immanuel Kants, lebte und streng auf eine Karriere im Staatsdienst vorbereitet wurde, war der sanfte und brave Junge, der Hoffmann beim Griechischen und Lateinischen half. Hoffmann hingegen war der, der bei gemeinsamen Unternehmungen die Initiative ergriff und den Freund mitriss.
Als sie heranwuchsen, weckte das hinter der Gartenmauer liegende Fräuleinstift mit den jungen Damen das Interesse der Burschen. Schnell war der Plan gefasst, einen unterirdischen Gang zu graben, um die Grazien beobachten zu können. Nach einigen Tagen anstrengender Arbeit durchkreuzte der »O-weh-Onkel« die Pläne: Er bemerkte den Gang. Die Jungen, von ihm zur Rede gestellt, behaupteten kühn, dass sie ihm eine Freude bereiten wollten und die Grube für eine seltene amerikanische Pflanze ausgehoben hatten. Der Onkel musste zwei Arbeiter beauftragen, die genügend Mühe obwalten lassen mussten, um den Gang aufzufüllen, die Erde zu verdichten und den Garten in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Hippel erwies sich auch in anderen Situationen als treuer Freund. Wenn Hoffmann wie zufällig Mädchen in den Straßen begegnen wollte, deren Weg er zuvor ausgespäht hatte, begleitete ihn Hippel und spendete Trost, wenn sie ihn nicht bemerkten oder seiner spotteten. Hoffmann empfand den eigenen Körper als Hemmnis gegenüber seinem Verlangen. Seinem Freunde Hippel gestand er: »Da ich sie einmal nicht durch die Annehmlichkeit meines Äußeren interessieren kann, so wollt ich, daß ich ein Ausbund von Häßlichkeit wäre …, damit ich ihr auffiele, damit sie mich wenigstens ansähe.« Dieses Gefühl der körperlichen Unzulänglichkeit thematisierte er in seiner gesamten künstlerischen Laufbahn. Seinen Höhepunkt erlangte diese Auseinandersetzung in dem Märchen Klein Zaches genannt Zinnober, in dem der ohnehin schon vom Pech verfolgten Bauernfamilie ein Wechselbalg »zu Schand und Spott des ganzen Dorfes« geboren wurde.
Wegen seines Alters verließ Hippel schon vor Hoffmann die Schule und wurde Student der Rechtswissenschaften an der Königsberger Universität. Der Familientradition folgend, schrieb sich auch Hoffmann im Wintersemester 1791/92 als Student der juristischen Fakultät der Albertus-Universität in Königsberg ein. Hoffmann sah das Studium der Rechtswissenschaften als sein Brotstudium an, das ihm künftig eine wirtschaftliche Unabhängigkeit als Basis für sein künstlerisches Schaffen bieten sollte. Es war eher eine Vernunftehe denn eine Liebesheirat. Und so notierte er: »Aus Überzeugung der Notwendigkeit studiere ich mein jus.« Gleichwohl lernte er zielstrebig und mit sehr viel Fleiß. Die Ausbildung an der Albertina entsprach der damaligen Üblichkeit mit vielen Vorlesungen und Lehrveranstaltungen zum Naturrecht, den Institutionen und Pandekten des römischen Rechts, aber auch schon dem modernen Preußischen Allgemeinen Landrecht. Immanuel Kant übte als Philosoph einen großen Einfluss auch auf die Professoren der juristischen Fakultät aus, die insbesondere das Naturrecht ausgerichtet an den philosophischen Grundsätzen des berühmtesten Lehrers dieser Universität lehrten. Bisher wird in vielen Beiträgen über die Studienjahre die These vertreten, dass Professor Daniel Christoph Reidenitz der Universitätslehrer war, der den größten Einfluss auf Hoffmann ausgeübt habe. Die neuesten Forschungsergebnisse der Autoren des vorliegenden Bandes gelangen jedoch zu der Erkenntnis, dass auch Professor Theodor Anton Heinrich Schmalz, der mit seiner Schrift zu politischen Vereinen im Zusammenhang mit der Demagogenverfolgung später eine unrühmliche Rolle spielte, eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für Hoffmanns Ausbildung an der Albertina gehabt haben dürfte. Überzeugte Kantianer waren zu Hoffmanns Studienzeiten diese beiden Professoren genauso wie das Gros des Lehrkörpers. Insoweit haben die Lehren Kants auch das Studium Hoffmanns geprägt, obwohl nicht nachgewiesen ist, dass er eine der Vorlesungen Kants besuchte. Hoffmann mühte sich fleißig, wie Generationen von Juristen vor und nach ihm. Auch Selbstzweifel hinsichtlich des Gelingens des doch so trockenen Studiums waren dem jungen Mann nicht fremd.
Das wahre Interesse Hoffmanns lag unzweifelhaft dennoch bei den Künsten. Er widmete sich weiter dem Musizieren, Komponieren, Schreiben und Zeichnen. Sein Musiklehrer wurde der Königsberger Organist und Komponist Christian Podbielski, der zunächst Theologie ebenfalls an der Albertina studiert hatte, später aber Organist am Königsberger Dom wurde. Die hier erworbenen Fähigkeiten versetzten den Studenten Hoffmann in die Lage, selbst als Musiklehrer fungieren zu können. Dies war weniger aus künstlerischer Selbstverwirklichung vonnöten als vielmehr dem Umstand geschuldet, dass der vom Vater zum Unterhalt gedachte Wechsel nur sehr schmal war und Hoffmann als Musiklehrer eine Chance sah, seine wirtschaftliche Lage zu verbessern.
Im Jahre 1792 zog eine Familie Hatt mit in das Doerffersche Haus in der Junkergasse; ein Ereignis, das in seinen Folgen für das weitere Leben des jungen Mannes prägend werden sollte. Der junge Student kannte die bildschöne und in ihrer Beziehung wenig glückliche Dorothea Hatt bereits, die verheiratet, Mutter von fünf Kindern und neun Jahre älter war als er. Sie war in jugendlichem Alter an einen mehr als doppelt so alten Kaufmann und Glücksritter verheiratet worden. Dora war in Königsberg keineswegs unbekannt, sie entstammte der zweiten Ehe ihres Vaters, des wohlhabenden Tuchhändlers Johann Friedrich Schlunck, mit der Kaufmannstochter Dorothea Adelgunde Horn. Nach dem Tode der zweiten Ehefrau heiratete Doras Vater mit einundsechzig Jahren die siebenundzwanzigjährige Tochter des Königsberger Professors Flottwell. Diese war bestrebt, die Stiefkinder eiligst aus dem Haus zu bekommen, und so war ihr der bis dahin glücklose Kaufmann und Spekulant Johannes Hatt, der seinem wirtschaftlich erfolgreichen Vetter nach Königsberg hinterhergezogen war, genau richtig. Johannes Hatt suchte eine Frau mit Kapital, die Stiefmutter wollte Dora schleunigst unter die Haube bringen.
Die Familie Doerffer verkehrte nun mit Dora Hatt und so kam es, dass die junge hübsche Dame auch zu Hoffmanns Konfirmation geladen wurde. Während die erwachsene Frau mit den übrigen Familienmitgliedern im Salon feierte, vergnügte Hoffmann sich allerdings mit seinem Freund Hippel in der kleinen Stube. Die freundschaftlichen Bande der Doerffers mit Dora Hatt wurden weiter gepflegt. So ergab es sich, dass die Familie Hatt bis zum Einzug ins eigene Haus für ungefähr zwei Jahre Mieter der Doerffers wurde.
Die reizende Hausgenossin »voll Sinn und Gefühl für die Künste« wünschte nun die Unterrichtung im Gesang und im Klavierspiel durch den musisch begabten jungen Jurastudenten. Es muss Hoffmann erschienen sein, als würde einem Dürstenden ein Kelch Wasser gereicht. Er verliebte sich unsterblich in seine ältere Schülerin, die den Überlieferungen zufolge den aktiveren Part in der sich entwickelnden Liebesbeziehung übernahm. Hoffmann weihte seinen treuen Freund Hippel in das Geheimnis seiner ersten großen Liebe ein. Überschattet war das Verhältnis durch die unglückliche Ehe der Frau Hatt, auf die auch noch andere Verehrer schauten. Und so berichtet Hoffmanns erster Biograf Hitzig, der auch ein Richterkollege und Freund Hoffmanns war, nach den Berichten Hippels: »… [E]r gab sich ihr mit der vollen Lebendigkeit frischer Jugend hin. … [I]n die Fülle des Genusses mischte sich die Gewissheit des sichern Verlustes.« Von Hippel stammt auch die Einschätzung, dass sein Freund durch diese Beziehung »schnell und über seine Jahre hinaus« reifte und sie auf sein »gesamtes Leben von dem entschiedensten Einflusse« war. Zwar verdankte er nach Ansicht des Freundes dieser Erfahrung »die vertraute Bekanntschaft mit den Tiefen des menschlichen Herzens«, die seinen Werken zugrunde liegt. Sie wurde Ursache für die »Zerrissenheit in seine[r] Seele …, deren Wunden bis an seinen Tod noch kenntlich waren«.
Die Angst vor Verlust schlich sich wieder und wieder in Hoffmanns Leben. Hippel beendete sein Jurastudium früher als Hoffmann und bewarb sich zur weiteren Ausbildung als Auskultator nach Marienwerder. Die Familie meinte, dass sich Hoffmann nun einen neuen Freund suchen müsse. Hoffmann aber hängte sein Herz nicht an viele Personen, nur die, die er in sein Herz schloss, blieben dort. Hippel blieb ein Freund für das gesamte Leben, bis hin zu Hoffmanns Totenbett. Zwischen ihnen entwickelte sich ein reger Briefverkehr, aus dem Hoffmanns literarisches Talent hervorscheint und der neben der tiefen Freundschaft der beiden Hoffmanns große Liebe zu Dora Hatt und seine Neigung zu den Künsten, insbesondere zur Musik, widerspiegelt. Jedoch hebt Hoffmann immer wieder das Zusammenspiel der Kunstformen hervor, in denen er sich weiterbildet: »Meine Musik – mein Malen – meine Autorschaft.« Zum Ende des Studiums schrieb er konzentriert an seinem ersten dreibändigen Roman Cornaro. Memoiren des Grafen Julius von S. Geschrieben in den Frühlingsmonden des Jahres 1795 und sandte die bis zum nächsten Brief fertiggestellten Seiten jeweils seinem Freund Hippel zur kritischen Rezension. Das große Thema dieses Romans, wie auch des folgenden Werkes Der Geheimnisvolle, das er einige Zeit später in Glogau weiterschrieb, aber wohl nicht vollendete, war vermutlich die Existenz von Geheimbünden, in deren Treiben die Protagonisten verwickelt wurden. Der erste Roman wurde vom Verleger zurückgewiesen, da Hoffmann als Verfasser anonym bleiben wollte. Beide Romane gingen im Verlauf der Zeit verschollen.
Das Verhältnis zu Dora Hatt wurde in Königsberg bekannt, als es zwischen Hoffmann und einem Rivalen zu Auseinandersetzungen um die Geliebte kam; ob es sich bei dem Widersacher um den Ehemann oder einen Nebenbuhler handelte, ist nicht bekannt. Die Streitigkeiten sollen in einem Duell gemündet haben.
Nach seinem Jurastudium begann Hoffmann den Dienst als Auskultator zunächst in Königsberg. Vor dem Hintergrund der bekannt gewordenen Affäre mit Dora Hatt ließ er sich an die Oberamtsregierung nach Glogau versetzen. Hier kam er im Hause seines Onkels Johann Ludwig Doerffer unter. Der Ortswechsel läutete dann auch das Ende der Beziehung zu Dora ein. Rückblickend betrachtete er das Verhältnis zu ihr im Verlaufe seines Lebens immer wieder aus verschiedenen Perspektiven. Von der melancholischen Fiktion, was gewesen wäre, wenn er sich entgegen allen Konventionen unumwunden zur Liebe bekannt hätte, bis hin zu einem scheinbaren Erfolg der Vernunft über die körperlichen Begierden wechselte seine Sichtweise. Dora blieb dabei aber immer eine der großen Leidenschaften seines Lebens. Auch hier war Hoffmann der Getriebene, der Zerrissene: Wirkliche Leidenschaften entbrennen und Hoffmann sollte noch einige Male in seinem Leben in Flammen aufgehen für die Frauen, mit denen er nicht nach den üblichen Konventionen verbunden war. Hoffmann brachte im Zusammenhang mit dem Ende der Beziehung zu Dora zum Ausdruck, nicht viel länger leben zu wollen. Die Forscher sind sich weitgehend einig darüber, dass dieses Verhältnis das Vorbild für eine später in der Erzählung Das Majorat beschriebene Beziehung war. Später ließ sich Dora Hatt scheiden und heiratete einen gegenüber Hoffmann noch um einige Monate jüngeren Mann.
Der Glogauer Teil der Verwandtschaft lag Hoffmann viel mehr: Hier war man offenherziger, freundlicher und seinen Interessen zugewandter, als es in Königsberg der Fall gewesen war. Eine der wenigen Personen, die Hoffmann in Glogau künstlerisch in ihren Bann ziehen konnte, war der Maler Molinary, der während seines dortigen Aufenthaltes von 1796 bis 1797 die Malereien einer Kirche bewerkstelligte. Durch seine Eigenart zog er nicht gerade die Gunst der Bewohner auf sich. Hoffmann ließ sich von solchen Ressentiments wenig beeindrucken. Er bewunderte die hingebungsvolle und alles um sich vergessende und verzehrende Künstlernatur Molinarys, verbrachte viele gemeinsame Abende mit ihm, erkannte auch dessen beinahe dämonischen Züge, wenn er bissig andere verhöhnte und »aus den sonst so schönen Augen oft eine gewisse boshafte Schadenfreude hervorstrahlte«. Von ihm lernte der für die Malerei begeisterte Hoffmann die Finessen der Wandmalerei, als er dem Künstler bei seinen Arbeiten in der Jesuitenkirche in Glogau half, obwohl er ahnte, dass ihm dies »wahrscheinlich juristischerseits übelgenommen werde!« Zwar wird in der Hoffmann-Literatur Molinary nur wenig wahrgenommen und meist auf seine Miniaturmalerei reduziert, von der Hoffmann allerdings begeistert war. Tatsächlich gehören Molinarys Werke heute jedoch zu den angesehensten Sammlungen der Welt, beispielsweise der Moskauer Tretjakow-Galerie. Molinary hatte während seiner späteren Schaffensphase in Russland mehrfach Zar Alexander I. porträtiert. Hoffmann zeichnete in seinem Nachtstück Die Jesuiterkirche in G. den zwischen Realität und Illusion schwankenden Maler Berthold mit Zügen Molinarys, verband sie mit eigenen Charaktermerkmalen und komponierte eine ständig unzufriedene, suchende Künstlerfigur, deren zerbrechliche Beziehung zur Erotik, sobald der Wunsch nach körperlicher Liebe erfüllt war, zur Entzauberung des Ideals führte.
Bald erweckte die im Hause des Onkels lebende Cousine Wilhelmine (Minna) Doerffer das Interesse des nun in Liebesdingen nicht mehr Unerfahrenen; beide verlobten sich im Januar 1798. Diese Beziehung war eine Vernunftbeziehung, die den Forschern immer wieder Rätsel aufgibt. Einiges spricht dafür, dass Hoffmann sie aus dem Gefühl heraus einging, mit der entfesselten Leidenschaft Schiffbruch erlitten zu haben. Nun gab es eine junge Frau, zu der er sich hingezogen fühlte. Sie entstammte dem »Gastnest«, wie er seinem Freund Hippel mitteilte. Seine Flügel, so meinte er resigniert, seien beschnitten. »Da bin ich hingeworfen an einem Platz, wo alles an einem seidnen Faden hängt – platzt er, so liegt der Herr RegierungsRath in spe im Dr..k!« Hoffmann band sich mit der Verlobung noch enger an die Familie des Onkels. Aber der war ein Karrierejurist und der noch wirtschaftlich abhängige Neffe heftete sich an dessen Fersen. Dass derlei Erwägungen, hätte Hoffmann sie angestellt, nicht völlig aus der Luft gegriffen wären, sollte die Zeit bald offenbaren.
Hoffmann schien in seiner eigenen künstlerischen Entwicklung zu stocken. Er widmete sich wieder intensiver seiner juristischen Ausbildung und lernte nun mit Eifer für das zweite Examen. Der Erfolg blieb nicht aus: Im Juni 1798 bestand Hoffmann das zweite juristische Examen »überall ausnehmend gut«. Zeitlich fiel dies mit der Versetzung des Onkels als Obertribunalsrat nach Berlin zusammen, weshalb sich Hoffmann für das Referendariat beim Kammergericht bewarb und mit seinen Verwandten nach Berlin zog.
Zuvor unternahm er mit dem Freund der Familie, der auch einer seiner Prüfer im Examen war, mit Oberamtsregierungsrat Jagwitz, den er später in den Serapionsbrüdern porträtieren wird, eine Reise ins Riesengebirge. Im Hinterkopf müssen dem jungen Juristen seine schriftstellerischen Ambitionen geschwirrt sein. Trotz der Ablehnung zur Veröffentlichung seines ersten Romans fasste er den Entschluss, ein Reisetagebuch zu führen und zu veröffentlichen. Der Weg der beiden Reisegefährten trennte sich und Hoffmann war, wohl auf Einfluss von Jagwitz, am Spieltisch zu etwas Geld gekommen – so jedenfalls steht es nach den Erzählungen unter den Serapionsbrüdern zu vermuten. So führte ihn seine Reise auch nach Dresden, wo er in der Galerie insbesondere die Werke der alten italienischen Meister Raffael, Correggio, Tizian und Battoni bewunderte. Er war von dem Eindruck so überwältigt, dass er meinte, auf dem Gebiet der Malerei nichts zu können, seine Farben wegwarf und wieder begann, Studien zu skizzieren. Auszüge aus seinen Reiseberichten sandte er an seine nun schon in Berlin weilende Verlobte Minna. Weder das Manuskript noch die Briefe sind erhalten geblieben; Minna soll sie vor Verärgerung vernichtet haben, als Hoffmann die Verlobung später aufkündigte.
In Berlin eröffnete sich für ihn ein völlig anderes kulturelles Leben; Besuche in Theatern, Opern und Ausstellungen wurden ihm zur Leidenschaft. Er wohnte mit der Familie des nun Geheimen Obertribunalrats Doerffer in einer herrschaftlichen Wohnung in der Leipziger Straße 66 in der Friedrichstadt, wo standesgemäße Gesellschaften stattfanden, bei denen auch Jean Paul anwesend war, mit dessen späterer Ehefrau Hoffmanns Verlobte befreundet war. Bei dem berühmten Kapellmeister und Komponisten Johann Friedrich Reichhardt, einem Landsmann aus Königsberg, der seines Amtes als Hofkapellmeister wegen seiner Begeisterung für die Französische Revolution enthoben worden war, nahm Hoffmann Unterricht im Komponieren und stellte 1799 sein Singspiel Die Maske fertig. Für das Textbuch zeichnete er die Sepia-Deckelzeichnungen und sandte dieses zusammen mit der Partitur der Königin Luise, der Gemahlin König Friedrich Wilhelms III., und verhoffte sich von ihr als Förderin der Künste die Aufführung seines Werkes beim Theaterdirektor Iffland durchzusetzen, was sie jedoch nicht unternahm. Aus den geplanten sechs Monaten, die Hoffmann zunächst für die Zeit des Referendariats veranschlagte, wurden so zwei Jahre. Er bestand 1800 das dritte Examen mit der Note »vorzüglich«.
Zu dieser Zeit wurden viele Assessoren in die polnischen Provinzen, das sogenannte Südpreußen, entsandt. So wurde auch Hoffmann im März 1800 zum Beisitzer der Regierung zu Posen mit uneingeschränkter Stimme ernannt. Die Provinz und die Stadt Posen gehörten seit der zweiten polnischen Teilung zu Preußen. Die Bevölkerung betrachtete die preußischen Beamten als Besatzer. Diese waren häufig jung und ungebunden, hatten ihre Familien hinter sich gelassen und sahen die Möglichkeit zu Ausschweifungen. Hitzig wird später anmerken, dass die Verlockungen durch Trinkgelage und hübsche polnische Frauen einen standhaften Charakter forderten; eine Forderung, die sein Freund Hoffmann kaum erfüllte. Der Philister Hitzig verstand seinen Freund in vieler Hinsicht kaum. Als erster Biograf balancierte er zwischen Freundschaft, Objektivität, eigenen Wertvorstellungen und gesellschaftlichen Konventionen; und niemandem wurde er auf diese Weise gerecht. Die leidenschaftliche Beziehung zu Dora Hatt verkommt so zu einer Randnotiz, weit entfernt von den Freuden, Hoffnungen und Schmerzen dieser ersten großen Liebe. Wegen der Eskapaden in Posen vermutete Hitzig mit den damaligen Gerüchten über eine angebliche Syphilis des Freundes: »Wir glauben auch ferner nicht zu irren, wenn wir in dieser Periode … den Keim zur schnellen Auflösung seines Körpers finden.« Um Spekulationen zum frühen Tod Hoffmanns gleich vorzubeugen: Wegen der Lähmungserscheinungen und weiteren üblichen Symptome wird heute davon ausgegangen, dass Hoffmann an einer degenerativen Erkrankung von der Art einer amyotrophen Lateralsklerose (ALS) litt. Zu seinen Posener Exzessen schrieb er dem Freunde Hippel: »Ein Kampf von Gefühlen, Vorsätzen pp, die sich gerade zu widersprachen, tobte schon seit ein paar Monathen in meinem Innern – ich wollte mich betäuben, und wurde das, was SchulRectoren, Prediger, Onkels und Tanten liederlich nennen. – Du weißt, daß Ausschweifungen allemahl ihr höchstes Ziel erreichen, wenn man sie aus Grundsatz begeht, und das war denn bey mir der Fall.«
Mit seinem Nachbarn Regierungsrat Johann Ludwig Schwarz arbeitete er an einer Kantate zur Feier des neuen Jahrhunderts, die am 31. Dezember 1800 in der Posener Ressource aufgeführt wurde. Von der Südpreußischen Zeitung wird die Musik des Regierungsassessors Hoffmann gelobt. 1801 wird Hoffmanns Singspiel, für das Goethes Scherz, List und Rache die Ideen für das Libretto lieferte, von der Döbbelin’schen Theatertruppe mehrmals in Posen aufgeführt. Jean Paul versuchte vergeblich, das Werk Goethe für eine Aufführung in Weimar schmackhaft zu machen. Leider sind Noten und Text dieses Singspiels nicht erhalten geblieben.
In Posen lernte Hoffmann die attraktive Marianna Thekla Michaelina Rorer kennen, die er immer Mischa nennen wird. In einem Brief an Hippel, dem gegenüber er sich sozial unterlegen zu fühlen scheint, behauptete er, dass sie die Tochter eines ehemaligen Stadtpräsidenten sei. Der Vater war wohl ein von den Preußen zwangspensionierter Magistratssekretär. Hoffmann löste die Verlobung mit Minna auf – was zu Verstimmungen im Verhältnis zur Familie und zu Jean Paul führte, dessen Frau mit Minna befreundet war – und heiratete Mischa im Juni 1802. Das musste plötzlich alles ganz schnell gehen, denn Hoffmann war mit seiner Beförderung zum Regierungsrat nach Płock versetzt worden, was er zu Recht als Strafversetzung betrachtete. Ursache dieser Versetzung war der Karikaturenskandal. Hoffmann hatte Karikaturen von Offizieren und Honoratioren der Stadt gezeichnet, die dann auf der Fastnachtsredoute verteilt worden waren. Die Gäste waren belustigt, da die karikierten Personen mit ihren dargestellten Schwächen zweifelsfrei zu erkennen waren. Der Spaß hielt aber nur so lange an, bis die Gäste ihre eigenen Bilder als Spiegel ihrer selbst in den Händen hielten. Der Garnisonskommandant Generalmajor von Zastrow verlangte mit Schreiben an den König die Bestrafung der Urheber. Zwar konnte Hoffmann eine Beteiligung nicht sicher nachgewiesen werden – eine Feststellung, auf die Hoffmann Wert legte –, aber dies hinderte die Vorgesetzten nicht, Hoffmann durch diese Versetzung zu maßregeln.
Aufgespießte Köpfe
In Płock fühlte er sich an einen Ort verbannt, »wo jede Freude erstirbt, wo … [er] lebendig begraben … [ist]«. Gleichwohl oder vielleicht gerade durch diese äußerliche Tristesse blieb er im Innern kreativ und nahm mit dem Lustspiel Der Preis an einem literarischen Preisausschreiben des von Kotzebue herausgegebenen Freimüthigen teil. Zwar konnte er den Preis nicht gewinnen und sein Werk wurde nicht abgedruckt, bekam aber die Einschätzung, »die meiste Anlage zum Lustspieldichter« zu haben, und den Wunsch mit auf den Weg, einen Verleger für dieses Stück zu finden. Dazu ermutigt, unternahm Hoffmann wieder Anstrengungen, ein Stück veröffentlichen zu lassen, scheiterte jedoch abermals. Er ließ sich nicht entmutigen, in ihm brannte die Seele des Künstlers, deren Schaffen nach außen drängt. Im Freimüthigen erschien 1803 endlich seine erste Veröffentlichung, das Schreiben eines Klostergeistlichen an seinen Freund in der Hauptstadt, mit der er sich in den Streit über Schillers Versuch, den Chor der attischen Tragödie ins zeitgenössische Schauspiel zu implementieren, einmischte. Die Genugtuung über diesen Abdruck ist riesengroß, er selbst beschrieb sie als »Vaterfreude«.
Hoffmann setzte alles daran, um dem Exil in Płock zu entkommen. Er schrieb hierzu Briefe, brachte sich in Erinnerung und bat insbesondere seinen inzwischen immer mehr an Einfluss gewinnenden Freund Hippel darum, sich für ihn zu verwenden. So gelang im Frühjahr 1804 die ersehnte Versetzung nach Warschau. Die Möglichkeiten der Ablenkung in der zur preußischen Provinzhauptstadt degradierten früheren Metropole waren groß. Gleichwohl gelang Hoffmann ein Spagat zwischen akribischer juristischer Arbeit und künstlerischem Schaffen. Hier lernte er den an das Warschauer Gericht versetzten Assessor Julius Eduard Hitzig kennen, der nach seinem Tode sein erster Biograf sein wird. Hoffmann komponiert viel und wird auch gespielt, bleibt aber ein lediglich regional bekannter Künstler. In Warschau ist er Mitbegründer der »Musikalischen Gesellschaft« und beteiligt sich an dem von ihr initiierten Wiederaufbau des Mniszek’schen Palastes, für dessen Konzertsaal er Wandfresken entwarf und bei den Wandmalereien selbst Hand anlegte. Im Juli 1805 wird seine Tochter Cäcilia geboren. Zu diesem Ereignis komponierte er eine große Messe, die in Warschau auch aufgeführt wurde.
Hoffmann hatte nie ein größeres Interesse für Politik gezeigt. Friedrich Wilhelm III. hatte sein Land aus kriegerischen Auseinandersetzungen mit Napoleon heraushalten können, bis er eine Vereinbarung mit dem Zaren schloss, in deren Folge Napoleon den Krieg erklärte und die preußische Armee schlug. Die Franzosen nehmen Berlin ein und sind wenig später auch in Warschau. Hoffmann ist sein Amt los, weigert sich, einen Huldigungseid auf Napoleon zu leisten, und muss die Stadt verlassen. Seine Frau Mischa schickte er mit Cäcilia zum Jahresanfang 1807 zu deren Verwandten nach Posen.
So spülen ihn die Wogen des Lebens wieder zurück nach Berlin, wo er hofft, in diesen Zeiten als Künstler überleben zu können; es wird die schrecklichste Zeit seines Lebens. Die Kriegswirren haben viele Flüchtlinge nach Berlin ziehen lassen, darunter auch unzählige nunmehr stellungslose Beamte. Hoffmann kommt im Gasthof Zum goldenen Adler unter. Während er in der Gaststube weilt, wird in sein Zimmer eingebrochen, die Rückwand des Sekretärs durchgesägt und fast seine gesamte Barschaft gestohlen. Die Handlung seiner späteren Erzählung Die Abenteuer in der Silvesternacht lässt er im Goldenen Adler spielen. In Berlin trifft er wiederholt mit dem Schriftsteller Zacharias Werner zusammen, lernt Chamisso und Koreff, zwei der späteren Serapionsbrüder, kennen und verkehrt mit weiteren Künstlern und Personen des öffentlichen Lebens wie Varnhagen. Das Interesse an Hoffmanns Bildern und Kompositionen war bescheiden, auch die Freunde konnten nur in einem gewissen Umfang Hilfe leisten. Mitten in die sich weiter verschlechternde Situation trifft die niederschmetternde Nachricht vom Tode seiner Tochter Cäcilia ein.
Auf seine Bitte um einen Kompositionsauftrag reagiert Iffland vom Königlichen Nationaltheater überhaupt nicht, obwohl Hoffmann in Erfahrung gebracht hatte, dass eine seiner früheren Kompositionen dort mehr Anklang gefunden hatte als eine vergleichbare Arbeit, man sich jedoch zugunsten des in Berlin bekannteren Konkurrenten entschieden hatte. Eine noch größere Demütigung erfuhr er, als er dem Leipziger Kunstverleger Kühnel eine Liste seiner Kompositionen mit einer Sinfonie, mehreren Ouvertüren, Quintetten, Klaviersonaten und weiteren Stücken wegen einer Veröffentlichung sandte und dieser statt einer Antwort ein Angebot für eine Stelle eines Korrektors mit einem Gehalt anbot, das Hoffmann nicht hätte ernähren können. Er geht bei der Malerei und Komposition weiter mit seinen Werken in Vorleistung, ohne dass diese entgolten wird. In einem Brief vom 7. Mai 1808 an Hippel, der den Freund in dieser misslichen Lage immer wieder unterstützte, schreibt Hoffmann resigniert: »Alles schlägt mir hier fehl, weder aus Bamberg, noch aus Zürich, noch aus Posen erhalte ich einen Pfennig; ich arbeite mich müde und matt, setze fort die Gesundheit zu und erwerbe Nichts! Ich mag Dir meine Noth nicht schildern; sie hat den höchsten Punkt erreicht. Seit fünf Tagen habe ich nichts gegessen als Brod – so war es noch nie!«
Endlich kann Hoffmann auf eine Anstellung als Musikdirektor im Theater in Bamberg hoffen. Für dessen Leiter, den Grafen von Soden, soll er vorher die Musik zu dessen Opernlibretto Der Trank der Unsterblichkeit komponieren. Hoffmann kann konzentriert und fleißig arbeiten, das zahlt sich aus und er liefert die Oper schon einen Monat später ab. Das Salär als Musikdirektor ist schmal bemessen, aber ihm wird in Aussicht gestellt, durch Kompositionen für das Theater Nebeneinnahmen zu generieren und als Musiklehrer etwas hinzuverdienen zu können. Er hat keine große Wahl »bey der jetzigen Concurrenz brodlos gewordener Künstler« und sieht die Arbeit in Bamberg als Chance, seine Kompositionen bekannt zu machen; letztlich eröffnete sich so die Möglichkeit für das angestrebte Künstlerleben. In Posen holt er Mischa ab und reist mit ihr dem erhofften Erfolg als Künstler entgegen, bar jeder Vorstellung, dass dies seine »Lehr- und Marterjahre« werden würden.
Das Paar trifft am 1. September 1808 in Bamberg ein. In einem seiner letzten Werke, Meister Johannes Wacht, geht er mit dem Abstand der Jahre versöhnlich mit seiner Bamberger Zeit ins Gericht. Zunächst scheint aber wieder alles fehlzuschlagen. Die Eröffnung des Theaters wird mehrfach verschoben. Der Neubeginn birgt das Ende in sich: Hoffmann dirigiert wenige Wochen nach seiner Ankunft die Oper Aline, Königin von Golkonda. Die Vorstellung gerät zu einem Desaster und die Schuld dafür wird in Hoffmann gesucht, der den Orchesterintrigen zum Opfer fällt und die Leitung niederlegt. Er versucht fortan, sich wegen der Reduzierung des Gehalts mit Kompositionsaufträgen und Musikstunden durchzuschlagen. Er beginnt, Julie Mark, der Tochter der Konsulin Mark, die er auch Julia oder Julchen nennt, Gesangsunterricht zu geben; Hoffmann empfindet sogleich Zuneigung zu der jungen und hübschen, aber erst dreizehnjährigen Gesangsschülerin. Von der besseren Gesellschaft wird er wohlwollend aufgenommen und begründet so die Freundschaft unter anderem zum Medizinaldirektor Marcus und zum literarisch interessierten Weinhändler Kunz, der sein erster Verleger werden sollte. Im zweiten Teil der Elixiere des Teufels wird Hoffmann später die Irrenanstalt St. Getreu erwähnen, die Doktor Marcus 1804 gegründet hatte, und den Freund als einen »in jede Abnormität des menschlichen Organismus tief eindringenden, genialen Arzt[e]« loben.
Neben Marcus pflegte Hoffmann Umgang mit den Bamberger Ärzten Speyer, Weiße und Pfeufer, die zu den kenntnisreichsten Medizinern ihrer Zeit gehörten, ihm die neueste medizinische und psychiatrische Literatur empfahlen, auch Zugang zu den Patienten gewährten und sein Interesse für die Psychologie und den Magnetismus beförderten. So erlangte Hoffmann die Kenntnisse seiner Zeit über Wahnsinn und krankhafte psychologische Zustände, die er in Traum-, Spuk- und Wahnszenen verarbeitete. Später versetzten ihn diese Kenntnisse – nach der wieder aufgenommenen richterlichen Tätigkeit – in die Lage, fachkundig über die Frage der Zurechnungsfähigkeit von Delinquenten zu urteilen, wie im Falle des wegen der Tötung seiner Frau verhafteten und später wegen Mordes verurteilten Tabaksspinnergesellen Schmolling.
Hoffmann schreibt wie nebenher seine brillante Erzählung Ritter Gluck und sendet sie der Allgemeinen Musikalischen Zeitung, der er anbietet, für sie als freier Musikredakteur zu arbeiten. Das Angebot wird gerne angenommen und Ritter Gluck erscheint am 15. Februar 1809. Nicht ohne Grund ist dieses Werk in den letzten Jahrzehnten als eines der Schlüsselwerke Hoffmanns erkannt worden. In ihm zeigen sich die seine Werke immer wieder tangierenden oder prägenden Themen des Doppelgängers, Kunstverständigen, Enthusiasten und Wahnsinnigen. Auch wurden nicht von der Hand zu weisende Überlegungen zu Parallelen in Hoffmanns Leben erkannt, dem bis dahin der künstlerische Ruhm ähnlich dem verkannten Ritter Gluck in der Erzählung versagt geblieben war. Einerseits wird zur Person des Musikers die Ansicht vertreten, dass es sich bei dem Ritter Gluck nicht um den Komponisten Gluck handeln könne – sondern es sich um einen Wahnsinnigen handeln müsse, der glaubt, Gluck zu sein –, da dieser zum Zeitpunkt der erzählten Zeit schon seit über zwanzig Jahren verstorben war. Andererseits kann Hoffmann den Komponisten Gluck in eine spätere Zeit versetzt haben, der sein Werk nur schwer zugänglich ist. Einen Anhaltspunkt für diese Sichtweise liefert Hoffmann selbst. Er notiert 1809 in seinem Schreibkalender: »Es müßte spaßhaft sein Anekdoten zu erfinden und ihnen den Anstrich höchster Authentizität durch Citaten u. s. w. zu geben, die durch Zusammenstellung von Personen die Jahrhunderte aus einander lebten oder ganz heterogener Vorfälle gleich sich als gelogen auswiesen.« Als Beispiel dafür präsentierte Hoffmann eine Anekdote, die Friedrich den Großen und Calderón zusammenführte.
Hoffmann, Kunz und Pfeufer
Hoffmann komponiert, schreibt und malt weiter. Seine Gesangsschülerin Julia reüssierte bereits am Pfingstsonntag 1809 in einem Konzert zum ersten Mal mit der Koloraturarie aus Ferdinando Paërs Oper Sargino oder Der Zögling der Liebe. Das Mädchen wächst zur jungen Frau heran, Hoffmann unterrichtet sie nun fast täglich und aus der Zuneigung entwickelt sich eine tiefe Leidenschaft. Hoffmann gesteht dem jungen Mädchen seine Liebe lange Zeit nicht. Auch diese Beziehung trägt ihr bitteres Ende von Anbeginn in sich. Zu Julias fünfzehntem Geburtstag schreibt Hoffmann ihr ein Sonett, das er später in der Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza als Sonett an Cäzilia verwendet. In der Bamberger Harmonie-Gesellschaft singt er zusammen mit Julia ein Duett. Wenn er mit ihr bei gesellschaftlichen Anlässen tanzt, ist er glücklich und notiert die Anzahl der Tänze in sein Tagebuch. Die Leidenschaft für Julia steigert sich hin bis zu Selbstmordgedanken, wenn er nicht der Ihre werden kann. Er fühlt sich einmal mehr im Leben völlig zerrissen und scheint dies mit ruheloser Arbeit auch sich selbst gegenüber zu verdrängen.
Ein Geniestreich gelang Hoffmann mit einer weiteren Veröffentlichung in der Musikalischen Zeitung. Am 4. Juli 1810 erschien seine Rezension zu Beethovens Fünfter Symphonie, welche die bis dahin vorherrschenden negativen Kritiken, die das Werk als langatmig, eigensinnig und willkürlich diskreditierten, durch eine sachliche und gründliche Analyse des Werkes entkräftete. Beethoven ist über die Rezension und ihre wertschätzende Wirkung voller Freude, was ihn in einem Brief zu folgender Bemerkung veranlasst: »… [M]anchmal mögte ich bald Toll werden über meinen unverdienten Ruhm …«
In seinem Tagebuch nutzt er für »Julia« auch den Namen »Käthchen« nach dem von ihm verehrten Werk Das Käthchen von Heilbronn von Heinrich von Kleist. Er muss dies so verschleiern, da er mit der temperamentvollen Mischa verheiratet ist, die ihm wegen der Beziehung Vorhaltungen macht. Sie hat auch in der Zeit, als Hoffmann in Berlin darbte, in Posen bewiesen, dass sie mithilfe ihrer Familie mit den Unbilden des Lebens umzugehen weiß. Hoffmann möchte diese Beziehung auch nach all dem, was sie zusammen durchgestanden hatten, nicht einfach beenden und Mischa nicht unnötig kränken. Er legt auch Wert darauf, seine Frau im Freundes- und Bekanntenkreis als weltgewandt, kunstverständig und intelligent darzustellen, und erzürnte, wenn dies infrage gestellt wurde. Irgendwie scheint er zu ahnen, dass sie ihm auch in seinem weiteren Leben immer wieder eine verlässliche Stütze sein wird. Auch die Zeit in Bamberg wollte nicht leichter werden. Er hatte nun mit dem Musikunterricht, den Kompositionen und Artikeln für die Musikalische Zeitung verschiedene Nebeneinkünfte, aber einen lebenserhaltenden Hauptberuf konnten all seine Künste nicht bieten. Verbittert schreibt er in sein Tagebuch: »Höchste infamste Geldnot – Kunz nichts hergegeben infame Stimmung. In der höchsten Not den alten Rock verkauft, um nur fressen zu können!!«
Die Situation bessert sich ein wenig, als Franz von Holbein, sein alter Bekannter aus Berlin, die Leitung des Theaters übernimmt und Hoffmann wieder stärker in die Arbeit des Hauses einbindet. Beiden gelingt es in kurzer Zeit, das Bamberger Theater zu einer der führenden Provinzbühnen des deutschen Sprachgebietes zu entwickeln. Die Hoffmann fast bis in den Wahnsinn treibende Liebe zu Julia bleibt. Dennoch gibt es Anfang 1812 ein nur kurz dauerndes Verhältnis mit der jungen Schauspielerin Demoiselle Neuherr, die noch bis 1809 in Kinderrollen zu sehen gewesen war. Aber auch mit dieser Liaison kann er das Verlangen nach Julia nicht kompensieren. Die Affäre mit der Schauspielerin bleibt, wie Hoffmann es seinem Tagebuch anvertraut, lediglich ein »Blitzableiter«.
Im Frühjahr 1812 komponiert er für Julia zum sechzehnten Geburtstag mehrere Canzonetten. Zwei Wochen später wird sie mit dem Kaufmann Johann Gerhard Graepel aus Hamburg verlobt, der auch schon doppelt so alt ist wie die Versprochene. Er ist aus Sicht der Mutter eine gute Partie, ist er doch mit seinem Vater, dem Senator J.G. Graepel der Ältere, Inhaber des Bankhauses J.G. Graepel & Sohn. Auf einem Ausflug zum Schloss Pommersfelden beleidigt der gekränkte Hoffmann den angetrunkenen Verlobten in Anwesenheit der geliebten Julia, der Konsulin Mark und weiterer Gäste schwer. Selbst ein kurz darauf von Hoffmann verfasster Entschuldigungsbrief an die Konsulin Mark kann nicht verhindern, dass sie ihm das Haus verbietet und damit das Ende der Gesangsstunden ausspricht. Julia wird noch im Dezember mit dem Bankier Graepel verheiratet. Vor der Abreise nach Hamburg sah Hoffmann Julia noch einmal und gestand ihr seine Liebe. Julia wird sich fünfzehn Jahre nach Hoffmanns Tod in einem Brief daran wie folgt erinnern: »Drei Jahre sah ich ihn täglich, aber erst die Stunde, die uns trennte, gab mir seine Liebe in Worten kund; sie erschreckte mich nicht, ich hatte sie, mir selbst kaum bewußt, längst empfunden.« Hoffmann legte im März 1813 darauf Wert, den Verlagsvertrag mit seinem Freund, Weinhändler und Verleger Kunz über das Werk Fantasiestücke in Callot’s Manier genau zu Julias Geburtstag zu unterzeichnen.
Hoffmann wird der tiefe Eindruck dieser Romanze ebenfalls bis an sein Lebensende begleiten. In den bis 1821 erschienenen beiden Teilen der Lebens-Ansichten des Katers Murr nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern sind in der Beziehung Kreislers zu dessen Julia Entsprechungen zum Verhältnis von Hoffmann zu seiner Julia erkennbar; aber auch Züge seiner späteren Freundin, der jungen Opernsängerin Johanna Eunike, sind in Kreislers Julia erkannt worden. Der Musikus Kreisler soll nach dem Willen der verwitweten Rätin Benzon nicht Julias Hand bekommen, sondern der geistig etwas zurückgebliebene, aber als standesgemäß empfundene Fürstensohn Ignaz. In der Geistesschwäche des Fürstensohns kann eine spöttische Stichelei auf Julia Marks Ehemann gesehen werden.
Als Franz von Holbein Bamberg verlässt und Hoffmann auf Empfehlung der Herausgeber der Allgemeinen Musikalischen Zeitung den Posten des Musikdirektors bei der zwischen Dresden und Leipzig pendelnden Theatertruppe von Seconda angeboten bekommt, steht Hoffmanns Entschluss fest und er schreibt: »Meine Lehr- und Marterjahre sind nun in Bamberg abgebüßt, jetzt kommen die Wander- und Meisterjahre; – nun sitz’ ich fest im Sattel!« Die letzten Tage in Bamberg nutzt Hoffmann, um mit der Komposition seiner Oper Undine zu beginnen, zu der Friedrich de la Motte Fouqué das Libretto lieferte.
Aber auch mit der Theatertruppe Secondas sollte er noch nicht das erfüllte Künstlerleben erfahren, von dem er so sehr träumte. Er und Mischa treffen im April 1813 in Dresden ein. Kurz darauf liefern sich napoleonische Truppen mit noch in Dresden befindlichen russischen Truppen Kämpfe. Hoffmann wird in der Nähe des Schlosstores von einer Kugel leicht verletzt. Die Enttäuschungen des Theaterlebens schien er durch schriftstellerischen Eifer und die Komposition seiner Oper Undine zu kompensieren. Mischa bereitet ihm zur Arbeit an seinen Kompositionen und Texten häufig ein Glas Punsch; seine Gedanken führen ihn immer wieder zu der jetzt unerreichbaren Julia. Nach einem Zerwürfnis mit Seconda liegt Hoffmann die Vorstellung nicht fern, durch Hilfe seines alten Freundes Hippel sich die Fesseln des Staatsdienstes wieder anlegen zu lassen. Selbst ein Angebot für die Stelle des Musikdirektors in Königsberg ist Hoffmann nicht mehr geneigt anzunehmen.
Das Ehepaar Hoffmann erreicht am 26. September 1814 Berlin. Schon am Folgetag gibt es ein Treffen, bei dem er endlich den Dichter des Undine-Librettos Fouqué kennenlernt und alte und neue Bekannte wie Tieck, Chamisso, Bernhardi, Franz Horn und den Maler Philipp Veit sieht. Anfang Oktober wird er als Mitarbeiter am Kammergericht »cum voto consultativo« (mit beratender Stimme) eingestellt und schon einen Monat später in den Kriminalsenat versetzt, jedoch noch ohne Gehalt. Langsam bahnt sich eine neue Leidenschaft Hoffmanns an: Bei einem Besuch des Violoncello-Virtuosen B. Romberg im Oktober 1814 hört er den Tenor Friedrich Eunike und dessen sechzehnjährige Tochter Johanna, deren Stimme und Liebreiz ihn verzaubert. Im Oktober erschien bei Kunz in Bamberg der dritte Band der Fantasiestücke in Callot’s Manier mit dem Märchen Der goldne Topf, der mit großem Erfolg bei den Lesern ankam. In Berlin fand er schnell den Kontakt zu vielen Künstlern; diejenigen aus dem engeren Freundeskreis, die sich im Geiste verbunden fühlten, nannten sich in loser Verbindung »Seraphinenorden«, dessen Erneuerung 1818 folgte und dessen Mitglieder sich den Namen »Serapionsbrüder« gaben, zu denen unter anderem der Schriftsteller, erster Hoffmann-Biograf und Kollege am Kammergericht Hitzig, Contessa, Koreff und Chamisso gehörten. Die Freundschaft zum Schauspieler Ludwig Devrient ist Grund für einige der vielen Anekdoten, die es über Hoffmann zu erzählen gibt. So wird einem Beisammensein im Weinlokal »Lutter & Wegner« auch die Schöpfung des Wortes »Sekt« für den sonst getrunkenen Schaumwein zugesprochen.
Hoffmann arbeitete mit unermüdlichem Fleiß an Kompositionen, Erzählungen und weiteren Artikeln für die Allgemeine Musikalische Zeitung. Den ersten Teil seiner Elixiere des Teufels hatte er bereits 1814 fertiggestellt, fand aber erst ein Jahr später einen Verleger dafür, der den ersten Teil im Herbst 1815 und den zweiten Teil im Frühjahr 1816 veröffentlicht. Von den Lesern wird der Roman angenommen, aber das Gros der Literaturkritik verweigert zunächst die Anerkennung der Elixiere; unter anderem Heinrich Heine erkennt die Bedeutung des Werkes sogleich. Mit seinen anderen Werken war er zu einem anerkannten Künstler geworden, der zu den höchstbezahlten Almanach- und Taschenbuchautoren seiner Zeit gehörte und in den höchsten gesellschaftlichen Kreisen Berlins verkehrte.
Hoffmann setzte alles daran, seine Oper Undine aufführen zu lassen. Trotz des wieder eingeschlagenen juristischen Berufsweges hoffte er weiter auf eine künftige musikalische Künstlertätigkeit; dies war es, wonach er strebte. Seine Zielstrebigkeit zahlte sich aber auch in der juristischen Arbeit aus: Er wurde am 22. April 1816 zum Kammergerichtsrat ernannt und im Folgemonat Wirkliches Mitglied des Kriminal-Senats. Die dienstlichen Beurteilungen waren hervorragend.
Fouqué und Hoffmann wandten sich kurz nach der Ernennung des Reichsgrafen Carl von Brühl zum neuen Generalintendanten des Nationaltheaters im Jahre 1815 wegen der Aufführung der Oper Undine an diesen. Sie rechneten sich einige Chancen für die Annahme des Stückes aus, da Brühl auch als Förderer deutscher Opern galt. Hoffmann schrieb in einem Brief an Kunz über Brühl: »… [E]in herrlicher wahrhaft nach unserer Weise gesinnter Mann wird Intendant des Theaters, und diesem steht eine große Revolution bevor, an der ich Theil nehme, wenigstens mittelbar.« Und in der Tat nimmt Brühl das Angebot zur Aufführung der Oper an.
In seiner Arbeit als Musikkritiker blieb er genauso unermüdlich. Die Bewunderung für Johanna Eunike strahlt auch aus diesen Texten. Für das Dramaturgische Wochenblatt vom 18. Mai 1816 schrieb er zu einer gelungenen Aufführung der ihm bestens bekannten Mozart-Oper Die Zauberflöte – in der er in Bamberg selbst das Glockenspiel gespielt und die er als Secondas Musikdirektor in Dresden und Leipzig mehrfach geleitet hatte – und lobt Johannas Gesang mit den Worten: »Mademoiselle Eunike sang vorzüglich die Arie: Ach, ich fühl’s etc. mit tief ins Gemüt dringendem Vortrage.« Erstmals für diese Oper hatte Carl Friedrich Schinkel als Bühnenbildner gewirkt. Schinkel konnte auch für die Schaffung der Bühnenbilder zur Undine gewonnen werden, die einhellig als meisterhaft beurteilt wurden. Zur gemeinsamen Arbeit an ihrer Zauberoper lud Fouqué den Schriftstellerkollegen Hoffmann mehrfach auf sein Landgut in Nennhausen ein, wo dieser auch Freundschaft mit der Frau des Hauses, Caroline de la Motte Fouqué, knüpfte. Sie veröffentlichte 1817 die Novelle Der Delphin, in der sie Hoffmann nur ein wenig verändert als Kapellmeister Gottmund auftreten lässt.
Die Premiere der Undine konnte am 3. August 1816 zum Geburtstag des Königs mit Erfolg stattfinden. Die Titelrolle sang auf seinen Wunsch die von Hoffmann verehrte Johanna Eunike, die bis dahin schon zu einem Liebling des Publikums geworden war; Heinrich Heine nannte sie die »Nachtigall von Berlin«. Und die Undine sollte ihre Glanzrolle werden. Carl Maria von Weber, der Hoffmann als seinen besten Freund in Berlin bezeichnete, verfasste eine sehr wohlwollende Rezension zu der Oper, was ihre Bekanntheit und Hoffmanns Ruhm als Komponist erheblich förderte. Am 29. Juli 1817 fanden die gelungenen Aufführungen der Oper, die bis dahin vierzehn Mal aufgeführt worden war, durch den Brand des Schauspielhauses ein jähes Ende. Hoffmann wäre aber nicht Hoffmann, bliebe er nicht hartnäckig: Er schrieb an Brühl und bat um Mitteilung, wie mit der Wiederaufführung der Undine verfahren würde, die Brühl zugestand, aber auf einen Termin nach dem Aufbau des abgebrannten Schauspielhauses vertröstete.
Nach den Befreiungskriegen über das napoleonische Heer wurden im Zuge der restaurativen Politik Anhänger liberaler und freiheitlicher Ideen verfolgt. Juristische Schützenhilfe sollte dabei die Immediat-Untersuchungskommission zur Ermittlung hochverräterischer Verbindungen und anderer gefährlicher Umtriebe leisten, die Hoffmann und viele seiner Kollegen verweigerten. In vielen Verfahren gegen sogenannte Demagogen sind Hoffmann und seine Kollegen zu dem Ergebnis gelangt, dass aufgrund bloßer Gesinnung keine strafbare Handlung vorliegt. Der politisch wenig interessierte Hoffmann war ohne Sympathie für die Demagogen und machte sich über Professor Friedrich Ludwig Jahn, den Turnvater Jahn, lustig, was aber nicht seine richterliche Objektivität beeinflusste – er entschied letztlich in einem äußerst umfassenden und akribisch begründeten Votum für dessen Freilassung aus der Haft. Willkürliches Handeln von Ministerialbürokratie und Polizei konnte und wollte er nicht dulden. So geriet er schnell in Widerspruch insbesondere zum Direktor im Polizeiministerium Karl Albert von Kamptz, Innen- und Polizeiminister von Schuckmann und Justizminister von Kircheisen. In einem Brief vom 24. Juni 1820 an seinen Freund Hippel klagt Hoffmann über die Zustände im Zusammenhang mit der Arbeit in der Kommission und schreibt: »… [U]nd wie Du mich kennst, magst Du Dir wohl meine Stimmung denken, als sich vor meinen Augen ein ganzes Gewebe heilloser Willkühr, frecher Nichtachtung aller Gesetze, persönlicher Animosität, entwickelte!«
Brand des Schauspielhauses
Seinen Widerwillen gegen diese Willkür brachte Hoffmann nicht nur in diesem Brief zum Ausdruck. Im Herbst 1821 zeichnete Hoffmann nach einer Anmerkung Hitzigs in einer Sitzung auf grobem Akten-Umschlagspapier auch seine als »Hoffmann selbst im Kampf mit der Bürokratie« benannte Karikatur, auf der er reitend auf Kater Murr mit einer Lanze gegen einen Beamten kämpft, der auf einem zweiten Beamten reitet. Gedeutet wird diese Karikatur als Kampf Hoffmanns gegen von Kamptz.
In seinem Märchen Meister Floh karikierte Hoffmann seinen Widerpart von Kamptz als Polizeischnüffler Knarrpanti, der bei den Verdächtigen schon eine Straftat erkunden werde, wenn er nur genau genug ermittelt. Da Hoffmann aus einer dienstlichen Akte auch noch das Wort »mordfaul« entlehnte, sah von Kamptz sogar die Pflicht zur Wahrung der Dienstgeheimnisse verletzt. Der Innen- und Polizeiminister Schuckmann berichtet in einem von von Kamptz konzipierten Schreiben an den Staatskanzler Hardenberg über die beabsichtigte Veröffentlichung des Meisters Floh und charakterisiert Hoffmann »als einen pflichtvergessenen, höchst unzuverlässigen und selbst gefährlichen Staatsbeamten«, für den er eine Strafversetzung empfiehlt. Das gegen Hoffmann gerichtete Verfahren endete ohne ein Ergebnis aufgrund des baldigen Todes des angeblich »pflichtvergessenen« Richters.
Zuvor erfolgte Ende 1821 für Hoffmann endlich die von der Arbeit in der Immediat-Kommission befreiende Beförderung in den Oberappellationssenat des Kammergerichts und damit der höchsten gerichtlichen Instanz in Preußen. Bei Abwesenheit des Präsidenten vertrat Hoffmann diesen bei der Ausübung der Dienstgeschäfte.
Die tief empfundene Freundschaft zu seiner jungen Freundin Johanna Eunike, die er auch gern Undinchen nannte, hielt über die gemeinsame Arbeit an der Undine an. In vielen seiner Musikkritiken findet sie durchweg lobend Erwähnung. Sobald ein neues Buch erschien, sandte er es ihr mit schmeichelnden Zeilen oder brachte es ihr. Als im November 1817 Nussknacker und Mausekönig zusammen mit Märchen von Contessa und Fouqué in einem Märchenband erschien, sandte er ihr diesen als »Weihnachtsbüchlein, das so eben ans Licht der Welt getreten«. Mit einem Brief vom 21. Januar 1819, in dem er sie »verehrteste Fee« nannte, sandte er ihr die gerade bei Schlesinger in Berlin erschienenen italienischen Duettinen, die er Jahre zuvor für seine Julia komponiert hatte. Er schrieb Johanna, dass diese Musik aus einer »schöneren Künstlerzeit« stammte, obwohl er zunächst froh gewesen war, Bamberg entflohen zu sein. Die Dienstgeschäfte am Kammergericht sah Hoffmann trotz seiner zwischenzeitlichen schriftstellerischen und kompositorischen Erfolge in Berlin als so belastend an, dass die beklemmenden Erinnerungen an die Bamberger »Lehr- und Marterjahre« dahinter verblassten. Im März 1820 sandte er Johanna Eunike mit dem ersten Band seines Katers Murr das Sonett An Johanna.
Schon auf seinem Sterbebett liegend, diktierte er folgenden letzten Brief an seine junge Freundin und ließ ein Exemplar des Meisters Floh übersenden: »Johanna! Ich sehe Ihren freundlichen Blick, ich höre Ihre süße liebliche Stimme: Ja oft lispelt mir in schlaflosen Nächten entgegen: Morgen so hell etc: Dieß tröstet mich für die Namenlosen Leiden, welche mich schon seit viertehalb Monaten nicht von dem SiechBette frei lassen. Gelähmt an Händen und Füßen bin ich außer Stande Ihnen beikommenden (sollte wohl eigentlich heißen: beispringenden) Meister Floh selbst zu überreichen. Hier ist er, aber mittelst Übersendung. Lesen Sie, lachen Sie, denken Sie alles was Ihr fröhlicher Sinn, Ihr feiner Takt Ihnen eingibt, und wogegen kein Minister etwas einwenden kann. Gott mit Ihnen, ich hoffe Sie bald wiederzusehen.«
Hoffmanns Wunsch erfüllte sich leider nicht mehr. Seine Augen schlossen sich am 25. Juni 1822 für immer.
Hippel blieb ein Freund über den Tod hinaus. Auf seinen Antrag als Chefpräsident der Westpreußischen Regierung weist der Justizminister von Kircheisen an, dass der Witwe Hoffmanns eine jährliche Pension von zweihundert Reichstalern zu zahlen sei. Er unterstützte Hitzig bei der Beschaffung des Materials für die erste Hoffmann-Biografie, strich aber Stellen und ließ Erläuterungen aus, die aus seiner Sicht dem Andenken des Freundes schaden könnten. Hitzig und Hippel wollten Hoffmann günstig darstellen, ungeachtet des Umstandes, dass der Mensch nicht nur seine eigene Schöpfung, sondern auch seine eigene Bürde ist, die ihn uns mit seinen Schwächen und Fehltritten viel näher bringt als ein verklärter Blick zum Olymp.
Ritter Gluck
Vorbemerkung
Im Jahr 1798 wurde die Allgemeine Musikalische Zeitung durch den Musikverleger Gottfried Christoph Härtel (1763–1827) und den Redakteur und Schriftsteller Friedrich Rochlitz (1769–1842) gegründet, sie erschien bis 1848 im Verlag Breitkopf & Härtel, der sich bleibenden Ruhm mit neuen kritischen Gesamtausgaben von Palestrina, Schütz, Mozart, Schubert und Mendelssohn-Bartholdy verschaffte. Bereits 1799 hatte E.T.A. Hoffmann vergeblich versucht, bei Breitkopf & Härtel seine Liedkomposition »fürs Klavier und Chitarra« verlegen zu lassen, doch der Verlag lehnte ab und schickte ihm sein Manuskript zurück. Friedrich Rochlitz, der Mitbegründer der AMZ, leitete deren Redaktion bis 1818 und feierte nebenbei auch Erfolge als Schriftsteller und Lustspieldichter. Rochlitz korrespondierte mit allen wichtigen Autoren seiner Zeit wie Goethe, Schiller, Wieland und Tieck.
Am 16. Oktober 1805 wurde der Regierungsrat Hoffmann in einem Bericht von Friedrich Rochlitz über die Musikalische Gesellschaft in Warschau erstmals in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung namentlich erwähnt.
Hoffmann schrieb einen nicht erhaltenen Empfehlungsbrief an Rochlitz und später auch eine nicht mehr zu identifizierende Komposition als Talentprobe. Zum Jahresende 1807 erhielt Hoffmann endlich eine positive Antwort von Rochlitz, in der dieser Hoffmanns Kompositionen rühmte und ihm das Versprechen übermittelte, eine sachkundige und unparteiische Rezension seiner Werke in der AMZ zu publizieren.
Am 9. Juni 1808 veröffentlichte Friedrich Rochlitz folgende Nachricht in der AMZ Nr. 37: »Hr. Musikd[irektor] Hoffmann, der vor einigen Jahren in Warschau angestellt, und seit der veränderten Ordnung der Dinge daselbst in Berlin sich aufhaltend, ist vom Hrn. Reichsgrafen Soden als Musikdirektor zum Bamberger Theater berufen worden. Man kann diese Bühne zur Acquisition eines so gründlichen Komponisten, so erfahrnen Singmeisters, und überhaupt so talentvollen, gebildeten und achtungswürdigen Mannes, Glück wünschen. In kurzem werden wir von ihm drey grosse charakteristische Klaviersonaten (Zürich bey Nägeli,) erscheinen, und von einer Oper, die Hr. Reichsgr. Soden gedichtet und Hr. H. in Musik gesetzt hat, ist wol auch schon im voraus anzunehmen, sie werde eine wahre Bereicherung der Bühne seyn.«
Hoffmann schrieb am 12. Januar 1809 einen umfangreichen Brief an Friedrich Rochlitz, dem das Manuskript seiner Erzählung Ritter Gluck beilag. Hoffmann berichtete Rochlitz über den Fortgang seiner Künstlerlaufbahn als Musikdirektor in Bamberg, die schon beendet schien, bevor sie richtig begonnen hatte.
»Ich wage es einen kleinen Aufsatz, dem eine wirkliche Begebenheit in Berlin zugrunde liegt, mit der Anfrage beyzulegen, ob er wohl in die Musik[alische] Zeitung aufgenommen werden könte? – Aehnliche Sachen habe ich ehmals in oben erwähnter Zeitung wirklich gefunden zB. die höchst interessanten Nachrichten von einem Wahnsinnigen, der auf eine wunderbare Art auf dem Clavier zu fantasiren pflegte. – Vielleicht könte ich mit der Redaktion der Mus[ikalischen] Zeitung in nähere Verbindung treten und zuweilen Aufsätze und auch Rezensionen kleinerer Werke einliefern.«
Dieser Brief Hoffmanns an Rochlitz ist ein taktisches Bravourstück, denn Hoffmanns, wie ein Köder hingeworfener, Hinweis auf den AMZ-Artikel über einen Wahnsinnigen stammte aus der Feder von Friedrich Rochlitz und erschien in den AMZ-Nr. 39–42 des Jahres 1804 unter dem Titel Der Besuch im Irrenhause mit Verfasserangabe und 1807 publizierte Rochlitz diese Studie sogar als Buchfassung in seinen Kleinen Romanen und Erzählungen.
Friedrich Rochlitz schluckte Hoffmanns taktischen Köder, und am 25. Januar 1809 notierte Hoffmann in seinem Tagebuch: »Einen sehr angenehmen Brief von Rochlitz aus Leipz[ig]. Er nimt den Ritter Gluck zum Einrücken, und mich zum Mitarbeiter an der Mus:Zeit: an.«
Hoffmanns konziliante Äußerungen über nicht autorisierte Kürzungen und Eingriffe in seinen Texten, die ja wie ein Freibrief für Rochlitz wirken, hätte er später sicherlich gerne zurückgenommen. Am 13. März 1809 notierte Hoffmann in seinem Tagebuch: »Den Ritter Gluk gedruckt gelesen! – Es ist sonderbar, daß sich die Sachen gedruckt anders ausnehmen als geschrieben.«
Hoffmanns erste bedeutende Erzählung war in der AMZ Nr. 20 vom 15. Februar 1809 gedruckt erschienen und noch am selben Tag schrieb er an die Redaktion der AMZ: »Mit dem was an dem Ritter Gluck geschehen ist, bin ich sehr wohl zufrieden, nur habe ich den alten Italiäner mit dem gekrümmten Finger so wie die Berliner Egoisten nicht ganz gern vermißt, wiewohl ich mich gern bescheide, daß die Züge des Gemähldes etwas zu grell aufgefaßt seyn mochten. Dagegen haben mich der zugesezte geschlossene Handelsstaat und die bösen Groschen recht sehr erfreut.«
Der Redakteur Friedrich Rochlitz hat also Hoffmanns Manuskript des Ritter Gluck nicht nur leicht gekürzt, sondern eigenmächtig ergänzt, was Hoffmann keineswegs gleichgültig hinnahm. Seinem Freund Hitzig schrieb er am 25. Mai 1809: »Sie können meinen Debut […] Ritter Gluck lesen; ein Aufsatz, der Ihnen in mancher Hinsicht merkwürdig seyn wird, dem Sie es aber auch anmerken werden daß R[ochlitz] hin und wieder nach seiner Art gefeilt hat, welches ich geschehen lassen mußte, unerachtet es mir nicht lieb war.« Seltsamerweise hat Hoffmann 1813 bei seiner Neuabschrift des Erstdrucks vom Ritter Gluck für die Buchfassung im ersten Band der Fantasiestücke in Callots Manier Rochlitz Eigenmächtigkeiten nicht wieder rückgängig gemacht, was aber ohne die ihm nicht vorliegende Manuskript-Fassung, die nicht mehr erhalten ist, auch schwer fiel.
Hoffmanns Text folgt hier ungekürzt in der originalen Orthographie nach dem Erstdruck aus der AMZ von 1809.
Der Spätherbst in Berlin hat gewöhnlich noch einige schöne Tage. Die Sonne tritt freundlich aus dem Gewölk hervor, und schnell verdampft die Nässe in der lauen Luft, welche durch die Strassen weht. Dann sieht man eine lange Reihe, buntgemischt – Elegants, Bürger mit der Hausfrau und den lieben Kleinen in Sonntagskleidern, Geistliche, Jüdinnen, Referendare, Freudenmädchen, Professoren, Putzmacherinnen, Tänzer, Offiziere u. s. w. durch die Linden, nach dem Thiergarten ziehen. Bald sind alle Plätze bey Klaus und Weber besetzt; der Mohrrüben-Kaffee dampft, die Elegants zünden ihre Zigaros an, man spricht, man streitet über Krieg und Frieden, über die Schuhe der Mad. Bethmann, ob sie neulich grau oder grün waren, über den geschlossenen Handelsstaat und böse Groschen u. s. w., bis alles in eine Arie aus Fanchon zerfliesst, womit eine verstimmte Harfe, ein paar nicht gestimmte Violinen, eine lungensüchtige Flöte und ein spasmatischer Fagott sich und die Zuhörer quälen.
Dicht an dem Geländer, welches den Weberschen Bezirk von der Heerstrasse trennt, stehen mehrere kleine, runde Tische und Gartenstühle; hier athmet man freye Luft, beobachtet die Kommenden und Gehenden, ist entfernt von dem kakophonischen Getöse jenes vermaledeyten Orchesters: da setze ich mich hin, und überlasse mich dem leichten Spiel meiner Phantasie, die mir befreundete Gestalten zuführt, mit denen ich über Wissenschaft, über Kunst, über alles, was dem Menschen am theuersten sein soll, spreche. Immer bunter und bunter wogt die Masse der Spaziergänger bey mir vorüber, aber nichts stört mich, nichts kann meine phantastische Gesellschaft verscheuchen. Nur das verwünschte Trio eines höchst niederträchtigen Walzers reisst mich aus der Traumwelt. Die kreischende Oberstimme der Violine und Flöte, und des Fagotts schnarrenden Grundbass allein höre ich; sie gehen auf und ab fest aneinander haltend in Oktaven, die das Ohr zerschneiden, und unwillkührlich, wie jemand, den ein brennender Schmerz ergreift, ruf’ ich aus:
Unter den Linden
Welche rasende Musik! die abscheulichen Oktaven! – Neben mir murmelt es:
Verwünschtes Schicksal! schon wieder ein Oktavenjäger!
Ich sehe auf und werde nun erst gewahr, dass, von mir unbemerkt, an demselben Tische ein Mann Platz genommen hat, der seinen Blick starr auf mich richtet, und von dem nun mein Auge nicht wieder loskommen kann.
Nie sah’ ich einen Kopf, nie eine Gestalt, die so schnell einen so tiefen Eindruck auf mich gemacht hätten. Eine sanft gebogene Nase schloss sich an eine breite, offene Stirn, mit merklichen Erhöhungen über den buschigen, halbgrauen Augenbraunen, unter denen die Augen mit beynahe wildem, jugendlichem Feuer (der Mann mochte über funfzig seyn) hervorblitzten. Das weich geformte Kinn stand in seltsamem Kontrast mit dem geschlossenen Munde, und ein skurriles Lächeln, hervorgebracht durch ein sonderbares Muskelspiel in den eingefallenen Backen, schien sich aufzulehnen gegen den tiefen, melancholischen Ernst, der auf der Stirn ruhte. Nur wenige graue Löckchen lagen hinter den grossen, vom Kopfe abstehenden Ohren. Ein sehr weiter, moderner Überrock hüllte die grosse hagere Gestalt ein. So wie mein Blick auf den Mann traf, schlug er die Augen nieder, und setzte das Geschäft fort, worin ihn mein Ausruf wahrscheinlich unterbrochen hatte. Er schüttete nämlich aus verschiedenen kleinen Düten mit sichtbarem Wohlgefallen Tabak in eine vor ihm stehende grosse Dose und feuchtete ihn mit rothem Wein aus einer Viertelsflasche an. Die Musik hatte aufgehört; ich fühlte die Nothwendigkeit, ihn anzureden.
Es ist gut, dass die Musik schweigt, sagte ich; das war ja nicht auszuhalten.
Der Alte warf mir einen flüchtigen Blick zu und schüttete die letzte Düte aus.
Es wäre besser, dass man gar nicht spielte; nahm ich nochmals das Wort.
Sind Sie nicht meiner Meynung?
Ich bin gar keiner Meynung, sagte er.
Sie sind Musiker und Kenner von Profession …
Sie irren; beydes bin ich nicht. Ich lernte ehemals Klavierspielen und Generalbass, wie eine Sache, die zur guten Erziehung gehört, und da sagte man mir unter anderm, nichts mache einen widrigern Effekt, als wenn der Bass mit der Oberstimme in Oktaven fortschreite. Ich nahm das damals auf Autorität an und habe es nachher immer bewährt gefunden.