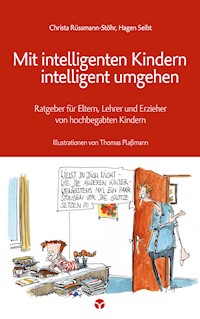
16,99 €
Mehr erfahren.
Es gibt viele Formen von Hochbegabung: sportliche, musikalische, sprachliche, emotionale, soziale, etc. Die intellektuelle Hochbegabung nimmt schon deshalb in der Reihe einen besonderen Platz ein, weil sie oft weder erkannt noch berücksichtigt wird und dann zu Verhaltensauffälligkeiten führen kann. Hochbegabte Kinder sind oft alles andere als glückliche Kinder. Das muss nicht sein. In ihrer Beratungspraxis haben die Autoren, beide Diplom-Psychologen, in unzähligen Fällen praktische Hilfestellungen für den Erziehungsalltag geben können und schöpfen für dieses Buch aus einem Schatz an Erfahrungen. Eltern, Erzieher(innen) und Lehrkräfte können davon profitieren. „Wir möchten betroffenen Eltern und Erziehern Mut machen, auch mal neue Wege zu gehen. Etwas Neues ausprobieren gibt den Eltern die Chance, ihre Kinder mit neuen Augen zu sehen und dadurch zu einem zufriedene(re)n Miteinander zu kommen.“ Dieses Buch wird empfohlen von der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Ähnliche
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
ISBN E-Book 978-3-92439-178-2
ISBN gedruckte Version 978-3-95779-022-4
Diesem E-Book liegt die Dritte aktualisierte Auflage 2019 der gedruckten Ausgabe zugrunde.
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
Originalausgabe unter dem gleichen Titel im Selbstverlag der Autoren
Erste Buchauflage 2015 im Info3-Verlag
Zweite Buchauflage 2015
Dritte aktualisierte Buchauflage 2019
© 2015 Info3-Verlagsgesellschaft Brüll & Heisterkamp KG
Buchgestaltung: Frank Schubert, Frankfurt am Main
Umschlag unter Verwendung einer Zeichnungvon Thomas Plaßmann
Satz: Felix Hau, Kulturfarm, Rinteln
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Über dieses Buch
Es gibt viele Formen von Hochbegabung: sportliche, musikalische, sprachliche, emotionale, soziale, etc.
Die intellektuelle Hochbegabung nimmt schon deshalb in der Reihe einen besonderen Platz ein, weil sie oft weder erkannt noch berücksichtigt wird und dann zu Verhaltensauffälligkeiten führen kann. Hochbegabte Kinder sind oft alles andere als glückliche Kinder. Das muss nicht sein. In ihrer Beratungspraxis haben die Autoren, beide Diplom-Psychologen, in unzähligen Fällen praktische Hilfestellungen für den Erziehungsalltag geben können und schöpfen für dieses Buch aus einem Schatz an Erfahrungen. Eltern, Erzieher(innen) und Lehrkräfte können davon profitieren. „Wir möchten betroffenen Eltern und Erziehern Mut machen, auch mal neue Wege zu gehen. Etwas Neues ausprobieren gibt den Eltern die Chance, ihre Kinder mit neuen Augen zu sehen und dadurch zu einem zufriedene(re)n Miteinander zu kommen.“
Dieses Buch wird empfohlen von der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind.
Über die Autoren
Hagen Seibt
Diplom-Psychologe, Fachpsychologe für Arbeit, Betriebe und Organisationen. Von 1990 bis 2004 Mitglied des Vorstandes der Wirtschaftspsychologie im BDP e.V. Gründer und 17 Jahre lang Leiter des Arbeitslkreises „Hochbegabte/Potenziale“ im Berufsverband Deutscher Psychologen e.V. Seit 1993 freiberuflicher Berater und Trainer.
Christa Rüssmann-Stöhr
Diplom-Psychologin, NLP-Practitioner. Von 1999 bis 2007 Vizepräsidentin des Verbandes zur Förderung der Wirtschaftspsychologie e.V. Seit 1974 freiberufliche Beraterin und Trainerin in der Personal- und Organisationsentwicklung.
INHALT
Zum Geleit
Vorwort
KAPITEL 1-23: URSACHEN, HINTERGRÜNDE, HANDHABUNG
Kapitel 1: Hochbegabung – kein eindeutiges Konzept
Kapitel 2: Erkennen von intellektueller Hochbegabung im Alltag
Kapitel 3: Begabungsdiagnostik durch Tests
Kapitel 4: Testverfahren konkret
Kapitel 5: Motivation
Kapitel 6: Lernen
Kapitel 7: Disziplin und Ordnung
Kapitel 8: Stress und Stressmanagement
Kapitel 9: Kommunikation von Gefühlen
Kapitel 10: Beziehung zu Gleichaltrigen
Kapitel 11: Beziehung zu Geschwistern
Kapitel 12: Tradition und Moral
Kapitel 13: Depressionen
Kapitel 14: Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen
Kapitel 15: Probleme der Eltern
Kapitel 16: Das Krabbelalter
Kapitel 17: Probleme im Kindergarten
Kapitel 18: Mobbing
Kapitel 19: Probleme in der Schule
Kapitel 20: AD(H)S
Kapitel 21: Asynchronie bestimmt die Entwicklung
Kapitel 22: Das 3 x 3 Begabungsmanagement
Kapitel 23: Das Prinzip der kognitiven Selbststeuerung
KAPITEL 24: BEGABUNGSMANAGEMENT
Begabungsmanagement 1:Arbeitshaltung in der Schule
Begabungsmanagement 2:Ausdauer fördernde Freizeitgestaltung
Begabungsmanagement 3:Angemessener elterlicher Erziehungsstil
Begabungsmanagement 4:Sozialverhalten in der Schule
Begabungsmanagement 5:Sozialverhalten in der Freizeit
Begabungsmanagement 6:Erziehung zum Sozialverhalten
Begabungsmanagement 7:Schule als Lernort für Gefühle
Begabungsmanagement 8:Freizeit und Emotionalität
Begabungsmanagement 9:Erziehungsstil und Gefühle
Kontakt und Informationen
Weitere Adressen
Autoren und Illustrator
Konformitätserklärung
Literaturhinweis
Zum Geleit
Mit diesem Buch halten Sie einen wunderbaren Ratgeber in Händen. Er richtet sich vor allem an Eltern hochbegabter Kinder und Jugendlicher, aber auch an deren Erzieher und Lehrer.
Die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind, DGhK e.V., arbeitet seit Jahren mit allen Beteiligten praxisnah und lebensorientiert. Dieses Buch stellt in besonderer Weise Beispiele aus solcher Arbeit dar. Gerade weil es kein wissenschaftlich orientiertes Buch ist, sondern aus Erfahrungen von Experten resultiert – nämlich den Eltern –, ist es wunderbar als Hilfe zur Selbsthilfe zu verstehen. Das Einbinden aller Beteiligten bietet neue Entwicklungschancen und fördert die Entfaltung der Hochbegabung.
Die beiden Autoren haben eine kreative Unterstützung durch den Illustrator Thomas Plaßmann erhalten, so dass auch der Humor beim Lesen nicht zu kurz kommt. Wir, die DGhK, haben eine große Freude an hochbegabten Kindern und wünschen uns, dass dieser Ratgeber dieselbe Freude in die Welt trägt.
Martina RosenboomPräsidentin der DGhK e.V.
„Ein Vorteil der Klugheit besteht darin,dass man sich dumm stellen kann.Das Gegenteil ist schon schwieriger.“
Kurt Tucholsky
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser1,
viele Bücher sind bereits zum Themenkreis Intelligenz/Hochbegabung bei Kindern geschrieben worden – warum noch eines?
Seit Jahrzehnten diagnostizieren und beraten wir zum Thema (Hoch-)Begabung. In dieser Zeit haben wir natürlich die einschlägige Literatur verfolgt. Meist schreiben Experten für Experten. Mit der Lupe zu suchen sind Ratgeber, die betroffenen Eltern, Erzieherinnen oder Lehrkräften konkrete Hinweise geben, wie nun mit problematischen hochbegabten bzw. besonders begabten Kindern umzugehen ist. Es gibt wenig Rat und Antwort auf die Frage: Wie gehe ich zu Hause mit solchen Kindern um? Die Eltern werden mit der Erziehung oft allein gelassen. Hier möchten wir konkrete Unterstützung anbieten.
Dieses Buch soll also nicht die akademische Diskussion bereichern. Es geht auch nicht um neue Schulprogramme. Es soll Rat geben, sprich: praktische Hilfestellung im Erziehungsalltag für die ganzheitliche Förderung der Kinder. Viele Förderprogramme beschränken sich auf den intellektuellen, kognitiven Bereich. Das greift zu kurz. Wo bleibt die Emotionalität? Wo das Sozialverhalten? Viele Probleme ergeben sich unserer Erfahrung nach erst dadurch, dass verschiedene Entwicklungsbereiche der Kinder unharmonisch auseinander klaffen.
Wir möchten betroffenen Eltern und Erziehern Mut machen, auch einmal neue Wege zu gehen. Etwas Neues ausprobieren gibt den Eltern die Chance, ihre Kinder mit anderen Augen zu sehen und dadurch zu einem zufriedene(re)n Miteinander zu kommen.
Dankbar sind wir den 4800 Eltern, die wir bisher beraten haben. Sie haben uns unendlich viele Beispiele genannt, wann und unter welchen Umständen bestimmte Maßnahmen erfolgreich waren. Diese wertvollen Rückmeldungen haben wir gesammelt und zu systematisieren versucht. Die Tipps gelten nicht nur für den Umgang mit Kindern, die klar als hochbegabt diagnostiziert worden sind, sondern auch für den Umgang mit besonders pfiffigen Kindern.
Mancher Tipp wird plausibler, wenn man mit einem neuen Verständnis und etwas anderer Hintergrundinformation an die Kinder herangeht. Als Grundlage dienen einschlägige psychologische Theorien, die allerdings stark verkürzt beschrieben sind.
Wir hoffen, dass Eltern unseren Ratgeber nicht nur einmal durchlesen und dann beiseite stellen, sondern ihn sich immer wieder einmal nehmen, darin herumschmökern und sich Anregungen zum Ausprobieren holen. Es gibt viele Eltern, die bei ihren besonders begabten Kindern mit ihren traditionellen Erziehungsmethoden nicht (mehr) weiterkommen. Diese finden hoffentlich den Mut, Neues zu riskieren. Denn es gehört schon Mut und Zuversicht dazu, sich mit seinem Kind gemeinsam auf eine neue Lernerfahrung einzulassen. Der Ausgang ist immer ungewiss. Die vielen aufgeführten Beispiele2, die sich natürlich nicht auf jedes Kind eins zu eins übertragen lassen, mögen die elterliche Phantasie anregen und zum Handeln auffordern.
Der besseren Auffindbarkeit wegen werden in diesem Buch auch die zusammenhängenden Ausführungen in einzelnen, jeweils kursiv überschriebenen Kerngedanken aufgeschlüsselt.
Wir wünschen allen Eltern, dass sie es schaffen, die wunderbare Kreativität dieser Kinder – die sich so oft störend in unserer Gesellschaft auswirkt – zu erhalten, ihre Kinder aber trotzdem zu befähigen, sich ohne seelischen Stress an gesellschaftliche Gepflogenheiten anpassen zu können. Wir haben solche sozial anpassungsfähigen Querdenker bitter nötig!
Christa Rüssmann-StöhrHagen Seibt
BEGRIFFSVIELFALT
Bei unserem Thema herrscht Verwirrung wie beim Turmbau zu Babel:
• „Hochbegabung“
• „besondere Begabung“
• „Sonderbegabung“
• „überdurchschnittliche Begabung“
• „Hochleistungsdisposition“
• „potenzielle Hochbegabung“
• „allgemeine Hochbegabung“
• „spezifische Begabungen“
• „intellektuelle Hochbegabung“
• „intellektuelle Begabung“
• „nicht-intellektuelle Begabung“
• „besonderes Talent“
• „generelle Intelligenz“
• „emotionale Intelligenz“
• „soziale Intelligenz“
• „allgemeine Intelligenz“
• „multiple Intelligenzen“
• „mathematisch-räumliche Intelligenz“
• „sprachliche Intelligenz“
• „fluide und kristalline Intelligenz“
So lauten einige der gebräuchlichen Begriffe in diesem Zusammenhang. Sie meinen teilweise dasselbe, teilweise Unterschiedliches. Geradezu eine Inflation von Begabungen und Intelligenzen.
THEORIEVIELFALT
Vergleichbares gilt für den theoretischen Hintergrund. Theorien zur Hochbegabung gibt es seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Experten sind sich bis heute nicht einig. Es gibt nicht die einzige, unumstrittene Auffassung,
• was Hochbegabung oder besondere Begabung eigentlich ist,
• womit sie zusammenhängt,
• wie sie entsteht,
• wie man am besten mit ihr umgeht.
Einig sind sich alle Experten darin, dass Intelligenz nicht homogen ist, dass sich Intelligenz also aus mehreren Aspekten ergibt. Ein Modell geht von einer Vielzahl unabhängiger Faktoren aus. Andere Experten sehen einen generellen Grundfaktor und darüber hinaus einzelne Spezialfaktoren.
Eine weitere Unterscheidung, die Eingang in die Konstruktion von Testverfahren gefunden hat, ist die Differenzierung zwischen sogenannter fluider und kristalliner Intelligenz. Unter fluider Intelligenz (von lateinisch fließend) wird „Bewegliches“ verstanden, also Denkgeschwindigkeit, Gedankenvielfalt, Kreativität, Originalität, Gehen eigener Denkwege, Phantasie. Kristalline Intelligenz ist dagegen eher etwas „Festes“, wie alles Gelernte, unsere Erfahrungen, Bildung, Wissen. Kristalline Intelligenz nimmt mit den Jahren zu, fluide Intelligenz nimmt mit den Jahren eher ab.
Bekannte deutsche Forscher auf dem Gebiet sind C. Fischer, K. A. Heller, F. J. Mönks und D. H. Rost, von denen jeder sein eigenes Konzept vertritt.
Lassen wir die Diskussion in der Wissenschaft beiseite, denn sie hilft im Alltag – im Umgang mit besonders begabten Kindern – nicht viel weiter. Was nun ist mit Hochbegabung gemeint?
Hochbegabung gleich Einstein oder Beethoven?
Es geht nicht um spezielle Sonderbegabungen à la Mozart oder Beet-hoven auf einem bestimmten Gebiet, sei es die Musik, die Kunst oder der Sport. Hochbegabung bezieht sich auf grundlegende Faktoren, die Intelligenz ausmachen, wie z.B. Denkgeschwindigkeit, Aufmerksamkeitsspanne, Erkennen logischer Zusammenhänge und Regeln, neugieriges kreatives Finden, das Wissen darum, warum etwas so und nicht anders ist.
Intellektuell hochbegabt ist jemand,
• der sich schnell und effektiv neues Wissen aneignen kann, landläufig schnelle Auffassungsgabe genannt;
• der neues Wissen, neue Erkenntnisse mit bereits vorher Eingespeichertem breit vernetzen kann;
• der sein Wissen in neuen Situationen gezielt einsetzen kann;
• der seine Denk- und Lösungsstrategien auf ungewohnte Fragestellungen zielsicher übertragen kann;
• der gut auch schwierige Probleme lösen kann.
Wie viel ist drei Viertel von 60?
Ein Beispiel für die Denkstrukturen Hochbegabter: Ein siebenjähriger Junge gab auf die Frage: „Wie viel ist drei Viertel von 60?“ die richtige Antwort: 45.
Da er Bruchrechnen nicht kannte, konnte er nicht den für uns üblichen Weg der Berechnung (60 : 4 x 3) beschritten haben. Wie er darauf gekommen ist? Er hat nicht geraten, sondern logisch abgeleitet: „Die Stunde hat 60 Minuten. Und eine Dreiviertelstunde hat 45 Minuten. Also muss es 45 sein.“
Wie viel ist 7 mal 7?
Ein Vorschüler, fünf Jahre alt, murmelt: „2 mal 7 ist 14, dann 28, 3 ... ist 48, dann muss ich noch eins dazu, raus kommt also 49.“ Was steckt hinter dieser kryptischen Äußerung? Der Gedankengang des Kleinen war offensichtlich folgender: 2 x 7 ist 14. Dann ist 4 x 7 das Doppelte, also 28. Dann müssen noch 3 x 7, also 21 dazu. Da nehme ich erst die glatte Zahl 20, da bin ich bei 48. Und dann bleibt noch eins, was dazu muss. Also ist das Ergebnis 49.
Wann hast du Geburtstag?
Und ein letztes Beispiel. Es geht um die Bestimmung des Geburtsdatums. Frage: „Wann hast du Geburtstag?“ Antwort eines Fünfjährigen: „Am 13. Februar.“ Nächste Frage: „Und in welchem Jahr?“ Erstaunte Antwort: „In jedem Jahr.“ Völlig korrekte Antwort auf die ihm gestellte schwammige Frage.
HOCHBEGABUNG GLEICH GUTE LEISTUNG? UND GLEICH GUTE SCHULNOTEN?
Begabung ist nicht gleich Leistung. Der Hochbegabte als Primus mit nur Einsen auf dem Zeugnis: Das ist ein Vorurteil, das muss ganz und gar nicht so sein. Die Meinung, dass besonders begabte Kinder aufgrund ihrer enormen Begabung schulische Anforderungen gut bewältigen, dass ihnen alles leicht(er) von der Hand geht, ist ein Mythos. Oder um es anders zu sagen: Lernen und üben müssen auch Hochbegabte. Viele Probleme mit besonders begabten Kindern ergeben sich daraus, dass sie das Üben, die Anstrengung und das Lernen nicht oder viel zu spät lernen. Nur ca. 20 bis 25 Prozent der Ursachen für gute Schulleistung sind auf die Intelligenz zurückzuführen, also weit mehr als zwei Drittel liegen an anderen Faktoren! Oder anders herum: Man muss keineswegs hochbegabt sein, um in Schule oder Beruf Erfolg zu haben. In Zahlen: Lediglich 15 Prozent der hochleistenden Schüler sind Hochbegabte. Die anderen 85 Prozent sind nicht hochbegabt und erbringen trotzdem Höchstleistungen.
Begabung ist ein Potenzial. Persönlichkeitsmerkmale wie Motivation, Arbeitshaltung, Lernstrategien, Anstrengung, Durchhaltevermögen müssen hinzukommen. Und es gibt noch einen dritten wichtigen Faktor, von dem die Leistung abhängt: das soziale Umfeld.
„DIE“ HOCHBEGABUNG GIBT ES NICHT
Ebenso wie normal begabte Kinder sehr verschieden sind, so sind auch Hochbegabte keine einheitliche, eindeutig erkennbare Gruppe. Unter Hochbegabten findet man eine ebenso große Vielfalt von kleinen Persönlichkeiten, eine Vielzahl unterschiedlicher Verhaltensweisen. Unauffällig Angepasste, auffällige Chaoten, unbeliebte Besserwisser, beliebte Klassensprecher, usw. usw.
Underachiever
Es gibt sehr wohl Hochbegabte, die sehr schlechte Noten haben, die in der Schule versagen. Auf neudeutsch nennt man sie „Underachiever“ (Minderleister oder Geringleister), da sie viel mehr leisten könnten als sie tatsächlich zeigen. Hochbegabung ist eben nur die Möglichkeit zur Leistung, nicht die Leistung selbst. Daher gehen schulische Fördermaßnahmen, die sich auf Leistung beziehen – und das ist bei den meisten nach wie vor der Fall –, an Hochbegabten oft spurlos vorbei.
Hochbegabung braucht Unterstützung
(Hoch-)Begabung ist, wenn man so will, der gute Boden, der bei entsprechender Pflege viele hervorragende Pflanzen hervorbringen kann. Wenn dieser gute Boden aber schlecht beackert wird, dann wächst nicht viel außer Unkraut. Das heißt: Hochbegabte Kinder bedürfen ebenso wie Minderbegabte einer besonderen Förderung, einer „Sonderpädagogik“. Hier sind Eltern wie Lehrer gefordert. Es kann nicht deutlich genug gesagt werden: Das Leistungsvermögen von Hochbegabten wird üblicherweise viel zu optimistisch eingeschätzt. Oder mit anderen Worten, von alleine entwickelt sich nicht viel. Ausgeklügelte individuell zugeschnittene Lerngelegenheiten mit hochwertigem Feedback sind absolut notwendig, damit auch besonders begabte Kinder lang andauernde Lernprozesse konzentriert durchhalten.
Hochbegabung ist äußerlich nicht sichtbar. In Situationen, in denen die besonderen Fähigkeiten Hochbegabter nicht zum Tragen kommen können, werden Hochbegabte nicht auffallen.
Hochbegabung gleich Behinderung?
Hochbegabung ist keine Krankheit, keine therapiebedürftige Behinderung. Hochbegabte sind keine durchgeistigten wunderlichen Sonderlinge, die an der richtigen Welt vorbei leben, Typ „zerstreuter Professor“. Auch die „Genie-Wahnsinn-These“ entspricht nicht den Tatsachen. Hoch- bzw. höchstbegabte Menschen entwickeln nicht zwangsläufig eine pathologische Persönlichkeitsstörung. Hochbegabung ist Potential, das allerdings nur bei entsprechender Erziehung und Unterrichtsgestaltung zu kreativ-schöpferischen oder wissenschaftlichen Leistungen führt.
Hochbegabung gleich Erfolg und Karriere?
In Schlüsselpositionen in der Wirtschaft oder in der Politik sitzen selten Hochbegabte. Wo Macht und Durchsetzungsverhalten eine große Rolle spielen, ist die ausgeprägte Sozialkompetenz Hochbegabter fehl am Platz. Sie streben deshalb in der Regel keine Führungspositionen an, sie verweigern sogar klassische Karrierewege, weil sie fürchten, dann nicht mehr inhaltlich sinnvoll arbeiten zu können. Andererseits wollen sie hoch motiviert ihre Umgebung, ihre Arbeit, ihre sozialen Beziehungen zum Besseren gestalten. Hochbegabte bringen sich hier deutlich mit Verbesserungsvorschlägen ein – nicht immer zur Freude von Chef und Kollegen.
Hochbegabten geht es zumeist um logische Konsequenzen, um sachliche Richtigkeit beziehungsweise grundsätzliche Klarheit. Dieses Bestreben kann dazu führen, dass einige Hochbegabte gegen die Autorität oder das System rebellieren und von daher aggressiv und renitent erscheinen. Sie haben ihre Schwierigkeiten mit dem normalen Erziehungssystem, ebenso wie Minderbegabte damit ihre Schwierigkeiten haben.
Hochbegabte Kinder ziehen sich durch ihre hohe soziale Sensibilität eher zurück – die anderen gleichaltrigen Kinder sind zu laut, zu dumm, zu derb, zu aggressiv... Hochbegabte sind nicht aggressiv – Aggression und körperliche Gewalt finden sich eher bei Kindern, die unterdurchschnittlich intelligent sind.
Hochbegabung/Intelligenz: eine Sache der Gene?
Seit Jahrzehnten gibt es einen Zweig der Intelligenzforschung, der sich mit der Anlage-Umwelt-Frage beschäftigt: Ist Intelligenz angeboren oder von der Umwelt des Kindes geprägt, also erziehungsabhängig? Die Antwort darauf ist nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-Als auch. Der heutiger Stand der Wissenschaft besagt: Die Intelligenz ist zu ca. 50 Prozent durch die genetische Ausstattung bestimmt und zu ca. 50 Prozent durch die Umgebungsbedingungen, etwa familiärer Umgangsstil, Schule, Freunde.
Dazu noch einmal das Landwirtschaftsbild zur Verdeutlichung: Hat der Bauer einen schlechten Ackerboden, bearbeitet ihn aber mit viel Bodenverbesserungsmitteln und Dünger, so wird er trotz schlechter Ausgangslage eine gute Ernte erhalten können. Hat der Bauer dagegen einen ausgezeichneten Boden, bearbeitet ihn aber nicht sorgsam, so wird er trotz guten Bodens im Laufe der Jahre nur eine schlechte Ernte einfahren. Genauso ist es mit den intellektuellen Fähigkeiten: Werden sie nicht gefördert und trainiert, verkümmert auch eine gute genetische Anlage. Auch Hirnzellen, die die Basis für den Grips darstellen, sind Körperzellen. Sie müssen wie Muskeln beansprucht, trainiert werden, sonst werden sie träge und schlaffen ab.
Aber der Bauer kann das Pflanzenwachstum auch durch zu viel Dünger erzwingen wollen. Entsprechend: Gerade für die frühe Kindheit darf nicht vergessen werden, dass Reifungsprozesse ihre Zeit brauchen, dass Förderung „um jeden Preis“ Schaden anrichten kann.
ABHAKEN UND AUFSUMMIEREN REICHEN NICHT
Es gibt nicht „die“ Hochbegabung, „das“ hochbegabte Kind, sondern ganz unterschiedliche Erscheinungsformen. Wie alle Menschen sind auch die besonders begabten verschieden. Daher ist jede Checkliste, auch unsere, mit großer Vorsicht zu genießen. Die einfache Formel „mein Kind ist umso begabter, je häufiger ich auf die folgenden Fragen mit ja antworte“ gilt nicht.
DENK-, BEOBACHTUNGS- UND GESPRÄCHSGRUNDLAGE
Die Checkliste enthält universelle bis konkrete Verhaltensweisen und Beobachtungen, die im Zusammenhang mit Hochbegabung gemacht worden sind. Nicht alle davon sind in wissenschaftlichen Studien auch tatsächlich belegt worden, von daher haben wir schon unsere „Bauchschmerzen“ bei der Veröffentlichung.
Dennoch kann die Checkliste hilfreich sein: Die Zusammenstellung soll Ihnen Denk- und Beobachtungsanstöße liefern, Ihren Blick schärfen und Ihnen erste Hinweise für Hochbegabung liefern. Die Checkliste kann auch als Gesprächsbasis dienen, wenn sich Eltern, Erzieher und Lehrer über das Kind austauschen.
Universelle Hinweise
• Braucht Ihr Kind wenig Schlaf?
• Treibt Ihr Kind wenig Sport?
• Ist Ihr Kind sehr lärmempfindlich?
• War Ihr Kind als Neugeborenes erstaunlich wach (große offene Augen, herumschauen, Kopf heben und drehen, Gegenstände fixieren...)?
• War Ihr Kind schon als Baby anstrengend, da es nicht alleine im Wagen liegen bleiben wollte?
• Hat Ihr Kind die Krabbelphase übersprungen und ist gleich gelaufen?
Hinweise für Hochbegabung aus dem Bereich:Lernen, Denken, Gedächtnis, intellektuelle Leistung
• Lernt das Kind leicht und schnell?
• Lernt es früh rechnen?
• Hat sich Ihr Kind – lange vor Schulbeginn – Lesen, Schreiben und Rechnen selbst beigebracht?
• Ist für Ihr Kind Lesen das Wichtigste im Leben?
• Schreibt (und liest) Ihr Kind Gedichte?
• Bevorzugt das Kind Kombinations- und Konstruktionsspiele?
• Hat das Kind in einzelnen Bereichen ein sehr hohes Detailwissen?
• Ist sein Wortschatz für das Alter ungewöhnlich groß?
• Ist die Sprache des Kindes ausdrucksvoll, ausgearbeitet und flüssig?
• Hat Ihr Kind nie Babysprache, sondern gleich „richtig“ gesprochen, in ganzen Sätzen?
• Erfasst es die Feinheiten der Sprache?
• Hat Ihr Kind schon früh die komplizierten Regeln der Sprache (Grammatikregeln) richtig angewendet?
• Ist Ihr Kind „gegensätzlich“: es redet wie ein Erwachsener, aber weint und tobt wie ein Kleinkind?
• Kann sich das Kind Fakten schnell merken?
• Lernt Ihr Kind Lieder und Gedichte schnell auswendig?
• Kann das Kind sehr viele Informationen behalten?
• Verknüpft das Kind Ideen oder Dinge miteinander nach Gesichtspunkten, die ungewöhnlich sind oder nicht auf der Hand liegen (divergentes Denken)?
• Beobachtet und kategorisiert Ihr Kind seltsame Gegenstände wie beispielsweise Tiergeweihe oder Kirchtürme?
• Verblüfft das Kind mit logischem Denken?
• Durchschaut es sehr schnell Ursache-Wirkung-Beziehungen?
• Sucht es nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden?
• Erkennt das Kind sehr schnell zugrundeliegende Prinzipien?
• Kann das Kind schnell gültige Verallgemeinerungen herstellen?
• Kann das Kind außergewöhnlich gut beobachten?
• Liest das Kind sehr viel von sich aus? Liest es Bücher, die über seine Altersstufe deutlich hinausgehen?
• Gibt das Kind in seinen Äußerungen zu erkennen, dass es kritisch, unabhängig und wertend denkt?
• Kann das Kind früher lesen als die meisten Kinder, oft schon, bevor es in die Schule kommt (ohne Anleitung)?
• Erlernt das Kind sehr schnell Grundfertigkeiten und braucht es dazu wenig Übung?
Hinweise für Hochbegabung aus dem Bereich:Arbeitshaltung, Interessen, Motivation
• Hat das Kind ein breites Interessenspektrum?
• Interessiert sich Ihr Kind weniger für Kinderspielzeug als für die Bedienung von Erwachsenengeräten?
• Verbringt Ihr Kind vergleichsweise wenig Zeit vor dem Fernsehapparat?
• Ist das Kind unendlich neugierig und fragt und fragt und fragt...?
• Hat Ihr Kind eine nahezu unbegrenzte Energie und ist einfach nicht müde/erschöpft zu kriegen?
• Geht das Kind in bestimmten Problemen phasenweise völlig auf?
• Kann es sich intensiv konzentrieren, zeigt es Ausdauer, kann es die Aufmerksamkeit lange bei einer Sache halten?
• Hat das Kind Interesse am Experimentieren und daran, Dinge anders zu tun?
• Kann sich Ihr Kind mit mehreren Sachen gleichzeitig beschäftigen?
• Will Ihr Kind Dinge unbedingt selbst tun, auf seine ganz eigene Art erledigen?
• Bemüht sich das Kind, Aufgaben stets vollständig zu lösen?
• Ist das Kind bei Routineaufgaben schnell gelangweilt?
• Klagt Ihr Kind bereits kurz nach der Einschulung über Langeweile, obwohl es sich sehr auf die Schule („endlich lernen“) gefreut hat?
• Macht Ihr Kind bei leichten Schulaufgaben viele Fehler, während es schwere Aufgaben problemlos bewältigt?
• Löst Ihr Kind Mathematikaufgaben vom Ergebnis her richtig, macht aber Fehler bei Zwischenschritten?
• Strebt das Kind nach Perfektion?
• Ist das Kind selbstkritisch?
• Ist das Kind mit seinem eigenen Tempo oder Ergebnis nicht schnell zufriedenzustellen? Erscheint die Diskrepanz zwischen dem, was Ihr Kind „im Kopf hat“ und dem, was es mit den Händen umsetzen kann, riesengroß?
• Wird Ihr Kind zornig, reagiert es sogar mit regelrechten Wutausbrüchen, wenn es aufgrund körperlicher Unzulänglichkeit Dinge nicht wie geplant umsetzen kann?
• Verhält sich Ihr Kind in der Schule nach Aussage der Lehrer auffällig: es spielt dem Klassenclown und stört den Unterricht? Es schaltet ab und träumt?
• Verweigert Ihr Kind strikt und unerbittlich den Schulbesuch?
• Hat Ihr Kind vor der Schule häufiger Bauch- und Kopfschmerzen, was in den Ferien so gut wie nie vorkommt?
• Ist Ihr Kind in der Schule schon gemobbt worden?
• Arbeitet es gern unabhängig, um hinreichend Zeit für das eigene Durchdenken eines Problems zu haben?
• Setzt es sich hohe Leistungsziele und löst es (selbst)gestellte Aufgaben mit einem Minimum an Anleitung und Hilfe durch Erwachsene?
• Interessiert es sich für viele „Erwachsenenthemen“ wie Religion, Philosophie, Politik, Umweltfragen, Sexualität, Gerechtigkeit in der Welt...?
Hinweise für Hochbegabung aus dem Bereich:Sozialverhalten
• Beschäftigt sich Ihr Kind viel mit Begriffen wie Recht und Unrecht, Gut und Böse? Ist es bereit, sich gegen autoritäres Verhalten zu engagieren?
• Vertritt Ihr Kind seine Meinung als Minderheit gegen die Meinung der Mehrheit?
• Ist Ihr Kind eigenwillig, individualistisch (im Sinne von Selbststeuerung)?
• Akzeptiert Ihr Kind erst dann die Meinung von Autoritäten, wenn es sie einer kritischen Prüfung unterzogen hat?
• Hohe Sensibilität gegenüber Ungerechtigkeit: Lässt sich Ihr Kind Ungerechtigkeiten nicht gefallen?
• Setzt sich Ihr Kind auch gegen Widerstände häufiger für schwächere Mitschüler ein?
• Vermeidet Ihr Kind körperliche Auseinandersetzungen und solcherlei „Wettkämpfe“?
• Kann Ihr Kind gut Verantwortung übernehmen? Erweist es sich in Planung und Organisation als zuverlässig?
• Wenn Ihr Kind keine passenden Freizeitpartner findet: Zieht es sich dann zurück, um sich mit Büchern oder Denkaufgaben zu beschäftigen?
• Hat(te) Ihr Kind im Vorschulalter eine sehr enge Beziehung zur Mutter?
• Spielt Ihr Kind bevorzugt mit älteren Kindern?
• Hat Ihr Kind wenige Freunde, vor allem kaum Beziehungen zu gleichaltrigen Kindern?
• Sucht Ihr Kind seine Freundschaften bevorzugt unter Gleichbefähigten?
• Neigt Ihr Kind schnell dazu, über Situationen zu bestimmen?
• Ist das Kind auffällig sensibel?
• Kann sich Ihr Kind gut in andere einfühlen? Ist es für politische und soziale Probleme aufgeschlossen?
• Hat das Kind einen ungewöhnlichen Sinn für Humor?
WARUM DAS KIND TESTEN LASSEN?
Eltern sollten zur definitiven Absicherung der Diagnose sowie zur Klärung der weiteren Schritte bei einem Psychologen einen umfangreichen Test durchführen lassen,
• wenn sich die Hinweise auf Hochbegabung häufen;
• wenn die Eltern verunsichert sind;
• wenn sich Meinungen oder (Vor-)Urteile gebildet haben;
• wenn Klarheit über die Stärken und Schwächen des Kindes gewonnen werden soll;
• wenn es in der Beurteilung des Kindes Diskrepanzen und Konflikte gibt – zwischen den beiden Elternteilen, zwischen Eltern und Kindergarten/Schule;
• wenn zusätzliche Informationen für eine Entscheidung eingeholt werden müssen (vorzeitige Einschulung, Gymnasialempfehlung).
In welchem Alter sollte man das Kind testen lassen?
Hier gilt der Grundsatz: Ein frühes Erkennen der Hochbegabung ist besser als ein (zu) spätes. Früh bedeutet aber nicht Kleinstkindalter, da für diese Altersspanne keine elaborierten Tests vorliegen (können).
Das optimale Alter wäre nach dem 6. Geburtstag, aber noch vor dem Einschulungstermin, damit rechtzeitig schulbezogene Weichen gestellt werden können.
Psychologischer Test
Zu psychologischen Testverfahren generell und zu Intelligenztests im Besonderen gibt es auch kritische Ansichten, die Intelligenztests beispielsweise wegen mangelnder Chancengleichheit als Ausleseverfahren ablehnen.
Das Konzept der Intelligenz und seiner Messbarkeit sieht in einem Intelligenztest ein wissenschaftlich abgesichertes Messverfahren, das für betroffene Eltern klare Vergleichszahlen liefern kann. Die individuellen geistigen Fähigkeiten (nennen wir sie Intelligenz) eines Kindes werden mit den entsprechenden Fähigkeiten der jeweiligen Altersgruppe verglichen. Damit kann für unterschiedliche Bereiche die individuelle Begabungsstruktur des Kindes festgestellt werden.
DER IQ
Die ersten Intelligenztests wurden bereits 1905 von BINET konstruiert. Der Intelligenzquotient geht auf STERN (1916) zurück, der ihn nach folgender Formel berechnet hat:
Intelligenzalter / Lebensalter x 100 = IQ
Das Intelligenzalter wird durch verschiedene Aufgaben ermittelt.
Höhe und Verteilung der IQ-Werte
Wie andere menschliche Eigenarten bildet man die Verteilung des Intelligenzwerts mit der so genannten Gaußschen Normalverteilungskurve ab. Die Kurve besagt, dass es viele Menschen gibt mit einer mittleren Intelligenzausprägung, es gibt wenige mit einer sehr geringen Intelligenz und ebenso wenige mit einer sehr hohen Intelligenz.
Bezogen auf durch Tests gemessene IQ-Werte legt man fest: 100 ist der Mittelwert und entspricht dem Durchschnitt der Altersgruppe. Bei einem IQ von unter 80 spricht man von Minderbegabung oder Lernbehinderung. Für Werte über 100 gilt:
IQ ≥ 130
Ab 130 liegt eindeutig Hochbegabung vor. Das sind immerhin gut zwei Prozent jedes Jahrgangs.
Dieser Grenzwert von 130 ist verteilungsstatistisch (Unschärfe: 2,2 Prozent bei PR ≥ 97,8) begründet, nicht inhaltlich! Er ist eine willkürliche Konvention. Es gibt keinerlei Belege dafür, dass ein Mensch mit einem IQ von 132 anders denkt, lernt, handelt als ein Mensch mit einem IQ von 128.
IQ ≥ 120 ≤ 130
In dem Bereich zwischen 120 und 130 ist eine individuelle Interpretation der Teilergebnisse und der Verhaltensbeobachtung erforderlich, um eine eindeutige Diagnose zu erhalten, die Grundlage für zum Teil einschneidende Maßnahmen ist. Die individuelle Interpretation ist auch deshalb angeraten, weil der ermittelte IQ-Zahlenwert von beispielsweise 127 kein exakt feststehender Wert ist, sondern eine Wahrscheinlichkeit beschreibt.
Das hat mit Testkonstruktion und Statistik zu tun: der mit einem Test ermittelte Wert von 127 kann bedeuten, dass der „wahre Wert“ im Bereich zwischen 117 (-10) und 137 (+10) liegt. Und dies gilt in aller Regel mit 95prozentiger Wahrscheinlichkeit („5 Prozent-Niveau“). Die Höhe des so genannten Vertrauensintervalls, im Beispiel ±10, ist von Test zu Test verschieden.
IQ-Wert: lebenslang stabil?
Die IQ-Werte bleiben nicht automatisch über Jahrzehnte stabil. Im frühkindlichen Entwicklungsalter schon gar nicht. Erst ab dem 5. Lebensjahr ist von einer gewissen Stabilität auszugehen. Dennoch gilt als Faustregel für die Grundschulzeit, dass Testwerte, die älter als ein Jahr sind, nur mit großer Vorsicht interpretiert werden sollten.
WER SOLL TESTEN?
• Wenn Sie sich dazu entschlossen haben, einen Test durchführen zu lassen, dann stellen Sie bitte in ureigenem Interesse sicher, dass Sie an eine(n) ausgewiesene(n) Fachfrau/-mann geraten. Die folgenden Fragen sollen Ihnen helfen, den erfahrenen, umsichtigen und problemlösungsorientierten Diagnostiker zu finden.
• Welche Ausbildung hat Ihr Gesprächspartner?
• Welche Erfahrung hat er auf dem Gebiet der Intelligenzdiagnostik und -beratung? Wie viele Kinder hat er bereits getestet?
• Welche(s) Testverfahren setzt er bei welchem Kind mit welcher Begründung ein?
• Fragt er Sie vorab nach Ziel und Zweck der Testung?
• Bietet der Diagnostiker neben dem Test auch Beratung an?
• Was genau ist in dem Preis enthalten, der Ihnen genannt wird?
• Aus wie vielen Bausteinen besteht die Testsitzung (Vorgespräch, Anamnese etc.)?
• Ist derjenige, der dann letztlich den Test durchführt, auch Ihr Gesprächspartner?
• Was rät er Ihnen, wie Sie Ihr Kind auf die Testung vorbereiten sollen? Was sollen Sie Ihrem Kind zum Test selbst und zu dem Zweck der Testung sagen?
• Wie geht der Diagnostiker vor dem eigentlichen Test auf Ihr Kind ein, damit es ausreichend motiviert ist mitzumachen? Hat er dazu ein Konzept?
• Beschränkt sich der Diagnostiker auf nackte Zahlen oder gehen Verhaltensbeobachtungen mit in das Ergebnis ein? Verhaltensbeobachtung meint, wie der Diagnostiker Ihr Kind vor, während und nach der eigentlichen Testung erlebt hat.
• Inwieweit wird das Kind in die Besprechung der Testergebnisse bzw. in die Beratung mit einbezogen? Hat der Diagnostiker dazu ein Konzept?
• Bekommen Sie ein schriftliches Ergebnis mit nach Hause?
• Würde sich Ihr Gesprächspartner auch in der Schule Ihres Kindes engagieren, beispielsweise mit den Lehrern reden, an einer Schulkonferenz teilnehmen oder ähnliches?
• Verfügt der Diagnostiker über Kontakte zu weiterhelfenden Institutionen (z.B. Therapie, Hochbegabtenförderung)?
Persönliche Test-Vorbereitung
Wenn Sie es einrichten können, kommen Sie zu zweit. Vater und Mutter sehen ihr Kind unterschiedlich und „hören auf anderen Ohren“. Und Sie vermeiden die Schwierigkeit, dem daheim gebliebenen Elternteil die Ergebnisbesprechung wiedergeben zu müssen.
Erklären Sie Ihrem Kind den Zweck des Testtermins: „Wir fahren zu jemandem, der herausfindet, was du so alles drauf hast“; „der uns hilft, die richtige Schule für dich zu finden“; „der uns erklärt, warum du so oft vor der Schule Bauchschmerzen hast“. Bleiben Sie ganz dicht bei der Wahrheit. Ihr Kind spürt, wenn Sie flunkern.
Erklären Sie Ihrem Kind im Groben, wie der Testtermin ablaufen wird. Vermeiden Sie den Begriff „Hochbegabung“ oder „Intelligenztest“. Ein Frage-und-Antwort-Spiel, ein Quiz mit Knobelaufgaben hört sich sowieso spannender an.





























