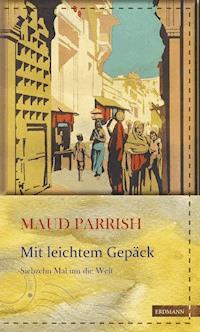
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Erdmann in der marixverlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die kühne Reisende
- Sprache: Deutsch
Noch immer herrscht Goldgräberstimmung in Kalifornien, als die 17-jährige Maud Parris 1895 in San Francisco heiratet – und es augenblicklich bereut. Denn "Freiheiten für normale Frauen, die gab es in San Francisco nicht". Die junge Frau mit dem großen Freiheitsdrang verlässt ihren Mann, schnappt sich ein Banjo und reist mit leichtem Gepäck und ein bisschen Geld in der Tasche über Seattle nach Alaska. Schnell schließt sie sich dort den Spielern und Spekulanten an, die ihren Traum vom Abenteuer verkörpern. – Get your gun, Maud! – Sie wird eine von ihnen, verdient ihr Geld spielend und tanzend. Wenn sie genug zusammen hat, reist sie weiter. Später, während eines längeren Aufenthalts in Peking, etabliert sie sich selbst als Geschäftsfrau und eröffnet einen Spielsalon, dessen Einnahmen es ihr ermöglichen, zu tun, was sie am liebsten macht: reisen, fremde, geheimnisvolle Orte aufsuchen, die Welt erobern: Afrika, Asien, Südamerika, Europa, die Südseeinseln, den Orient. Siebzehn Mal hat sie den Erdball umkreist, hat Kriege und politische Unruhen erlebt. Vom russisch-japanischen Krieg über die Turbulenzen des 1. Weltkriegs bis zu den Ereignissen am Vorabend des 2. Weltkriegs, den sie bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin erlebt – reisend hat Maud Parrish die Zeitläufe und politischen Veränderungen auf der Welt erfahren. Und schließlich hat sie über die Erfahrungen ihres Lebens ein Buch geschrieben. Es ist spannender als jeder Abenteuerroman: der Bericht einer mutigen, wachen, unerschrockenen Frau die mitten im Weltgeschehen unterwegs ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE KÜHNE REISENDE
Maud Parrish, geboren 1878 in San Francisco, sollte, so der Wunsch der Eltern, eine Pianistin werden, aber das junge Mädchen war zu zierlich, ihre Hände zu klein. Auch die von den Eltern arrangierte Ehe hielt nicht lange. Aufgewachsen auf San Franciscos Russian Hill, von wo aus man einen guten Blick auf den Hafen hatte, erwachten in ihr Fernweh, Reisefieber und Wanderlust. 1895 unternahm sie die erste ihrer großen Reisen, die sie immer wieder rund um die Welt führten. 1939 schrieb sie darüber ihr erstes und einziges Buch. 1976, im Alter von 98 Jahren, starb sie in ihrer Heimatstadt.
Conny Lösch lebt in Berlin und hat unter anderem Bücher von Gail Jones, Don Winslow und Ian Rankin übersetzt.
Susanne Gretter studierte Anglistik, Romanistik und Politische Wissenschaft in Tübingen und Berlin. Sie lebt und arbeitet als Verlagslektorin in Berlin. Sie ist die Herausgeberin der Reihe DIE KÜHNE REISENDE.
Maud Parrish
Mit leichtem Gepäck
Siebzehn Mal um die Welt
Aus dem Amerikanischen Englisch vonConny Lösch
Mit einem Vorwort vonSusanne Gretter
INHALT
„LEBEN, DAS IST MUSIK, TANZ UND FREIHEIT“Vorwort von Susanne Gretter
ICH LEBE, WIE ES MIR GEFÄLLT
IZURÜCK ZUM URSPRUNG
Der Goldene Westen
Ab nach Norden
Nach Süden
IIFLÜGGE WERDEN
Nach Osten
Peking
IIIFRÖHLICHE KARUSSELLFAHRT
Wahnsinn in Manila
Lateinamerikaner sind unglaublich
Hüpfen, hopsen und springen
IVWO DIE SONNE AUFGEHT
VVAGABUNDENZEIT
Auf fahrenden Zügen
VIDIE BÜRDE DES WEISSEN MANNES
Maskerade
Die Zivilisatoren ziehen in den Krieg
Mutter Indien
Ruinen, menschliche und andere
VIINIEMANDSLAND IM OSTEN
Die Gewürzinseln
VIIIZWISCHENSPIEL
IXAUF DER KÄSEKISTE
XMITTEN IM NIRGENDWO
Geliebte alte Städte
Tausendsiebenhundert Meilen über den Jangtse
Abstecher nach Hause
XIVON INSEL ZU INSEL IM PAZIFIK
Weiße Männer
Feiernde Forscher
Neuseeland
Inseln voller Palmen
Die von Gott vergessenen Inseln
XIIMED KOMMT IN DIE USA
XIIIZWANGSJACKE
XIVENTKOMMEN
Französische Hölle
XVEIN JAHR AM ÄQUATOR
Para
Großvaterfluss
Sprung über die Anden
Ecuador
Reise nach Eden
XVI»UNBEKANNT VERZOGEN«
XVIINORDISCHE MENSCHEN – REINE UND ANDERE
Reine
Hamburg
Mittsommernacht
Olympiade
XVIIIWESTLICHER ORIENT
Fahrerflucht
Roter Stern
XIXSALAAM
Iran
Fremde Götter
Tausend und eine Nacht
XXSCHICKSAL
Ambitionen
Pomp und so weiter
Hooky
L’envoi
VORWORT
»Leben, das ist Musik, Tanz und Freiheit.«
»In meiner Familie gibt es seit zwei Generationen Vagabunden und Abenteurer … sie zogen los, um etwas zu erleben.« Auch Maud Parrish, geboren 1878 in San Francisco und behütet aufgewachsen als Einzelkind – ihr Vater war ein begüterter Holzhändler, die musisch veranlagte Mutter brachte ihr Tanzen, Klavier- und Banjospielen bei –, wollte etwas erleben, denn »zu Hause ging es zu wie im Kloster«. Die Familie bewohnte ein Haus auf dem Russian Hill, von wo aus man einen guten Blick auf den Hafen und die ein- und auslaufenden Schiffe hatte. Da muss ihre »Wanderlust«, ihr unbändiger Drang nach Freiheit entstanden sein. Und Freiheit bedeutete für das junge Mädchen: Reisen. Und nur um reisen zu können, heiratete die erst 16-jährige Maud einen jungen Mann, dessen Vater Teilhaber der Pacific Mail Company war. Sein Sohn sollte das Büro in Panama übernehmen. Aber der blieb lieber in San Francisco, denn Panama war ihm zu gefährlich. Und »da wollte ich nichts mehr mit ihm zu tun haben … und lief davon, ohne ihm etwas zu sagen«, schreibt sie. Hat sie ihren Eltern etwas gesagt? Vermutlich nicht, sie hätten sie wohl kaum ziehen lassen, als sie 17-jährig mit »ein bisschen Geld und meinem Banjo« San Francisco per Schiff Richtung Seattle verlässt und von Seattle mit einer Schiffspassage nach Alaska weiterreist. Dort, in Klondike, herrscht Goldgräberstimmung und es gab hier, anders als in San Francisco, Jobs für junge Mädchen. Maud Parrish schlägt sich durch und verdient mit Banjospielen ihr Geld in Varietés und Tanzsälen. Unter all den »Goldgräbern, Abenteurern, Spekulanten und Spielern« hätte ihr der Sinn nach Freiheit und Abenteuer schnell verloren gehen können, aber das Gegenteil tritt ein, die »Wanderlust« lässt sie nicht mehr los, siebzehn Mal wird sie die Welt umrunden. Sie wird alle Kontinente bereisen, sogar die Antarktis, und überall Station machen, mit »Ausnahme von zwei oder drei ›verbotenen Orten‹«. (Es sind zwei, Afghanistan und Turkestan.) Manchmal in Begleitung, meistens aber allein. Am Anfang ihrer Weltenbummelei hat sie in Peking einen Spielsalon eröffnet. Er wird zu ihrer Basis, dorthin kehrt sie regelmäßig zurück, wenn ihr das Geld ausgeht. Maud Parrish, die Geschäftsfrau. Dann reist sie wieder los und setzt sich den Wirren des Weltgeschehens aus. Sie hat den russisch-japanischen Krieg erlebt, um die Jahrhundertwende die Herrschaft der Kaiserinwitwe in China verfolgt und 1911 die Revolution und den Zusammenbruch der mandschurischen Monarchie. Sie hat die Diktatur von Cipriano Castro in Venezuela beschrieben, das von den Briten kontrollierte Kapstadt besucht, 80 ausländische Kriegsschiffe im Hafen von Yokohama am Vorabend des 1. Weltkriegs gesehen, den französischen Kolonialismus in Indochina erfahren; auf Sardinien erlebt sie die Vendetta. Maud Parrish, die Kriegsreporterin. 1936 besucht sie in Berlin die Olympischen Spiele und ist dann froh, »dem ganzen Heil Hitler« und der »schrecklichen, unmenschlichen Regierung« wieder den Rücken kehren zu können. (»An den Feiertagen breiten sich die Hakenkreuze aus wie Hautausschlag.«) Sie erlebt das zaristische Russland und die Sowjetunion unter Stalin – und zieht ihre Vergleiche. Maud Parrish, die politische Beobachterin. Sie versucht, hinter die Schleier der Frauen in der Türkei und im Iran zu blicken und kritisiert die Prostitution in Japan und den Sklavenhandel in Kuba. Maud Parrish, die Feministin. Sie begegnet den Menschen mit großer Neugier und versucht alles Fremde zu verstehen. Maud Parrish, die Anthropologin. Sie ergötzt sich an der Pflanzen- und Tierwelt, wo immer sie sich aufhält, und beschreibt sie bis ins Einzelne. Maud Parrish, die begeisterte Botanikerin. Sie reist in Länder und Gebiete, die Frauen damals noch verschlossen waren. Maud Parrish, die Pionierin. Sie packt ihr Banjo und ihre Klaviernoten aus, wenn das Geld knapp wird. Wenn sie Spaß haben will. Maud Parrish, die Musikerin. Sie leidet unter Heimweh und besucht ihre Eltern. Maud Parrish, die gute Tochter. Sie verliebt sich, und hat nicht immer Glück. Maud Parrish, die Liebende.
Sie wandert auch dann noch meilenweit, wenn »die Schuhe schon nachgaben und ich meine Füße mit Pappe, Sacktuch und Bindfaden umwickeln musste«. Als »Hobo« entert sie Züge und ist unterwegs durch Amerika. Zu den Galapagos-Inseln reist sie auf einem Schoner, auf dem »den Passagieren von Ratten die Zehen blutig gebissen werden«. Maud Parrish, die Abenteurerin.
Viele Jahre ist Maud Parrish um die Welt gereist. Mit leichtem Gepäck. »Darüber musst du schreiben«, bedrängten sie ihre Freundinnen und Freunde. Schließlich hat sie dem Druck nachgegeben und ein Buch geschrieben, ihr einziges, da ist sie 60 Jahre alt. Diese Information entnehmen wir dem kurzen Nachruf, der am 1. November 1976 im »San Francisco Chronicle« erschien:
Maud Parrishs abenteuerliches Leben ist mit 98 zu Ende gegangen.
Die Aufbahrung der Abenteurerin und Autorin Maud Parrish findet am Montag um 10 Uhr in den Räumen von Hogan & Sullivan Funeral Home, 1266 Ninth avenue statt.
Die in San Francisco geborene Maud Parrish starb am Donnerstag. Nach einer kurzen Ehe, die sie mit 16 einging, verließ Maud Parrish ihren reichen Ehemann und machte sich zum Yukon auf, wo sie während der späten 1890er Jahre in den Salons von Dawson City vor Goldgräbern auftrat.
50 Jahre lang reiste Maud Parrish immer wieder um die Welt. Zur Zeit der Herrschaft der Kaiserinwitwe Anfang des 20. Jahrhunderts hielt sie sich in China auf. In Peking führte sie einen Spielsalon. 1939 begann sie mit der Niederschrift ihrer Memoiren, die unter dem Titel »Nine Pounds of Luggage« erschienen.
Maud Parrish lebte zum Schluss in einem städtischen Pflegeheim. Sie hinterläßt ihre langjährige Freundin Amalia A. Ferro, wohnhaft in San Francisco.
Alles, was wir sonst über sie wissen, steht in ihrem Buch (und nur da). Es ist das Zeugnis einer »Herumtreiberin, die die Welt sehen wollte« und dabei viel gelernt hat. Die Bildungsreise einer jungen Frau, die zur weisen Weltversteherin wurde.
Wer sie auf ihren Reisen begleitet, wird was erleben und viel lernen.
Susanne Gretter
ICH LEBE, WIE ES MIR GEFÄLLT
»Durch viele Länder bin ich gewandert,und habe gestaunt und gehört und gesehen.«
Saadi
»Hören Sie, junger Mann«, sagte ich zu dem Reporter, »ich lebe, wie es mir gefällt. Bei mir hat es nie eine Ordnung gegeben und mein Leben lässt sich in keine Kolumne packen.«
Das war vor ein paar Jahren. Und ich habe es ernst gemeint. Ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben, und wenn wohlmeinende Bekannte irgendwo auf der Welt dies vorschlugen, weil ich ihnen eine scheinbar interessante Geschichte erzählte, tat ich den Vorschlag stets als Scherz ab.
Ich lachte in mich hinein und dachte: »Wenn ihr nur die Hälfte wüsstet.« Denn im Leben eines Reisenden gibt es mehr als nur Sehenswürdigkeiten. Bücher voller Kummer und Elend, oder zu vieler »Ichs«, mochte ich noch nie und ich glaubte nicht, dass es in meinem Leben vieles gab, das außer mir auch noch andere interessieren würde. Man kann nicht herumfahren, wie es einem passt, ohne für »wunderlich« oder zumindest unkonventionell gehalten zu werden. Und mit Ausnahme von zwei oder drei »verbotenen« Orten, war ich überall.
Dass ich beinahe alles tun würde, um endlich auch dorthin zu gelangen, wird dadurch belegt, dass ich jetzt sogar ein Buch schreibe. Die Möglichkeit das Land zu bereisen, das mir jedes Mal verboten wurde, als ich seine Grenzen erreichte sowie ein Ticket nach New York, als ich festsaß, sind die Gründe, weshalb ich nun versuche, in dieses Buch zu packen, was sich, wie ich dem jungen Journalisten an den Kopf geworfen hatte, in keiner Kolumne zusammenfassen lässt.
Vielleicht ist es auch die Rache des Schicksals, denn ich habe das Gefühl, dass ich meine Lebensenergie aus mir herausziehe. Dabei mache ich mir keine Sorgen darüber, was die Leute denken; mit denen, die mich missbilligen, will ich nichts zu tun haben. Wenn man herumgekommen ist, gewöhnt man sich solche Bedenken ab, lange bevor man das sechzigste Lebensjahr erreicht hat. Nur mir tut es weh, wenn ich mich an Dinge erinnere, die ich schon vergessen habe. Aber da ich das Ticket in die USA nun genutzt habe, werde ich auch weitermachen mit meiner Aufgabe, hoffentlich zum Gefallen der Leser – und wenn ich fertig bin, will ich in jenes ferne Land reisen.
»Fang einfach vorne an«, wurde mir gesagt. »Und erzähl die Geschichte bis heute weiter.«
I
ZURÜCK ZUM URSPRUNG
Der Goldene Westen
Gibt es nicht immer ein »vorher«? Ich kann mir nicht vorstellen, dass etwas einfach so anfängt – dass ein Kind vom Wesen her schlecht und ein anderes gut ist, einfach nur durch Zufall. Hinter diesem »gut« und »böse« muss noch etwas anderes stecken. Wenn man zwei Hunde hat, von denen der eine immer am Feuer sitzt und der andere draußen in den Hügeln herumschnuppert, schlägt man doch auch nicht den einen, nur weil er nicht so ist wie der andere. Vielleicht ist das Schicksal daran Schuld oder die Vorfahren.
In meiner Familie gibt es seit Generationen Vagabunden und Abenteurer. Ich weiß nicht, wie es dem ein oder anderen am Ende ergangen ist. Sie zogen los, um etwas zu erleben. Einer meiner Großväter starb noch vor meiner Geburt in Indien. Andere kamen nach Amerika, als es noch neu war. Wenn es allmählich friedlicher zuging, zog jede Generation ein Stück weiter nach Westen. Meine Mutter wurde in einem kalifornischen Goldgräberlager geboren. Mein Vater nahm mit sechzehn aus Ohio Reißaus. Nach der Feier zur Fertigstellung der First Transcontinental Railroad in Utah zog er nach Kalifornien. Er arbeitete in Minen und Holzfällerlagern. Später verdiente er in Trinity County, im Norden des Staats viel Geld mit Holz. Als ich 1878 in San Francisco geboren wurde, war er noch immer im Holzgeschäft.
Da San Francisco an der Westküste liegt, gab es im Westen kein Land mehr, in das man hätte ziehen können. Aber wieso hätte durch meine Adern anderes Blut fließen sollen, nur weil ich zufällig ein Mädchen war? Hätte ich mit gefalteten Händen ruhig zu Hause sitzen sollen?
Manche Menschen lassen sich vor lauter Angst, ihre Eltern zu enttäuschen, davon abhalten, Sachen zu machen und zu verreisen, aber ich habe immer gewusst, dass mich meine Eltern verstehen und mir Beifall spenden würden, wenn ich meinen eigenen Weg ging.
Allerdings versuchten sie, mich »ordentlich« zu erziehen; ich genoss keinerlei Freiheiten. Nicht mal zur Tanzstunde durfte ich, wobei mir meine Mutter, die selbst Instrumente spielte und eine recht gute Musikerin war, Tanzen und Klavier, Banjo und Mandoline beibrachte. Abgesehen davon, ging es zu Hause zu wie im Kloster. San Francisco war damals ein ziemlich raues Pflaster und ich vermute, das ist auch der Grund, weshalb meine Mutter so streng war.
Ich durfte zu Hause Jungs empfangen – mit ordentlicher Genehmigung – und ich hatte Liebhaber. Den ersten mit vierzehn, den besten Jungen auf der Welt. Hätte ich ihn geheiratet, wäre es höchstwahrscheinlich gut gegangen, aber meine Mutter war anderer Ansicht. Sie ließ mich nie machen, was ich wollte. Vermutlich war ich recht wild und eigensinnig. Ich dachte, da sie nur siebzehn Jahre älter war als ich, wusste sie es nicht besser und hat sich wohl Sorgen gemacht, weil es in der Stadt so derb zuging. Trotzdem wollte ich weg – wer kann es mir verdenken? Innerlich verkrampfte ich ständig, als bekäme ich keine Luft mehr. Als mich dann der Sohn eines reichen Mannes heiraten wollte, dachte ich: »Dadurch werde ich Freiheiten bekommen.« Geliebt habe ich ihn nicht – den armen Kerl – aber meine Familie hießes gut und sein Vater besaß Anleihen an der Pacific Mail Company und auch in Panama.
Das Haus meines Vaters befand sich auf dem Russian Hill. Von dort konnte man den ganzen Hafen sehen, die Schiffe in der Bucht waren eine Verlockung für mich. Wenn sie auf den Pazifik hinausfuhren, malte ich mir aus, wo sie anlegen würden – die Inseln, die ich mir vorstellte, wie Blütenblätter an einer riesigen Lotuspflanze. Dann musste ich mich wieder dem »Tu dies nicht und das nicht« unterwerfen.
Der junge Mann sollte eine gute Anstellung in der Firma seines Vaters erhalten und nach Panama reisen. Als ich ihm mein Ja-Wort gab, dachte ich an all die fernen Orte. Seit ich denken kann, hatte ich lebendige Geographie im Kopf.
Also wurden wir vermählt. Ich war erst sechzehn. Es war einer der stürmischsten Tage; Wind und Regen hätten den Klang der Orgel beinahe übertönt. Wegen des Donners, der die Kirche beben ließ, konnte ich die Worte des netten kleinen Predigers nicht hören. Aber als er mich fragend ansah, wisperte ich leise: »Ich will.«
Wenn ich im Kino eine Hochzeit sehe, gerät mir bis zum heutigen Tag das Blut in Wallung.
Mein Ehemann hatte Geschichten aus Panama gehört. Wie schlimm es dort sei. Ein Mann sei delirierend zurückgekehrt. Er beschloss, in dem Büro in San Francisco zu bleiben. Als ich feststellte, dass er keinerlei Abenteurergeist besaß, wollte ich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Egal, wie ein Mann ist, sagte ich, Mut muss er haben.
Doch dann sollten wir ein Baby bekommen. Erst hatte ich gar nichts zu tun und als das kleine Baby kam, war es besser. Aber nach nur zwei Monaten war es schon wieder nicht mehr da. Ich dachte, ich würde verrückt werden, so gefesselt ans Haus – und dass etwas Schreckliches passieren würde wenn ich nicht herauskäme. Ich weiß nicht, was mit mir los war, nur dass ich unglücklich war.
Dann eines Tages – nie hatte ich etwas zu tun – wurde eine Fuhre Kohle geliefert. Jedes Mal, wenn eine Schaufel die Schütte herunterrutschte, schauderte es mich. Ich stand am Fenster, sah zu und dachte: »Ich muss hier bleiben, bis das alles verbrannt ist!« Ein schrecklicher Gedanke. Und noch viele weitere Fuhren. »So wird es den Rest meines Lebens sein«, und ich wusste, dass ich das nicht ertragen konnte. Wenn ich an die Endlosigkeit all dessen dachte, schmerzte mein Kopf, als würde ein Feuer darin lodern.
Und so lief ich davon. Wären Löwen hinter mir her gewesen, hätte ich es nicht eiliger haben können. Ohne ihm etwas zu sagen. Ohne meiner Mutter oder meinem Vater etwas zu sagen. Freiheiten, die gab es für normale Frauen in San Francisco nicht. Aber ich hatte welche gefunden. Es gab damals keine Bürojobs für junge Frauen. Man heiratete, sonst wurde man zur alten Jungfer oder konnte gleich zur Hölle fahren. Sucht es euch aus.
Das hat es nicht besser gemacht – nur allen Sorge bereitet. Schließlich fanden mich meine Eltern und nahmen mich mit nach Hause. Die Familie meines Ehemanns kam, einige den ganzen weiten Weg aus ihrer schönen Heimat im »alten New England« und flehten mich an zu ihrem einzigen Sohn zurückzukehren. Ich konnte es einfach nicht. Aus der Sicht einer anderen mochte nichts verkehrt an ihm gewesen sein. Für eine andere hätte er vielleicht einen guten Ehemann abgegeben. Also versuchte ich eine Scheidung zu erwirken.
Aber der arme alte Richter sagte, ich sei zu jung. Es müsse eine Versöhnung geben. Und dann erzählte er noch irgendwas vom vornehmen alten Osten und dem frischen jungen Westen, die sich miteinander vertragen sollten. Aber seine schönen Worte waren eine Prophezeiung von kurzer Dauer. Als ich aufstand, um den Gerichtssaal zu verlassen, gab sich die Abordnung aus dem vornehmen alten Osten ein kleines bisschen zu spöttisch für den Geschmack meiner kleinen ein Meter achtundsiebzig großen Mutter, die in Kalifornien geboren und aufgewachsen war. Sie schlug meinem Noch-Ehemann ein paar Zähne in den Rachen, plättete zumindest ein Grinsen aus Maine. Pa warf ihn eine Treppe hinunter. Die gegnerischen Anwälte stellten gelassen ihre Aktentaschen ab und bearbeiteten sich gegenseitig.
Mein Vater nahm mich mit auf sein Land im Trinity County, um dem Skandal zu entkommen. Dort hatte ich Zeit, über alles nachzudenken, ich spazierte oder ritt durch die Wälder. Ich wusste, dass ich zu dem Ehemann, an den mich das Urteil des Richters weiterhin juristisch band, nicht zurückkehren würde. Und das bedeutete, dass ich nicht in San Francisco leben konnte. Manche betrachten das Leben schwarz-weiß; andere – und das sind die glücklichen – in altgoldenen Tönen. Aber mein Leben damals ließ mich rot sehen. Fernweh kann bisweilen das herrlichste überhaupt sein, aber wenn es an einem nagt und einem in die Eingeweide sticht, besonders im Frühjahr, einem aber Hände und Füße gebunden sind, dann ist das schrecklich. Also ging ich. Ohne einer Menschenseele etwas davon zu sagen.
Ab nach Norden
Ich hatte ein bisschen Geld und mein Banjo. Keine Ahnung, was ich machen würde, wenn mir das Geld ausging, aber ich zog trotzdem fort, erst nach Seattle, von wo aus ich blitzschnell eine Schiffspassage nach Alaska bekam. Die Luft war erfüllt von der Goldgräberstimmung am Klondike. Die Verlockungen des Abenteuers zogen mich an Bord und das Gefühl des Gebundenseins blieb an Land.
Hier sah ich Menschen, die ich verstand. Hier waren sie alle aus Fleisch und Blut, die Menschen, die meine Phantasie bevölkerten, die auf meiner geistigen Landkarte der guten alten Mutter Erde gelebt hatten, und gereist waren. Die Phantasie ist herrlich, anregend wie ein Cocktail, aber erst die Realität beschert einem das vollständige Fünf-Gänge-Menü mit Champagner. Die Goldgräber, Unterhändler, Abenteurer, Spekulanten und Spieler; andere rätselhafte Charaktere, deren Geschäfte sich nur schwer beschreiben lassen, passten in meinen Traum. Auf dem Schiff waren auch einige Frauen, die Hotels oder Restaurants eröffnen oder in den Tanzsälen Gold schürfen wollten und auch eine oder zwei, die wie ich, einfach neugierig waren, was der Goldrausch am Klondike ihnen zu bieten hatte. Goldgräberfrauen waren keine da, weil Goldgräber keine Frauen haben. Aber egal, wer sie waren oder woher sie kamen, die alten wie die jungen, sie hatten Mut, und das bewunderte ich.
Von Skagway aus überquerte ich den Pass nach White Horse, teils zu Fuß, teils mit dem Hundegespann. Da fühlte ich mich wirklich frei in dem Land! Mit dem Hundegespann ging es fünfhundert Meilen weiter nach Dawson. Hunde und Menschen konnten es nicht erwarten, in die Hauptstadt des eisigen Nordlands zu gelangen. Mit gerade mal zehn Dollar traf ich ein, aber Mr. Rockefeller selbst hätte sich nicht reicher fühlen können. Die Stimmung war so berauschend, ich hätte gewettet, dass ich die Berge mit einem einzigen Katzensprung überqueren kann. Die Luft war elektrisch geladen und die Menschen waren es auch, zu hundert Prozent lebendig, was auch immer sie sonst geplagt haben mag. Und wenn auch sie vor Ehefrauen oder Männern, Konventionen oder Beschränkungen davongelaufen waren? Der Ruf des Abenteuers, der Ruf der Wildnis, steckte in den meisten, was auch immer sie vorhatten.
Bis heute höre ich die Stimme des Hundeschlittenfahrers in der eisig kalten Luft, wenn er die Tiere antrieb. Ich war froh, den Schlitten genommen zu haben. Viele von denen, die später in jenem Sommer das Schiff bestiegen, gingen in den Stromschnellen unter. Draußen vor White Horse ist ein Friedhof für die Toten, die geborgen wurden.
Dawson ist ein kleiner Ort, der sich am Ufer des Yukon erstreckt, am Fuße eines Hügels. Eine breite Narbe zieht sich quer darüber, höchstwahrscheinlich Reste von Ausgrabungen. Die kanadischen Mounties, die Polizei, und andere hatten alles gut im Griff, jedenfalls im Vergleich zu dem, was ich später auf amerikanischem Gebiet in Nome vorfand. Eine Weile teilte ich mir eine Blockhütte mit einem sehr lieben, schönen und unvoreingenommenen Mädchen – eine visionäre Träumerin, so ehrlich wie man nur sein kann. Über Jahre blieb sie mir als das Mädchen aus Robert W. Services Gedicht »Meine Madonna« in Erinnerung, denn sie hatte genau so einen Ausdruck – Augen sind die Fenster zur Seele, egal wie wir uns nach außen hin geben. »Meine Madonna – ich holte mir eine Frau von der Straße heran – schamlos, aber ach, so schön!« Jahre später erfuhr ich, dass sie im Gefängnis gestorben war, wo sie wegen Diebstahls einiger tausend Dollar gelandet war. Ich bin sicher, dass sie unschuldig war. Sie liebte einen Barmann und viele Barmänner wurden reich, weil sie die Goldgräber beim Abwiegen des Goldstaubs betrogen, mit dem sie ihre Drinks bezahlten, vor allem die Säufer, aber auch andere. Wahrscheinlich hatte man sie als Lockvogel vorgeschickt. Sie war zu gut für Betrügereien. Unabhängig davon, was die Menschen, die sich an anderer Leute Vorschriften halten (Gott hat sie sich nicht ausgedacht) von Abenteurern halten, fühlen sich diese untereinander oft stärker verbunden, als die, die nur so tun als ob und sich benehmen, weil das angeblich korrekt ist. Entlegene Orte haben ihre eigenen Tragödien – ohne auf die Tränendrüse drücken zu wollen.
Zunächst habe ich in einem Varieté Banjo gespielt, aber der Tanzsaal auf der anderen Straßenseite, einer von fünfzig oder mehr, die sich am Flussufer entlangzogen, war aufregender. Also rüber mit mir. Er war sehr beliebt. Alle zog es dorthin. Ein langer Tresen, Tische und Stühle, eine Tanzfläche und ein paar Zimmer für die Verliebten fanden sich dort. In der Ecke stand ein großer warmer Ofen (wenn draußen Minusgrade herrschten, glühte er kirschrot). Die großen unbekümmerten Männer mit dem Goldstaub zog es hierher und schöne Mädchen von überallher aus der Welt flatterten herum wie exotische Schmetterlinge. Selbst jetzt spüre ich noch das Zisch Bumm Hurra Peng dieses Tanzsaals und die unbekümmerte Stimmung, die dort herrschte. Kein Wunder, dass Rex Beach diese Mädchen in seinen Romanen verherrlicht. Ich habe keinen Zweifel daran, dass einige seither ganz oben in der Welt angekommen sind, denn nichts verhilft einem schneller zu einem Platz an der Sonne als Lebensfreude und Liebenswürdigkeit.
Zum Beispiel waren da die drei fröhlichen Lamar-Schwestern, die alle, eine nach der anderen, den unbeschwerten Goldgräber Swift Water Bill geheiratet haben. Eine echte Familienangelegenheit. Sie setzten alle auf den einen Mann und staubten nacheinander mit der Scheidung einen dicken Batzen seines Vermögens ab. Eines Tages, als wir gemeinsam aßen, vertraute mir die geistreichste der Lamars eine Geschichte an, die beleuchtete wie Swift Water innerlich tickte. Anscheinend mochte sie Speck und Eier zum Frühstück, aber in Dawson ging es um die Eier und Bill hatte alle gekauft, den Markt verknappt, so dass seine Angebetete, die sich in ihrer Zuneigung schwankend gezeigt hatte, ihm die Eier entweder aus der Hand fressen oder ganz auf Eier verzichten musste. Swift Water Bill hielt nichts von langwierigen Dressurmaßnahmen.
Ein Mädchen, das ich kannte, blieb für zwanzigtausend Dollar zwei Winter lang bei einem Goldgräber am Klondike. Ein anderes, ein verheiratetes Mädchen, war gekommen, um Geld zu beschaffen, denn ihr Mann war verletzt und es ging ihnen zu Hause nicht gut. Sie verdiente mehrere tausend, fuhr zurück, kaufte ein Hotel in einer Stadt im mittleren Westen und kümmerte sich um ihren Mann. Seither ging es ihnen gut.
An meinem ersten Abend in dem Tanzsaal forderte mich der österreichische Besitzer eines kleinen Restaurants, das hundert Dollar Umsatz täglich machte (hauptsächlich mit Bohnen), zum Walzer auf.
»Wenn du diesen Männern nicht versprichst, dass du später mit ihnen nach Hause gehst, tanzen sie nicht mit dir«, bläute er mir ein. »Aber du kannst ihnen was vormachen und sie zum Schluss abservieren.«
Ich war so jung, er hielt mich für unerfahren. Ich dankte ihm und sagte, ich wolle seinen Rat beherzigen. Aber er ließ mir nicht die Chance, mit einem anderen zu tanzen. Immer wieder tanzte er mit mir und wurde sehr zutraulich.
Ich erklärte mich mit jedem seiner Vorschläge einverstanden und sagte zum Schluss schlicht: »Gute Nacht.«
Er wirkte verletzt und entgegnete vorwurfsvoll: »Aber du hast es versprochen!«
»Hast du mir das nicht beigebracht?«, fragte ich.
Wie die Geschichte die Runde machte.
Oh, es war großartig, frei zu sein und sich seinen eigenen Weg zu überlegen. Dabei hielt man mich dort oben gar nicht für wild, eigensinnig und ungezogen.
Ein Tanz von einer Minute kostete zwei Dollar, wir tanzten die ganze Nacht und bekamen die Hälfte, außerdem fünfzig Cent für jeden Drink, den wir mit einem Gast tranken – sein Preis wurde in Goldstaub über dem Tresen abgewogen. Was für ein Geldsegen! Aber in Gedanken überlegte ich nur, wie ich möglichst schnell genug zusammenbekam, um die zweitausend Meilen den Yukon abwärts nach St. Michaels und Nome zu gelangen. Mir sind Orte immer schnell über gewesen.
Wenn es auf die frühen Morgenstunden zuging und der Schnaps sich in den Köpfen bemerkbar machte, brach meist eine Schlägerei aus. Streitigkeiten über Schürfrechte und die Umgehung derselben wurden häufig in Bars und Tanzsälen ausgetragen, wo die meisten in Dawson den Großteil ihrer Zeit verbrachten. In meiner ersten Woche dort sah ich, wie zwei Männer bei einem solchen Streit getötet wurden. Einer stand am Tresen und seinem Gesichtsausdruck nach hegte er Mordgedanken. Der andere kam, um ihn zu töten und beide schossen aufeinander. Der eine starb sofort, der andere wenige Stunden später. Kurz davor hatte ich eine ältere Frau auf dem Trail kennengelernt, die ich sehr bewunderte, weil sie sich in ihrem Alter alleine an einen solchen Ort gewagt hatte. Sie war Künstlerin und verdiente sehr gut, malte Schilder für Geschäftsleute. Wir wurden gute Freudinnen und sie wollte sehen, wo ich arbeitete. Also hatte ich sie an diesem Abend mitgebracht. Wahrscheinlich war es das erste Mal in ihrem Leben, dass sie eine Bar betrat und mit ansehen zu müssen wie nur zehn Minuten nach ihrem Eintreten zwei Männer starben, war schon ein Schock.
Kaum taute im Juni das Eis, zog ich weiter.
Damals war der Yukon »neu«. Der Kanal war noch nicht ausgehoben und oft blieben die Schiffe während der Monate, in denen der Fluss befahrbar war, auf Sandbänken liegen, bis sie befreit wurden.
In einer der Kabinen neben meiner befand sich ein sehr behäbiger U.S. Marshal aus Washington, D.C., der einen Gefangenen nach Nome brachte. Die Kabine auf der anderen Seite wurde von einer französischen »Elise« bewohnt, einer Dame aus Lousetown.
Lousetown, von Dawson aus gesehen auf der anderen Seite des Flusses, war inzwischen ein einziges glühend rotes Gebiet und in der Stunde bevor das Schiff seine Fahrt flussabwärts begann, sah ich die ausgelassenen Französinnen an Bord kommen und für Aufruhr sorgen, wie eine Brut gackernder Hühner. Es war das erste Schiff, das in jenem Jahr ablegte.
Ein Passagier hatte vor, eine zollpflichtige Brücke in der Nähe von Nome zu bauen. Ein anderer, ein reicher Mann aus New York, hatte über Geschäftspartner Geld investiert, keinerlei Nachrichten mehr darüber erhalten, und sich daher auf den Weg gemacht, die Miene persönlich in Augenschein zu nehmen. Immer wenn wir auf einer Sandbank festsaßen, bestand er darauf, Gold zu waschen. Eines Tages warf ihm ein Witzbold, als er diesem gerade den Rücken kehrte, ein winziges Nugget ins Sieb. Hätte man ihm nicht erklärt, dass die Sandbank die meiste Zeit unter Wasser lag, wäre er wie Crusoe einfach dort geblieben.
In der Nähe von Circle City (unterhalb des Polarkreises) spielten wir auf einer Sandbank Ball, bis ein anderes Schiff vorbeikam und unser Boot in den Fluss gleiten ließ, indem es stundenlang mit dem Seitenrad Wasser aufwühlte, bis wir frei waren.
In Circle City warf der Koch den Müll ins Wasser. Schlittenhunde schwammen den Brocken hinterher und man konnte sehen, wie die Hunde noch unter Wasser an den Knochen nagten. Sicherheit hat Vorrang. Sie waren wunderschön und ungeheuer intelligent. Viele Geschichten über Schlittenhunde waren in Umlauf, die mitten im Nirgendwo Essen stahlen, das auf Bäumen versteckt lag.
Ein junger Goldgräber namens Thiers erzählte mir, er sei eines Nachts von einem Schlittenhund geweckt worden, der so voll mit gestiebitztem Speck von einem Baum gesprungen war, dass ihm bei der Landung eine Art Bellen entfuhr (normalerweise bellen Schlittenhunde nicht). Später musste er den Hund töten. Nachdem er den ganzen Tag auf der Jagd gewesen war, hatte Thiers gerade mal ein einziges arktisches Schneehuhn mitgebracht, ein großer genießbarer Vogel. Während er diesen rupfte, kam der Hund angestürmt, riss ihn ihm aus den Händen und rannte fort damit. Der Verlust von Vorräten konnte einen leicht das Leben kosten und so musste der Dieb als Maßnahme der Selbstverteidigung getötet werden.
Jahre später zogen zwei unverheiratete Damen namens Thiers in mein Haus in San Francisco. »Hatten Sie mal einen Bruder in der Arktis?«, fragte ich.
»Ja«, erwiderten sie und wie sich herausstellte, war es tatsächlich mein Goldgräberfreund. Ich erfuhr, dass er mit seiner Halbblut-Eskimofrau und ihren beiden Söhnen in die Staaten gezogen war. Später verbrachte ich eine sehr schöne Woche mit ihnen auf ihrer Rinderfarm in Arizona.
An der Mündung des Koyukuk River, innerhalb des Polarkreises, wurden zwei Goldgräber und eine kleine Bootsladung Vorräte über die Seite heruntergelassen. Sie sollten ein Jahr lang alleine, fernab jeder Siedlung in der Arktis bleiben. Ich hatte einen Kloß in der Kehle, als ich sie so frei von Angst und mit solch großer Hoffnung ins große Unbekannte ziehen sah, und mit all den Menschen verglich, die zu Hause lebten und trotz aller Annehmlichkeiten ständig nörgeln und Aspirin schlucken.
In einer alten russischen Siedlung in der Nähe von St. Michaels kamen vier erschöpfte und erledigte, aber keinesfalls entmutigte Männer an Bord. Da sie das letzte Schiff der vorangegangenen Saison um einen Tag verpasst hatten, waren sie gezwungen gewesen, acht Monate, abgeschnitten von der Außenwelt, in jenem dunklen kleinen Dorf zu verbringen.
Es war herrlich, endlich in Nome anzukommen, aber mit Dawson konnte die Stadt kaum mithalten. Als gelangte man nach einer rasanten Fahrt durch Stromschnellen in stehendes Gewässer. Das Faszinierendste waren natürlich auch hier die Tanzsäle und wie schon in Dawson machte ich die Runde. Eigenartig die Eskimos die ganze Nacht an den Eingängen der Tanzsäle stehen zu sehen – wie die Holzindianer vor den Zigarrengeschäften –, wie sie das Geschehen in sich aufsogen und wunderschöne aus Walrossstoßzähnen geschnitzte Cribbagebretter anboten. Was müssen diese armen Männer, die so etwas noch nie zuvor gesehen hatten, und eigentlich Vorräte an Fisch und Wild für die lange Nacht draußen sammeln wollten, von der Musik, den Menschen und dem Tanz gehalten haben? Zweifelsohne sind in jenem Winter einige von ihnen verhungert.
Nome war eine schlimme Stadt, wild und betrügerisch, voller Diebe, Mörder und wahrer Gesetzlosigkeit; in Dawson konnten dagegen alle ihren Goldstaub in Säcken vor der Tür stehen lassen und sie waren dort sicher. In Nome ging nichts dergleichen. Dawson wurde kanadisch regiert und Nome von den Vereinigten Staaten, aber das war nicht der wahre Grund, weshalb die Zustände in Dawson bessere waren – und auch an den Mounties lag es nicht. Es war so schwierig nach Dawson zu gelangen, dass schon etwas in einem stecken musste, wenn man dorthin wollte, Nome lag dagegen auf direktem Weg von San Francisco und Seattle. Alle, die das Geld für eine Fahrkarte besaßen, ließen sich in Nome nieder, um von den Kühneren zu profitieren. Aber es gab weniger Chancen.
Eines Abends, in einem derben kleinen »Theater« (der Himmel möge mir verzeihen, es überhaupt so zu nennen, aber keine andere Bezeichnung würde besser passen), hatte ich die Nase voll und bekam Heimweh. Mit siebzehn, egal, wie unbedingt man fort möchte, sehnt man sich nach Ma und Pa und vertrauten Dingen. Ich spielte »Swanee River« mit leichten Abwandlungen und »Old Black Joe« und so weiter. Viele wurden schwermütig. Wir sprachen mit vier prima Jungs darüber, Goldgräber auf dem Weg nach Patagonien. Als sie meinten, ich könne doch Halt in San Francisco machen und meiner Mutter und meinem Vater zeigen, dass ich noch lebte und es mir gut ging, erklärte ich mich bereit, sie als ihr Maskottchen zu begleiten. Einfach so, kurzentschlossen, begab ich mich vom einen Ende Amerikas auf den Weg ans andere. Sonst hätte ich keine Schiffsreise bekommen. Ein Kapitän hatte auf Nachfrage gesagt: »Verdammt seien die Passagiere. Lieber nehme ich Fracht auf.« Fracht zahlte sich aus und musste weder essen noch schlafen. Aber die vier Männer hatten bereits Vorkehrungen getroffen.
Ich verabschiede mich nicht gerne, wenn’s an die Abreise geht. So ist es immer. Trotzdem muss ich. Diese Freunde! Und das Land! Ich hielt die Arktis für den schönsten Ort auf Erden. Zumindest damals. Doch seither habe ich so viele noch schönere Orte gesehen.
Nach Süden
Es war wunderbar, Ma und Pa wiederzusehen. Natürlich konnte ich sie nicht damit beunruhigen, dass ich mich in Tanzsälen und derartigem herumgetrieben hatte, noch dazu in Alaska. Ich sagte, ich sei als Reisebegleitung einer reichen alten Dame unterwegs gewesen. Häufig ist es besser, zu flunkern. Was bringt es schon, jemandem unnötig weh zu tun, nur um die Wahrheit zu sagen? Verletzt wird man schon genug. Besonders in Familien. Eltern können nie verstehen, warum ihre Kinder Dinge tun, die ihnen nicht richtig erscheinen.
Meinen Mann habe ich nicht besucht. Seit unserer letzten gemeinsamen Fahrt im Streifenwagen, nachdem der Richter »eine Versöhnung« angeordnet hatte, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Aber ich fand keine Ruhe. Noch immer sehnte ich mich nach der Ferne. Darüber kam ich nie hinweg, vielleicht weil ich nie lange genug an einem Ort blieb und mich daher niemand je über haben konnte. Hat man etwas über, umgibt einen Leblosigkeit. Romantik, das sind nicht nur zwei Menschen zusammen – so vieles auf der Welt ist so romantisch.
Der alte Dampfer, die City of Para, mit der wir nach Süden fuhren, war romantisch. Wie eine Familie. Alle an Bord wollten dasselbe – an neue Orte gelangen. In warmen Nächten spielte ich Banjo im Mondschein und noch bevor wir alle Lieder gesungen und uns alle Geschichten erzählt hatten, graute der Morgen. Die Reise dauerte Monate, aber das kümmerte niemanden. Wir fuhren. Und wir waren glücklich.
Auch die vielen Dutzend Häfen, in denen wir festmachten, waren romantisch. Damals gab es erst wenige Züge, die in die zentralamerikanischen Städte fuhren, aber wenn wir Zeit hatten, reisten wir damit. Tagelang blieben wir in Salvador, Guatemala – fast zu lang, denn manchmal bekam ich Heimweh, wenn ich bei anderen in ein nettes Heim spähte und das Familienleben sah und bei mir dachte: »Eines Tages gewöhne ich mir das ab und werde sesshaft.« Aber ich wusste, dass es dazu nicht kommen würde. Bisweilen musste ich schon lachen, wenn ich es nur laut aussprach und dann war es auch vorbei damit. So ist es seither gewesen. Besonders zu Weihnachten, wenn ich durch die Straßen ging und in die Häuser blickte, in denen Familien feierten, und ich mir dabei vorkam wie ein Wolf, der in die Schaufenster der Hauptstraße stiert und hinein will.
Aber selbst das gehört zum Romantischen daran. Man kann nicht alles gleichzeitig haben und das eine ist mir lieber, als das andere. Meistens, selbst damals schon, habe ich nichts bereut. Das Irrlicht tanzte in der Ferne und es machte Spaß ihm hinterherzulaufen, auch wenn man bald merkt, dass es unerreichbar und immer schon woanders ist.
In Panama City – bevor je jemand an den Kanal dachte – saß ich eines Abends auf der Plaza vor der alten und sehr schönen Kathedrale, wo gerade ein religiöses Fest gefeiert wurde. Ein Umzugswagen kam vorbei und alle Menschen gingen mit flackernden Kerzen hinein. Wegen der Hitze ließen sie die Tür offen. Es war wunderschön unter dem Sternenhimmel zu sitzen.
Wie anders war Punta Arenas weit unten an der Spitze Südamerikas. Dort gab es keine alten Gebäude, es war die damals jüngste Goldgräberstadt der Welt und dort ging es derber und rauer zu, als ich es je erlebt hatte. Am Klondike war man vergleichsweise zivilisiert. Dafür kam hier keine Langeweile auf. Und Frauen waren rar. Die Männer, die in die Stadt kamen – Goldgräber oder Schafzüchter, die seit Monaten unterwegs waren – starrten einen an, nicht unhöflich, aber beim seltenen Anblick einer weißen Frau konnten sie nicht anders. Einige dieser alten Härtefälle bekamen feuchte Augen. Sogar sie hatten manchmal Heimweh! Aber schon bald war es vergessen, wenn sie Gelage feierten und ihren Verdienst verprassten.
Einen Abend in einer Kneipe, die »Bucket of Blood« hieß, und in der es ungezwungen und freizügig zuging, und die die einzige ihrer Art war, weil der Schnaps hier nicht verwässert oder mit anderen Substanzen versetzt wurde, werde ich nie vergessen. Es gab kein Programm, aber trotzdem war immer Theater. Die meisten der zehn oder mehr Barkeeper stammten aus Buenos Aires.
Als zwei meiner Klondikefreunde und ich durch die Tür traten, sahen wir ein argentinisches Mädchen auf einen langen Tisch springen und mit anmutigen Füßchen Gläser heruntertreten, damit sie Platz zum Tanzen hatte. Eine ihrer Freundinnen spielte Mundharmonika – ein größeres Orchester hatte sie nicht. Aber das Feuer und der Schwung, mit denen sie tanzte, ließ alle anderen Tänzerinnen zu Pantomimen verblassen. Noch bevor ihr Tanz zu Ende war, hörte ich die vertrauten Geräusche des Nachtlebens – auf den Boden schlagende Körper und das Klirren von brechendem Glas. Ein hundert Kilo schwerer Schwede namens Ollie im Cordanzug beherrschte jetzt die Bühne und der Klang der Mundharmonika verhallte zum Heulen eines einsamen Wolfs. Ol-lies blaue Augen waren rot vor Mordlust und er brüllte und schrie wie ein Bulle. Mike, ein kleiner Mann mit Augenklappe, der eine beigefarbene Hose und ein wollenes Unterhemd trug, hatte ihn zu Boden geschickt. Der arme Ollie wurde von Mike und seinen Leuten buchstäblich in die Gosse gefegt – das war der Höhepunkt einer Fehde, die bereits seit Tagen brodelte.
In einer anderen Ecke, wie bei einer Nebenvorstellung im Zirkus, bedrohten sich zwei Argentinier gegenseitig mit Messern, ihre Augen funkelten ebenso wie ihre stählernen Klingen. Sie erinnerten mich an zwei schwarze Katzen auf einem Baum, die miauten und mit den Pfoten ausholten, böse fauchten und noch mehr miauten. Ein Messerkampf, von Experten ausgefochten, ist ebenso kompliziert wie Fechten. Der Unterlegene wurde Zentimeter um Zentimeter zurückgedrängt und schien zum Sterben bereit, aber als er eine schwere Schnittwunde davontrug, riefen die anderen »Bastante!« (genug!). Der Sieger schob sich zum Tresen wie eine große hässliche Krabbe; der Verlierer wurde in ein Hinterzimmer gezerrt, wo er in Frieden bluten konnte. Es ging das Gerücht, er habe einen großen Griechen erstochen und sich dessen Schürfrechte unter den Nagel gerissen.
Oft denke ich an dieses Duell, wenn ich gefragt werde, ob ich zu einem Preiskampf mitkommen will. Kaum auszudenken, dass ich Geld bezahlen soll, um mir anzusehen, wie zwei Männer mit Boxhandschuhen vorsichtig aufeinander losgehen, wo ich mir in meinem Leben doch so viele echte Kämpfe habe ansehen müssen, und das völlig kostenlos.
Aber in Patagonien wurde nicht immer nur gekämpft. Es gab auch viele herrliche Tage im Freien. Mit meinen vier guten Freunden ging ich Gold suchen, fischen und wandern. Draußen in der Natur habe ich immer Freude, und wenn ich sterbe, möchte ich nicht irgend so ein blöder Engel sein. Ich wäre gerne im Wald, vielleicht als schöner Mammutbaum oder als hübsche Pappel. Auch eine Zeder wäre mir recht.
Nach ungefähr einem Monat in Patagonien, konnte ich es kaum erwarten, weiter zu fahren und so stach ich eines Tages in See – als plötzlich ein Schiff da war – mit Ziel Europa. Auch an einem solchen Ort fällt der Abschied schwer und ich ließ viele gute Freunde zurück – um neuen entgegen zu reisen – und neuen Sehenswürdigkeiten.
II
FLÜGGE WERDEN
Nach Osten
Als ich an Bord ging, schwebte mir kein besonderer Ort vor. Patagonien hatte großen Spaß gemacht. Ich war jung, verrückt danach zu reisen und ich hatte etwas Geld. Hätte jemand zu mir gesagt: »Komm, wir fliegen zum Mond, schauen uns all die hübschen Krater dort oben an und gucken mal wie die Leute so sind«, ich wäre einverstanden gewesen. In Punta Arenas hatte ich ziemlich viel getrunken – dort gab es wenig mehr zu tun, als einsamen Männern beim Feiern zu helfen, wenn sie aus der Wildnis zurückkamen. Trotzdem fürchtete ich, nicht weit genug herumzukommen, um alles auf der Welt zu sehen, und so zog ich weiter.
Nachdem ich das wilde Leben in der Arktis und Antarktis kennengelernt hatte, beschloss ich unterwegs auf dem Schiff, dass jetzt Paris dran war. Jeder hat von Paris gehört und weiß, dass es als die zivilisierteste und gebildetste Stadt der Welt gilt. Nach Punta Arenas und dem Yukon, dachte ich, würde ich das sicher zu schätzen wissen.
Ich zog ins Quartier Latin. Dort ging es vergnügt zu. Viele wunderbare und interessante Menschen lebten dort, damals noch wahre Künstler, erst die wachsende Bekanntheit ruinierte alles. Jetzt ist es dort ganz anders. Die wahren Künstler zogen fort, als die Studenten und Touristen kamen. Aber damals war es wunderbar. Alle waren »echt« – posierten nicht nur oder wollten Künstler sein, weil sie es für schick hielten. Ein Musiker hörte mich spielen und bot mir Unterricht an. Er sagte, ich habe Talent, was damals vielleicht sogar gestimmt haben mag. Meine Mutter hatte Musik immer geliebt und auch Klavier gespielt. Dieser Mann wurde ein guter Freund und es war eine wunderbare Gelegenheit, denn inzwischen wurde er als großartiger Musiker berühmt. Ich hatte die lauten Tanzsäle ein bisschen über, das Klavier ist weicher und passt besser zur Pariser Atmosphäre als das Banjo. Ein paar Monate lang habe ich viel geübt, aber nicht lange genug, um richtig gut zu werden.
Abends konnte ich nicht anders als mich dort herumzutreiben, wo getanzt und geredet wurde, und ich lernte eine Menge nur durchs Zuhören und Spaßhaben. Hätte ich nicht Gus kennengelernt, wäre ich vielleicht länger geblieben.
Gus war ein guter Mann, ein menschlicher Dynamo an Energie. Oft habe ich gedacht, er würde ausbrennen. Er fürchtete sich vor nichts und hatte eine schreckliche Sehnsucht nach dem Ungewöhnlichen und Aufregenden. Als Frankokanadier war er durch ganz Asien gereist, hatte dort viele Abenteuer erlebt und jetzt interessierte er sich für China. Er erzählte mir vom Orient und mein Interesse an der Musik verblasste, jetzt wollte ich den Orient kennenlernen, bevor es zu spät dafür war, und so verließ ich Paris gemeinsam mit Gus, um in einem seiner »Clubs« in Peking zu arbeiten. Wir fuhren mit dem Schiff über das Mittelmeer, den Suezkanal und die Straße von Malakka. Unterwegs gab es zahlreiche Zwischenstationen und ich verliebte mich unsterblich in den Orient. Ich wusste, so wie man manchmal ohne jeden Zweifel weiß – viel mehr als eine Ahnung, und so als wäre es meinem ganzen Wesen unauslöschlich eingeschrieben –, dass Asien meine Heimat war. Das Gefühl hat mich nie verlassen. Jahre später wachte ich in irgendeinem anderen Teil der Welt auf und spürte eine Sehnsucht nach China in mir, so wie andere Menschen Heimweh empfinden.
Kanton, Shanghai, Mukden, Peking, Tientsin. Ach, was waren das früher für herrliche Orte. Besonders Peking. Und die Menschen, denen man damals dort begegnete – von der Gesandtschaft, Abenteurer aus reiner Abenteuerlust und abenteuerlustige Unternehmer, die sich Zugang zu den sehr alten Systemen verschaffen wollten.
China wurde mir in den Jahren vor dem Krieg mehr zur Heimat als irgendein anderer Ort und einige meiner besten Freunde stammen aus jener Zeit im Orient. Ich komme überall mit den Menschen zurecht, aber mit manchen gibt man sich noch lieber ab, als mit anderen.
In Kanton bekam ich den Namen Nan verpasst, weil ich eines der Mädchen an jemanden gleichen Namens erinnerte. Nan blieb hängen und bis heute bekomme ich an »Nan« Parrish adressierte Post und muss jedes Mal, wenn ich meine postlagernden Sendungen abhole, erklären, dass ich sowohl Nan wie auch Maud heiße, in China war es immer Nan. Obwohl ich den Großteil der Vorkriegszeit dort verbrachte, kam ich nicht zur Ruhe. Nicht einmal dort in der bunten Umgebung und dem bezaubernden Leben, das wir alle führten, fand ich meinen Frieden.
Nie verging ein Jahr, in dem ich nicht nach Hause fuhr, um meine Mutter und meinen Vater zu besuchen – und natürlich reiste ich über verschiedene Routen, damit ich unterwegs immer neue Orte zu sehen bekam. Bisweilen war ich gute sechs Monate unterwegs – fuhr mit der Eisenbahn quer durch Sibirien oder machte einen Abstecher auf eine abgelegene Insel. Auf diesen »Heimfahrten« besuchte ich jeden Kontinent. Manchmal alleine. Manchmal, wenn eine Reisegruppe unterwegs zu einem anderen Ort den Club besuchte, verspürte ich den Drang und schloss mich ihnen an – oft reiste ich auf dem Weg nach San Francisco um die ganze Welt.
Das Wasser in China war nicht gut und Champagner war das einzige, was wir für trinkbar hielten (teilweise auch deshalb, fürchte ich, weil damit mehr Profit zu machen war). Vermutlich befand ich mich in China sechs Monate lang ununterbrochen in einem glückseligen Champagnerrausch. Und auch wenn ich reiste, trank ich. Wenn man irgendwo ankam – besonders, wenn man pleite war – konnte man sich nicht einfach hinsetzen und sich zu Tode langweilen, also zog man erstmal los und bestellte was zu trinken. Sonst wäre man alleine geblieben. Niemals wäre mir eingefallen, aufzuschreiben, was ich tat. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, nur dass ich fürchtete, es zu vergessen. Und das wäre auch beinahe passiert, bis ich begann, dieses Buch zu schreiben. Nie habe ich mich bemüht, mich an etwas zu erinnern – außer an die Orte, die ich auf meinen Karussellfahrten schon gesehen hatte – sondern eher darum, etwas zu vergessen. Ich wollte einfach losziehen und mich überraschen lassen, was als nächstes kommen würde, egal wie, und das Beschwerliche verdrängen.
Meiner Mutter und meinem Vater erzählte ich, dass ich das erste Kino in Peking eröffnet hätte, als es noch in ganz China keines gab. Erst vor wenigen Monaten, als ich eine Freundin aus jenen Tagen besuchte und wir über Peking sprachen, erzählte mir ihr Sohn (sie lebt jetzt in wohlanständiger Sicherheit, so wie viele meiner Freundinnen – nur ich nicht), wie aufregend er es fände, dass seine Mutter das erste Kino dort eröffnet habe. Ich warf meiner alten Freundin einen Blick zu. Sie wandte sich errötend ab und wir wechselten schnell das Thema. Damals war das die Standarderklärung, die abenteuerlustige Mädchen ihren Angehörigen präsentierten, in einer Zeit, in der ein Mädchen noch als »ungezogen« galt, wenn sie der stumpfsinnigen Rolle nicht gerecht wurde, die einzunehmen von ihr als weiblichem Wesen erwartet wurde.
Und das ist auch einer der Gründe, weshalb dieses Buch keiner Ordnung folgen kann. In meinem Leben gab es schließlich auch keine – ich hatte nicht alles vorher geplant. Ich fuhr hin, wohin ich konnte, und wenn mir das Geld ausging, kehrte ich irgendwie nach Peking zurück – arbeitete im Club bis ich wieder genug Geld hatte, um woanders hinzureisen, wohin auch immer – an einen mir unbekannten Ort.
So lange Gus lebte, war er mein Anker. Ich konnte mich immer auf ihn verlassen, unter allen Umständen. Ein paar Mal brachte er mich nach Hause. Einmal reiste ich mit Gus herum und sah auf dem Heimweg nach San Francisco zum ersten Mal Yokohama. Manchmal fuhren wir über den Fluss nach Tientsin, wobei auf dem Boot überall Vitrinen mit Gewehren standen, für den Ernstfall. Ich erinnere mich an einen Coolie-Aufstand, die Waffen wurden herausgeholt und es gab Tote. Egal wo, mit Gus war es immer aufregend. Er konnte sich einfach nicht von dort fernhalten, wo es »brenzlig« wurde und Weiße in Gefahr gerieten.
Während des russisch-japanischen Kriegs fuhr ich mit ihm nach Mukden in der Mandschurei. Durch Bestechung war er an eine Glücksspiellizenz dort gekommen, mit der direkt hinter der Front viel Geld zu verdienen war. In dieser Schule erwarb ich meine Kenntnisse auf diesem Gebiet. Nach ein paar Wochen wurde Gus verhaftet und als Spion zum Tod durch Erschießen verurteilt. Auch ich rechnete damit, verhaftet zu werden, ebenfalls fälschlicherweise als Spionin. Aber da sich dieser großartige Freund mehr als einmal aus einer Zwangslage zu befreien verstanden hatte, war ich nicht sonderlich erstaunt, als er eines Morgens lässig hereinspazierte und sagte: »Komm schon, Nan, geh packen. Wir fahren nach Tientsin.«
Von dort aus begaben wir uns auf eine Reise um die Welt. Schließlich landete ich in San Francisco und er in Montreal, wo inzwischen eine Straße nach Gus und seinem Bruder benannt ist. Ich war noch nicht lange zuhause, als ich ein Telegramm erhielt, ich möge meinen Besuch abkürzen und nach Montreal eilen, da wir schleunigst nach Europa und von dort aus weiter nach China reisen mussten. Als ich aber in Montreal eintraf, holten mich seine Tanten ab und teilten mir mit, Gus sei tot. Er war in seinem Swimming-Pool an einem Herzinfarkt gestorben. Die Tanten hatten meine Briefe gelesen und wussten über uns Bescheid, deshalb hatten sie mich abgepasst und es mir gesagt. Er war erst dreißig Jahre alt gewesen, aber genau das, was ich befürchtet hatte, war geschehen: Er hatte so schnell und gefährlich gelebt, dass die Anstrengung zu viel für ihn geworden war.
Alleine und einsam fuhr ich weiter. Zum ersten Mal über Sibirien nach Peking. Im Zug lernte ich den russischen Botschafter in China kennen und wir wurden gute Freunde. In Peking beschloss ich dann, meinen eigenen Spielsalon zu eröffnen. Für zweihundert Dollar im Monat mietete ich das Haus eines Mandarin in einer von Laternen beleuchteten Gasse, in der ansonsten die Kamele ausruhten. Wahre Paläste waren das, die wir in Peking und Schanghai hatten. Wäre der Weltkrieg nicht gewesen, wäre ich vermutlich immer noch dort. Ich liebte Peking und kam voran. Mein Haus war wie eine Festung, alles verrammelt. Bevor wir jemanden einließen, schauten wir durch ein kleines Loch, wer da vor der Tür stand.
Damals gab es gute Menschen in China. Die meisten Weißen waren von der Gesandtschaft; alle anderen hielten sich auf eigenes Risiko hier auf. Die meisten von ihnen waren unerschrockene Abenteurer, die Ungewöhnliches zu bieten hatten. Ich erinnere mich, dass einer behauptete, er sei der illegitime Sohn von Edward VII. Jedenfalls sah er aus wie der König und war sehr charmant und kultiviert. Auch hatte er Geld – trug immer nur zwanzig Dollar Goldstücke mit sich herum. Ein wunderbarer Mensch, wenn man ihn erst einmal kannte. Manchmal kamen die Offiziere von den Marineschiffen – allesamt nette junge Burschen.
Aber die ausländischen Gesandten und unser eigenes diplomatisches Corps bildeten den Kern meiner Kundschaft, ursprünglich waren sie wegen meiner Freundschaft zum russischen Botschafter vorbeigekommen. Die meisten tauchten nach dem Essen in Abendgarderobe auf, tranken Champagner und spielten bis zum Morgengrauen. Mit Musik, klassischer und überhaupt, trug auch ich zur Unterhaltung bei.
Ich hatte nur einen weiblichen Gast. Oft denke ich an die arme englische Seele. An einem großen englischen College hatte die junge Frau einen genialen Chinesen kennengelernt und ihn geheiratet. Jetzt lebte sie mit seinen elf chinesischen Frauen in der Chinese City, einer für Weiße entsetzlichen Gegend Pekings. Da ihr der Mut fehlte nach Hause zurückzukehren, hatte sie sich dem Opium und Alkohol verschrieben. Wir versuchten sie davon abzubringen, aber vergeblich.
Manchmal hatten wir natürlich auch Probleme mit dem Gesetz. Ein Richter der Vereinigten Staaten in Shanghai schickte einmal den Staatsanwalt nach Peking, um die »wilden« US-Bürger hinauszuwerfen, die Zocker und die Mädchen. Als Betreiberin eines Spielsalons mit drei Roulettetischen, die von Chinesen bedient wurden, gehörte ich natürlich auch dazu. Aber nicht nur das. Weil ich klein und vermeintlich anständig war (ich wog weniger als 45 Kilo und war nicht einmal einen Meter sechzig groß), entschieden meine Landsleute zu meiner Bestürzung, dass ausgerechnet ich dem Staatsanwalt einen Strich durch die Rechnung machen sollte. Der Plan klang ganz einfach. Ich hatte nicht mehr zu tun, als zu verhindern, dass er ein Exempel an uns statuierte und ihn stattdessen zum Affen zu machen! Ich hasste meine Rolle, aber ich wusste auch, was es bedeutet hätte, wären meine Freunde (und sie waren meine Freunde, diese wunderbaren internationalen Abenteurer) aus der Stadt vertrieben worden, nur damit ein ehrgeiziger Politiker Applaus bekommen und seine eigenen Etablissements eröffnen konnte.
Als ich erfuhr, dass der Staatsanwalt und seine Begleiter erst einmal die Sehenswürdigkeiten der Stadt betrachten wollten, beschloss auch ich, mir diese anzusehen und stieg zu ihm in den Zug. Mit einem hochintellektuellen Buch bewaffnet setzte ich mich in ein leeres Abteil und begann zu lesen. Es dauerte nicht lange, bis der bedeutende Mann sich mir höchstpersönlich vorstellte und später verbrachten wir den Nachmittag zusammen, kletterten auf der großen chinesischen Mauer herum und ritten auf Eseln zu den Ming-Gräbern. Das bereitete mir so viel Freude, dass ich meine Aufgabe beinahe vergessen hätte. Einige seiner Begleiter machten Fotos von uns beiden, so wohlig und freundlich sahen wir darauf aus. Mir rutschte das Herz in die Hose, aber ich spornte mich selbst an, indem ich innerlich das steinalte Lied vom Überleben des Stärkeren anstimmte.
Als es am Abend spät wurde und ich feststellte, dass er moralisch nicht besser war als wir – eher schlimmer, finde ich, denn wir waren wenigstens ehrlich – fasste ich meinen Mut zusammen. Ich nahm seine Einladung an, am nächsten Abend in Peking mit ihm im besten Hotel der Stadt (selbstverständlich) zu speisen. Als er erfuhr, dass er mit einer jener Rebellinnen am Tisch saß, die auszumerzen er gekommen war, staunte er nicht schlecht. Seine gesamte Reisegruppe floh am darauffolgenden Tag mit dem ersten Zug. Wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit Steinen werfen!
So lustig war es aber nicht immer – auch nicht so einfach. Häufig gab es Ärger und immer, wenn wir erfuhren, dass die von Weißen geführten Spielsalons geschlossen werden sollten, verschwand ich. Für mich war es ohnehin ein guter Vorwand, mich an einen neuen Ort zu begeben. Zum richtigen Zeitpunkt zu verschwinden kann sehr hilfreich sein. Manchmal erspart man sich dadurch sehr viel Ärger.
Peking
Damals war das Leben in China noch genauso wie vor zweioder vielleicht auch fünftausend Jahren. In mancher Hinsicht wie im Märchen, nur brutaler. Die verbotene Stadt war damals wirklich verboten (heute kann jeder für dreißig Cent hinein – vorausgesetzt die Japaner haben sie nicht schon wieder geschlossen).
Es gab keine Wasserleitungen. Coolies verkauften für wenig Geld Eimer mit heißem Wasser, die sie an Stöcken quer über den Schultern trugen. Ich hatte eine Badewanne aus Holz.
Und natürlich gab es keine Telefone. Selbst als ich nach Einführung des Telefons wieder einmal nach Hause kam und sich alle bereits »pleite telefoniert« hatten, hatte ich noch nicht viel damit zu tun. Wenn ich zweimal am Tag angerufen wurde, glaubte ich schon krank davon zu werden. Radios sind heute so verbreitet wie Telefone, und doch habe ich nie eins gehabt, und würde auch nicht wissen, wie man es bedient. Noch immer bin ich tief beeindruckt, wenn plötzlich bei einer Freundin zu Hause die Möbel sprechen oder singen.
Wenn ich an Peking zurückdenke, fallen mir Straßenhunde ein – große gelbe und gelbbraune Kreaturen, die im Dreck lagen, die Vorläufer des Ritzy Chow (für den sich das Reisen definitiv ausgezahlt hat!). Niemals sehe ich einen Chow-chow mit niedlichem Schleifchen um den Hals, ohne an seine Vorfahren zu denken, die manchmal schwer verletzt von Kämpfen waren.
Damals gab es keine Kuriositätenhändler, aber die Palasteunuchen – große, seltsam aussehende »Männer« mit rasierten Schädeln und gelben Gewändern – stahlen und verkauften herrliche Stoffe. Außerhalb des Palastes durfte man nur Drachen mit nicht mehr als vier Klauen tragen; innerhalb des Palastes waren fünf erlaubt und wir kauften den gelben Satin-Stoff mit den fünf Klauen, wann immer wir konnten.
Ich hatte wunderbare Sammlungen orientalischer Kunst – goldene Buddhas und Dinge, die mir die Leute von der Gesandtschaft abkaufen wollten. Was ich meiner Familie nicht schickte, verkaufte ich, als mir bewusst wurde, dass ich niemals ein Haus haben und seßhaft werden würde. Weltliche Besitztümer haben mir ohnehin nie etwas bedeutet.





























