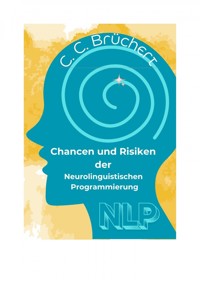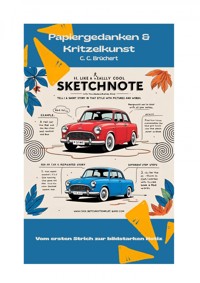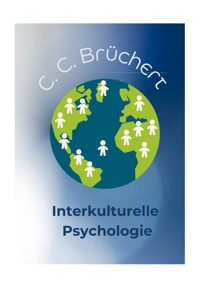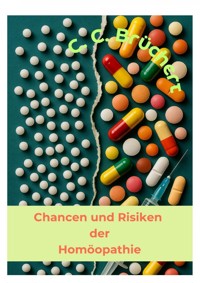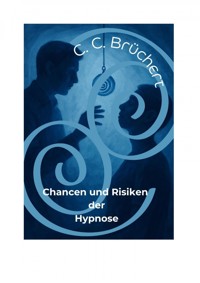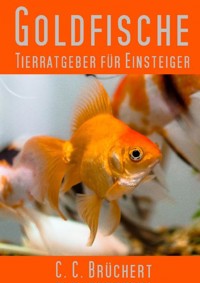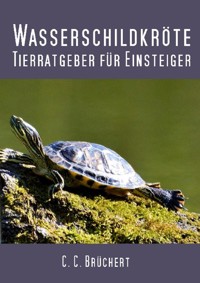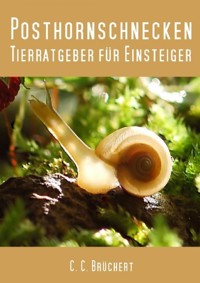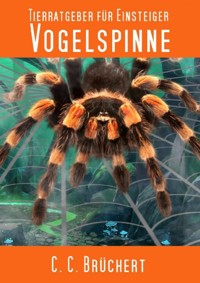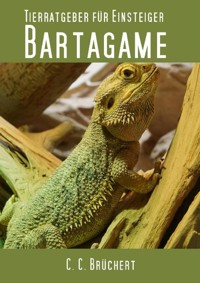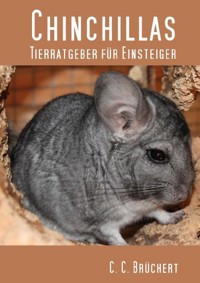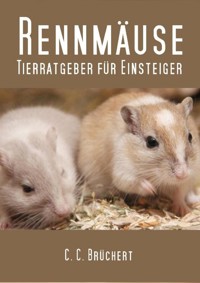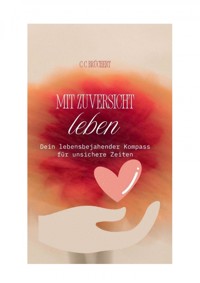
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Dein Leben selbst gestalten – Stabilität finden, flexibel bleiben und innere Kraft entfalten In einer Welt, die sich ständig verändert und oft unsicher wirkt, ist es wichtiger denn je, einen festen Anker zu haben – für Körper, Geist und Seele. Dieses Buch begleitet dich Schritt für Schritt dabei, deine eigene Lebensvision zu entwickeln, innere Zweifel zu meistern und mutig deinen Weg zu gehen. Du lernst, wie du finanzielle Sicherheit auch mit kleinem Budget schaffst, auf Veränderungen gelassen reagierst und dein soziales Netzwerk als kraftvolle Unterstützung nutzt. Mit praxisnahen Strategien für mehr Stabilität und Flexibilität, bewährten Methoden zur Stressbewältigung und einfachen Ritualen für mehr Lebensfreude zeigt dir dieses Buch, wie du deine Energie stärkst und mentale Stärke aufbaust. Dabei ist es nicht nur ein Ratgeber, sondern ein Mutmacher – der dich einlädt, dein Leben bewusst und selbstbestimmt zu gestalten, authentische Beziehungen zu pflegen und Sinn in deinem Alltag zu finden. Ob du gerade vor großen Veränderungen stehst oder einfach mehr Balance und Zufriedenheit suchst: Dieses Buch ist dein Begleiter auf dem Weg zu mehr Lebensfreude und innerer Sicherheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mit Zuversicht leben
Dein lebensbejahender Kompass für unsichere Zeiten
C. C. Brüchert
Impressum
Texte: © Copyright by C. C. Brüchert
Umschlaggestaltung: © Copyright by Carola Käpernick
C. C. Brüchert/ c/o C. Käpernick
Spitalstr. 38
79359 Riegel am Kaiserstuhl
Herstellung: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Hinweis zum Urheberrecht
Dieses EBook ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Zugänglichmachung oder Bearbeitung des Inhalts – sei es ganz oder teilweise – ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Autors untersagt. Dies gilt insbesondere für Kopien, Downloads, Weitergabe an Dritte oder die Nutzung in anderen Publikationen. Verstöße können zivil- und strafrechtlich verfolgt werden.
Du verstehst kein Amtsdeutsch? Dann hier für Dich übersetzt: Hey, das hier ist mein Werk – bitte kopiere, verbreite oder bearbeite das Buch nicht ohne meine ausdrückliche Erlaubnis. Wenn Du das Buch teilst oder nutzt, frag mich vorher kurz. Danke für Dein Verständnis!
Teil 1: Grundlagen & Perspektiven Die Basis für ein stabiles Lebensgefühl schaffen
1. Warum Unsicherheit zum Leben gehört – und wie du sie annehmen kannst Es gibt Phasen im Leben, in denen alles unsicher scheint. Die Welt verändert sich schnell, Gewissheiten brechen weg, und plötzlich ist nichts mehr so, wie es einmal war. Vielleicht kennst du solche Momente – eine Beziehung endet, eine berufliche Perspektive verschwindet, eine Krankheit taucht auf, eine Zukunftsplanung zerfällt. Das Gefühl der Unsicherheit kann lähmend sein. Und doch: Sie ist ein Teil des Lebens, unvermeidlich, ehrlich – und auch voller Möglichkeiten.
In Wahrheit ist Unsicherheit kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Tor zu Wachstum, Kreativität und innerer Freiheit. Wenn wir aufhören, sie zu bekämpfen, und beginnen, sie anzunehmen, wird sie nicht mehr zum Feind, sondern zum Wegweiser. Sie zwingt uns, innezuhalten, uns neu auszurichten, offener zu denken – und oft stärker zurückzukommen, als wir es je für möglich gehalten hätten.
Dieses Kapitel lädt dich ein, Unsicherheit nicht nur zu ertragen, sondern aktiv mit ihr umzugehen. Du wirst verstehen, wie sie funktioniert, warum sie uns so herausfordert, und wie du mit einfachen Perspektivwechseln und Strategien wieder Stabilität in dir selbst findest – ganz unabhängig davon, was im Außen geschieht.
1.1 Was Unsicherheit wirklich ist – zwischen Risiko und Unbekanntem Unsicherheit wird oft mit Angst verwechselt. Dabei ist sie nicht per se negativ. Unsicherheit bedeutet zunächst nur: Es gibt mehrere Möglichkeiten, und der Ausgang ist offen. Es ist der Raum zwischen dem, was war, und dem, was noch nicht ist. Dieser Zwischenraum kann beängstigend wirken – aber auch voller Chancen stecken.
Wichtig ist, Unsicherheit vom tatsächlichen Risiko zu unterscheiden. Risiko bedeutet: Ich kenne mögliche Ergebnisse und kann sie bewerten. Unsicherheit dagegen meint: Ich weiß noch nicht, was kommt – es kann gut ausgehen, schlecht, ganz anders. Das ist ein großer Unterschied.
Wenn du dir das bewusst machst, beginnt ein wichtiger Perspektivwechsel: Unsicherheit ist kein Fehler im System. Sie ist der natürliche Zustand von Zukunft. Alles, was noch vor dir liegt, ist per Definition unsicher – und gerade darin liegt das Leben selbst.
1.2 Unser Gehirn liebt Kontrolle – und warum das oft nicht hilft Unser Gehirn ist ein Sicherheitsfanatiker. Es will voraussehen, planen, kontrollieren – und das aus gutem Grund: Kontrolle hat evolutionär unser Überleben gesichert. Damals bedeutete Unsicherheit reale Gefahr – ein Raubtier, ein plötzlicher Sturm, ein feindlicher Stamm. Unser Organismus reagiert also bis heute mit Stress auf das Unvorhersehbare.
Aber: In der heutigen Welt ist vieles komplexer, aber nicht unmittelbar lebensbedrohlich. Unser Gehirn unterscheidet das nicht. Es schlägt Alarm, sobald wir etwas nicht abschätzen können – egal, ob es um einen Jobwechsel, eine ungeklärte Beziehung oder die Frage geht, wie es politisch weitergeht.
Das Problem: Unser Versuch, alles kontrollieren zu wollen, führt oft zu genau dem Gegenteil – innerer Unruhe, Druck, Erschöpfung. Kontrolle funktioniert nur in Maßen. Viel wirksamer ist es, bewusst zwischen Einfluss und Akzeptanz zu unterscheiden: Was kann ich gestalten – und was nicht?
1.3 Was passiert, wenn wir gegen Unsicherheit ankämpfen Wenn wir Unsicherheit bekämpfen, stecken wir oft viel Energie in etwas, das wir gar nicht beeinflussen können. Das kann zu Grübelschleifen führen, zu Entscheidungsvermeidung, sogar zu körperlichem Stress. Wir versuchen, durch „Perfektsein“, „Vorbereitetsein“ oder „Alles unter Kontrolle haben“ Unsicherheit zu vertreiben – aber sie bleibt. Sie ist hartnäckig. Und: je mehr wir gegen sie kämpfen, desto größer erscheint sie.
Dieser Widerstand kostet Kraft und Lebensfreude. Vielleicht hast du das schon erlebt: Du willst alles durchplanen, aber ein einziger Anruf, eine Nachricht, eine äußere Veränderung wirft alles um. Die Erkenntnis daraus: Unsicherheit lässt sich nicht besiegen – nur integrieren.
Wenn du aufhörst zu kämpfen, gewinnst du Energie zurück. Es entsteht Raum für neue Ideen, für Vertrauen, für Spontanität. Plötzlich ist da wieder Leichtigkeit – nicht, weil du alles im Griff hast, sondern weil du lernst, mit dem, was unklar ist, in Frieden zu sein.
1.4 Akzeptanz als Stärke: Der erste Schritt zur inneren Ruhe Akzeptanz heißt nicht: alles gut finden. Es heißt auch nicht: aufgeben. Akzeptanz bedeutet, anzuerkennen, was ist – ohne es sofort ändern zu wollen. Es ist der Moment, in dem du die Realität nicht mehr leugnest, sondern bewusst mit ihr in Kontakt trittst.
Das klingt einfach, ist aber oft herausfordernd. Denn Akzeptanz erfordert, dass wir uns verletzlich zeigen, dass wir sagen: „Ja, ich weiß nicht, wie es weitergeht.“ Doch gerade darin liegt Stärke. Denn du beginnst, auf einer tieferen Ebene Vertrauen aufzubauen – nicht in den Ausgang, sondern in deinen Umgang damit.
Übung: Schließe für einen Moment die Augen und sage dir innerlich: „Ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht – und das ist in Ordnung.“ Wiederhole diesen Satz einige Male. Spüre, wie sich dein Körper anfühlt. Du wirst merken: Etwas entspannt sich. Du kommst im Jetzt an.
1.5 Zwischen Vertrauen und Kontrolle – ein neues Gleichgewicht Das Leben verlangt nicht, dass du alle Antworten kennst. Es verlangt nur, dass du mit Offenheit und Präsenz auf das reagierst, was geschieht. Dafür brauchst du Vertrauen – nicht in die äußeren Umstände, sondern in dich selbst. In deine Fähigkeit, Lösungen zu finden, mit Gefühlen umzugehen, Entscheidungen zu treffen, wenn es so weit ist.
Stell dir vor: Du stehst auf einem Steg, der in einen nebligen See führt. Du siehst nicht, was am Ende kommt. Aber du weißt: Der nächste Schritt ist sicher. Genau so funktioniert Vertrauen. Es ersetzt nicht die Planung – aber es balanciert sie. Du brauchst Kontrolle da, wo sie sinnvoll ist – und Vertrauen dort, wo Kontrolle endet.
Ein bewusstes Gleichgewicht zwischen beiden Polen zu finden, kann dein Lebensgefühl grundlegend verändern. Du wirst unabhängiger vom Außen, resilienter bei Veränderungen – und innerlich ruhiger.
1.6 Strategien für mehr Gelassenheit im Umgang mit dem Unvorhersehbaren Abschließend ein paar alltagstaugliche Werkzeuge, mit denen du dich stärken kannst:
Die 3-Zonen-Methode: Teile Situationen gedanklich in drei Bereiche ein: Was liegt in meiner Kontrolle? Was liegt außerhalb? Was kann ich beeinflussen? Konzentriere dich nur auf den Einflussbereich – hier ist deine Kraft.
• Atemanker: In Momenten von Unruhe: 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen – 10
Runden. Der Körper beruhigt sich, der Kopf wird klarer.
• „Worst Case“-Übung: Stell dir das schlimmstmögliche Szenario vor – dann frage dich: Und
was würde ich dann tun? Oft merkst du: Selbst dann gäbe es Wege.
• „Heute ist genug“-Tagebuch: Abends 3 Dinge aufschreiben, die dir heute Sicherheit oder
Vertrauen gegeben haben – auch kleine Momente.
• Veränderungstagebuch: Beobachte, wie oft du mit Unsicherheit konfrontiert warst – und
wie du es gemeistert hast. So entsteht Vertrauen durch Erfahrung.
Fazit:
Unsicherheit gehört zum Leben wie das Wetter zum Himmel. Du kannst sie nicht wegdenken, aber du kannst lernen, mit ihr zu tanzen. Sie ist nicht dein Feind – sie ist ein Lehrer, ein Impulsgeber, ein Weckruf. Und wer sie annimmt, gewinnt nicht nur inneren Frieden, sondern auch Mut, Kreativität und Lebensfreude.
Du musst nicht alles wissen. Aber du darfst alles fühlen. Und du darfst vertrauen, dass du mehr tragen kannst, als du vielleicht glaubst.
2. Positive Psychologie: Was Hoffnung und Optimismus bewirken Vielleicht hast du in schwierigen Zeiten schon Sätze gehört wie: „Denk einfach positiv“ oder „Das wird schon wieder“. Gut gemeint – aber oft zu kurz gegriffen. Denn echter Optimismus hat wenig mit Schönrederei zu tun. Er wurzelt in einer Haltung, die anerkennt, dass es Herausforderungen gibt – und trotzdem daran glaubt, dass Entwicklung möglich ist. Positive Psychologie beschäftigt sich genau damit: Was macht uns stark, was schenkt uns Sinn, was bringt uns in unsere Kraft?
Statt nur auf Schwächen, Mängel und Probleme zu schauen, fragt die positive Psychologie: Was gelingt dir? Was tut dir gut? Was lässt dich wachsen? Sie betrachtet nicht nur Symptome und Defizite, sondern auch Ressourcen, Potenziale und Freude – also das, was uns aufblühen lässt, auch wenn das Leben gerade schwer ist.
In diesem Kapitel lernst du, wie Optimismus und Hoffnung als psychologische Kräfte wirken – wissenschaftlich fundiert, alltagstauglich und ganz ohne Zwang zur Dauerfröhlichkeit. Es geht um eine zugewandte Perspektive auf dich selbst und dein Leben – und darum, wie du sie mit kleinen Schritten und innerer Klarheit entwickeln kannst.
2.1 Wurzeln der positiven Psychologie – was sie anders macht Die positive Psychologie entstand als Reaktion auf die lange einseitige Ausrichtung der klassischen Psychologie. Jahrzehntelang lag der Fokus vor allem auf Störungen, Defiziten und Heilung. Erst um die Jahrtausendwende formulierten Wissenschaftler wie Martin Seligman eine neue Vision: Was wäre, wenn wir Menschen nicht nur reparieren, sondern zum Aufblühen bringen?
Die positive Psychologie fragt:
Was macht das Leben lebenswert?
Was sind Bedingungen für psychisches Wohlbefinden?
Wie können Menschen resilient, kreativ und erfüllt leben?
Sie arbeitet mit wissenschaftlichen Methoden, untersucht aber positive Emotionen, Stärken, Beziehungen, Sinn, Zielklarheit und Lebensfreude. Sie sagt nicht: Alles ist gut. Sondern: Es gibt auch das Gute – und es verdient genauso viel Aufmerksamkeit.
Das Besondere: Sie ist praxisnah und anwendbar. Ihre Erkenntnisse lassen sich direkt im Alltag verankern – und sie helfen dabei, emotionale Stärke zu entwickeln, ohne Probleme zu verleugnen.
2.2 Optimismus ist lernbar: Zwischen Realismus und Schönfärberei Optimismus ist kein angeborener Charakterzug – er ist ein Denkstil. Und wie jeder Denkstil lässt er sich hinterfragen, üben und verändern. Ein realistischer Optimist ignoriert Probleme nicht, aber er traut sich zu, Lösungen zu finden, und sieht im Scheitern nicht das Ende, sondern einen Zwischenstand.
Viele Menschen glauben, sie seien „einfach keine Optimisten“. Doch Studien zeigen: Unsere Gedanken lassen sich trainieren wie Muskeln. Wenn du merkst, dass dein innerer Dialog vor allem von Sorgen und Zweifeln geprägt ist, kannst du beginnen, bewusste Gegengewichte zu setzen:
– Statt: „Ich schaffe das nie“ → „Ich kann es versuchen und lernen“ – Statt: „Es geht sowieso schief“ → „Es gibt mehrere mögliche Ausgänge“ – Statt: „Ich habe kein Glück“ → „Ich gestalte meine Chancen aktiv mit“
Optimismus bedeutet nicht, alles rosarot zu sehen. Es bedeutet, an Möglichkeiten zu glauben – und dir selbst zuzutrauen, mit dem, was kommt, umgehen zu können. Es ist ein realistischer Blick mit einer Zukunft in Bewegung.
2.3 Die Kraft positiver Emotionen im Alltag erkennen und nutzen Positive Emotionen sind keine bloße Deko unseres Alltags – sie erfüllen zentrale Funktionen in unserem psychischen System. Sie erweitern unseren Blick, fördern Kreativität, machen uns aufnahmefähiger für neue Perspektiven und stärken unsere sozialen Bindungen.
Beispiele für positive Emotionen sind: Freude, Dankbarkeit, Interesse, Stolz, Hoffnung, Heiterkeit, Ruhe, Liebe. Sie sind leise Verstärker unserer inneren Stabilität. Und oft sind sie flüchtig – deshalb lohnt es sich, sie bewusst zu erkennen und einzuladen.
Was kannst du tun?
• Spüre bewusst nach, wann du Freude empfindest – und wie sie sich körperlich zeigt.
• Führe ein kleines „Mini-Momente“-Tagebuch: Notiere täglich 1–2 positive Erlebnisse.
• Verstärke Dankbarkeit durch inneres „Verweilen“ – z. B. 10 Sekunden bewusst genießen.
So trainierst du dein Gehirn, das Gute nicht nur zu bemerken, sondern auch emotional zu verankern – was wiederum deine Widerstandskraft erhöht.
2.4 Hoffnung als Haltung: Warum sie mehr ist als Wunschdenken Hoffnung wird oft unterschätzt. Viele verwechseln sie mit bloßem Wünschen oder naiver Zuversicht. Doch echte Hoffnung ist ein aktiver, mentaler Prozess. Die amerikanische Psychologin C.R. Snyder definierte sie als Kombination aus zwei Elementen:
• Wille (Ich will ein Ziel erreichen)
• Weg (Ich glaube, es gibt Wege dahin – oder ich finde sie)
Hoffnung ist also nicht passiv, sondern lösungsorientiert. Sie erlaubt es dir, in Bewegung zu bleiben – auch dann, wenn der Weg unklar ist. Hoffnung sagt: Ich weiß nicht genau, wie – aber ich glaube daran, dass etwas möglich ist.
Sie ist eine Haltung, die sich durch Übung vertiefen lässt:
• Erkenne eigene Hoffnungsgeschichten in deinem Leben (Wann hast du trotz Unsicherheit
weitergemacht?).
• Suche Menschen, die Hoffnung ausstrahlen – ihre Perspektive wirkt oft ansteckend.
• Sprich über das, was du dir wünschst – nicht nur über das, was du fürchtest.
Hoffnung macht handlungsfähig – und ist damit eine der stärksten inneren Ressourcen in Krisenzeiten.
2.5 Glücksmomente kultivieren –die „Broaden-and-Build“-Theorie Die US-Psychologin Barbara Fredrickson entwickelte die sogenannte Broaden-and-Build-Theorie. Sie beschreibt, wie positive Emotionen unsere Wahrnehmung erweitern (broaden) und gleichzeitig innere Ressourcen aufbauen (build).
Wenn du dich gut fühlst – also freudig, neugierig, verbunden oder dankbar –, bist du kreativer, lösungsorientierter und sozial zugänglicher. Dein Gehirn ist offener für neue Ideen, dein Körper entspannter, deine Beziehungen stabiler.
Kleine Glücksmomente sind wie psychologische „Zinseszinsen“ – sie zahlen langfristig auf deine Widerstandskraft ein. Deshalb ist es keine Oberflächlichkeit, Freude zu kultivieren – es ist psychologische Gesundheitsvorsorge.
Praktische Umsetzung:
• Integriere täglich eine „Mikrofreude“ – bewusst, ohne Ablenkung.
• Nutze kleine Rituale: Lieblingslied hören, Sonnenstrahlen auf der Haut, gutes Gespräch.
• Frage dich regelmäßig: Was hat mir heute ein Lächeln geschenkt?
2.6 Was Studien zeigen: Wie Optimismus die Gesundheit stärkt Wissenschaftliche Studien zeigen eindrucksvoll: Optimistische Menschen sind gesünder, leben länger, erholen sich schneller von Krankheiten und leiden seltener an Depressionen. Der Grund: Ihr Körper ist weniger im Dauerstress-Modus – das reduziert Entzündungsprozesse, senkt Blutdruck und stärkt das Immunsystem.
Optimismus wirkt wie ein inneres Puffer-System: Stress wird nicht negiert, aber besser verarbeitet. Menschen mit optimistischer Haltung suchen häufiger aktiv nach Lösungen, holen sich schneller Hilfe, bleiben eher in Bewegung – körperlich wie psychisch.
Eine große Langzeitstudie der Harvard University zeigte sogar: Optimistische Frauen hatten eine um 30 % geringere Sterblichkeitsrate über Jahrzehnte hinweg. Das ist keine Magie – es ist die Kraft von Denkstilen, die unser Verhalten und unsere Biochemie beeinflussen.
2.7 Übungen für mehr positive Perspektiven im Alltag
Hier findest du neue, exklusive Übungen, die sich nicht in den bisherigen Sonderteilen oder Praxislisten wiederholen – alle mit Fokus auf positive Psychologie:
Die Reframing-Brille
Nimm dir eine belastende Situation aus den letzten Tagen. Schreibe sie auf – nüchtern, sachlich. Dann beantworte schriftlich drei Fragen:
– Was ist das Lernpotenzial in dieser Erfahrung? – Was wäre eine positive Deutung dieser Situation? – Was könnte sich dadurch langfristig zum Besseren wenden?
Erfolgsmosaik
Erstelle ein kleines Poster oder digitales Moodboard mit 9–12 persönlichen Erfolgen – egal wie klein. Vom bestandenen Führerschein bis zum ersten eigenen Umzug. Hänge es sichtbar auf. Es erinnert dich: Ich kann mehr, als ich oft glaube.
„Best Possible Self“-Visualisierung (10-Minuten-Variante)
Setze dich ruhig hin, schließe die Augen. Stell dir dein Leben in 3 Jahren vor – und alles ist so gut gelaufen, wie es möglich war. Wo lebst du? Was machst du? Wie fühlst du dich? Danach: Schreibe 10 Minuten lang auf, was du gesehen und gespürt hast.
Mut-Postfach
Lege eine kleine Box oder digitale Notizsammlung an, in die du regelmäßig Situationen einträgst, in denen du mutig warst – auch im Kleinen. Wenn du zweifelst: Nachlesen!
Dankbarkeits-Doppelschritt Schreibe abends zwei Dinge auf: 1. Wofür war ich heute dankbar? 2. Woran hatte ich heute Anteil, das anderen geholfen oder sie berührt hat? Das bringt Balance zwischen Empfangen und Geben.
Fazit:
Positive Psychologie zeigt dir: Stärke wächst nicht trotz, sondern durch das Leben. Optimismus und Hoffnung sind keine naiven Fluchten – sondern klare Entscheidungen für eine Perspektive, die dich handlungsfähig macht. Du darfst zweifeln. Und trotzdem hoffen. Du darfst stolpern. Und trotzdem vorwärtsgehen.
Denn echte Stärke beginnt oft mit einem ganz einfachen Satz: „Ich glaube, dass es gut werden kann.“
3. Die Kraft der Selbstwirksamkeit – Du bist dein wichtigster Anker Manchmal fühlt es sich so an, als würde das Leben mit uns passieren, statt dass wir es selbst mitgestalten. In Zeiten von Krisen, Unsicherheit oder Überforderung taucht schnell das Gefühl auf, ausgeliefert zu sein. Aber genau hier liegt ein riesiger Wendepunkt: Selbstwirksamkeit – also das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, Einfluss auf das eigene Leben zu nehmen – ist der Schlüssel, um aus der Ohnmacht in die Handlung zu kommen.
Selbstwirksamkeit bedeutet nicht, immer alles im Griff haben zu müssen. Es geht darum, dir selbst zuzutrauen, mit Herausforderungen umgehen zu können. Du musst nicht alles wissen, können oder kontrollieren. Aber wenn du glaubst, dass du gestalten kannst, verändert sich dein Blick: Du erkennst Möglichkeiten, wo vorher nur Probleme waren. Und du wirst handlungsfähiger – auch innerlich.
In diesem Kapitel schauen wir gemeinsam, wie du deine Selbstwirksamkeit stärken kannst – Schritt für Schritt. Du lernst, welche Denk- und Verhaltensmuster sie blockieren, wie du deine inneren Ressourcen aktivierst und warum kleine Erfolge eine große Wirkung haben. Du bist nicht dein Problem – du bist dein Anker. Und du hast mehr in dir, als du vielleicht glaubst.
3.1 Was ist Selbstwirksamkeit – und warum sie so entscheidend ist Der Begriff „Selbstwirksamkeit“ stammt aus der Psychologie, genauer von Albert Bandura, einem der bedeutendsten Lern- und Motivationstheoretiker. Er beschrieb damit das subjektive Empfinden eines Menschen, selbst etwas bewirken zu können – egal ob im Innen oder Außen.
Wenn du ein Ziel verfolgst, ist es nicht allein entscheidend, ob du die Fähigkeiten dafür hast – sondern ob du glaubst, dass du sie wirkungsvoll einsetzen kannst. Selbstwirksamkeit ist also eng mit Motivation, Mut, Durchhaltevermögen und Lebenszufriedenheit verknüpft.
Menschen mit hoher Selbstwirksamkeit:
• suchen eher nach Lösungen als nach Schuldigen,
• bleiben auch bei Rückschlägen am Ball,
• übernehmen Verantwortung für ihr Denken und Handeln,
• fühlen sich weniger schnell hilflos oder überfordert.
Und das Beste: Selbstwirksamkeit ist nicht angeboren – sie ist lern- und trainierbar. Sie entsteht durch Erfahrung, Reflexion und Ermutigung. Und sie beginnt bei dir selbst.
3.2 Wie unsere Erfahrungen unsere innere Stärke formen