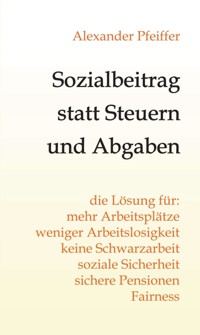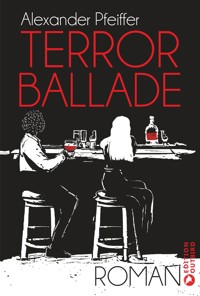Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Outbird
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
15 Erzählungen des Friedrich-Glauser-Preisträgers Alexander Pfeiffers mäandern durch die Nacht und lassen hoffen, dass dieses Gefühl der Zeitlosigkeit nie enden möge. In einer dunklen Schnittmenge aus Einsamkeit, Erotik und Kreativität begegnen sich seine Figuren oft neben der Spur -, setzen Energien frei, geben sich einer ungreifbaren Schwerelosigkeit hin, verlieren einander wieder. Auf der Suche nach sich selbst, kultiviert in ihrer Verschrobenheit, zeitverlustig, im sich auflösenden Selbst gefangen.Man kommt nicht umhin, den wundgelebten Charakteren zu folgen, sie an sich zu nehmen und mit ihnen verloren zu gehen. Sein erzählerischer Sound spielt mit einem unauflösbaren Kraftfeld zwischen Nähe und Distanz, verbindet Sehnsucht und Obsession, Dealerei und Sucht, lässt uns irgendwo über die Autobahn rasen, provozieren, anziehen und wegstoßen, betrügen, Fluchtreflexen und herannahendem Vollsuff beiwohnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Pfeiffer
Mitternachtssymphonie
Erzählungen
Impressum
Oktober 2022
© Edition Outbird, Gera
www.edition-outbird.de
Coverfotografie: Canadian Hopper
Lektorat: Vanessa-Marie Starker, Tristan Rosenkranz
Buchsatz: Benjamin Schmidt
ISBN: 978-3-948887-45-2
Preis: 6,99 €
Alle Rechte vorbehalten.
„We do the things in the dark
that in the light wouldn’t be alright.
We do the things in the night
that in the day wouldn’t be okay.
But once darkness falls
well Baby, it’s a free-for-all.
We use the logic of night!”
(Chain & the Gang - Logic of Night)
Eine Zeit zum Leben
Niemand kann eine Frau lieben und gleichzeitig einen Roman schreiben. Hat mal einer behauptet. Ich habe viel übrig für solche Zitate, und doch war ich einmal größenwahnsinnig genug, es zu versuchen. Auch wenn das bedeutete, dass während des Schreibens immer wieder mal das Telefon klingelte.
„Ich bin total untersext“, raunte sie durch den Hörer. Sie klang wirklich ein bisschen angegriffen. „Könntest du bitte jetzt gleich vorbeikommen und mir das Hirn rausficken?“
„Ich arbeite.“
„Du nimmst diese Beziehung überhaupt nicht ernst, oder?“
„Natürlich. Aber da ist diese Geschichte…“
„Und was ist mit mir?“
„Okay, ich kann in etwa einer halben Stunde bei dir sein. Ob ich das mit deinem Hirn hinkriege, kann ich nicht versprechen. Aber ich werde mein Bestes geben.“
„Sicher?“
„Natürlich. Du kennst mich doch. Ich nehme alles ernst, was ich einmal angefangen habe.“
Vierzig Minuten später wand sie sich auf dem fleckigen Sofa unter mir, das noch den Umzug aus ihrer letzten Studenten-WG mitgemacht hatte. Ich wollte gar nicht wissen, wer für all die Flecken verantwortlich zeichnete. Ich mühte mich ernsthaft, steckte in ihr drin bis zum Anschlag. Sie zappelte wie ein Fisch am Haken, wollte immer noch mehr von ihm.
„Ich glaube, er ist seit dem letzten Mal noch größer geworden“, keuchte sie.
„Ich bin 45“, presste ich hervor. „Da wächst nichts mehr.“
„Aber du kommst mit ihm heute an ganz andere Stellen ran.“
„Das liegt am Winkel.“ Ich stützte mich an der speckigen Rückenlehne ab, stieß von oben herab in sie rein, ihre Beine hinter meinem Rücken verschränkt.
„Okay…“, gurrte sie, „aber du fickst wie ein Mädchen, verdammt noch mal.“
Ich hielt in der Bewegung inne. „Was soll das heißen?“
„Na, soll das etwa die ganze Nacht so weitergehen? Oder wirst du mich irgendwann auch noch mal richtig durchnehmen mit dem großen Ding?“
„Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ein verdammt ordinäres Mundwerk hast?“
„Na bitte, Herr Schriftsteller, wie hätten Sie denn gerne, dass ich meine Wünsche äußere? ‚Könnten Sie bitte ihren Penis ein bisschen fester in mich rein stoßen?’ - so in etwa?“
„Schon besser“, schnaufte ich und begann so ansatzlos, sie mit aller Kraft zu nehmen, dass ihr die Luft wegblieb. In den nächsten drei Minuten stellte ihr ordinäres Mundwerk den Dienst ein, bis zwei kurze, schrille Schreie daraus entwichen.
Später lagen wir auf dem fleckigen Sofa nebeneinander und teilten eine Flasche Wein.
„Worum geht’s eigentlich in dem Roman?“, wollte sie wissen.
„In welchem Roman?“
Sie nahm mir die Flasche aus der Hand und pochte mit der anderen gegen meine Stirn. „Hast du dir jetzt dein eigenes Hirn rausgefickt? Von deinem Roman rede ich. Von dem, den du grade schreibst.“
„Man kann keinen Roman schreiben und gleichzeitig mit dir zusammen sein“, sagte ich und angelte mir die Flasche zurück. „Vollkommen unmöglich.“
„Was soll das denn heißen? Ich dachte, Schriftsteller lassen sich von ihren Frauengeschichten inspirieren.“
„Tun sie auch. Und schreiben dann später irgendwann darüber. Wenn sie vorbei sind.“
„Okay. Über welche vergangene Frauengeschichte schreibst du also gerade?“
„Wer sagt dir denn, dass ich über eine Frauengeschichte schreibe?“
„Gibt’s noch was anderes, was dich inspiriert?“
„Haufenweise.“ Es klang zynischer als beabsichtigt. „Aber das wirst du mir wohl bald alles aus dem Schädel gefickt haben.“
„Du kannst mich nicht leiden, stimmt’s?“
„Ich bin verrückt nach dir.“
„Ja. Verrückt bist du ganz bestimmt.“
Es gibt eine Zeit zum Leben und eine Zeit zum Schreiben. Und beide müssen irgendwie zu ihrem Recht kommen. Am liebsten hätte ich beides gleichzeitig gehabt, aber gerade verdrängte das Leben die Zeit, die ich mir hätte nehmen müssen, um schreiben zu können. Ich fühlte, wie ich blass und durchsichtig wurde ohne die Arbeit an diesem Roman. Aber wenn es zu schlimm wurde, war da immer sie, um mich aufzufüllen – mit Blut, mit Leben.
„Ah, verdammt“, keuchte sie unter mir. „Dein großes Ding füllt mich wirklich ganz aus.“
„Ich gebe mein Bestes.“
Sie klammerte sich an mir fest, ihre Hände umfassten meine Unterarme, die ich rechts und links von ihr abgestützt hatte. Ihr straffer Körper mit den Konturen einer Sprinterin gab meinen Stößen nach, zitterte auf und ab auf dem fleckigen Sofa. Von draußen fiel das Mondlicht durch die Fenster ihrer kleinen Kellerwohnung und spiegelte sich im Schweiß auf ihrer Haut.
Nachts war ich am besten. Es war die Zeit meiner größten Produktivität, den Ordnungsprinzipien von Erwerb und Produktion zum Trotz. Es war die Zeit, in der die Wörter zu mir kamen, in der ich real wurde. Und jetzt, jetzt fühlte ich sie kommen, die Wörter, das Leben. Ich bäumte mich auf über ihr, sie packte mich mit einer ihrer Hände im Nacken, bohrte ihre Augen in meine, und ich spritzte in sie rein, zwischen diese hungrigen Schenkel, die mich umklammerten - also wer füllte hier eigentlich wen auf, verdammt?
„Ich weiß gar nicht, ob du als Schriftsteller was taugst“, raunte sie in mein Ohr. „Aber das hier kriegst du wirklich gut hin.“
Sie hatte irgendwann in einem meiner Literaturkurse an der Uni gesessen. Der Kurs schien sie wenig zu interessieren, aber sie hatte sehr bald sehr deutlich gemacht, wofür sie sich interessierte. Zuerst hatte ich nicht gewusst, wie sehr ich mich darauf einlassen sollte. Mittlerweile stellte sich diese Frage nicht mehr. Ich nahm alles ernst, was ich einmal angefangen hatte.
„Ich muss heute Nacht noch was arbeiten“, sagte ich, als wir danach nebeneinander lagen. „Mir fehlen zu den täglichen zweitausend Wörtern für heute noch etwa fünfhundert.“
„Wovon redest Du?“, wollte sie wissen.
„Von dem Roman.“
„Von welchem Roman?“
„Habe ich dir jetzt doch endlich das Hirn rausgefickt? Von meinem Roman rede ich. Von dem, den ich gerade schreibe.“
„Ich dachte, man kann keinen Roman schreiben und gleichzeitig mit mir zusammen sein“, sagte sie und griff zwischen meine Beine.
„Ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich hinkriege. Aber ich gebe jedenfalls mein Bestes.“
„Das tust du tatsächlich. Es richtet sich grade schon wieder auf.“
„Ich meine das ernst“, keuchte ich. „Ich muss heute Nacht noch diese fünfhundert Wörter schreiben. Irgendwie.“
„Na und? Halte ich dich etwa davon ab?“
Ihre Finger richteten mich weiter auf. Ich spürte ein Ziehen da unten, knapp oberhalb von dort, wo ihre Hand am Werk war. Dieses Ziehen im Bauch, die Schuldgefühle, weil ich nicht schrieb, nicht dazu kam. Aber ich glaubte mittlerweile, dass man das akzeptieren musste, den Dingen ihren Platz geben, alles zu seinem Recht kommen lassen musste. Das Leben und das Schreiben. Die Worte liefen einem nicht weg. Die waren in einem drin und bauten sich ständig neu auf, so wie die Haut, deren verschiedene Schichten ständig abgerieben werden und nachwachsen.
„Ich glaube, dein Bester wächst doch noch“, gurrte sie. „Der wird grade immer größer und größer.“
„Das liegt dann wohl an deiner Arbeit.“
„Ist doch keine Arbeit.“
Ihre Haare wischten über meinen Bauch, dann fanden ihre Lippen, wonach sie suchten.
„Scheiße“, presste ich hervor.
„Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie ein ziemlich ordinäres Mundwerk haben, Herr Schriftsteller?“
Jetzt fühlte ich, wir mir die Luft wegblieb, die Wörter, das Leben. Sie bäumte sich auf über mir und saugte das alles aus mir raus, das letzte bisschen Blut, das Leben, die fünfhundert Worte für diese Nacht.
Es hat mal einer behauptet, ein Mensch, der kein Liebesleben hat, könne sich selber kaum kennenlernen. Und sich selber kennenzulernen, das ist doch die Voraussetzung, um sich die Welt zu erschließen und über sie schreiben zu können. Oder etwa nicht? Genauso wie ohne das Leben das Schreiben nicht zu haben ist, so ist ohne die Liebe kein Leben zu haben. Das eine setzt das andere in Gang. Wie eine Reihe von Dominosteinen fallen sie übereinander her, schleudern ihre Samen dem nächsten hinterher, imitieren einander.
Jedenfalls, sie hatte sich über die speckige Rückenlehne des fleckigen Sofas gebeugt, hielt sich daran fest. Wie ein dunkler Schatten hing ich über ihr, umfasste diesen langgliedrigen Körper von hinten, und meine Schenkel klatschten gegen ihren Hintern. Ich hatte sie. Vollkommen. Ihr Fisch hatte meinen Köder gierig geschluckt und konnte gar nicht anders, als den Haken ebenso freudig hinabzusaugen.
„Ich hoffe, es ist Ihnen recht so, Frau Literaturstudentin“, keuchte ich in den Haaransatz über ihrem Nacken.
„Das ist ein Kurs nach meinem Geschmack“, schnaufte sie. „Ich bin begeistert, wie ernst du deinen Lehrauftrag nimmst.“
„Du meinst, du lernst hier etwas?“
„Na, und wie. Ich komme nur leider gar nicht zum Mitschreiben. Du wirst mir die heutige Lektion wohl direkt ins Hirn ficken müssen.“
Ich fiel über sie her, als sei sie die Welt, die ich mir erschließen wollte. Ihre Pobacken zitterten vor mir, sie glänzten im Mondlicht, das durch die Fenster zu uns herabfiel. Ich gab mein Bestes, ich füllte sie auf, ich versenkte meinen Samen in ihr.
„Ganze Arbeit, Herr Schriftsteller.“ Sie reckte den Daumen, während mein großes Ding klein wurde.
Ihr ordinäres Mundwerk hatte sie von einer Kindheit im tiefsten Ruhrpott. Sie konnte nichts dafür. Und ich liebte es. Es inspirierte mich.
Später, als wir auf dem fleckigen Sofa lagen, redeten wir wieder von dem Roman. Von meinem Roman. Von dem, den ich gerade schrieb.
„Warum machst du eigentlich so ’n verdammtes Geheimnis aus dieser Geschichte?“, wollte sie wissen.
„Geheimnis, Geschichte – ist das nicht fast dasselbe? Eine Geschichte haben wir doch alle. Und versuchen wir nicht alle ständig, hinter ihre Geheimnisse zu kommen? Wahrscheinlich birgt selbst dieses Sofa hier mehr Geheimnisse als mein Roman. Wer zeichnet eigentlich für all die Flecken verantwortlich?“
„Die stammen noch aus meiner letzten WG. Da haben wir immer gerne Gemeinschaftsabende veranstaltet.“
„Gemeinschaftsabende?“
„Ja, da ging schon mal was daneben.“
„Du meinst…“
„Kaffee, Bier, manchmal auch Sekt.“
„Das ist alles?“
„Das ist alles.“ Sie nickte entschieden. So als sei sie es, die heute den Kurs hielt. „Alles andere existiert nur in der Phantasie des Schriftstellers, der ständig versucht, sein Leben mit Geheimnissen aufzufüllen.“
Irgendwann, sagte ich mir, irgendwann werde ich schreibend leben. Es wird eins sein. Ein Leben werde ich dann nicht mehr brauchen. Vielleicht nicht mal eine Liebe. Ganz sicher keine überdrehte Studentin mit ordinärem Mundwerk, die mich nachts, wenn ich am besten bin, vom Schreibtisch weglockt, um ihr mal eben das Hirn rauszuficken und sie immer noch ein bisschen fester durchzunehmen, sie aufzufüllen mit dem, was ich zu geben habe, den Worten, dem einzigen Leben, das mir zur Verfügung steht.
Aber so funktioniert das nicht. Es gibt eine Zeit zum Leben und eine Zeit zum Schreiben. Beides gleichzeitig ist nicht zu haben.
Ich nahm mir also meine Zeit zum Leben, gab mein Bestes, dieser überdrehten Studentin das Hirn rauszuficken oder auch nur mein eigenes, schrieb in der verleibenden Zeit diesen Roman, gab ihm den Titel „Eine Zeit zum Leben“, und er erschien zwei Jahr später mit einer Widmung auf dem Vorsatzblatt „Für die Frau mit dem ordinären Mundwerk“. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich sie seit über einem Jahr nicht mehr gesehen oder von ihr gehört. Ich hoffte, dass sie vielleicht das Buch in die Finger bekommen und die Widmung sehen würde. Und dass vielleicht irgendwann nachts, wenn ich am besten war, das Telefon klingeln und sie dran sein würde. Aber auch das funktionierte nicht.
Mitternachtssymphonie
„We’re exiles now pulling out of this place
Too far along to let alone
Chasing a world to call our own”
(Son Volt - Exiles)
Diese Geschichte beginnt mit dem Fahrer. Der Fahrer arbeitet für die Wach- und Schließgesellschaft. Er vollführt planvolle Bewegungen durch die Nacht, legt auf seinen Wegen von einem Objekt zum nächsten ein unverrückbares Koordinatensystem über die von ihren Pflichten befreite Stadt. Er hält die Ordnungsprinzipien von Erwerb und Produktion aufrecht, während die menschliche Gemeinschaft, die ihn umgibt, sich zum Zweck der Rekreation bewusstlos trinkt, unter dicken Federbetten dem neuen Tag entgegen dämmert oder mit ausgelassenen Zuckungen der Ordnung zu trotzen versucht. Der Fahrer bleibt hiervon unberührt. Er macht seinen Job.
Von Zeit zu Zeit erledigt der Fahrer kleine Aufträge für die Schauspielerin. Das gehört nicht zu seinem Job. Er macht es trotzdem. Er bringt ihr Zeitschriften, Sandwiches und billigen Schnaps aus der Nachttankstelle.
Die Schauspielerin bewohnt ein Zimmer im vierten Stock eines Hotels direkt neben dem Hauptbahnhof. Im Foyer des Hotels flackert täglich vierundzwanzig Stunden lang ein Kaminfeuer über den Bildschirm eines Fernsehers, der in die Wand eingelassen ist.
Aus dem Fenster ihres Zimmers kann die Schauspielerin die Züge sehen, die in das lang gezogene Bahnhofsgebäude einfahren und es wieder verlassen. Das Hotel ist für Durchreisende gedacht. Auch die Schauspielerin möchte weiter reisen, aber sie weiß nicht wohin. Sie verlässt kaum das Zimmer. Sie wartet auf den Anruf ihres Agenten, der sie auf den Weg zu ihrem nächsten Engagement schickt. Sie wartet auf den Fahrer, der sie mit billigem Essen und Alkohol versorgt. Sie steht an ihrem Fenster und schaut den Zügen hinterher, heftet ihre Augen an die beweglichen Lichter in der Nacht.
Die Schauspielerin spielt nicht mehr. So lange sie das Zimmer nicht verlässt, muss sie nicht spielen. Sie lässt die Lichter dort draußen mit ihr spielen. Die Lichter und den billigen Schnaps. Sie wartet auf den Fahrer. Ihre Flasche ist leer.
Der Fahrer transportiert auf dem Beifahrersitz, auf dem nie irgendjemand mit ihm fährt, ein Thunfisch-Sandwich und eine Flasche Dornkaat. Er passiert das Bahnhofsgebäude, das wie ein fetter Leuchtkäfer in der Nacht sitzt. Vor dem Hotel stoppt er seinen VW mit dem Emblem der Wach- und Schließgesellschaft an den Seiten. Er durchquert das Foyer mit dem flackernden Kaminfeuer, das niemanden wärmt und nimmt den Fahrstuhl in den vierten Stock.
Die Schauspielerin öffnet ihm und nimmt gleich darauf wieder ihren Platz am Fenster ein.
„Hier ist etwas zu essen für Sie…“, sagt er. „Und was Sie sonst noch brauchen.“
Sie schaut einem Zug hinterher, dessen erleuchtete Fenster zu winzigen Punkten werden, die den nächtlichen Horizont perforieren und sich schließlich auflösen. Es scheint, als habe sie die Anwesenheit des Fahrers gar nicht registriert. Der macht ein paar Schritte ins Zimmer, stellt was er mitgebracht hat auf dem einzigen Tisch im Raum ab.
Die Schauspielerin wartet, bis sich der Fahrer wieder zur Tür zurückgezogen hat, die noch immer halb offensteht und das Licht aus dem Hotelflur als schmalen, lang gezogenen Streifen hereinlässt. Sie ignoriert das Sandwich und nimmt die Flasche. Wie auf eine geheime Regieanweisung kehrt sie wieder zu ihrem Platz am Fenster zurück. Das Licht des Bahnhofs bricht sich in der Fensterscheibe, dem Glas der Flasche, der durchsichtigen Flüssigkeit, die im Hals der Schauspielerin verschwindet.
„Wissen Sie, wie viele Züge jede Nacht von hier abfahren?“
Der Fahrer schüttelt den Kopf. Seine Silhouette stanzt einen unförmigen Schatten aus dem Streifen Licht, der durch die Tür hereinfällt.
„Sechzehn“, sagt die Schauspielerin. „Sechzehn Züge, die diesen Ort verlassen. Jede Nacht.“
Der Fahrer nickt. Er tritt von einem Fuß auf den anderen.
Das Gesicht der Schauspielerin liegt jetzt im Licht. Die Augen sind geschlossen, die Lider zwei dunkle Halbmonde.
„Sechzehn“, wiederholt sie. „Sechzehn, die hier rauskommen. Und eine, die bleibt.“
Sie scheint auf eine Antwort zu warten.
Der Fahrer nickt zu dem Sandwich auf dem Tisch. „Ich habe Ihnen etwas zu essen mitgebracht.“
Ihre Hand mit der Flasche fährt jäh durch die Luft. Schnaps tropft auf den Boden, klatscht gegen die Fensterscheibe.
„Ich will nicht essen!“ Sie trinkt aus der Flasche. „Ich will spielen, hören Sie, endlich wieder spielen. Ich will raus, genau wie diese Züge da unten. Raus in die Welt. Das ist es, was ich will – mich in diese Welt reinspielen!“
Der Fahrer tritt wieder von einem Fuß auf den anderen. Ganz ohne Anweisung verlässt die Schauspielerin ihren Platz am Fenster. Sie tritt zu dem Fahrer in den schmalen Streifen Licht. Ihr Schatten vereint sich mit seinem, sie greift nach seinem Handgelenk.
„Bringen Sie mich hier raus!“
Er windet sich, will mit seinem Schatten dem ihren ausweichen. „Ich muss arbeiten.“
„Genau das muss ich auch.“ Ihre Stimme ist rau. Sie hallt durch den Hotelflur. „Worauf warten wir noch? Lassen Sie uns arbeiten!“
Neben dem Fahrer, auf dem Beifahrersitz, auf dem nie irgendjemand mit ihm fährt, sitzt nun die Schauspielerin. Die Hände des Fahrers halten das Lenkrad des VWs, der wie ein Insekt seinen Weg durch die Nacht findet. Zwischen den Oberschenkeln der Schauspielerin ruht die Schnapsflasche. Ihr Kopf lehnt an der Nackenstütze. Es scheint, als sei sie eingeschlafen.
Der Fahrer räuspert sich. „Wohin fahren wir?“
Der Kopf der Schauspielerin kommt hoch. Die dunklen Halbmonde ihrer Lider verschwinden, machen Platz für zwei leuchtende Vollmonde.
„Das fragen Sie mich? Ich denke, Sie sind mein Agent.“
„Also, eigentlich…“
„Bringen Sie mich zum Set! Wofür bezahle ich Sie sonst?“
Der Fahrer mustert sie. Er schüttelt den Kopf. Es scheint, als resigniere er.
Der VW sucht sich einen Weg aus der Stadt hinaus. Er durchquert die Randzonen der bewohnten Gebiete, Ansammlungen lebloser Industriehallen und den Gürtel geduldeter Prostitution – seine beweglichen Lichter wie Insektenfühler auf dem dunklen Asphalt.
Vor einem der gewerblichen Objekte, die zu überwachen der Job des Fahrers ist, hält er an. Es ist ein mehrstöckiges Bürogebäude im Industriegebiet außerhalb der Stadt. Die Glasfassade eine Ansammlung von nachtblinden Fenstern. Davor ein abgrundtiefer See aus Schatten, der bei Tag ein Innenhof sein muss.
Mittels Chipkarte und Zugangscode öffnet der Fahrer das Rolltor und fährt die Schauspielerin auf das Firmengelände. Sie steigt aus, lässt ihre Augen skeptisch umherschweifen.
„Was wird hier gedreht? Was ist meine Rolle?“
Der Fahrer tritt neben sie. Er tritt von einem Fuß auf den anderen. Die Augen der Schauspielerin leuchten ungeduldig in der Nacht. Der Fahrer räuspert sich, seine Füße finden keine Ruhe.
„Sie sind eine alternde Schauspielerin“, setzt er an. „Sie waren mal eine der ganz Großen der Branche, ein Star. Die Regisseure lagen Ihnen zu Füßen. Aber heute ruft Sie keiner mehr an.“
Das leuchtende Augenpaar wird von Skepsis verengt. Die Schauspielerin wartet.
„Bis zu diesem Moment“, sagt der Fahrer. „Bis zu diesem Engagement, dieser Aufführung mit Ihnen in einem Ein-Personen-Stück, vom Regisseur eigens für Sie geschrieben.“ Er breitet die Arme aus, fasst mit ihnen den See aus Schatten ein, in dem sie stehen. „Eine riesige, leere Bühne, die von Scheinwerfern grell erleuchtet wird.“
Die Schauspieleraugen weiten sich. Der Fahrer spricht weiter.
„In der Mitte der Bühne: Sie – als einzige Akteurin. Sie treten aus dem Dunkel vor Ihr Publikum.“