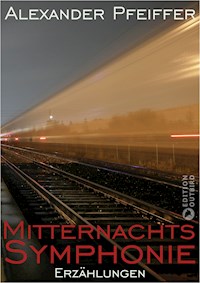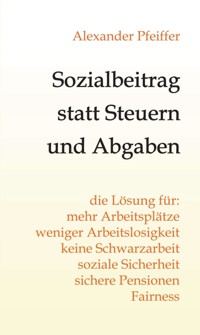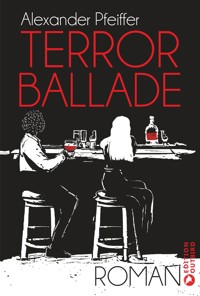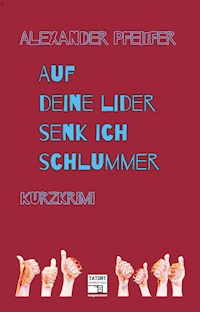Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Donau-Universität Krems
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Spiele faszinieren, erfreuen und motivieren Menschen schon seit der Frühzeit menschlicher Evolution und gehören somit zu den ältesten praktizierten Kulturgütern. Mit der digitalen Revolution hat sich das Spiel in all seinen mannigfaltigen virtuellen und realen Ausprägungen mittlerweile als Kulturpraxis nachhaltig in unserer Gesellschaft etabliert. Digitale Spiele stellen heute einen der bedeutendsten Industriezweige dar und haben auch längst den Weg in Branchen abseits der Unterhaltungsindustrie gefunden. Diese Entwicklungen brachten die noch junge Wissenschaftsdisziplin der Game Studies hervor. Einen entscheidenden Beitrag dazu leistet das Zentrum für Angewandte Spieleforschung der Donau-Universität Krems, das sich seit der Gründung im Jahr 2006 intensiv und pionierhaft mit verschiedenen Themen wie etwa "Game Based Learning", "Gamification", "Serious Games" sowie "Virtual Reality" und "E-Sports" auseinandersetzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Welt der Spiele 360°
Welt der Spiele 360°
Sammelband des Zentrums für Angewandte Spieleforschung der Donau-Universität Krems
Herausgegeben von:
Natalie Denk
Alexander Pfeiffer
Étienne Rembold
Thomas Wernbacher
Lektorat: Verena Wernbacher
Satz, Umschlaggestaltung: Martin Reitschmied
Verlag: Edition Donau-Universität Krems
©2017 Donau-Universität Krems
donau-uni.ac.at/ags
ISBN Taschenbuch: 978-3-903150-12-6
ISBN Hardcover: 978-3-903150-11-9
ISBN e-Book: 978-3-903150-10-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und der Autor/inn/en unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Die in der Publikation geäußerten Ansichten liegen in der Verantwortung der Autor/inn/en und geben nicht notwendigerweise die Meinung der Donau-Universität Krems wieder.
Inhaltsverzeichnis
1.Spiel & Perspektiven
1.1.Positive Effekte von digitalen VideospielenManuel Ninaus
1.2.Spielend Schlüsselkompetenzen generierenClaudia Zechmeister
1.3.Beyond Yarn-Balls & Sequeaking BonesKatharina Gollonitsch / Michelle Westerlaken
1.4.Leute, Ihr könnt das auch!Markus Heiss / Ralph J. Möller
2.Spiel & Pädagogik
2.1.Unwanted distractions or beneficial tools?Suzana Porc
2.2.MedienSpielPädagogik im elementaren BildungsbereichRegina Romanek
2.3.Ein Plädoyer für eine (längst überfällige) BildungsrevolutionDominik Steidl
2.4.Let's Play – Wenn Schule ein Spiel wäre…Thomas Kockmann
2.5.Bildung – Spiel – SchuleSieglinde Landauer
2.6.Möglichkeiten und Grenzen gemeinsamen digitalen Spielens vonEltern mit ihren KindernKarina Kaiser-Fallent
2.7.Das Spiel als Freiraum beim Denken und FühlenGerda Liska
3.Spiel & Politik
3.1.Komplexe Simulationen als Abbildungen der RealitätWolfgang Gruber
3.2.Runtastic into a SuperBetter Life!Isabella Andric
3.3.(Serious) Digital Games für politische BildungSonja Gabriel
3.4.Games and Citizen EngagementVanessa Camilleri, Alexiei Dingli, Matthew Montebello
3.5.Urheberrecht – Let‘s Play zulässig?Johannes Öhlböck
4.Spiel & Kultur
4.1.Videospiele – Eskapismus für Alle!Martin Fischer
4.2.Wenn die Pflichterfüllung zur Freizeitbeschäftigung wirdÉtienne Rembold
4.3.Auf den Spuren der digitalen ZwergeTom Hildgen
4.4.Videospiel: Das Kunstwerk der Gegenwart?Ivan Davidov
4.5.20 Jahre Machinima – Das Erbe der RangersThomas Veigl
5.Autorinnen und Autoren
Vorwort
Wäre das Zentrum für Angewandte Spieleforschung ein Aufbaustrategiespiel, so hätten wir den Grundstein für Rathaus Level 1 im November 2006 gelegt. Herbert Rosenstingl hatte in diesem Jahr als erster Student bei Zentrumsgründer Michael Wagner den Lehrgang „Computer Game Studies, MA“ belegt. Während Herbert noch mitten in der klassischen Heldenreise war, startete schon der 2. Durchlauf des Universitätslehrgangs. Sechs weitere mögliche Helden wurden in die Ausbildungswarteschlange eingereiht. Michael Wagner führte bereits bei diesem Lehrgang die Tradition ein, eigene Student/innen als Referent/innen einzuarbeiten und so bereicherte Herbert Rosenstingl noch während seines Studiums den Lehrgang mit einem Vortrag zum Thema „Spiel und Jugendschutz“.
Im Mai 2008 wurden die Held/innen vor eine erste große Mission gestellt. Diese führte an das MIT Game-Lab nach Boston, wo ein Modul des Studiums absolviert werden konnte. Ende 2008 kam dann auch schon der Ausbau des Rathauses auf Level 3, der weitere Möglichkeiten im Spiel freischaltete. So konnte eine zweite und dritte Kaserne errichtet werden. Die zweite Kaserne war die Übernahme des Universitätslehrgangs „Educational Technology, MSc“ – eine Kooperation mit dem Institut für Medienbildung in Salzburg. Um ein Angebot für die steigende Zahl an Pädagog/innen zu schaffen, die sich mit digitalen und analogen Spielen im Unterrichtskontext auseinandersetzen, wurde der Universitätslehrgang „MedienSpielPädagogik, MA“ ins Leben gerufen. Parallel dazu wurde der dritte Durchlauf von „Game Studies“ gestartet. Hier waren relevante Player wie Thomas Wernbacher, Thomas Cap, Bernd Dillinger und als erste Studentin im „Fernlehrmodus“ Sonja Gabriel mit dabei. Bei „MedienSpielPädagogik“ waren u.a. Horst Pohlmann und Jürgen Sleegers in einer Pionierrolle. Sie sollten dann 2010 die Lehrgangsleitung „Deutschland“ des Universitätslehrgangs „Handlungsorientierte Medienpädagogik“, unserer vierten Kaserne, übernehmen. 2010 stieß eine weitere Heldin ans Zentrum, Karin Kirchmayer, die bis heute die Lehrgänge und ihre Truppen auf organisatorischer Ebene im Griff hat. Mitte 2010 übernahm Doris Rusch die Leitung des Zentrums von Michi Wagner und übergab das Zepter Anfang 2011 an mich.
2013 wurde die erste Iteration des Universitätslehrgangs „MedienSpielPädagogik“ nach dem Prinzip der „mobilen Uni“ in Zell am See durchgeführt; 2015 mit demselben Konzept in Luxemburg. Seit 2015 gibt es unsere fünfte und sechste Kaserne und das Rathaus ist mittlerweile zu einer beachtlichen Größe herangewachsen. Im Universitätslehrgang „Game Based Media & Education, MSc“ steht eine intensive wissenschaftliche Vertiefung im Vordergrund und bei „Transmedia Design & Gamification, MA“ wird der Hypertrend Gamification wissenschaftlich aufbereitet.
Heute – 10 ½ Jahre nach dem „ein Personen Start“ von „Game Studies“ – sind wir bei ca. 150 aktiven Studentinnen und Studenten aus neun verschiedenen Ländern angelangt. Und wir blicken im Bereich der universitären Lehre weiter positiv in die Zukunft mit spannenden Plänen zu neuen Studienprogrammen.
Neben der Lehre ist natürlich Forschung und Entwicklung ein wichtiger Zweig geworden. So verfügt das Zentrum über ein Labor, in dem unsere Alchemist/innen fleißig an Innovationen im Bereich der Spieleforschung tüfteln. In den Anfangsjahren des Zentrums waren wir bei bekannten Projekten wie die der YPD Challenge oder Ludwig dabei. Mit jeder Ausbaustufe unseres Labors kamen neue Aufgaben und Herausforderungen hinzu, sodass wir nun zu unserem 10-jährigen Jubiläum stolz auf über 20 abgeschlossene und ca. 8 aktive Forschungsprojekte blicken können. Hierbei gehört natürlich der Kern des Alchemist/innen-Teams besonders hervorgehoben: Natalie Denk, Thomas Wernbacher, Nikolaus König, Martin Reitschmied und Manuel Ihl. Étienne Rembold steuert seine Zauber aus der Ferne bei, wie etwa beim vorliegenden Sammelband.
Der stetige Auf- und Ausbau unseres Zentrums wurde auch möglich, da wir in einer sehr feinen Gilde angedockt sind. Wir grüßen unsere Mitstreiter/innen des Departments für Kunst- und Kulturwissenschaften und bedanken uns bei unseren Gildenmeisterinnen Anja Grebe und Eva Maria Stöckler.
Ich selbst war übrigens beim 2. Durchlauf von „Game Studies“ mit dabei und bin ein stolzer Alumnus des Zentrums. Mit mir hatte damals auch Andreas Wochenalt abgeschlossen. Gemeinsam mit Herbert waren wir somit die „ersten Drei“.
In diesem Buch möchten wir auf 10 Jahre Zentrum für Angewandte Spieleforschung zurückblicken und das mit den Aufsätzen unserer Student/innen, Absolvent/innen, Vortragenden und Freund/innen des Zentrums feiern.
Viel Spaß beim Schmökern,
Alex Pfeiffer
Leitung des Zentrums für Angewandte Spieleforschung der Donau-Universität Krems
1. Spiel & Perspektiven
1.1. Positive Effekte von digitalen Videospielen
Eine psychologische und neurowissenschaftliche Perspektive
Manuel Ninaus
Heutzutage sind Videospiele allgegenwärtig. Ob auf Smartphones, Handhelds, im Webbrowser, am PC oder auf Spielekonsolen – digitale Spiele sind für jeden schnell und nahezu überall verfügbar. Laut der Interactive Software Federation Europe (ISFE, 2012) spielen 25% der EuropäerInnen mindestens einmal pro Woche ein Videospiel. Einer Statistik aus den USA zufolge spielen sogar 91% der Kinder zwischen 2 und 17 Jahren Videospiele (NPD Group, 2011). Spielen ist eine äußerst belohnende Aktivität und ist vor allem mit Unterhaltung verbunden. Daher ist es wenig verwunderlich, dass die meisten Personen Videospiele als reines Unterhaltungsmedium ansehen. Aktuelle wissenschaftliche Studien zeigen jedoch immer öfter, dass sich digitale Spiele auch positiv auf die Kognition der Spieler und Spielerinnen auswirken können. Außerdem wurden in den letzten Jahren Videospiele vermehrt auch im Bildungsbereich und beim Training von Kindern und Erwachsenen eingesetzt. In diesem Kapitel wird daher ein Überblick zu kognitiven Verbesserungen auf Grund von Videospielen gegeben und erklärt, wie diverse Spielelemente die kognitive Leistung in „Nicht-Spiel“ Anwendungen verbessern können.
In den Medien werden meist negative Effekte von Spielen berichtet, wie etwa Spielsucht oder der Zusammenhang zwischen sogenannten „Killer-Spielen“ und Aggressivität bzw. Gewalt. Insbesondere werden diese negativen Effekte bei Kindern und Jugendlichen geschildert. Es ist zutreffend, dass sich die meisten wissenschaftlichen Untersuchungen mit den negativen Aspekten von digitalen Spielen beschäftigen (z.B.: Anderson et al., 2010; Ferguson, 2013; Lemola et al., 2011; Przybylski, Deci, Rigby, & Ryan, 2014; Przybylski, Ryan, & Rigby, 2009). Jedoch hat eine erst vor Kurzem veröffentlichte Meta-Analyse gezeigt, dass die negativen Positive Effekte von digitalen Videospielen Auswirkungen von gewalttätigen Videospielen, wie erhöhte Aggression, reduziertes prosoziales Verhalten, verschlechtere akademische Leistung, depressive Symptome und Aufmerksamkeitsdefizite, minimal sind (Ferguson, 2015). Außerdem zeigt sich, dass das Spielen von prosozialen Spielen (z.B.: Super Mario Sunshine, Nintendo) wiederum im Zusammenhang mit reduzierter Aggression und erhöhtem prosozialem Verhalten steht (Gentile et al., 2009; Greitemeyer & Mügge, 2014).
Durch den immer größer werdenden Einfluss von digitalen Spielen auf unsere Gesellschaft hat sich die Forschung auch immer mehr für die positiven Effekte von digitalen Videospielen interessiert, um eine objektive Sicht auf dieses Medium zu etablieren. Diesbezüglich gab es insbesondere in den letzten Jahren äußerst interessante und einflussreiche wissenschaftliche Studien. Die auch immer größer werdende Akzeptanz von Videospielen zeigt sich vor allem dadurch, dass Spiele auch immer häufiger in den Bereichen Bildung und Training eingesetzt werden (z.B.: Cole, Yoo, & Knutson, 2012; Kiili, Ninaus, Koskela, Tuomi, & Lindstedt, 2013; Mekler, Brühlmann, Opwis, & Tuch, 2013; Ninaus et al., 2015; Prins, Dovis, Ponsioen, ten Brink, & van der Oord, 2011). Spielen an sich ist eine äußerst belohnende Tätigkeit und daher wurde in den letzten Jahren versucht, die belohnenden Elemente von Spielmechaniken auszunutzen und diese in konventionelle „Nicht-Spiel“-Anwendungen zu integrieren. Das sogenannte „spiel-basierte Lernen“ und „Gamification“ haben unter anderem das Ziel, Lernen und die Lernleistung mit spiel-basierten Ansätzen und Mechaniken zu verbessern und dabei die Motivation und das Interesse der Lerner und Lernerinnen zu erhöhen. Diese und ähnliche Ansätze verstehen Spiele nicht nur als reines Unterhaltungsmedium, sondern zielen darauf ab, positive und motivierende Aspekte von Spielen und Spielmechaniken für ernsthafte Anwendungen zu nutzen.
Besonders im Bereich des kognitiven Trainings, dem Lernen, oder bei Interventionen im Bildungsbereich sind Spiele und spiel-basierte Ansätze äußerst vielversprechend, da sie die Nutzer und Nutzerinnen dazu motivieren, die Anwendungen weiter zu verwenden (z.B.: Erhel & Jamet, 2013; Ninaus et al., 2013) und dabei Lernerfolge und kognitive Verbesserungen zu erzielen. Der motivationale Anreiz von diversen Spielelementen oder Spielen ist noch nicht vollständig geklärt, aber allgemeine Aspekte, wie das sofortige Feedback und die aktive Interaktion in Spielen werden als zentral erachtet (Garris, Ahlers, & Driskell, 2002). Der Selbstbestimmungstheorie zufolge (Deci & Ryan, 2000) kann der intrinsisch motivationale Anreiz von Spielen dadurch erklärt werden, dass Spiele und diverse Spielemechaniken grundlegende psychologische Bedürfnisse von Kompetenz, Autonomie und Bezug befriedigen (Przybylski, Rigby, & Ryan, 2010). Die Befriedigung dieser Bedürfnisse führt nicht nur zu erhöhter wahrgenommener Motivation, sondern bewegt Menschen dazu, die befriedigende Tätigkeit weiterhin auszuführen. In einer spielbasierten Lernumgebung würde dies bedeuten, dass die Lerner und Lernerinnen mehr Spaß an der Anwendung haben, sich länger mit den Lerninhalten beschäftigen und dadurch bessere Lernleistungen erzielen können.
Speziell das sofortige Feedback und die aktive Interaktion in Spielen tragen dazu bei, grundlegende psychologische Bedürfnisse zu befriedigen und dabei ein belohnendes Erlebnis für die Anwender und Anwenderinnen zu generieren. Außerdem hat sich gezeigt, dass sofortiges Feedback eine äußerst wichtige Komponente für erfolgreiches Lernen sein kann. Das langfristige Behalten von Inhalten profitiert viel stärker von Lernen mit Feedback-Charakter (z.B.: Tests, Frage-Antwort Anwendungen, etc.) als vom simplen Wiederholen des Lehrinhalts (Karpicke & Roediger, 2008). Das Feedback über beispielsweise die Richtigkeit einer Antwort in einer Lernaufgabe ist entscheidend für erfolgreiches Lernen. Herkömmliche Lernmethoden verfügen oftmals nicht über ausreichende Feedback- und Interaktionsmöglichkeiten. Das Lernen mit einem Buch oder der Verschriftlichung eines Lehrinhalts (z.B.: Skriptum, Präsentationsfolien, etc.) führt meist dazu, dass der Lerner und die Lernerin Inhalte lediglich wiederholen. Innovative digitale Lösungen wie Lernspiele oder Lernplattformen haben oft viele Spielmechaniken und Feedback-Elemente, die das Lernen unterstützen und verbessern können. Man geht davon aus, dass spiel-basiertes Lernen über diverse Spielmechaniken (z.B.: Feedback) auf das mesolimbische und mesokortikale dopaminerge Belohnungssystem wirkt und darüber die Lernleistung verbessert (Cohen Kadosh, Dowker, Heine, Kaufmann, & Kucian, 2013; Howard-Jones, Demetriou, Bogacz, Yoo, & Leonards, 2011). Der Neurotransmitter Dopamin ist zentral für belohnungsassoziierte Prozesse (Schultz, 2006; Wise, 2004) und wurde oft in Zusammenhang mit verbesserter Lern- und Erinnerungsleistung gebracht (Flagel et al., 2011; Grace, 2010).
Sowohl positives als auch negatives Feedback wirken auf die Belohnungszentren des Gehirns, welche eine bedeutende Rolle bei kognitiven, emotionalen und Motivierungsprozessen spielen. Bei Aktivierung dieser Zentren, beispielsweise durch Feedback in einer digitalen Lernumgebung, wird der Neurotransmitter Dopamin ausgeschüttet (Bunzeck & Düzel, 2006; Li, Cullen, Anwyl, & Rowan, 2003). Lerninhalte, die zeitlich nahe eines Feedbacks präsentiert werden, werden daher durch die Dopaminausschüttung besser gelernt und memoriert (Grace, 2010; Lisman, Grace, & Duzel, 2011). Bereits Ende der 90er Jahre wurde gezeigt, dass auch das Spielen von Computerspielen zu einer Dopaminausschüttung im menschlichen Gehirn führt (Koepp et al., 1998). Daher und aufgrund der oben erläuterten Befunde ist es wenig verwunderlich, dass sich mittlerweile Lernspiele oder gamifizierte Anwendungen im Lernkontext großer Beliebtheit erfreuen. Innovative Lösungen, die den Anziehungsfaktor und Spaß von Spielen für Lernzwecke auszunutzen, sind äußerst vielversprechende Alternativen zu herkömmlichen Lernansätzen.
In den letzten Jahren wurden einige interessante Studien veröffentlicht, die nicht nur eine verbesserte Lernleistung bei Verwendung von spielbasierten Ansätzen zeigen (für eine umfangreiche systematische Literaturanalyse siehe Boyle et al., 2015), sondern auch eine verbesserte kognitive Leistung in unterschiedlichen Aufgaben (Mekler et al., 2013; Ninaus et al., 2015; Prins et al., 2011). Mekler und Kollegen (2013) erweiterten eine einfache Bildannotations-Aufgabe mit Spiel-Elementen (Punkte, Level und Bestenlisten). Personen, die daraufhin mit der Spielversion der Bildannotations-Aufgabe konfrontiert waren, produzierten signifikant mehr Annotationen, als Personen die eine herkömmliche Bildannotations-Aufgabe ohne Spiel-Elemente erhielten. Auch in kognitiv sehr herausfordernden Aufgaben, wie etwa beim Training vom Arbeitsgedächtnis, zeigen sich Vorteile bei Implementation von Spiel-Elementen. Kinder mit einer Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zeigten beispielsweise bei einem Arbeitsgedächtnistraining mit Spielelementen erhöhte Motivation, verbesserte Trainingsleistung und trainierten öfter als Kinder mit ADHS, die ein konventionelles Arbeitsgedächtnis-Training erhielten (Prins et al., 2011). Aber auch gesunde Erwachsene profitieren von der Implementation von einfachen Spielelementen in herkömmlichen Arbeitsgedächtnistrainings (Ninaus et al., 2015).
Abb. 1.1-1 Beispiel für eine einfache Implementation von Spielelementen in eine kognitive Aufgabe; Links: kognitive Aufgabe mit Spielelementen; Rechts: herkömmliche kognitive Aufgabe ohne Spielelemente; für umfangreiche Beschreibung der zugrundeliegenden Studie siehe Ninaus et al., 2015; Pereira et al., 2015.
Die erwähnten Studien zeigen, wie bereits kleinste Veränderungen (z.B.: Implementation von Punkten, Fortschrittsbalken, Level-Indikatoren, Bilder & Animationen; sieheAbb. 1.1-1) an einer herkömmlichen kognitiven Aufgabe die Leistung und Motivation von Personen erhöhen können (Mekler et al., 2013; Ninaus et al., 2015; Prins et al., 2011). Die Integration von einfachen Spielmechaniken ist eine einfache und vielversprechende Option für zukünftige Anwendungen, um bessere Erfolge bei Interventionen im Bildungsbereich, bei kognitiven Trainings und Lernaufgaben zu erzielen. Dennoch sind wir gerade erst am Beginn zu verstehen, welche Effekte unterschiedliche Spielelemente auf die Spieler und Spielerinnen haben und wie man optimal von der Implementation von solchen Elementen profitieren kann.
Ein weiterer relevanter Aspekt im Zusammenhang von Spielen und Kognition ist die Tatsache, dass sich auch Unterhaltungsspiele positiv auf die Kognition der Spieler und Spielerinnen auswirken können. Da aber Spiele und deren Mechaniken sehr heterogen sind, ist es schwierig, generelle Faktoren zu identifizieren. Daher ist vorweg zu erwähnen, dass Videospiele sehr unterschiedliche Effekte haben können. Daphne Bavelier, eine Wissenschaftlerin, die sich unter anderem mit Ego-Shootern beschäftigt, hat dies sehr gut verdeutlicht, indem sie argumentierte, dass man genau so wenig sagen kann, was die Effekte von Videospielen sind, wie man sagen kann, was die Effekte von Nahrung sind (Bavelier et al., 2011). Dies soll klar verdeutlichen, wie unterschiedlich Spiele und somit auch deren Effekte sein können. Man würde ja auch nicht behaupten, dass Gemüse den gleichen Effekt auf unseren Körper hat wie Fleisch, und dennoch handelt es sich bei beidem um Nahrung, die regelmäßig konsumiert wird. Genauso wenig würde man behaupten, dass Komödien oder Romanzen ähnliche Effekte haben wie Horrorfilme.
Mittlerweile gibt es Millionen von unterschiedlichen Spielen, die in hunderte unterschiedliche Spielegenres eingeordnet werden können. Um daher eine Aussage bezüglich der Effekte von Spielen machen zu können, muss man das jeweilige Spiel bzw. zumindest das Spielgenre genau analysieren und differenziert betrachten. Interessanterweise gibt es reichlich Forschung zu den in den Medien oft negativ behafteten Ego-Shootern und deren positive Effekte auf die Kognition der Spieler und Spielerinnen (z.B.: Dye, Green, & Bavelier, 2009; Green & Bavelier, 2003, 2006, 2007). Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass Videospiele tatsächlich eine ganze Reihe von kognitiven Fähigkeiten verbessern können. Dies widerspricht eindeutig der landläufigen Meinung, dass das Spielen von Videospielen intellektuell anspruchslos ist. Insbesondere in dem Genre der „Shooter“ Videospiele (z.B.: Halo, Microsoft Studios; Call of Duty, Activision), welches oft in Zusammenhang mit aggressivem Verhalten und antisozialem Verhalten gebracht wird, gibt es überzeugende Befunde. Eine beträchtliche Anzahl an Studien weist auf einen direkten Zusammenhang zwischen „Shooter“-Spielen und räumlichen Fähigkeiten hin (als Übersichtsartikel siehe Green & Bavelier, 2012). Dabei handelt es sich nicht bloß um reine korrelative Zusammenhänge. Die Forschergruppe um Daphne Bavelier teilte Studienteilnehmer und Studienteilnehmerinnen ohne Spielerfahrung zufällig in zwei Gruppen ein. Eine Gruppe wurde aufgefordert, für eine vorgegebene Zeitspanne einen „Shooter“ zu spielen, während eine andere Gruppe ein anderes Spielgenre als Training erhielt. Bei der „Shooter“-Gruppe zeigten sich signifikante Verbesserungen gegenüber der anderen Gruppe hinsichtlich Aufmerksamkeit, der räumlichen Auflösung bei visueller Verarbeitung sowie verbesserte Leistung in mentalen Rotationsaufgaben (Green & Bavelier, 2012). Bei genauerer Betrachtung des typischen Spielgeschehens in Shootern sind diese Effekte auch äußert einleuchtend. Von den SpielerInnen wird durchgehende Aufmerksamkeit auf die virtuelle Welt gefordert, um nicht von GegnerInnen überrascht zu werden. Außerdem ist es gleichzeitig notwendig, sich zu orientieren, um potentiell gefährliche Situationen zu identifizieren und gegebenenfalls zu meiden. Auch die Interaktion mit digitalen Landkarten ist notwendig, um sich in der Spielwelt besser und somit sicher und effizient zurechtzufinden. Im Feuergefecht ist es des Weiteren notwendig, oft mehrere Gegner und Gegnerinnen in der virtuellen Welt visuell zu verfolgen, um die potentiellen Ziele oder Gefahren nicht aus den Augen zu verlieren. Mit ähnlichen Situationen sind wir täglich im echten Leben konfrontiert. Beispielsweise sind beim Autofahren sehr ähnliche kognitive Vorgänge notwendig und obwohl es bisher dazu keine Forschung gibt, könnten Ego-Shooter ein interessantes Training für die Aufmerksamkeit und das simultane Monitoring der Umwelt sein. Außerdem argumentiert die Forschergruppe um Daphne Bavelier, dass das Spielen von actionreichen Videospielen unter Umständen helfen kann, altersbedingte kognitive Verschlechterungen zu verlangsamen (Green & Bavelier, 2003, 2006a; Green, Li, & Bavelier, 2010).
In diesem Zusammenhang gibt es eine äußerst interessante wissenschaftliche Studie, die das Ziel hatte, ein Unterhaltungsspiel mit einem kommerziell vertriebenen kognitiven Training (Lumosity) hinsichtlich der kognitiven Effekte zu vergleichen (Shute, Ventura, & Ke, 2015). Dazu wurde das innovative 3D-Puzzle Unterhaltungsspiel Portal 2 (Valve Corporation), welches aus der Ego-Perspektive gespielt wird, gewählt. In Portal 2 muss der Spieler oder die Spielerin durch die Erstellung von Portalen Logik-Puzzles lösen. Mit den erstellten Portalen kann man Hindernisse überwinden, um ein Spiellevel zu lösen. Die primäre Mechanik besteht darin, mit einer Portal-Kanone zwei unterschiedliche Portale zu erstellen. Diese Portale sind im Raum miteinander verknüpft, d.h., wenn der Avatar im Spiel durch das erste Portal schreitet, kommt er beim zweiten Portal wieder heraus. Das erlaubt es dem Spieler oder der Spielerin Gravitation und Momentum auszunutzen, um sich oder andere Gegenstände über weite Distanzen zu befördern. Um diese Mechanik angemessen auszunutzen und die Puzzles zu lösen, ist es notwendig, räumliche, physikalische und zeitliche Aspekte der Spielwelt zu berücksichtigen und diese auszunutzen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Studie wurden dann zufällig entweder der Portal 2-Gruppe oder der kognitiven Trainings-Gruppe (Lumosity) zugeordnet. Personen der beiden Gruppen mussten daraufhin mit der jeweiligen Intervention (Portal 2 vs. Lumosity) 8 Stunden lang spielen bzw. trainieren. Während sich bei der kognitiven Trainings-Gruppe in keiner der erhobenen kognitiven Maße Verbesserungen zeigten, wies die Portal 2-Gruppe signifikante Verbesserungen in räumlichen Fähigkeiten auf. Diese Ergebnisse beweisen eindrucksvoll, dass ein Unterhaltungsspiel, welches nicht dazu entwickelt worden ist, kognitive Fähigkeiten zu verbessern, einen größeren positiven Effekt auf die Kognition der Anwender und Anwenderinnen ausübt, als ein kommerziell vertriebenes kognitives Training (Shute et al., 2015).
Solche Studien erweitern nicht nur den wachsenden Anteil an wissenschaftlichen Studien, die sich mit den positiven Effekten von Videospielen auf Kognition beschäftigen, sondern bestätigen auch das immense globale Interesse an digitalen Spielen. Mehr und mehr ForscherInnen beschäftigen sich aber nicht nur mit den kognitiven Effekten von Videospielen, sondern auch mit motivationalen, emotionalen und sozialen Effekten. Obwohl es diesbezüglich noch vergleichsweise wenig Forschung gibt, weisen aktuelle Studien immer wieder auf positive Effekte in unterschiedlichsten Domänen hin (Boyle et al., 2016; Granic, Lobel, & Engels, 2013). Nichtsdestotrotz wird es zukünftig notwendig sein, unterschiedliche Spielgenres und deren Effekte gründlicher zu betrachten. Ein besseres Verständnis von unterschiedlichen Spielelementen wird außerdem dazu beitragen, motivierende, innovative, und effiziente Lernumgebungen zu entwickeln. Generell ist zu sagen, dass die positiven Effekte von Unterhaltungsspielen und Spielelementen in Lernumgebungen nicht länger zu leugnen sind. Seien es die Leistungs- und Motivationssteigerung durch Implementation von Spiel-Elementen in herkömmlichen kognitiven Aufgaben oder die kognitiven Verbesserungen, die mit dem Spielen von digitalen Unterhaltungsspielen einhergehen: Digitale Spiele sind ein elementarer Bestandteil unserer Gesellschaft und haben oft zu Unrecht einen schlechten Ruf. Es ist notwendig, eine objektive Sicht auf Spiele und deren Mechaniken zu fördern, um die Entwicklung von innovativen Anwendungen weiter voranzutreiben.
Literatur
Anderson, C. A., Shibuya, A., Ihori, N., Swing, E. L., Bushman, B. J., Sakamoto, A., … Saleem, M. (2010). Violent video game effects on aggression, empathy, and prosocial behavior in Eastern and Western countries: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 136(2), 151–173. http://doi.org/10.1037/a0018251
Bavelier, D., Green, C. S., Han, D. H., Renshaw, P. F., Merzenich, M. M., & Gentile, D. a. (2011). Brains on video games. Nature Reviews. Neuroscience, 12(12), 763–8. http://doi.org/10.1038/nrn3135
Boyle, E. A., Hainey, T., Connolly, T. M., Gray, G., Earp, J., Ott, M., … Pereira, J. (2016). An update to the systematic literature review of empirical evidence of the impacts and outcomes of computer games and serious games. Computers & Education, 94, 178–192.http://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.11.003
Boyle, E. A., Hainey, T., Connolly, T. M., Gray, G., Earp, J., Ott, M., … Riberio, C. (2015). An update to the systematic literature review of empirical evidence of the impacts and outcomes of computer games and serious games. Computers & Education, -.http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2015.11.003
Bunzeck, N., & Düzel, E. (2006). Absolute Coding of Stimulus Novelty in the Human Substantia Nigra/VTA. Neuron, 51(3), 369–379.http://doi.org/10.1016/j.neuron.2006.06.021
Cohen Kadosh, R., Dowker, A., Heine, A., Kaufmann, L., & Kucian, K. (2013). Interventions for improving numerical abilities: Present and future. Trends in Neuroscience and Education, 2(2), 85–93.http://doi.org/10.1016/j.tine.2013.04.001
Cole, S. W., Yoo, D. J., & Knutson, B. (2012). Interactivity and rewardrelated neural activation during a serious videogame. PloS One, 7(3), e33909.http://doi.org/10.1371/journal.pone.0033909
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.http://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
Dye, M. W. G., Green, C. S., & Bavelier, D. (2009). Increasing Speed of Processing With Action Video Games. Current Directions in Psychological Science, 18(6), 321–326.http://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2009.01660.x
Erhel, S., & Jamet, E. (2013). Digital game-based learning: Impact of instructions and feedback on motivation and learning effectiveness. Computers and Education, 67, 156–167.http://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.02.019
Ferguson, C. J. (2013). Violent video games and the Supreme Court: Lessons for the scientific community in the wake of Brown v. Entertainment Merchants Association. American Psychologist, 68(2), 57–74.http://doi.org/10.1037/a0030597
Ferguson, C. J. (2015). Do Angry Birds Make for Angry Children? A Meta-Analysis of Video Game Influences on Children’s and Adolescents' Aggression, Mental Health, Prosocial Behavior, and Academic Performance. Perspectives on Psychological Science, 10(5), 646–666.http://doi.org/10.1177/1745691615592234
Flagel, S. B., Clark, J. J., Robinson, T. E., Mayo, L., Czuj, A., Willuhn, I., … Akil, H. (2011). A selective role for dopamine in stimulus-reward learning. Nature, 469(7328), 53–57.http://doi.org/10.1038/nature09588
Garris, R., Ahlers, R., & Driskell, J. E. (2002). Games, Motivation, and Learning: A Research and Practice Model. Simulation & Gaming, 33(4), 441–467.http://doi.org/10.1177/1046878102238607
Gentile, D. A., Anderson, C. A., Yukawa, S., Ihori, N., Saleem, M., Lim Kam Ming, … Sakamoto, A. (2009). The Effects of Prosocial Video Games on Prosocial Behaviors: International Evidence From Correlational, Longitudinal, and Experimental Studies. Personality and Social Psychology Bulletin, 35(6), 752–763.http://doi.org/10.1177/0146167209333045
Grace, A. A. (2010). Dopamine system dysregulation by the ventral subiculum as the common pathophysiological basis for schizophrenia psychosis, psychostimulant abuse, and stress. Neurotoxicity Research, 18(3-4), 367–376.http://doi.org/10.1007/s12640-010-9154-6
Granic, I., Lobel, A., & Engels, R. C. M. E. (2013). The Benefits of Playing Video Games. The American Psychologist, 69(1).http://doi.org/10.1037/a0034857
Green, C. S., & Bavelier, D. (2003). Action video game modifies visual selective attention. Nature, 423(6939), 534–7.http://doi.org/10.1038/nature01647
Green, C. S., & Bavelier, D. (2006a). Effect of action video games on the spatial distribution of visuospatial attention. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 32(6), 1465–1478.http://doi.org/10.1037/0096-1523.32.6.1465
Green, C. S., & Bavelier, D. (2006b). Enumeration versus multiple object tracking: the case of action video game players. Cognition, 101(1), 217–45.http://doi.org/10.1016/j.cognition.2005.10.004
Green, C. S., & Bavelier, D. (2007). Action-video-game experience alters the spatial resolution of vision. Psychological Science, 18(1), 88–94.http://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.01853.x
Green, C. S., & Bavelier, D. (2012). Learning , Attentional Control , and Action Video Games. Current Biology, 22(6), R197–R206.http://doi.org/10.1016/j.cub.2012.02.012
Green, C. S., Li, R., & Bavelier, D. (2010). Perceptual Learning During Action Video Game Playing. Topics in Cognitive Science, 2(2), 202–216.http://doi.org/10.1111/j.1756-8765.2009.01054.x
Greitemeyer, T., & Mügge, D. O. (2014). Video games do affect social outcomes: a meta-analytic review of the effects of violent and prosocial video game play. Personality & Social Psychology Bulletin, 40(5), 578–89.http://doi.org/10.1177/0146167213520459
Howard-Jones, P., Demetriou, S., Bogacz, R., Yoo, J. H., & Leonards, U. (2011). Toward a Science of Learning Games. Mind, Brain, and Education, 5(1), 33–41.http://doi.org/10.1111/j.1751-228X.2011.01108.x
ISFE. (2012). Videogames in Europe: Consumer Study – European Summary Report. Brussels.
Karpicke, J. D., & Roediger, H. L. (2008). The critical importance of retrieval for learning. Science (New York, N.Y.), 319(5865), 966–968.http://doi.org/10.1126/science.1152408
Kiili, K., Ninaus, M., Koskela, M., Tuomi, M., & Lindstedt, A. (2013). Developing Games for Health Impact : Case Brains vs Zombies. In Proceedings of The 7th European Conference on Games Based Learning – ECGBL 2013 (pp. 297–304). Porto: acpi.
Koepp, M. J., Gunn, R. N., Lawrence, a D., Cunningham, V. J., Dagher, a, Jones, T., … Grasby, P. M. (1998). Evidence for striatal dopamine release during a video game. Nature, 393(6682), 266–8.http://doi.org/10.1038/30498
Lemola, S., Brand, S., Vogler, N., Perkinson-Gloor, N., Allemand, M., & Grob, A. (2011). Habitual computer game playing at night is related to depressive symptoms. Personality and Individual Differences, 51(2), 117– 122.http://doi.org/10.1016/j.paid.2011.03.024
Li, S., Cullen, W. K., Anwyl, R., & Rowan, M. J. (2003). Dopaminedependent facilitation of LTP induction in hippocampal CA1 by exposure to spatial novelty. Nature Neuroscience, 6(5), 526–531.http://doi.org/10.1038/nn1049
Lisman, J., Grace, A. A., & Duzel, E. (2011). A neoHebbian framework for episodic memory; role of dopamine-dependent late LTP. Trends in Neurosciences, 34(10), 536–547.http://doi.org/10.1016/j.tins.2011.07.006
Mekler, E. D., Brühlmann, F., Opwis, K., & Tuch, A. N. (2013). Do Points , Levels and Leaderboards Harm Intrinsic Motivation ? An Empirical Analysis of Common Gamification Elements. In Gamification 2013 Proceedings of the First International Conference on Gameful Design, Research, and Applications (pp. 66–73). ACM.
Ninaus, M., Pereira, G., Stefitz, R., Prada, R., Paiva, A., & Wood, G. (2015). Game elements improve performance in a working memory training task. International Journal of Serious Games, 2(1), 3–16.http://doi.org/10.17083/ijsg.v2i1.60
Ninaus, M., Witte, M., Kober, S. E., Friedrich, E. V. C., Kurzmann, J., Hartsuiker, E., … Wood, G. (2013). Neurofeedback and Serious Games. In T. M. Connolly, E. Boyle, T. Hainey, G. Baxter, & P. Moreno-ger (Eds.), Psychology, Pedagogy, and Assessment in Serious Games (pp. 82–110). Hershey, PA: IGI Global. http://doi.org/10.4018/978-1-4666-4773-2.ch005
NPD Group. (2011). The video game industry is adding 2–17-year-old gamers at a rate higher than that age group’s population growth. Zugang überhttps://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/
Pereira, G., Ninaus, M., Prada, R., Wood, G., Neuper, C., & Paiva, A. (2015). Free Your Brain: A Working Memory Training Game. (A. De Gloria, Ed.)Games and Learning Alliance conference 2014 (Vol. 9221). Cham: Springer International Publishing.http://doi.org/10.1007/978-3-319-22960-7-13
Prins, P. J. M., Dovis, S., Ponsioen, A., ten Brink, E., & van der Oord, S. (2011). Does computerized working memory training with game elements enhance motivation and training efficacy in children with ADHD? Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 14(3), 115–22.http://doi.org/10.1089/cyber.2009.0206
Przybylski, A. K., Deci, E. L., Rigby, C. S., & Ryan, R. M. (2014). Competence-impeding electronic games and players’ aggressive feelings, thoughts, and behaviors. Journal of Personality and Social Psychology, 106(3), 441–457.http://doi.org/10.1037/a0034820
Przybylski, A. K., Rigby, C. S., & Ryan, R. M. (2010). A motivational model of video game engagement. Review of General Psychology, 14(2), 154–166.http://doi.org/10.1037/a0019440
Przybylski, A. K., Ryan, R. M., & Rigby, C. S. (2009). The motivating role of violence in video games. Personality & Social Psychology Bulletin, 35(2), 243–59.http://doi.org/10.1177/0146167208327216
Schultz, W. (2006). Behavioral theories and the neurophysiology of reward. Annual Review of Psychology, 57, 87–115.http://doi.org/10.1146/annurev.psych.56.091103.070229
Shute, V. J., Ventura, M., & Ke, F. (2015). The power of play: The effects of Portal 2 and Lumosity on cognitive and noncognitive skills. Computers & Education, 80, 58–67.http://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.08.013
Wise, R. A. (2004). Dopamine, learning and motivation. Nature Reviews. Neuroscience, 5(6), 483–494.http://doi.org/10.1038/nrn1406
1.2. Spielend Schlüsselkompetenzen generieren
Potentialanalyse in der Berufsorientierung anhand digitaler Spiele
Claudia Zechmeister
1.2.1. Einleitung
Repräsentative Studien wie die „JIM-Studie 2015“ (Medienpädagogischer Forschungsverband Südwest, 2015) und die „Oö. Jugend-Medien-Studie 2015“ (Education Group, 2015) bestätigen, dass Jugendliche einen großen Teil ihrer Freizeit mit digitalen Spielen verbringen. Daher liegt es nahe, auch Computerspiele als Medium in der Berufsorientierung zur Interessens- und Potentialanalyse bei einer computerspielerfahrenen Zielgruppe – vorwiegend Jugendliche und junge Erwachsene – einzusetzen. Durch die gezielte Reflexion und Auseinandersetzung mit der persönlichen digitalen Spielbiographie und auch in pädagogischen Computerspiel-Projekten gestalten sich Transferräume (vgl. Fritz, 2005), wo Kompetenzen sichtbar werden und ein Zugang zu der Lebenswelt der spielaffinen Zielgruppe eröffnet wird. Aufgrund der aktuellen prekären Arbeitsmarktsituation gestaltet es sich für Berufseinsteigende und Arbeitssuchende als große Herausforderung, den gewünschten Beruf zu erlernen oder im ursprünglichen Berufsfeld über einen längeren Zeitraum zu arbeiten (vgl. Hirschbichler & Knittler, 2010, S. 15f). Somit stellt die Generierung und Bewusstmachung von Schlüsselkompetenzen, welche digitale, soziale, kognitive sowie persönlichkeitsbezogene Kompetenzen beinhalten, einen zentralen Aspekt für die Partizipation am Arbeitsmarkt dar.
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Generierung von Schlüsselkompetenzen anhand digitaler Spiele von computerspielerfahrenen Personen und bietet methodische Anregungen für die Nutzung des kompetenzförderlichen Potentials von digitalen Spielen in der Berufsorientierung.
1.2.2. Vier Phasen oder „Levels“ in der Berufsorientierung
Die Arbeits- und Berufsfindungskompetenz ist für die erfolgreiche berufliche Integration von zentraler Bedeutung. Junge Menschen durchlaufen während ihrer beruflichen Orientierung vier Phasen. In der ersten Phase müssen Berufe mit deren Anforderungen erforscht und analysiert werden, um in der zweiten Phase persönliche Interessen, Fähigkeiten und Kompetenzen auszuforschen bzw. zu generieren und sie infolge mit der Kompatibilität zu Berufsfeldern zu prüfen. Erst dann können in der dritten Phase Bewerbungsunterlagen erstellt werden, um den aktiven Bewerbungsprozess einzuleiten. Da persönliche berufliche Vorstellungen von Menschen nicht immer mit den realen Bedingungen der Wirtschaftswelt übereinstimmen, muss in Phase vier eine sorgfältige Reflexion mit einem überarbeiteten Karriereplan vorgenommen werden (vgl. Jung & Oesterle, 2010, S. 191). Das Modell kann auch auf Personen angewandt werden, die bereits in der Arbeitswelt integriert sind oder waren und eine berufliche Umorientierung (oft auch unfreiwillig) anstreben.
1.2.3. Generierung und Bewusstmachung von Kompetenzen
Bei der Kompetenzmessung ist vorerst festzulegen, welche Kompetenzen bewertet werden sollen und ebenso gilt es, zu eruieren, ob die Kompetenzen bereits vorhanden sind. Oft sind vorhandene Kompetenzen nicht direkt sichtbar. Dann bedarf es einer Beobachtung, ob die Kompetenz in Form von konkreten Handlungen identifiziert werden kann. Zur Erhebung wird oft nach ausgeübten Tätigkeiten gefragt oder auch eine Analyse in begrenzten Teilbereichen oder in spezifischen Handlungsfeldern vorgenommen, um Kompetenzen zu evaluieren. Beispielsweise könnte bei einer Person, die lange Zeit komplexe Aufbau-Strategie Computerspiele gespielt hat, der Schluss erfolgen, dass diese über Managementfähigkeiten verfügt. Jedoch stellt diese Schlussfolgerung keine Garantie für diese Kompetenz dar. Zur Erhebung können offene, aber auch gestützte Fragen gestellt werden. Gestützte Fragen geben einen Teil einer möglichen Antwort vor, wodurch sie der Person helfen, sich an Tätigkeiten oder Lebensphasen besser zu erinnern. Bei der Selbsteinschätzung kann die gleiche Methode angewandt werden: Personen erinnern sich an vergangene Handlungen und Tätigkeiten und identifizieren selbst die dazu benötigten Kompetenzen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass Menschen sich kaum objektiv einschätzen können, daher ist auch eine neutrale Fremdperspektive wichtig. Ein einfacheres und zeiteffizienteres Messverfahren stellt das Vorlegen von Kompetenzlisten, meist mit Schlüsselkompetenzen, dar. Diese geben jedoch ein ungenaueres Bild, da die Personen oft an der Spielend Schlüsselkompetenzen generieren detailierten Zuordung scheitern oder sich ihrer Kompetenz nicht bewusst sind. Die Genauigkeit der Messverfahren wird mit einer Kombination von Fremd- und Selbsteinschätzung, mehreren fremdeinschätzenden Personen sowie mit einer qualifizierten Fachperson für die Kompetenzbewusstmachung erhöht (vgl. Gnahs, 2010, S. 54f).
1.2.4. Erforderliche Schlüsselkompetenzen für eine kompexe digitale Lebenswelt
Das Projekt „Definition and Selection of Competencies“ (DeSeCo, OECD, 2005)wurde basierend auf dem „Programme for International Student Assessment – PISA“ (OECD, 2015) entwickelt. Es stellt eine Erweiterung an Kompetenzbereichen, die für den Lebenserfolg in der heutigen komplexen und technologischen Wissensgesellschaft erforderlich sind, dar. Das DeSeCo-Projekt nennt für den konzeptuellen Referenzrahmen drei sich überschneidende Bereiche fürSchlüsselkompetenzen, die sich aus „interaktiver Medien- und Mittelanwendung,Interagieren in heterogenen Gruppenundautonomem Handeln“zusammensetzen (vgl. OECD 2005, S.5-7).
Nachstehend werden die drei Kompetenzkategorien mit den wesentlichen sozialen-, digitalen- und persönlichkeitsbeszogenen Schlüsselkompetenzen, die wiederum in drei Bereiche unterteilt sind, überblicksmäßig aufgelistet:
Kategorie 1: INTERAKTIVE MEDIEN- UND MITTELANWENDUNG
Um den Anforderungen einer globalisierten, dynamischen Welt im ständigen Wandel sowohl in beruflichen als auch in sozialen Bereichen zu genügen, bedarf es technologischer Medienkompetenz, um sich aktiv in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen einbringen zu können. Da sich diese Branche sehr schnell weiterentwickelt, ist eine ständige Erweiterung der diesbezüglichen Kenntnisse erforderlich, um diese Mittel und Werkzeuge für die eigenen Bedürfnisse einsetzen zu können.
Kategorie 1A: Fähigkeit zur interaktiven Sprach-, Symbol- und Textanwendung
Kategorie 1B: Fähigkeit zur interaktiven Wissens- und Informationsnutzung
Kategorie 1C: Fähigkeit zur interaktiven Technologieanwendung
Kategorie 2: INTERAGIEREN IN HETEROGENEN GRUPPEN
Für das Überleben, im Blick auf materielle Güter, auf psychische Stabilität und auf soziale Identität in einer globalisierten Gesellschaft, sind soziale Beziehungen unbedingt notwendig. Traditionelle soziale Bindungen treten immer mehr in den Hintergrund, daher sind neue Formen von Bindungen und Zusammenarbeit erforderlich. Netzwerke bilden die Grundlage für soziales Kapital von Einzelpersonen. Alltägliche Aufgaben, wie Lernen, Leben und Arbeiten, werden gemeinsam bewältigt und sind geprägt von gegenseitiger Unterstützung und dem Austausch von Wissen und Gütern. Soziale Kompetenz beinhaltet auch die Empathiefähigkeit, um kollektiv das Leben und Ziele zu meistern.
Kategorie 2A: Fähigkeit zur Beziehungsunterhaltung zu anderen
Kategorie 2B: Kooperationsfähigkeit
Kategorie 2C: Fähigkeit zur Konflikt- und Lösungsbewältigung
Kategorie 3: AUTONOMES HANDELN
Eigenständiges Handeln bedeutet, sich seiner eigenen Identität in der Gesellschaft bewusst zu sein und Sensibilität für die Umwelt und Mitmenschen aufzubringen. Seine eigene gesellschaftliche Rolle zu kennen und Entscheidungen in sozialen, politischen und beruflichen Umgebungen aktiv mitzugestalten, ist wesentlich. Im Umsetzen von eigenen Zielen erleben sich Menschen selbstwirksam und als Teil der Gemeinschaft. Ebenso ist es wichtig, die eigenen Rechte einzufordern und für sich und andere Verantwortung zu übernehmen. Selbständiges Handeln begünstigt die Entwicklung einer gefestigten Identität, verleiht dem Leben Sinnhaftigkeit und ermöglicht selbstreflexives Denken, um Umweltsysteme zu verstehen.
Kategorie 3A: Handlungsfähigkeit im größeren Kontext
Kategorie 3B: Fähigkeit, eigene Lebenspläne und persönliche Projekte zu gestalten
Kategorie 3C: Fähigkeit zur Wahrnehmung von Rechten, Interessen, Grenzen sowie Bedürfnissen (vgl. OECD 2005, S.12-17)
1.2.5. Genre-Vielfalt in digitalen Spielen
Laut der Oö. Jugend-Medien-Studie 2015 werden Strategie- und Aufbauspiele am häufigsten gespielt, gefolgt von Jump and Run sowie Adventure-Spielen. Erst an vierter Stelle der Beliebtheitsskala finden sich, vorwiegend bei Jungen, „Ballerspiele“. Mädchen bevorzugen generell Denkspiele und Geschicklichkeitsspiele (vgl. Education Group, 2015).
Der online „Spielratgeber NRW“ (Computer Projekt Köln e. V., 2015) bietet unter Einbezug medien- und bildungspädagogischer Aspekte eine gute Auflistung der diversen Genres sowie deren Anforderungen an die Spielerinnen und Spieler. Aus der folgenden ausführlichen Aufzählung geht einerseits die Vielfalt an Spielinhalten und Kompetenzanforderungen hervor und andererseits kann dadurch die Faszination für digitale Spiele nachvollzogen werden.
ADVENTURE: Verschiedene Spielcharaktere werden im klassischen Abenteuerspiel gesteuert und weisen eine in sich geschlossene Geschichte auf. In den Adventure-Spielen liegt der Fokus auf dem Lösen von Rätseln und Aufgaben, dem Sammeln von Gegenständen und Informationen sowie infolge darauf die passende Kombination der Ergebnisse, um im Spiel beziehungsweise in der Geschichte voranzukommen. Fähigkeiten wie beispielsweise Kombinationsgabe, logisches Denken, Konzentration, Geduld und Ausdauer sind von den Spielerinnen und Spielern gefordert. Die Spiele weisen teilweise auch Interaktionen mit anderen Spielfiguren auf. Eine faszinierende Wirkung stellt das Erleben einer interaktiven filmischen Geschichte, das Lösen von komplizierten Rätselketten oder das Zusammensetzen von Puzzleteilen zu einem großen Ganzen dar (vgl. ebd.).
STRATEGIE: Ganze Völker und gesamte Fraktionen werden in diesem Genre gesteuert. Der/die Spielende hat die Verantwortung und Kontrolle für unterschiedliche Wirkungsfelder. Oft sind die Ressourcen begrenzt, mit denen gewissenhaft gehaushaltet werden muss. Die Spiele finden rundenbasiert und in Echtzeit statt. Es gibt unterschiedliche Schwerpunkte, wie beispielsweise den Aufbau einer gut florierenden Wirtschaft oder die Eroberung wie auch die Verteidigung eines Territoriums. Durchsetzungsvermögen, Diplomatie, vorausschauendes ökonomisches und strategisches Planen, Überschauen komplexer Spielbereiche, Treffen von Entscheidungen wie auch Übernahme von Verantwortung zählen zu den geforderten Kompetenzen, die für das Spiel benötigt werden.(vgl. ebd.)
DENKEN UND GESCHICKLICHKEIT: Bei Denk- und Geschicklichkeitsspielen gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Sie fordern ein hohes Maß an Konzentration, Ausdauer und Frustrationstoleranz. Rasche Erfolgsrückmeldungen werden bei den kniffligen und komplexen Spielen geboten. Neben Geschicklichkeit ist auch operatives Denken gefordert. Elemente verschieben, ordnen sowie Regelwerke aufeinander abstimmen sind oft die Aufgaben in diesem Genre. Für die Attraktivität sorgen häufig Szenen in Comicdarstellung (vgl. ebd.).
EDUTAINMENT: Der Name ergibt sich aus den englischen Wörtern education und entertainment. Dieses Spielgenre hat den Anspruch, pädagogische Inhalte, Lernen und Unterhaltung zu verbinden. Die Spiele wollen Interesse und Motivation beim Lernen anhand von Spaß und Spielen erzielen. Zu diesem Genre zählen auchLernprogramme, Serious GamesundInfotainment-Programme. Das übergeordnete Ziel besteht im Vermitteln von ernsthaften Wissens- und Lerninhalten in spielerischer Weise (vgl. ebd.).
GESELLSCHAFTSSPIELE: Als Grundlage dienen das Brett-, Kartenoder Würfelspielprinzip, welches auf Bildschirmen dargestellt wird. Oft werden noch zusätzlich zu den üblichen Eingabegeräten (Controller genannt) eine Kamera, mehrere Mikrofone oder eine Tanzmatte für das Spiel benötigt. Diese Spiele weisen eine hohe soziale Komponente auf, da sie zusammen mit der Familie, mit FreundInnen, auf Partys oder bei Familientreffen gespielt werden können (vgl. ebd.).
JUMP AND RUN: Jump-and-Run-Spiele werden auch als Plattformspiele bezeichnet. In diesen muss die Spielfigur geschickt über Hindernisse laufen und hüpfen sowie oftmals auch nebenbei Gegenstände einsammeln oder Gegner besiegen bzw. entkommen. Das wohl berühmteste Beispiel für dieses Genre ist dieSuper MarioSerie (Nintendo). Belohnungen, z.B. in Form von Punkten, und das Erreichen einer nächsten Spielebene stellen den Anreiz dieser Spielkategorie dar (vgl. ebd.).
ONLINESPIELE: Onlinespiele werden auf einem gemeinsamen Server, gemeinsam mit anderen Spielerinnen und Spielern in Echtzeit gespielt. Die Aufgaben sind oft im Team zu bewältigen. Dazu müssen alle Spielenden zum selben Zeitpunkt online sein und entsprechend viel Zeit in die Aufgaben investieren. Folglich wird von den Spielerinnen und Spielern Zeitmanagement und hohe Kooperationskompetenz gefordert. Mehrere Genreformen können hier auch ineinandergreifen (vgl. ebd.).
RENNSPIELE: Mit diversen Fahrzeugen können die Spielenden bei Rennspielen in einer definierten Strecke ihr Fahrzeug steuern. Diese Spiele werden in die zwei Kategorien Renn-Simulation und Fun-Racing unterteilt. Bei der Renn-Simulation sollen die Rennen sehr realitätsgetreu nachempfunden werden, wobei es beim Fun-Racing eher um den Spaß auf skurrilen oder futuristischen Fahrstrecken mit „crazy cars“ geht (vgl. ebd.).
ROLLENSPIELE: Dieses Genre gehört zu den Abenteuerspielen, wo die Spielenden die Geschichte aus der Perspektive eines spezfiischen Charakters erleben können. Am Beginn eines Rollenspiels steht oft eine Charaktergenerierung, bei welcher der eigene Charakter angepasst wird. Dabei wird etwa das Aussehen, Geschlecht, das Volk oder die Klasse des Charakters gewählt. Je nach Auswahl sind die Figuren mit speziellen Fähigkeiten ausgestattet, die im Spiel nutzbringend eingesetzt werden müssen. Genretypisch werden im Spielverlauf unterschiedliche Aufgaben (Quests) bewältigt, Kämpfe ausgetragen oder Dialoge geführt. Die Entscheidungen und Taten der Spielenden haben meist eine Auswirkung auf den Verlauf der Hintergrundgeschichte (vgl. ebd.).
SHOOTER: In Shooter-Spielen müssen sich die Spielenden mit Waffen gegen Feinde verteidigen, sprich, sie müssen ihre Gegner töten. In manchen Spielen ist die Aufgabenstellung auch, mit möglichst wenig Waffengewalt auszukommen. Das Besiegen der Feinde erfordert meist taktisches und strategisches Vorgehen sowie entsprechendes vorausschauendes Denken und Geschicklichkeit. Shooter werden häufig im Mehrspielermodus, wo viel Teamarbeit gefragt ist, angeboten. Diese Spiele werden in der Öffentlichkeit kritisch diskutiert, da sie oft mit realen Gewalttaten in Zusammenhang gebracht werden. Genre-Kombinationen werden oftmals in Shooterspielen vorgefunden (vgl. ebd.).
SIMULATION: Simulationen haben den Anspruch, verschiedene Lebensbereiche möglichst realitätsnah abzubilden und so den Spielenden zu ermöglichen, Erfahrungen darin zu machen. Die Bewältigung der aus der Realität genommenen Aufgabe – etwa das Managment einer Fußballmannschaft oder die Bewirtschaftung eines Bauernhofes – wird dabei zum eigentlichen Spiel. Oft können auch in unterschiedlichen Rollen vielfältige Perspektiven eingenommen werden, somit kann das Erfahrungsund Kompetenzspektrum erweitert werden (vgl. ebd.).
SPORT: Bei Sport-Spielen werden reale oder fiktive Sportarten nachgespielt, mit Wettkämpfen und Regeln, wie sie auch aus den realen Ausübungen bekannt sind. Fast alle Sportarten sind in dieser Kategorie vertreten. Strategien und Bewegungsabläufe können aufgrund einer Analyse oft gut nachvollzogen und optimiert werden. Das virtuelle Training könnte für die reale Ausübung einer Sportart vorteilhaft sein (vgl. ebd.).
1.2.6. Klassifizierung von Spielertypen in digitalen Spielen
Bartle hat in den neunziger Jahren eine Klassifizierung von Spielertypen vorgenommen, in der er vier Typus-Formen aufgrund des Verhaltens in Computerspielen im Einzelspieler- und Mehrspieler-Onlinemodus beschreibt (vgl. Bartle, 1999). Seine Forschung bezieht sich vorwiegend auf Online-Computerspiele, wo viele Spielerinnen und Spieler weltweit gemeinsam auf einem Server ein Spiel spielen. Er teilt die Charaktertypen in vier Kategorien:
Die erste Kategorie stellen die erfolgsorientierten Typen, sogenannte ACHIEVERS, dar. Sie sind sehr zielorientiert, streben ständig nächste Spielebenen und höhere Ränge an. Durch das Sammeln von Punkten und das Verdienen von virtuellem Geld sind sie stark motiviert. Wenn es nötig ist, sind sie auch bereit, Mitspielerinnen und Mitspieler zu „töten“, um eigene Gewinne zu erzielen. Sie sind ständig auf den eigenen Vorteil bedacht und machen kaum etwas ohne Gegenleistung.
EXPLORERS sind die EntdeckerInnen – sie erkunden die Spiellandschaft mit dem Ziel, neue spannende Entdeckungen sowie neue Erfahrungen zu machen. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen Erkenntnissen, nach der Generierung von neuen Ideen, Strategien und optimierten Lösungsmöglichkeiten. Viel Abwechslung sowie Vielfalt sind für diesen Typus motivierend.
Für den SOCIALIZER-Typ sind Punkte, Ziel oder Gewinn eher nebensächlich. Socializer interessieren sich hauptsächlich für soziale und kommunikative Interaktionen mit anderen Spielerinnen und Spielern. Sie schätzen das gemeinsame Erlebnis wie auch den Austausch und das Knüpfen neuer Kontakte. Durch die Beziehungsgestaltung zu den Mitspielenden als auch durch Diskussionen in Foren und Chats sind sie besonders motivierbar.
Die letzte Kategorie stellen die KILLER-Typen dar, welche eher eine destruktive Spielhaltung aufweisen. Sie wollen nicht nur gewinnen, sondern auch ihre Gegnerinnen und Gegner „sterben“ sehen. Sie verursachen oft Stress oder Desaster und beteiligen sich kaum an gemeinsamen Aktionen, die eine Spielgemeinschaft voranbringt. Ihre überwiegende Motivation besteht darin, anderen Spielerinnen und Spielern Schaden zuzufügen. Sehr oft ist ihr Ziel, Schadenfreude zu empfinden und andere beim Scheitern zu beobachten (vgl. ebd.).
Yee kritisiert jedoch die strenge Kategorisierung von Bartle und meint, dass Spielende nicht nur einen Charaktertypus aufweisen, sondern dass in der Realität auch Mischtypen mit unterschiedlichen Zielen und Motivationen auftreten (vgl. Yee 2007, S. 772-774).
Von den Spielenden wird eine virtuelle Identität kreiert und durch diese virtuelle Rolle werden bestimmte Handlungen, Sicht- und Denkweisen vollzogen, jedoch werden die Aktionen auch von den Lebenserfahrungen aus dem realen Leben beeinflusst. Die Synthese von virtueller und realer Identität, die sogenannte projizierte Identität, stellt das Verbindungsstück der beiden Identitäten dar. Über die projizierte Identität findet ein Austausch der beiden Welten statt. Demnach könnten auch Lernerfahrungen aus der virtuellen in die reale Welt einfließen (vgl. Gee, 2007, S. 49ff).
Fritz nennt für Transferbedingungen in erster Linie eine Faszination für die virtuelle Welt, für das Spiel, das eine hohe Konzentration und Aufmerksamkeit erfordert. Je mehr positive Gefühle durch das Spiel ausgelöst werden, desto stärker ist der Transferprozess zu erwarten. Grundlegend muss jedoch eine Bereitschaft und Akzeptanz für den Transfer vorhanden sein. Ein bedeutendes Element ist die Rahmungskompetenz, wonach Spielende den angemessenen Rahmen für Handlungen, die für die jeweilige Welt adäquat sind, finden müssen. Auf Grund dessen ist es wichtig, Grenzen zwischen den Welten setzen zu können, um den Transfer kontrollieren zu können. Bei einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist diese Kontrollkompetenz vorhanden. Fritz gibt auch die Handlungsempfehlung, bewusst Transferräume zu initiieren (vgl. Fritz, 2005). Die methodische Gestaltung von Transferräumen geschieht am besten durch Reflexion über das eigene Handeln in digitalen Spielen, duch Bewusstmachen und die praxisnahe Veranschaulichung, wie sich die Unterschiede zwischen der virtuellen Welt im Spiel und dem realem Leben darstellen.
1.2.7. Kompetenzförderliches Potential in Computerspielen
Gebel, Gurt und Wagner haben 30 populäre digitale Spiele mit einem eigens entwickelten Analyseschema nach kompetenzförderlichen Potenzialen untersucht.Dazu mussten relevante Kompetenzdimensionen festgelegt werden, welche Kriterien zur Beurteilung für das kompetenzförderliche Potenzial von Computerspielen bieten sollen. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht alle populären Computerspiele in gleicher Intensität alle Kompetenzkategorien fördern (vgl. Gebel et al., 2005). Es kann angenommen werden, dass diese Kompetenzdimensionen in unterschiedlicher Ausprägung in fast allen digitalen Spielen vorzufinden sind.
Kognitive Kompetenz–relevante Komponenten:
Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnis, Abstraktion, Schlussfolgern, Strukturverständnis, Bedeutungsverständnis, Handlungsplanung neuer Aufgaben, Problemlösen
Soziale Kompetenz– relevante Komponenten:
Perspektivenübernahme, Empathiefähigkeit, Ambiguitätstoleranz, Interaktionsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Moralische Urteilskompetenz
Medienkompetenz– relevante Komponenten:
Medienkunde, Mediengestaltung, selbstbestimmter Umgang, aktive Kommunikation
Persönlichkeitsbezogene Kompetenz –relevante Komponenten:
Selbstbeobachtung, Selbstkritik/-reflexion, Identitätswahrnehmung, Emotionale Selbstkontrolle
Sensomotorik– relevante Komponenten:
Hand-Auge-Koordination, Reaktionsgeschwindigkeit
Die Spielenden selbst nehmen digitale Spiele kaum als Lernfeld wahr, wo Kompetenzen erworben oder trainiert werden können. Die Hauptmotivationen liegen im Spielvergnügen, in der Abwechslung zum Alltag, in Freiheit von Verpflichtungen, in externen Leistungsanforderungen, in der positiv empfundenen Stimmungsregulation und bei online Massenspieler-Plattformen in den sozialen Beziehungen. Das Spielgenre ist weniger für positive Wirkung verantwortlich, vielmehr sind dies Game-Strukturen sowie Belohnungsmechanismen. Jene Aspekte finden sich in allen Genres wieder. Spielbezogenes Wissen und Fähigkeiten sollen Anerkennung finden, um den Grundstein für bewusst gewünschte Transferprozesse in andere Lebensbereiche zu legen (vgl. Fritz et al., 2011, S. 270-273).
1.2.8. Methodische Anregungen zur Kompetenzgenerierung
Wenn die oben angeführten Komponenten, die kompetenzförderlichen Kategorien aus digitalen Spielen, die Spielertypen von Bartle sowie die Spielanforderungen aus den diversen Spiel-Genres den Schlüsselkompetenzen aus dem DeSeCo Projekt gegenübergestellt werden, kann festgestellt werden, dass Gemeinsamkeiten an Kompetenzen zu verzeichnen sind. Nun gilt es, kreative methodische Gestaltungsprozesse zu kreieren, um die genützen Fähigkeiten und Verhaltensweisen von Personen mit digitaler Spielbiograpie sichtbar zu machen und handlungsorientierte Projektformate zur Kompetenzgenerierung zu entwickeln. Folgend werden zwei Praxisbeispiele angeführt, die als Anregung für den Einsatz von kommerziellen Spielen dienen sollen. Zur Unterstützung wird im letzten Abschnitt des Beitrages ein Fragenkatalog zur Kompetenzgenerierung anhand der digitalen persönlichen Spielerfahrung sowie anhand digitaler Spielprojekte zur Verfügung gestellt.
1.2.8.1.Praxisbeispiel I: Interview
Eine klassische Methode besteht in Form einer Befragung, wobei in detektivischer Weise nach Schlüsselkompetenzen geforscht wird und gefundene schriftlich festgehalten werden. Zur Generierung von Schlüsselkompetenzen können Fachkräfte in der beruflichen Orientierung eine Befragung durchführen, aber auch die Zielgruppe selbst kann sich gegenseitig interviewen. Die identifizierten Kompetenzen werden beispielsweise in Form eines Kompetenzpasses, eines Zeugnisses mit Schulnoten oder Punkten als auch mit einem Präsentations-Video oder Kompetenz-Portfolio dokumentiert. Im Anschluss können die Ergebnisse einem Publikum oder in einem simulierten Vorstellungsgespäch präsentiert werden.
1.2.8.2.Praxisbeispiel II: Lan-Party
Unter Berücksichtigung der Alterskennzeichungen USK (USK, 2011) und PEGI (PEGI, 2015) können im Mehrspielermodus über eine Lanverbindung kommerzielle digitale Spiele gespielt werden. Die Zielgruppe kann auch ihre digitalen Lieblingsspiele mitbringen. Im Anschluss, ähnlich wie im ersten Beispiel, wird anhand des Fragenkataloges eine Kompetenzanalyse, in Form von Reflexion oder gegenseitiger Beurteilung, vorgenommen. Ebenso besteht die Option, auch in realen sowie in virtuellen Teams zu spielen. Eine weitere Möglichkeit, digitale Kompetenzen zu fördern, ergibt sich, wenn in unterschiedlichen Räumen unter Einsatz von informationstechnologischen Medien, wie beispielsweise über die Plattform Teamspeak, mit Headset gespielt wird. Die Spielerfahrenen können dabei ihre technischen Fähigkeiten bei der Installation einbringen und diese an nicht erfahrene Peers weitergeben. Somit eröffnet sich die Chance zur Peer-Education in der Medienarbeit. Diese Form der pädagogischen Vermittlung stellt auch eine Entlastung für das pädagogische Personal hinsichtlich der technichnischen Handhabung dar.
1.2.8.3.Fragenkatalog zur Kompetenzgenerierung anhand digitaler Spielerfahrung
Eine offene Fragestellung soll die Spielenden zur Selbst- und Fremdreflexion anregen und motivieren. Die Zielgruppe soll erforschen, welche Fertigkeiten und Kompetenzen beim Spielen ihrer bevorzugten digitalen Spiele zur Anwendung kommen und auch einen Vergleich zur realen Welt vornehmen. Personen mit mangelndem Reflexionsvermögen können zur Unterstützung Kompetenzlisten vorgelegt werden. Jene Kompetenzen gehen aus den oben beschriebenen Abschnitten Spielgenre, Spielertypen, kompetenzförderliches Potential in digitalen Spielen und Schlüsselkompetenzen hervor. Auch das Wording kann für die Zielgruppe individuell adaptiert werden. Wenn Kompetenzen erkannt werden, kann der Grad der Ausprägung mittels einer Skalierung sichtbar gemacht werden. Der Fragenkatalog erhebt keinen Anspuch auf Vollständigkeit, sondern bietet lediglich eine Anregung. Die generierten Antworten können auch Überschneidungen zu anderen Kategorien und/oder Mehrfachzuteilungen vorweisen.
Fragen zu kognitiven Kompetenzen(Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnis, Abstraktion, Schlussfolgern, Strukturverständnis, Bedeutungsverständnis, Handlungsplanung, Problemlösen, Lernkompetenz,...)
–Wie viel musst du in Spielen lesen und schreiben? Was musst du lesen?
–Wie würdest du deine Konzentrationsfähigkeit in Spielen beschreiben?
–Hast du bestimmte Spielstrategien, um Spielziele zu erreichen? Wenn ja: welche?
–Gibt es in den Spielen Symbole/Bilder, die SpielerInnen kennen müssen, um das Spiel spielen zu können? Wie unterschiedlich sind diesbezüglich Spiele?
–Welche Aufgaben/Spielziele/Regeln gibt es in den Spielen?
–Was musstest du lernen, um diese Spiele spielen zu können bzw. welche Fähigkeiten sind nötig? Wie hast du das gelernt? (Konkrete Beispiele/Spiele!)
–Wie bewältigst du Herausforderungen? Was machst du, wenn du nicht weiter kommst?
–...
Fragen zu sozialen Kompetenzen(Perspektivenübernahme, Empathiefähigkeit, Ambiguitätstoleranz, Interaktionsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Moralische Urteilskompetenz,...)
–Bist du in bestimmten Gaming-Online-Netzwerken (Chats/Foren) zum Austausch?
–Wenn ja, bei welchen? Was sind die Themen?
–Wie wird im Spiel kommuniziert? Zu welchem Zweck?
–In welcher Sprache sind die Spiele, die du spielst? Ev. Muttersprache?
–Spielst du lieber alleine oder mit anderen Personen? Was sind die Voru. Nachteile?
–Hast du Leute durch Online-Spiele kennen gelernt?
–Was meinst du, ist wichtig, um im Team gut zusammenspielen zu können?
–Wie triffst du Entscheidungen im Spiel?
–Was ist in Spielen erlaubt, was im realem Leben nicht erlaubt ist? Wie geht es dir damit?
–...
Fragen zur Medienkompetenz(Medienkunde, Mediengestaltung, selbstbestimmter Umgang, aktive Kommunikation, ...)
–Was muss eine Person können, hinsichtlich des Umgangs mit Plattformen, Hardware, Software (PC, Konsolen, ...), um digitale Spiele spielen zu können?
–Welche Vorbereitung/Vorarbeit muss auf den Plattformen gemacht werden, um spielen zu können?
–Wie gehst du vor, wenn du ein neues Spiel bekommst, hinsichtlich Spielregeln und Handhabung? Wie war das früher – gab es im Verlauf deiner „Spielkarriere“ Veränderungen?
–Beteiligst du dich in der Fan-Community mit selbst erstellten Medien? (Let´s Plays, Tutorials, Modding,...)
–...
Fragen zu persönlichkeitsbezogenen Kompetenzen (Selbstbeobachtung, Selbstkritik/-reflexion, Identitätswahrnehmung, Emotionale Selbstkontrolle, ...)
–Was machst du, wenn du dich im Spiel ärgerst?
–Wie reagierst du, wenn der Druck im Spiel steigt? Was geht in dir vor?
–Wie ist die Stimmung bzw. der Umgang unter den Spielenden im Mehrspieler-Modus?
–Gibt es Konflikte im Mehrspielermodus? Wenn ja: Wie gehst du damit um?
–Beschäftigt dich ein Spiel auch noch nach dem Spielen? Wenn ja: Was? Welche Überlegungen stellst du an?
–Welche Fähigkeiten braucht man, um im Spiel erfolgreich zu sein?
–Wie reagierst oder agierst du, wenn du erfolgreich warst oder gewonnen hast?
–Welche Rollen spielst du gerne? Welche Tätigkeiten führst du im Spiel gerne aus?
–Was fasziniert/motiviert dich im Spiel?
–Welche Spielsituationen empfindest du als eine Herausforderung?
–In welchen Spiel-Situationen fühlst du dich gut/schlecht (genaue Beschreibung)? Was unternimmst du dann?
–Haben sich deine Vorlieben/Gewohnheiten im Laufe der Zeit verändert? Wenn ja: Wie?
–...
Fragen zur Sensomotorik(Hand-Auge-Koordination, Reaktionsgeschwindigkeit, ...)
–Wie schnell ist deine Reaktion in digitalen Spielen? Wie würdest du deine Reaktion im Alltag bewerten?
–Wie lange musst du überlegen, was du am Controller/auf der Tastatur machen musst?
–...
Fragen zur realen Berufswelt(Die Antworten zu diesen Fragen können erst nach Tagen bewusst werden!)
–Siehst du Gemeinsamkeiten zwischen Spielen und Arbeitswelt? Wenn ja: welche?
–Sind dir Berufe bekannt, wo du Fähigkeiten, die du beim Spielen anwendest, auch beruflich einsetzen könntest?
–Was würde dich motivieren, wenn deine Arbeit ein Computerspiel wäre?
–Gibt es in Computerspielen Situationen, in den du anders reagierst und handelst als in der Realität?
–...
1.2.9. Fazit
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Berufsorientierungs- und Arbeitsintegrationsprojekten stehen nicht selten vor der Herausforderung, Motivationstiefs zu überwinden sowie Zuversicht und Vertrauen in die eigenen Kompetenzen zu finden. Sowohl analoge als auch digitale Spiele können eine freudvolle Unterstützung zu herkömmlichen Methoden der Potentialanalyse in der Berufsorientierung bieten. Die Generierung von Schlüsselkompetenzen anhand der digitalen Spielerfahrung bei einer digitalaffinen Zielgruppe stellt eine innovative und ergänzende Methode zur Kompetenzbewusstmachung in der beruflichen Orientierung dar.
Literatur
Bartle, R. (1999). Hearts, Clubs, Diamonds, Spades: Players who suit Muds. Abgerufen am 3. März 2015 von:http://www.mud.co.uk/richard/hcds.htm.
Computer Projekt Köln e. V. (2015). Beurteilungen. Abgerufen am 26. Jänner 2016 von http://www.spieleratgebernrw.de/Beurteilungen.3.de.html.
Education Group (2015). 4.Oö Jugend-Medien-Studie 2015. Abgerufen am 25. Jänner vonhttps://www.edugroup.at/fileadmin/DAM/Innovation/Forschung/Dateien/Charts_Jugendliche_2015.pdf
Fritz, J. (2005). Wie virtuelle Welten wirken. Abgerufen am 20. Jänner 2016 von http://www.bpd.de/gesellschaft/medien/computerspiele/63699/wie-virtuelle-welten-wirken?p=all.
Fritz, J., Lambert, C., Schmidt, J.-H., & Witting, T. (2011). Kompetenzen und exzessive Nutzung bei Computerspielern: Gefordert, gefördert, gefährdet. LfM (Hrsg.). Berlin: Vistas.
Gebel, C., Gurt, M., & Wagner, U. (2005). Kompetenzförderliche Potenziale populärer Computerspiele. In Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Weiterbildung (Hrsg.), E-Lernen: Hybride Lernformen, Online-Communities, Spiele. Quem-Report, Heft 92. Berlin. S. 241-376.
Gee, J. P. (2007). What video games have to teach us about learning and literacy. New York: Palgrave Macmillan.
Gnahs, D. (2010). Kompetenzen-Erwerb, Erfassung, Instrumente. Bielefeld: Bertelsmann Verlag.
Hirschbichler, B., & Knittler, K. (2010). Eintritt junger Menschen in den Arbeitsmarkt. Wien: Kommissionsverlag.
Jung, E., & Oesterle, A. (2010). Beruflich-orientierte Selbstkonzepte und Kompetenzerwerb am Übergang Bildungs-/Ausbildungssystem. In U. Sauer-Schiffer, & T. Brüggemann (Hrsg.), Der Übergang Schule – Beruf. Beratung als pädagogische Intervention (Bd. 3). Münster: Waxmann
Medienpädagogischer Forschungsverband Südwest (2015). JIM-Studie 2015. Jugend, Information (Multi-) Media. Basisstudie zum Medienumgang 12-bis 19-Jähriger in Deutschland 2015. Abgerufen am 20. Jänner 2016 von http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf15/JIM_2015.pdf
OECD (2005). Definition und Auswahl von Schlüsselkompetenzen. Abgerufen am 25. Jänner 2016 vonhttp://www.oecd.org/pisa/35693281.pdf.
OECD (2015). Was ist Pisa?. Abgerufen am 25. Jänner 2016 vonhttp://www.oecd.org/berlin/themen/pisa-internationaleschulleistungsstudiederoecd.html.
PEGI (2015). PEGI – Pan European Game Information. Abgerufen am 20. Jänner 2016 von http://www.pegi.info/at/index/id/607.
USK (2011). Grundsätze der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Abgerufen am 20. Jänner 2016 von http://www.usk.defileadmin/documents/Publisher_Bereich/USK_Grunds aetze_2011.pdf.
Yee, N. (2007). Motivations of Play in Online Games. Journal of Cyber Psychology and Behavior. Vol. 9, Nr. 6, S. 772-775.
1.3.Beyond Yarn-Balls & Sequeaking Bones
Inviting animals as co-players and co-designers
Katharina Gollonitsch / Michelle Westerlaken
1.3.1. Abstract
In this article we elaborate on the emerging potential for the inclusion of animals as co-players (designing for) and co-designers (designing with) and suggest that these new practices may contribute to a more inclusive way of addressing and discussing the lives of nonhuman beings that we share our planet with. Our aim is to argue how play and playful design are suitable contexts for the design and development of technologies and practices that allow animals to join the human-animal interaction on their own terms and outline the challenges and questions that this topic might raise. By presenting recent examples within the field of game/play design that include animals, we hope to inspire the reader and open up for new ways of thinking and acting within the field of playful technologically mediated interactions and artefact development with animals. Additionally, we suggest how a more inclusive design approach opens up possibilities for rethinking human-animal relationships and move towards including animals in participatory design processes in an ethically appropriate manner.
1.3.2. Introduction