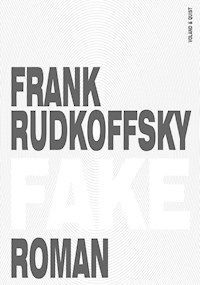Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Voland & Quist
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eigentlich zählte sich Malte immer zu den Guten. Nun aber hat sich der Familienvater selbst ins Exil verbannt und versteckt sich ausgerechnet an dem Ort, den er am meisten verachtet: im verwahrlosten Kleingarten seines eigenen Vaters. Der Job als Journalist hat ihn ausgebrannt, die Ehe steckt in einer Krise und sein Sohn schimpft ihn bloß noch einen Heuchler. Noch schwerer wiegt jedoch etwas anderes: Um sich vor der Verantwortung für seinen cholerischen, demenzkranken Vater zu drücken, hat Malte sich auf einen fragwürdigen Deal eingelassen – mit katastrophalen Folgen. Ein Roman über das durchsickernde Gift toxischer Männlichkeit von einer Generation zur nächsten und einen Mann, der erst unter Schmerzen lernen muss, was es heißt, wirklich Verantwortung zu übernehmen – als Vater, als Partner, als Sohn.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frank Rudkoffsky, geboren 1980 in Nordenham, lebt als Autor, freier Journalist und Literaturvermittler in Stuttgart. Sein zweiter Roman »Fake« (Voland & Quist) war 2019 für den Hotlist-Preis nominiert und wurde vom Land Baden-Württemberg 2021 durch ein Jahresstipendium für Literatur ausgezeichnet. Für »Mittnachtstraße« erhielt er ein Stipendium vom Förderkreis Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Auf seinem Blog www.rudkoffsky.com schreibt er über Gegenwartsliteratur.
Einige zentrale Schauplätze dieses Romans sind real oder an reale Orte in Stuttgart angelehnt. Mit Ausnahme der ganz und gar unwahrscheinlichen Episoden über den Nachbarsvogel und die Schnecke in der Muschel sind sämtliche Figuren und Ereignisse frei erfunden.
© Verlag Voland & Quist GmbH, Berlin und Dresden 2022
Lektorat: Hanne Reinhardt
Korrektorat: Kristina Wengorz
Umschlaggestaltung und Satz: HawaiiF3
Satz: Fred Uhde
ISBN 978-3-86391-336-6
eISBN 978-3-86391-355-7
www.voland-quist.de
Für meine Töchter
Inhalt
Mittwoch
1 Exil
2 Blockade
3 Der Makel
4 Sohnemann
5 Neues aus dem Ministerium
Donnerstag
6 Einfach weg
7 Happy Hypoxia
8 Caro
9 Der Knacks
10 Gleisbett
11 Du bist anerkannt
12 Monster
13 Denkmäler
Freitag
14 OK Doomer
15 Lektionen
16 Wiedergänger
17 Muscheln
Samstag
18 This is fine
Dank
Mittwoch
1Exil
Mit sieben passten seine Beine noch quer unter den Tisch, und er konnte gerade so aufrecht sitzen, es war zwar höllisch unbequem, aber immerhin ein sicheres Versteck. Draußen herrschten gut dreißig Grad im Schatten, und die Hitze staute sich im Inneren wie heute der Qualm, niemand wäre freiwillig hier reingekommen, und wenn, dann nur, um sich ein Bier zu holen.
Jetzt wuchert längst Schimmel in den leeren Flaschen, in einer klebt eine tote Spinne mit den Beinen im Pilz, und Malte denkt an die Eislaternen mit gefrorenen Blüten, die Nathalie im Winter mit den Kindern gemacht hat. Das ist sechs gärende Monate her. Jetzt ist Sommer, und anstatt bei ihnen zu sein, schwitzt er neben Schimmellaternen mit angezogenen, brennenden Knien im toten Winkel einer Gartenlaube und hofft wie damals, nicht entdeckt zu werden.
Als Erstklässler konnte er die Uhr noch nicht lesen, gefühlt versteckte er sich für Stunden unter dem Tisch, mindestens eine Reise zu Sendaks Wilden Kerlen und wieder zurück. Zurück zu den echten Monstern, die überall nach ihm suchten, nur nicht hier, am wahrscheinlichsten Ort von allen.
Eines von ihnen schleicht nun schon seit Minuten um die Hütte herum, vielleicht prüft es gerade mit strengem Blick den Heckenwuchs, schnuppert an den Hortensien, nascht mit seinen wulstigen Lippen direkt von einer Rebe. Dabei war sich Malte sicher gewesen, dass Heinz heute nicht hier sein würde. Immer wieder bricht sein Husten in das Summen, das Malte schon seit Tagen in den Wahnsinn treibt, ohne dass er bislang ein Wespennest gefunden hätte. Die Schritte kommen näher, schweres Schuhwerk auf Holz, dann ein Schatten. Heinz späht durch das einzige Fenster und verdunkelt damit den Raum, allein sein Wanst reicht für eine spontane Sonnenfinsternis. Ein kurzes Flackern, als er sich die Handkante an die Stirn legt, dann humpelt er davon, und über Malte schwirrt wieder der Staub von Jahrzehnten im gleißenden Licht.
Er holt tief Luft und spürt ein Stechen in der Brust, wartet vorsichtshalber lieber noch ab. Zwei der Flaschen neben ihm sind ungeöffnet und seit September 2018 abgelaufen, fast zwei Jahre schon. Malte macht eine auf, das warme Bier schmeckt abgestanden und hefig, trotzdem setzt er noch ein zweites Mal an und trinkt das erste Drittel, ohne abzusetzen, schaut dabei aufs Handy. Er sollte Nathalie endlich antworten: dass er auf dem Heimweg selbstverständlich kurz Feuchttücher kaufen könne. Und dass es heute vielleicht etwas später im Büro werde. Ganz automatisch geht sein Blick zum MacBook, es steht aufgeklappt zwischen ausgeblichenen VfB- und Ferrari-Wimpeln auf dem Klapptisch und überführt ihn mit seinem leuchtenden Apfel nicht nur als Poser, sondern auch als Lügner.
Das Geräusch des hüftsteifen Gangs lässt nicht lange auf sich warten, nur hört Malte es viel zu spät – und dann schon das Schloss. Natürlich hat Heinz einen Zweitschlüssel. Um sich die Blamage zu ersparen, will Malte noch schnell unterm Tisch hervorkraxeln, stößt sich dabei aber den Kopf am Metallscharnier. Der Schmerz ist so heftig, dass seine Hand sofort an die Stirn schießt und er den alten Mann nur mit einem Auge hereinkommen sieht. Fast wie damals streckt Heinz seinen Arm zu ihm aus, nur aufstehen lässt er Malte diesmal aus eigener Kraft. Wenn er wollte, könnte Heinz es sicher noch immer; seine Oberarme sehen aus wie aus der Lederweste geplatzt.
»Schlimm?«
Malte sieht auf seine Hand, die er sich eben noch gegen die Schramme gepresst hat, und zerreibt etwas Blut zwischen den Fingern. »Geht schon.«
Heinz reicht ihm ein Taschentuch und kramt in einer Schublade der Küchenzeile herum, findet aber nur akkurat zusammengefaltete Lappen und Geschirrtücher, die er achtlos zurück ins Fach stopft. »Irgendwo hat Walter bestimmt Pflaster und was zum Desinfizieren hier«, murmelt er mehr zu sich selbst als zu Malte und macht sich gleich über die nächste Schublade her.
»Lass gut sein.« Malte hält sich das Bier an den Kopf, als wäre es kalt. Er deutet auf die Flasche: »Ich bin medizinisch bestens versorgt.«
Heinz lacht kurz auf, künstlich zwar, aber durchaus anerkennend. »Erst ein paar Tage hier, und schon sprichste unsere Sprache.«
Er nimmt sich das andere Bier, öffnet es an seinem Schlüsselbund und setzt sich ungefragt an den Klapptisch. Auch das eine klare Sprache: Das hier ist sein Revier, nicht Maltes. Er schiebt den Tisch etwas nach vorn, um mehr Platz für sich zu schaffen, kneift die Augen zusammen und schaut unverhohlen auf den Bildschirm des Computers.
»Was haste da unterm Tisch überhaupt gemacht?«
Die Gartenlaube ist nur wenige Quadratmeter groß, trotzdem hat Malte das Gefühl, einen riesigen Satz machen zu müssen, um das MacBook vom Tisch zu nehmen und es zusammenzuklappen. Weil sich seine Hände wieder flattrig anfühlen, presst er die Finger fest ans Metallgehäuse.
»Ach, es ist dieses Wespennest«, sagt er bemüht beiläufig. »Ich find’s einfach nicht.«
Heinz legt den Kopf in seinen fleischigen Nacken, die Haare im Schweiß, und formt mit der Hand eine Muschel am Ohr. »Hm, hör nix. Aber vielleicht sind deine Ohren besser als meine«, sagt er grinsend. Dann nimmt er wieder einen Schluck Bier und schaut sich in der Hütte um, als würde er hier nicht schon seit Jahrzehnten ein und aus gehen.
Malte lehnt mit dem Rücken am Türrahmen und lächelt gezwungen, er muss wortwörtlich die Zähne zusammenbeißen, um freundlich zu bleiben. Schon ist alles wieder da: der Druck auf seiner Brust. Die Enge. Vor allem aber das Gift. Es wird Stunden dauern, bis es abgebaut ist und er wieder klar denken kann. Er fixiert ein Astloch in ein Wandpaneel, bis ihm die Augen brennen, und schweigt. Er will nicht mit ihm reden. Weder übers Wetter noch über Schädlinge und Nützlinge im Kleingarten oder die guten alten Zeiten. Und schon gar nicht über letzten Donnerstag. Sieht Heinz in seine Richtung, schaut Malte auf sein Handy, an seinem Bier nippt er immer erst dann, wenn Heinz seines gerade abgestellt hat. Dabei weiß Malte es längst: Ihr Schweigen ist eine Machtprobe, die er nur verlieren kann. Heinz wird erst gehen, wenn er das will. Vor allem bedeutet ihr Schweigen aber, ohne Ablenkung das ständige Summen ertragen zu müssen – wie das Sirren eines Zahnarztbohrers mit nur halber Umdrehungszahl. Damit es auch wirklich quält.
Von wegen Ruheoase, wie es auf dem Schild am Eingang heißt. Wirklich leise ist es im Kleingartenverein Weichenherz nie. Auf dem Kiesweg läuft gerade jemand pfeifend mit einer Schubkarre vorbei, weiter hinten plätschert es aus einem Gartenschlauch, während nebenan zwei alte Frauen in breitestem Schwäbisch miteinander schwätzen und in einer anderen Parzelle nach mehreren Versuchen ein Rasenmäher angeworfen wird, weil ja immer einer irgendwo mähen muss. Und die Vögel haben um diese Uhrzeit sowieso nicht alle Tassen im Schrank, findet Malte – ganz besonders die Papageien, die sich hier angesiedelt haben und damit genauso fehl am Platz sind wie er.
»Wolltest du eigentlich was Bestimmtes?«, fragt er schließlich und ist danach so erleichtert, als hätte er zu lange die Luft angehalten und nun wieder geatmet.
Endlich steht Heinz auf. Er stützt sich auf die Tischkante, schiebt sich hoch und geht schwerfällig zur Tür, bleibt dort viel zu dicht an Malte stehen.
»Hab mir Sorgen gemacht. Du wirktest ein bisschen durch den Wind die letzten Tage.«
»Ich bin okay.«
»Hier bei uns passt man aufeinander auf.« Heinz lächelt und legt seine große Hand auf Maltes Schulter, sachte nur, ganz ohne Druck. »Find ich übrigens gut, dass du vor der Abstimmung am Samstag ein bisschen Präsenz zeigst. Dein Vater kann stolz auf dich sein. Und wer weiß, vielleicht wird ja noch ’n richtiger Gärtner aus dir!« Heinz lacht laut und jovial, genau wie früher auf Familienfesten, wenn er betrunken den Scherzbold gab und Malte mit billigen Taschenspielertricks beeindruckte.
Malte spielt das Spiel mit. »Mit diesen Händen?«, fragt er ironisch und zeigt seine sauberen, hornhautlosen Finger vor: Schreibtischtäterhände.
»Wenn du erst auf den Geschmack kommst, wirste dir die hier schon noch schmutzig machen, wart’s ab.«
Heinz macht sich auf den Weg zurück in die Kommandozentrale, wie er seine Laube halb im Scherz nennt, dreht sich nach einigen Metern aber noch einmal um. »In ner Stunde fahre ich zum Krankenhaus. Komm vorbei, wenn du mitwillst.«
»Ich schaff’s erst heute Abend«, lügt Malte und krallt seine Finger um den Flaschenhals. »Du weißt ja, die Wespen.«
Heinz klopft sich an den Schädel und grinst: »Du musst nach Hohlräumen suchen.«
Malte sieht ihm nach, sein Gang ist unrund und abgehackt wie in einem Zeichentrickfilm mit zu wenigen Zwischenbildern. Fast hat er Mitleid mit Heinz. Die Zeit und seine Hüfte haben es nicht gut mit ihm gemeint. Im Lexikon seiner Erinnerungen ist Heinz noch immer als echtes Mannsbild verzeichnet, so jedenfalls sprachen andere über ihn, besonders sein Vater. Früher konnte er mit seinem Selbstbewusstsein und der bulligen Statur jeden Raum für sich einnehmen, jetzt ist er fett und bewegt sich steif wie eine ausgemusterte Actionfigur mit Sand in den Gelenken.
An Bedrohlichkeit hat er für Malte trotzdem nichts eingebüßt, dafür ist seine Erinnerung an diesen Nachmittag im Sommer 1986 noch viel zu plastisch. Die Erinnerung an die schiere Kraft, mit der Heinz ihn mit nur einem Arm unter dem Tisch hervorzerrte und nach draußen in den Garten schleifte, um ihn dort seinem Richter vorzuführen. An die Ohrfeige, die ihm sein angetrunkener Vater vor allen gab. Niemand von ihnen schritt ein, natürlich nicht. Es ging sie nichts an. Und sein Vater hatte ja auch jedes Recht, wütend auf ihn zu sein: Malte war heimlich in sein Paradies eingedrungen, das eben nur deshalb ein Paradies war, weil er darin nichts zu suchen hatte. Jedes verdammte Wochenende und mindestens jeden zweiten Abend verbrachte sein Vater allein im Schrebergarten, er braucht eben die Erholung, erklärte Maltes Mutter stets und ließ dabei offen, ob von der Arbeit oder seiner Familie. Die Ohrfeige war ein hoher Preis dafür, um ihn – wenn auch nur aus der Ferne – wenigstens einmal ausgelassen und glücklich zu sehen.
Als Heinz um die Ecke gebogen ist, geht Malte wieder hinein und macht sich selbst auf die Suche nach einem Pflaster. In den Schubladen findet er nichts außer Besteck, Samentüten oder Gartenwerkzeug, im Eckschrank erwartungsgemäß nur Aktenordner mit alten Sitzungsprotokollen. Überraschend ist dagegen, was Malte an der Innenseite der Schranktür entdeckt. Neben zwei Postkarten aus Griechenland klebt ein Bild, das er seinem Vater als Kind gemalt hat. Hepi Ent heißt es oben in Großbuchstaben, darunter stehen Luke Skywalker und ein Darth Vader ohne Maske, lächelnd und Hand in Hand, auf einer Wiese.
Malte muss erst lachen, kann sich dann aber nicht gegen die Tränen wehren, als er sich seinen Vater am Beatmungsgerät vorstellt. Plötzlich wird es ihm zu stickig in der Laube. Draußen zündet er sich eine Zigarette an. Er nimmt drei, vier tiefe Züge, bis ihm schwindelig wird, und setzt sich auf die Bank, starrt auf die Hand, mit der er die Zigarette hält. Schlagartig wird er sich seiner eigenen Armseligkeit bewusst. Wie lächerlich er doch ist: ein Zweiundvierzigjähriger, der sich unterm Tisch vor einem alten Mann versteckt, den er schon so lange kennt, dass er ihn als Kind Onkel nannte. Ein Familienvater, der vor lauter Scham seine Frau und seine Kinder belügt und sich ihnen heimlich entzieht. Ein Feigling, der sich lieber selbst cancelt, bevor es andere für ihn tun und er sich vor ihnen verantworten müsste. Auf Twitter hätten sie ihre helle Freude daran, über ihn zu richten, wie er hier im spießigen Kleingarten seines Vaters sitzt: ein fragiler und offensichtlich frühverboomerter, privilegierter weißer Cishet Dude mit Peak Male Tears im Gesicht, der all diese Ausdrücke kennt und für wichtig hält und sich allein deshalb immer zu den Guten gezählt hat. Dabei ist er nichts weiter als eine traurige, enttäuschende Figur – wie der späte Luke Skywalker im Exil. Wie der Held seiner Kindheit trägt Malte nur einen Handschuh, schwarz, aus Leder, wie er will auch Malte damit nur verbergen, dass er im Kern kaum besser ist als sein Vater, der zwar kein Cyborg, aber dafür starker Raucher ist. Niemand soll wissen, dass auch Malte seit Tagen heimlich in der Parzelle raucht. Das Gesicht kann man waschen, aber den Gestank an den Händen wird man nicht los, egal, wie lange man schrubbt. Darum der Handschuh. Darum auch die Kaugummis gegen den Mundgeruch, der zu weite Overall aus der Laube.
Am Abend wird Malte Nathalie wieder von seinem Arbeitstag erzählen, und sie wird ihn nicht infrage stellen, schließlich hört sie ohnehin nur noch mit halbem Ohr zu – und zwar zu Recht. Auch deshalb wird er morgen wiederkommen. Diese Parzelle ist sein Exil: Hier kann er keinen weiteren Schaden anrichten, in sicherer Quarantäne mit all den toxischen alten weißen Männern, denen er sich bis vor Kurzem noch moralisch so überlegen fühlte. Dabei ist er, wie Malte jetzt weiß, kaum besser als sie. In Wahrheit ist er längst zu demjenigen geworden, der er nie sein wollte. Zu dem Mann, dessen Platz er nun einnimmt, weil er es ihm verdammt noch mal schuldig ist.
2Blockade
Würde er Nathalie fragen, wann die Dinge bei ihm aus dem Lot geraten sind, würde sie wohl einen deutlich früheren Zeitpunkt nennen, vielleicht würde sie auch von einem schleichenden Prozess sprechen, von kleinen Ausbrüchen und frühen Symptomen, von gutmütig oder gar fahrlässig übersehenen Warnzeichen. Jedenfalls würde sie nicht den 17. Februar nennen, warum auch? Nur Malte weiß, was für eine Lawine dieser Tag in ihm ausgelöst hat. Dabei waren da zunächst bloß der Ärger über eine blockierte Ausfahrt und sein Versuch, gelassen zu bleiben.
Denn das hatte er Nathalie versprochen: dass er sich in Zukunft zusammenreißen, nicht immer gleich an die Decke gehen würde. Gründe dafür hätte es an diesem Morgen genug gegeben, und es waren dieselben wie immer. Ein Teenager, der nicht aus dem Bett wollte, und ein Kleinkind, das sich erst nach mehreren Wutanfällen wickeln und anziehen ließ, Streit über verbrannte Brötchen und darüber, wer diesmal den Autoschlüssel verlegt hatte – und überhaupt: Wieso auf jede Kritik automatisch ein Gegenvorwurf folgen musste und warum sie alle nicht verdammt noch mal früher aufstünden, wenn morgens immer so viel Zeitdruck herrschte. Malte hatte das alles stoisch ausgehalten. Diesmal hatte er die Fassung bewahrt. Weder hatte er jemanden angeschrien noch Türen geknallt, und obwohl Jonas zu spät zur Klassenarbeit, Nora zu spät zum Morgenkreis und er selbst zu spät zu einem Pressetermin zu kommen drohten, hatte Malte noch nicht einmal beim Kratzen der vereisten Autoscheiben geflucht.
Nur: Wenn er jetzt hupte, war das alles nichts mehr wert. Dann hatte er es sprichwörtlich auf den letzten Metern verkackt. Leicht fiel ihm das nicht. Schon seit Minuten stand er mit laufendem Motor in der blockierten Ausfahrt und wartete darauf, dass sich die Situation von selbst löste, dass jemand angerannt käme, mit entschuldigender Geste in den alten Volvo stiege und die Gasse wieder frei machte. Trotz Stuttgarter Kennzeichen gehörte der Wagen offenbar niemandem aus der Nachbarschaft, der Neuschnee auf dem Dach war letzte Nacht nur außerhalb des Talkessels liegen geblieben. Um zu wissen, dass man nicht mitten in einer Gasse parkte, musste man allerdings auch nicht von hier sein, sondern nur einigermaßen bei Verstand. Oder kein Arschloch.
Malte bohrte seine Nägel ins Lenkrad und holte tief Luft, sah zu, wie sie beim Ausatmen kondensierte und die Fenster weiter beschlagen ließ. Parallel zur Feuchtigkeit staute sich auch die Lautstärke im Auto. Auf der Rückbank zickten Jonas und Nora einander an und bildeten mit ihrem Gekeife einen harten Kontrast zu dem aufgekratzten Frühstücksradiosprech aus den Boxen, den Malte irgendwann leiser drehte, ohne dass es ihn erleichterte. Am nervigsten war ohnehin das Gebläse der Lüftung, ohrenbetäubend laut, als wäre es im Panikmodus wie ein überschießendes Immunsystem.
Mit derselben Intensität rauschten längst auch wieder die Stresshormone durch Malte; wie so oft in den letzten Monaten vergifteten sie plötzlich seine Gedanken und verengten seinen Blick, drohten ihm die Kontrolle zu entreißen. Er atmete tief ein und stieß auf einen Widerstand in seiner Brust, fast wie eine imaginäre Delle. Normalerweise hätte er jetzt einen Schrei fahren lassen, gegen das Lenkrad gehämmert, etwas durchs Auto gepfeffert – ganz gleich, ob seine Kinder auf der Rückbank saßen oder nicht. Und das war ja das eigentliche Problem: Die Wut verschwand meist schon nach Minuten. Die Scham aber blieb für Stunden.
»Jetzt hup doch endlich mal«, forderte Jonas und beugte sich vor. Die Protestnote seiner Schwester ignorierend, dass er ihr den Blick versperrte, quetschte er sich mit der Schulter voran zwischen die Vordersitze und versuchte, mit der Hand ans Lenkrad zu kommen. »Soll ich?«
»Lass es bitte. Der fährt bestimmt gleich weg.«
Jonas ließ sich in seinen Sitz zurückfallen und erwiderte mit gespielter Resignation: »Du bist der Boss.«
»Ich bin der Boss.«
»Du weißt schon, dass ich zu spät komme, Boss?«
Malte antwortete nicht, sondern fuhr bis auf einen Meter an das abgestellte Auto heran, als würde das irgendetwas bringen. Viel lieber hätte er seinen Motor einmal laut aufheulen lassen oder – besser noch – diesen beschissenen Volvo aus dieser beschissenen Gasse gerammt, mitten auf die Straße und in den Kreuzungsverkehr, in die Massenkarambolage hinein.
Stattdessen holte Malte Nathalies Kaubonbons aus der Jackentasche. Bei Ärger helfe es ihr manchmal, etwas kräftig zu zerbeißen, hatte sie ihm geraten – aber weil Nathalies Ärger nie so groß war wie seiner, nahm er lieber gleich drei Stück auf einmal und bereute das sofort, der zähe Klumpen verklebte seine Zähne und ermüdete den Kiefer, ließ sich, groß, wie er war, aber genauso wenig herunterschlucken wie seine Wut.
Jonas schnallte sich ab. »Ich glaub, ich laufe lieber.«
»Bleib sitzen«, befahl Malte mit vollem Mund und halbierter Autorität. »Dafür bist du viel zu spät dran. Nächstes Mal stehst du vielleicht einfach früher auf!«
»Was isst Papa da?«, warf Nora ein, bekam von Jonas aber keine Antwort, weil der viel zu sehr damit beschäftigt war, vierzehn zu sein.
»Dann gehe ich eben schneller. Oder renne. Alles besser, als vor den anderen aus dieser Dreckschleuder zu steigen.«
Jonas war seit Wochen sauer darüber, dass Malte sich gegen seinen Wunsch sträubte, ihn dreihundert Meter vor dem Schulgebäude abzusetzen oder aufzulesen – aus Scham darüber, dass sie neuerdings ein so großes Auto fuhren. Deshalb auch der Rücksitz. Malte dagegen war sauer über den FCK-SUV-Sticker mitten auf der Windschutzscheibe, den er – auf der Motorhaube kniend – fast eine Stunde lang abzukratzen versucht hatte und dessen Rückstände noch immer am Glas klebten. Natürlich wollte Jonas mit der Sache nichts zu tun gehabt haben.
»Wie oft soll ich es dir noch sagen? Es. Ist. Ein. Hybrid.«
Jonas hustete das Wort »Heuchler« in seine Hand und warf Malte beim Blickkontakt im Rückspiegel ein neunmalkluges Grinsen zu.
Sein Sohn hatte Haltung und Mut, das mochte Malte an ihm; er selbst hatte es als Jugendlicher nie gewagt, so offen zu rebellieren. Trotzdem zog sich sein Magen zusammen, wenn er an die Diskussionen über den Sommer dachte. Nach der missratenen Reise im letzten Jahr war er so urlaubsbedürftig wie nie, Jonas aber weigerte sich beharrlich, je wieder in ein Flugzeug zu steigen. Am meisten ärgerte ihn daran, dass sein Sohn ja eigentlich recht hatte. Malte hatte damals als einer der ersten über Fridays for Future in Stuttgart berichtet, hatte Jonas nicht nur zum Demonstrieren ermutigt und begleitet, sondern ihm auch Entschuldigungen fürs Schulschwänzen geschrieben. Nun wünschte er sich allerdings manchmal den dreizehnjährigen Jonas zurück, der sich vom Thailandurlaub noch beeindrucken ließ und den Malte – nicht ohne heimlichen Stolz – für die prahlerischen Selfies vom Strand rügen musste, die er ständig bei Instagram postete. Den Jonas, den er noch väterlich über die Probleme dieser Welt aufklären durfte, anstatt sich nun selbst andauernd belehren lassen zu müssen. Der alte Jonas hatte zu ihm aufgesehen, der neue fand sich dagegen besonders clever und lustig, wenn er seine kleine Schwester darauf dressierte, ihren Vater bei jeder Gelegenheit einen Mansplainer zu nennen: Nora, wenn du dich nicht wickeln lässt, kriegst du einen wunden Po. – Papa, du bist ein Mansplainer! – Du sollst deine Popel nicht essen. – Mansplainer, Mansplainer!
»Mach wenigstens den Motor aus, solange wir stehen.«
»Dann geht die Heizung nicht.«
»Wir werden schon nicht erfrieren – der fährt ja auch bestimmt gleich weg«, äffte Jonas ihn nach.
Jetzt schaltete sich auch Nora empört ein: »Aber mir ist kalt! Und ich will auch so ein Bonbon!«
»Die kannst du noch nicht essen.«
»Das ist gemein!«
»Wenn du den Motor nicht ausmachst, steig ich aus.«
Malte gab auf und drehte den Zündschlüssel um.
Nora schrie sofort los: »Jonas ist so eine Scheißnase!«
»Sag so was nicht zu deinem Bruder.«
»Aber mir ist kalt!«
»Ey, Nora, du hast nen Schneeanzug und Fäustlinge an, du kannst gar nicht frieren.«
Eine »Scheißnase« kriegte Nora noch heraus, dann rief sie nach ihrer Mama und begann zu brüllen, so laut sie konnte.
Malte versuchte erneut, tief durchzuatmen, aber der Widerstand in seinem Brustkorb war sogar noch größer geworden. Der Druck war kaum auszuhalten. Einen Augenblick lang stellte er sich vor, dass das ganze Auto von Wasser umgeben war und immer schneller in die Tiefe sank, stellte sich vor, er müsste seine Beine mit aller Kraft gegen die Windschutzscheibe stemmen, um sie zum Bersten zu bringen. Fast genauso viel Kraft kostete es ihn, jetzt einfach auszusteigen, um sich und den Kindern in letzter Sekunde einen Wutausbruch zu ersparen.
»Beruhig du bitte deine Schwester«, sagte er mit gepresster Stimme zu Jonas. »Ich gehe mal nachsehen, wem das Auto gehört.«
Als er ausstieg, brauchte Malte noch einen Moment, bevor er gehen konnte, die Knie waren weich und alle seine Nerven alarmiert – eigentlich müsste er jetzt rennen, sagte ihm sein Körper, ganz von dem Urinstinkt getrieben, nicht vom nächstbesten Säbelzahntiger gefressen zu werden. Aber was wusste sein dummer, atavistischer Körper schon von der Uhr, die einem ständig im Nacken saß, egal, wie schnell man rannte? Scheiß auf Säbelzahntiger, dachte Malte: Für den modernen, vom permanenten Termindruck geplagten Menschen war manchmal schon ein Falschparker der Endgegner.
Er legte eine Hand auf die Motorhaube des Volvos. Sie war noch warm, lange konnte er hier angesichts der Kälte noch nicht stehen. Der Wagen war ein Diesel älterer Bauart und hätte eigentlich gar nicht in den Bannkreis der Stuttgarter Innenstadtbezirke einfahren dürfen. Hinter der Windschutzscheibe lag natürlich kein Zettel mit Telefonnummer, das wäre ja auch zu einfach gewesen; stattdessen entdeckte Malte auf dem Beifahrersitz eine halb volle Schachtel Zigaretten und einen ausgeblichenen, an den Faltstellen bereits rissigen Stadtplan von Stuttgart. Kein Kindersitz auf der Rückbank, dafür aber eine Ausgabe der BILD und leere Flaschen im Fußraum, einmal Wasser und zweimal Bier, das billige von Lidl in Plastik. Ein Familienauto war das nicht, sicher auch nicht das einer Frau. Malte ahnte, wie es darin roch, eine Mischung aus kaltem Rauch, Rasierwasser und Wunderbaum, und er ahnte auch, dass er sich zusammenreißen müsste, wenn der Fahrer zurückkam – mit solchen eskalierte das schnell.
Aber er konnte das. Wenn dieser Morgen aus der Hölle kein Beweis dafür war, dass Malte die Ruhe bewahren konnte, was dann? Er widerstand dem Reflex, auf die Uhr zu schauen, und fixierte stattdessen einen losen Backstein an der Hauswand zu seiner Rechten, spürte, wie seine Gelassenheit zurückkehrte und er langsam wieder atmen, wieder klar denken konnte.
Scheiß auf Säbelzahntiger. Scheiß auf die Uhr im Nacken! Dann schaffte er es eben nicht zur Pressekonferenz, na und? Die wichtigsten Infos bekam er sowieso per Mail, und am Telefon nachhaken konnte er immer. Dass Nora ihren Morgenkreis verpasste, kam dank ihrer Trotzanfälle ohnehin zweimal pro Woche vor. Und Jonas hatte natürlich recht: Wenn er jetzt loslief, verpasste er vielleicht die ersten Minuten seiner Klassenarbeit, aber in Mathe machte ihm eh keiner was vor. Malte war stolz auf sich, fast ärgerte es ihn sogar, dass Nathalie nicht dabei war, um Zeugin seiner geradezu übermenschlichen, weil instinktüberwindenden Selbstbeherrschung zu sein.
Die innere Ruhe, die er gefunden hatte, war so tief, dass ihn der extreme Lärm hinter seinem Rücken umso gewaltsamer wieder herausriss. Malte schreckte zusammen und machte aus Reflex einen Satz zur Seite, dabei war es nur Jonas als Nachwuchscholeriker an der Hupe. Einmal lang und zweimal kurz, dann das Ganze von vorn, immer wieder – ein Wutanfall in ohrenbetäubendem Morsecode und dazwischen eine Sirene aus Kleinkindgeschrei.
Ein Ruck ging durch Maltes Körper, er konnte gar nicht anders, als zu schreien: »Sag mal, spinnst du jetzt völlig? Hör sofort auf mit der Scheiße!«
Aber Jonas konnte oder wollte ihn nicht hören, er machte einfach weiter und ließ Malte keine andere Wahl, als zum Auto zu hechten und die Fahrertür aufzureißen. Er überlegte nicht, was er tat, handelte nur noch aus Impuls, als er seinen Sohn am Arm packte und aus dem Wagen zerrte.
»Was ist denn hier los?«, hörte er Nathalie plötzlich rufen, die in Hausschuhen und schnell übergeworfenem Mantel zum Auto eilte und als Erstes die weinende Nora herausholte.
Ehe Malte etwas sagen konnte, preschte Jonas schon mit einer Blitzanalyse vor: »Papa rastet mal wieder aus.«
Malte lachte künstlich auf und drehte sich weg, auf keinen Fall wollte er Nathalie jetzt in die Augen sehen und sich ihrem enttäuschten, urteilenden Blick aussetzen. Aber Jonas hatte ja recht, er rastete wirklich aus: Vor lauter Zorn trat er mit Anlauf gegen das Vorderrad des Volvos, er brauchte einen Blitzableiter, wusste einfach nicht, wohin sonst mit diesem Energieüberschuss, den ihm sein verfluchter, fluchtbereiter Körper aufzwang.
»Hey, was soll das?«
Der alte Mann lief von der Straße in die Gasse herein, hatte es dabei aber nicht besonders eilig. An seinem Auto angekommen, riss er etwas unbeholfen die Zellophanfolie einer Zigarettenschachtel auf, die er offenbar am Automaten auf der gegenüberliegenden Straßenseite gezogen hatte, und steckte sich erst mal eine an.
Malte war fassungslos. Er wusste wirklich nicht, was er sagen sollte. »Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?«, stöhnte er.
Für einige Sekunden sagte niemand etwas, bis Nora, die als Einzige die Situation nicht verstand, schließlich fragte: »Wer ist der Mann, Mama?«
Wieder war es Jonas, der vorpreschte und als Erster auf den Besitzer des Wagens zuging. »Hallo, Opa.«
3Der Makel
Endlich sieht er ihn nicht mehr, den Makel, aber er ist noch immer da, genau dort, wo Malte jetzt die Hacke in den Boden rammt und Wurzel um Wurzel aus der trockenen Erde rupft, ohne bisher wirklich vorangekommen zu sein. Das Unkraut ist einfach überall. Nach nicht einmal einer halben Stunde Jäten ist er bereits erschöpft. Alles brennt, die Knie und die Hände und seine Augen sowieso, immer wieder wischt Malte sich den Schweiß aus dem Gesicht und bekommt ihn trotzdem nicht in andere Bahnen gelenkt, also lässt er ihn einfach laufen, stellt sich vor, der Schweiß könne den verfluchten Makel wie Salzsäure aus seinen Augen ätzen. Mit voller Wucht hackt er die Klinge wieder ins Beet und stößt gegen einen Stein im Untergrund. Seine Hand zuckt nach hinten wie beim Rückstoß nach einem Schuss, doch obwohl ihm der Arm bis zum Ellenbogen schmerzt, macht Malte einfach weiter, ohne System, ohne Rhythmus und ohne seine Kräfte zu schonen. Dennoch ist da keine Katharsis, nur Qual, und überhaupt fragt sich Malte, wie Menschen Gartenarbeit als friedlich empfinden können, wenn sie doch in Wahrheit nichts weiter ist als ein vergeblicher Krieg gegen die Natur, die sich, egal, wie sehr man sich aufreibt, am Ende ja doch durchsetzen wird.
Jahrzehntelang hat sein Vater das kleine Stückle mit einer solchen Akribie und Hingabe gepflegt, dass Malte als Kind geradezu eifersüchtig auf all die Pflanzen war, mit denen er zu konkurrieren glaubte. Zu Hause machte er nie auch nur einen Finger krumm, hier aber konnte er sich den ganzen Tag lang bucklig arbeiten, nur um abends dann, wenn er nicht gerade vollkommen abwesend ein Buch las, wortlos und ausgelaugt mit einem Bier vor dem Fernseher einzuschlafen. Der Garten war die eine Sache in seinem Leben, auf die er wirklich stolz war, die eine Sache, die er tatsächlich unter Kontrolle hatte.
Um zu wissen, wie es ihm in der Zeit, die sie einander nicht gesehen haben, ergangen ist, muss Malte sich nur umschauen: Die Beete sind überwuchert und verwahrlost, die Hecken ausufernd wie eine besonders schlimme Lockdown-Frisur. Während es grün aus allen Fugen des Gehwegs sprießt, gleichen etliche Keramiktöpfe offenen Särgen. Ein postapokalyptisches Idyll mit Gartenzwerg: Der frech zwinkernde Zeuge des Niedergangs ist im Laufe der Jahre immer tiefer im Matsch versunken, nur sein Oberkörper ragt noch schief aus dem Dreck wie eine urdeutsche Sphinx.
***
Trotzdem beteuerte er, als er nach fast zwei Jahren Funkstille unerwartet in Maltes Einfahrt auftauchte, süffisant: »Wie soll’s mir schon gehen? Du weißt doch: Schlechten Menschen geht’s immer gut.«
»Gilt das auch umgekehrt?«, erwiderte Malte gereizt, und damit war fürs Erste alles gesagt.
Weil Nathalie nun selbst die Kinder wegbrachte, blieb ihm jedoch nichts anderes übrig, als seinen Vater hineinzubitten und sich für seine Höflichkeit zu verfluchen: Auch Vampire konnten ein Haus schließlich nur auf Einladung betreten. Viel zu lange hatte er seinem Vater erlaubt, ihm seine Energie zu rauben, diese Tür wollte er ihm nun keinesfalls wieder öffnen.
Auf der Treppe überließ er ihm bewusst den Vortritt. Alt war er geworden, das sah Malte an seinem Gang. Beinahe tastend setzte er einen Fuß vor den anderen und ließ die Hand stets am Geländer, unsicher wie ein Blinder, der nicht wusste, wann die Stufen endeten.
Kaum war er wieder auf sicherem Terrain, kehrte aber sofort die alte Bestimmtheit zurück. Wie selbstverständlich nahm er auf dem Sessel im Wohnzimmer Platz, die Beine breit wie ein Manspreader alter Schule, und klärte Malte ungefragt darüber auf, dass er seinen Kaffee zwar immer noch stark, inzwischen aber mit viel Milch trinke: »Mein Magen macht das sonst nicht mehr mit.«
Malte nahm die Bestellung kommentarlos entgegen, war aber eigentlich dankbar für die Chance, sich ihm zumindest kurz entziehen zu können. Oder lange genug, um spontan zum Barista zu werden: Denn natürlich hätte er auch eine Kapsel nehmen können. War das Wasser erst heiß, brauchte die von Jonas so verhasste, weil alles andere als nachhaltige Maschine gerade mal zwanzig Sekunden für einen Café Crème. Genau das sprach für die Kaffeemühle. Malte drehte so langsam an der Kurbel, dass ihn jeder Widerstand im Mahlwerk Kraft kostete. Kurz weckte das Geräusch der knackenden Bohnen Erinnerungen an sein früheres Zähneknirschen und daran, dass er seine Beißschiene von einem Tag auf den anderen nicht mehr gebraucht hatte, kaum dass er von zu Hause ausgezogen war; ein Grund mehr, seinen Vater nebenan warten zu lassen.
Als Malte erst Minuten später mit dem Kaffee zurück ins Wohnzimmer kam, fühlte er sich auch olfaktorisch in seine Kindheit zurückversetzt. Der kalte Rauch in den Klamotten seines Vaters hatte sich bereits im ganzen Raum verteilt wie ein Klecks Tinte im Wasserglas. Noch ehe er die Tassen abstellte, kippte Malte das Fenster – eine Geste, die er gegenüber willkommeneren Gästen als unhöflich empfunden hätte, die von seinem Vater aber nicht einmal bemerkt wurde.
Der sah sich ein gerahmtes Foto von Jonas an, das er von der Wand genommen hatte, und tippte mit einem Fingernagel aufs Glas. »Groß ist er geworden, der Junge«, stellte er fest. »Wie alt ist er jetzt?«
»Inzwischen ist er vierzehn, und Nora wird im Sommer vier.«
Sein Vater nickte und wirkte einen Moment lang, als versuchte er, sich die Zahlen einzuprägen, dann wechselte er abrupt das Thema und deutete auf die Februar-Ausgabe des Stadtmagazins Zacke auf dem Couchtisch. »Arbeitest du noch für die?«
»Nur manchmal. Ich habe mich vor ein paar Monaten selbstständig gemacht und schreibe jetzt frei.«
»Das ist gut. Da musst du dir nix mehr vorschreiben lassen«, entgegnete er, und Malte war froh, dass er es dabei beließ und nicht wie früher auf die angeblichen Staatsmedien schimpfte.
Stattdessen sah sich der alte Mann weiter im Raum um, krampfhaft auf der Suche nach einem Aufhänger für Gesprächsstoff. Viel zu entdecken gab es allerdings nicht, seit sich Nathalie diesem Minimalismus-Trend verschrieben hatte und Malte sich für jeden zweiten Gegenstand eine persönliche Geschichte einfallen lassen musste, damit sie ihn nicht aussortierte. Immer wieder entdeckte er in der Zu-verschenken-Kiste an der Straße etwas, das er heimlich zurück in die Wohnung schmuggeln musste – zuletzt Filetstücke seiner eingestaubten DVD-Sammlung oder die bunt zusammengewürfelten Kaffeebecher ihrer ersten gemeinsamen Wohnung, aus denen er noch immer lieber trank als aus den teuren Designertassen, die sie ihm zum Geburtstag geschenkt hatte. Die neue Kargheit fiel sogar seinem Vater auf.
»Zieht ihr um?«
»Nathalie mistet alles aus, was wir nicht mehr brauchen.«
»Na, dann pass mal lieber auf, dass du dich hier nützlich genug machst«, sagte sein Vater grinsend und traf damit einen wunden Punkt.
Zwar hatte Malte Nathalie mit seinem Artikel über Menschen, die ihren Besitz auf das Nötigste reduzieren, um ein nachhaltigeres und fokussierteres Leben zu führen, selbst auf das Thema gebracht, doch mittlerweile fürchtete er sich so sehr vor Nathalies Konsequenz beim Ausmisten, dass er es nicht einmal wagte, sich mit ihr das Scheidungsdrama Marriage Story auf Netflix anzuschauen.
Er starrte auf die große weiße Wand über dem Sofa, die nur noch von einer kleinen Hängepflanze geziert wurde, und ignorierte einfach, was sein Vater als Nächstes sagte: »Tja. Wär’s nach Johanna gegangen, hätten wir sicher auch auf solch einer Katalogseite gelebt.«
Wenn es eines gab, über das Malte nicht mit ihm sprechen wollte, dann war das seine Mutter. Bis zum Schluss hatte sie ihre unglückliche Ehe einfach ertragen, ohne je über ihr Leben zu klagen, dabei hatte ihr Maltes Vater sogar im Tod noch die kalte Schulter gezeigt: Auf keinen Fall hatte sich der große Hobbygärtner imstande gesehen, nun auch noch die Pflege für ihr kleines Grab zu übernehmen – und damit endgültig den Bruch mit Malte in Kauf genommen. Obwohl es zwischen ihnen nie den einen großen Streit, sondern immer bloß viele kleine gegeben hatte, war das ihr letzter gewesen. Danach gab es bloß noch pflichtbewusste Telefonate zu Geburts- oder Feiertagen, und zuletzt nicht einmal mehr das. Sie hatten ihre Beziehung einfach ausschleichen lassen wie ein verblassendes Foto.
Nun machte sein Vater jedoch keine Anstalten, sein plötzliches Auftauchen zu begründen, sondern tat stattdessen so, als wäre sein Besuch ein ganz alltäglicher. Als er sich vorbeugte, um Milch nachzugießen, erzählte er im Plauderton: »Ich trinke meinen Kaffee jetzt weiß, das übersäuert den Magen nicht so.«
Malte lehnte sich zurück, die Arme über Kreuz, und channelte angesichts der vermeintlich neuen Information bloß lakonisch Loriot: »Ach was.«
Wieder entstand eine Schweigepause, diesmal so lang, dass Malte irgendwann lieber selbst die Initiative ergriff, als die dröhnende Stille zu ertragen. »Nathalie hat jetzt zusammen mit einer Freundin eine eigene Apotheke am Feuersee, sie ist wirklich schön geworden.«
»Gut, gut«, sagte sein Vater, ohne nachzuhaken, dann rührte er wieder wortlos in seiner Kaffeetasse herum – dreimal nach links und zweimal nach rechts, was Malte nur deshalb bemerkte, weil ihn das leichte Zittern am Löffel irritierte.
»Und, was liest du gerade so?«, versuchte sein Vater sich dann am einzigen Thema, über das sie früher hatten reden können, ohne dass es irgendwann in Streit ausgeartet war.
»Nichts«, erwiderte Malte. »Keine Zeit.«
»Hm.«
»Wie geht es Heinz?«
»Ach, du kennst doch den Spruch: Schlechten Menschen …«
»Das hast du vorhin schon über dich gesagt.«
»Macht’s nicht weniger richtig.«
Erst als sich Malte zwang, ihm direkt in die Augen zu sehen, fiel ihm auf, dass er bislang jeden Blickkontakt vermieden hatte; nun war es allerdings sein Vater, der wegsah, als Malte ihn fragte: »Was ist los, warum bist du hier? Brauchst du meine Hilfe bei irgendetwas?«
Dass er ihn überhaupt fragte, machte Malte einen Moment lang stolz: Es war der Beweis dafür, dass er über seinen Schatten springen, auf die feigen Rituale toxischer Männlichkeit pfeifen konnte. Anders sein Vater: Eher hätte der eine in seiner Backentasche versteckte Zyankali-Kapsel zerbissen, als aktiv um Hilfe zu bitten.
Darum war Malte auch nicht überrascht, als er bloß lächelnd den Kopf schüttelte. »Nein, nein, alles bestens. Obwohl … doch, ein Aschenbecher wäre prima«, sagte er. Dann suchte er in seinen Jackentaschen nach Zigaretten und zog eine andere Schachtel heraus als jene, die er vorhin am Automaten gekauft hatte. Zusammen mit der Packung im Auto besaß er nun also mindestens drei.
»Tut mir leid, nicht hier drinnen. Du müsstest runter vor die Haustür, wir haben ja keinen Balkon.«
Sein Vater legte die Zigaretten auf den Tisch, als hoffte er, dass Malte es sich noch anders überlegen würde, und nahm wieder das Foto von Jonas in die Hand.
Die beiden hatten sich immer gut verstanden. So viel Geduld und Interesse wie für seinen Enkel hatte er für den eigenen Sohn nie aufbringen können. Tatsächlich hatte es Malte früher sogar als verletzend empfunden, die zwei beim Fußballspielen zu beobachten – ganz besonders, als sein Vater Jonas dabei einmal versehentlich Malte nannte.
Die Smartwatch an Maltes Handgelenk vibrierte, und sofort fielen ihm die drei Telefoninterviews und zwei Textabgaben ein, die vor ihm lagen; das Display zeigte allerdings keine neue Nachricht an, sondern empfahl ihm bloß eine Atemübung zur Entspannung. Als er darauf achtete, merkte er tatsächlich, wie flach und kurz er atmete, also holte er mehrmals tief Luft, ohne sich jedoch dadurch Erleichterung zu verschaffen. Viel zu sehr roch sie nach seinem Vater, nach kaltem Rauch und altem Mann.
Plötzlich ekelte er sich davor, dieselbe Luft zu atmen wie er und damit unzählige Partikel, die eben erst durch seine schwarze Lunge geströmt waren. Auch sein Zorn wurde immer größer: darüber, mit welch dreister Selbstverständlichkeit sein Vater es wagte, einfach so herzukommen und seine Luft, sein Zuhause, sein Leben wieder mit dem Gift zu kontaminieren, das er so zuverlässig in Maltes Innerem freisetzte. Wie Teer hatte es sich fast vierzig Jahre lang noch in Maltes kleinsten Verästelungen abgelagert; die Spätfolgen zeigten sich erst jetzt, in seinen vermeintlich besten Jahren.
»Bitte erklär’s mir«, sagte er ruhig. »Es ist Montagmorgen, kurz nach neun. Die Kinder sind in der Schule und in der Kita, Nathalie und ich müssen arbeiten. Du wirst doch einen Grund dafür haben, dass du nach all der Zeit ohne Ankündigung wieder bei uns auftauchst.«
Mit einem Mal wurde sein Vater unruhig, er richtete sich auf und schaute sich nervös im Zimmer um, sah dann auf seine Uhr. Kaum setzte er an, um etwas zu sagen, geriet er schon wieder ins Stocken.
»Du kannst doch nicht einfach herkommen und so tun, als wären die letzten Jahre nicht gewesen«, setzte Malte nach, diesmal schärfer. »Also noch einmal: Warum zum Teufel bist du hier?«
Und plötzlich war es genau wie früher: Sein Vater explodierte ohne die geringste Vorwarnung und ließ Malte vor Schreck zusammenzucken: »So redest du nicht mit mir!«, brüllte er los. »So nicht! Ich werd ja wohl noch meine Familie besuchen dürfen!« Er hob die flache Hand wie zur Androhung einer Ohrfeige – »Pass ja auf, du!« –, dann ballte er sie zur Faust und schlug so fest auf den Couchtisch, dass die Kaffeetasse kippte.
Doch genauso jäh, wie er sich zu alter, einschüchternder Größe aufgebläht hatte, fiel er auch wieder in sich zusammen. Keine fünf Sekunden später sah Malte nur noch einen schwächlichen Greis, der sich, erschrocken über seine eigene Reaktion, sofort ans Putzen der Kaffeeflecken auf dem Tischtuch machte und sich dabei geradezu erschütternd unterwürfig entschuldigte.
»Es … tut mir leid, ehrlich. Ich wisch das auf, wir können das Tuch auch reinigen lassen, ich zahl das.«
Inzwischen hatte sich Malte wieder gesammelt. Er stand auf und bat seinen Vater mit fester Stimme: »Lass es. Bitte geh einfach.«
Als der trotzdem weitermachte und unbeholfen ein Taschentuch aus seiner Jacke fummelte, um kniend den Teppich trocken zu tupfen, und damit alles nur noch schlimmer machte, reagierte Malte nicht länger als das Kind seines Vaters, sondern als der Mann, den der aus ihm gemacht hatte.
»Los, raus hier!«, befahl er streng und zeigte zur Tür.
Sein Vater hielt beim Putzen inne und warf ihm einen hilflosen Blick zu.
Aber für Malte gab es jetzt kein Halten mehr, er bebte am ganzen Körper und ließ einen so lauten, sich überschlagenden Schrei fahren, dass sein Hals noch Stunden später wie nach einer Verätzung brannte: »RAUS HIER!«
Sein Gebrüll konnte im Treppenhaus unmöglich zu überhören gewesen sein, trotzdem ließ Nathalie sich nichts anmerken, als sie ins Wohnzimmer kam und seinen Vater zum zweiten Mal an diesem Morgen begrüßte: »Hallo, Walter, was führt dich zu uns?«