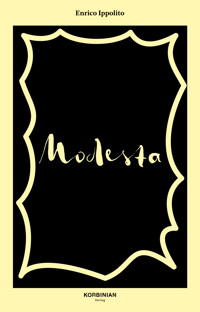
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MÄRZ Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwölf Stunden im Leben eines Verlassenen: Die beste Freundin bereitet gerade eine Party für ihn vor, um ihn von der Trennung seines Exfreunds abzulenken. Während sie all seine Freunde zusammentrommelt, schlendert er gedankenverloren durch die Stadt – und wird mit seinen Dämonen konfrontiert. Schon einmal haben sie ihn heimgesucht, in seinem alten Leben, vor dem er geflohen war, um hier an diesem neuen Ort wie ein Einsiedler zu leben. Doch dann lernte er R kennen. Seine Geister verschwanden, vor allem Modesta, die ihn seit seiner Kindheit regelmäßig besucht hatte. Nun, da er wieder mit sich alleine ist, tritt sie erneut auf den Plan. Mit »Modesta« erzählt Enrico Ippolito facettenreich und elegant eine moderne und schaurige Variante von Virginia Woolfs »Mrs. Dalloway«. In einer aus vielen Straßen zusammengeschalteten Stadt verliert sich der Protagonist in einem immer bedrohlicher werdenden Bewusstseinsstrom.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Modesta
Dies ist der Roman
Modesta
von Enrico Ippolito,
in dem sich der Protagonist
in einer
aus vielen Straßen zusammengeschalteten Stadt
in einem immer
bedrohlicher werdenden
Bewusstseinsstrom
verliert.
INHALT
Modesta
ZITATNACHWEISE
»Still, one got over things.
Still, life had a way of adding day to day.«
»Trotzdem, man kam über alles hinweg.
Trotzdem, das Leben hatte die Gewohnheit, einen Tag an den andern zu fügen.«
Virginia Woolf, Mrs Dalloway
Er sagte, er werde die Blumen selbst kaufen.
C hatte genug zu tun mit den Vorbereitungen. Alles wollte sie selbst organisieren, und die Cateringfirma würde bald schon vorbeikommen.
Ja, die Blumen wollte er selbst kaufen. Das hatte er entschieden an diesem milden Mittwochmorgen, so klar und frisch wie eine Weidenmyrte. Als er die Wohnung verließ, sah er, wie seine Nachbarinnen draußen ihren Tee zu sich nahmen, vor den Häusern, die am Eingang mit Holz verkleidet waren, während die oberen Stockwerke modern und metallisch in die Sonne blitzten. Sein Haus hingegen war klassisch gebaut, Obergeschoss, Erdgeschoss, von außen sah es dunkel aus, einige würden behaupten: fast düster. Innen aber leuchtete es, ja, selbst die schwächsten Sonnenstrahlen schafften es, durch die vielen Fensterfronten auf der Rückseite, die im Verborgenen lagen, das Haus mit Licht zu durchströmen.
Er nickte seinen Nachbarinnen zu, sie unterbrachen ihr Gespräch und die Jüngere von beiden hob für einen kurzen Moment die Hand. Er wollte ihnen schon zurufen: Ich gehe die Blumen heute selbst kaufen, schwieg dann aber doch, er hatte sie schließlich nicht zu seiner Feier eingeladen und wollte ihnen nicht das Gefühl geben, unwillkommen zu sein, obwohl sie das natürlich waren. Er sorgte sich um die Gästeliste, um die Stimmung: Würden sich alle verstehen? Würden alle Spaß haben können? Das waren die Fragen, die ihn umtrieben. Er kannte die Nachbarinnen nicht gut genug, um abschätzen zu können, wie und ob sie sich unter all die anderen Gäste mischen könnten, schließlich war er erst vor ein paar Jahren aus einer anderen, kalten, gesichtslosen Großstadt in diese gezogen, und die Party war ja ohnehin nicht seine Idee gewesen, denn er hatte nichts zu feiern, er hatte keine Lust auf andere Menschen, er wollte nicht vorgeben, dass alles in Ordnung war. Nichts war in Ordnung, er wollte sich nicht mit einer Party ablenken, er wollte nicht vergessen, er wollte seinen Schmerz nicht betäuben und schon gar nicht wollte er auf sich und sein Werk anstoßen. Warum auch? Als ich hierhergezogen war, warst du noch da, dachte er; als ich hierhergezogen war, brauchte ich niemanden anderen, denn du warst an meiner Seite; als ich hierhergezogen war, fühlte ich mich unverwundbar; als ich hierhergezogen war, war ich zum ersten Mal, ja, glücklich. Er bog ab in die große Straße, dachte noch einen Moment daran, dass seine Nachbarinnen später doch noch von der Feier erfahren und vielleicht enttäuscht sein würden, vielleicht war es ihnen auch einfach gleichgültig und sie waren froh, nicht mit anderen, ihnen unvertrauten Leuten verkrampft über das Wetter sprechen zu müssen, und da trafen ihn der Klang der Menschen, die Musik aus den Geschäften, die Neonlichter unvorbereitet. Er war noch nicht wach genug, um sich gleich der Stadt hinzugeben, er hatte beschlossen, was er beschlossen hatte, es gab kein Zurück mehr. Er hatte es C versprochen; liebe C, mit ihrem gütigen Blick und ihrer unermüdlichen Hingabe an ihn; liebe C, die sich um ihn kümmerte und ihm jetzt die Vorbereitungen der Feier abnahm; C, die ihn oft nervte mit ihren heterosexuellen Liebesgeschichten, die immer gleich ausgingen, weil die Männer alle gleich waren, er hatte es nie geschafft, sie zu unterscheiden, weil der Typ Mann, den C so begehrte, sie jedes Mal zu Beginn mit dem gleichen intellektuellen Charme gefangen nahm, nur um sich dann doch Monate später als jemand zu entpuppen, vor dem sie eigentlich ihr ganzes Leben lang schon fliehen wollte, und dann war er es, der sich ausgiebig alles anhörte, an den richtigen Stellen nickte, sie in den Arm nahm.
Und jetzt? Jetzt tat sie das Gleiche für ihn, offenbar gab es auch für ihn eine gewisse Art Mann, die ihm alles entgleiten ließ, ihn alles vergessen ließ. Er war weitaus oberflächlicher als C; liebte nichts mehr, als wenn die Menschen ihm sagten, wie attraktiv sein Partner doch war, weil so der Zauber auf ihn abfärbte. Schließlich hatte er ihn sich ausgesucht, es war sein Verdienst, er hatte sich entschieden für diese eine Person. Sein Typ Mann? Flüchtig, unbeständig, sprunghaft. Trauriger Welpenblick. Er tastete nach den Kopfhörern in seiner Jackentasche und machte die Musik an, er atmete aus: zu lange, zu laut, er konnte die Blicke der Passanten auf sich spüren. Wie viel Zeit war vergangen, seit R nicht mehr bei ihm war? C hatte ihm gesagt, er solle nach vorn schauen, das Vergangene in der Vergangenheit lassen, c'est passé, mon chouchou, sagte sie, obwohl C kein Französisch sprach, geschweige denn je in Frankreich gelebt hatte, aber sobald dieser Satz fiel, musste er lächeln, er konnte nicht anders. Sie beide wussten, wie sehr er der Vergangenheit verhaftet blieb, wie sehr er jedes mittlerweile verlorene Detail analysierte, wie schlecht er loslassen konnte. Vielleicht sollte er ihr auf dem Weg zu seinen Besorgungen ein Geschenk kaufen, eine Baskenmütze oder Macarons.
Bald würde er an die Ecke vom Blumenladen kommen, aber bevor er Blumen kaufen konnte, brauchte er dringend einen Kaffee in einem dieser alten Kaffeehäuser, die aus der Stadt nach und nach verschwanden. Sein Lieblingscafé lag gleich am Ende der Straße. Er war genau hier in diese Gegend gezogen, weil er es unterstützen wollte, um jeden Preis wollte er dieses Café erhalten, denn hier durfte er noch rauchen, aber vor allem gab es nirgendwo so guten Kaffee wie hier. Er setzte sich am Tresen an einen der fünf Plätze, nahm seine Kopfhörer ab, bestellte einen Kaffee, ohne Milch, ohne Zucker, holte eine Zigarette aus der Brusttasche und schaute sich genau um. So viel wie möglich wollte er von diesem Ort aufsaugen, aus Angst, ihn zu vergessen, sobald es ihn irgendwann nicht mehr geben würde. Links vom Tresen stand ein altes Telefon mit Drehscheibe, blassrosa, wie aus einem Zeichentrickfilm, Staub hatte sich darauf angesammelt. Hinter dem Telefon glitt sein Blick auf einen quadratischen kleinen Tisch, nicht größer als fünfzig mal fünfzig Zentimeter, daneben ein Stuhl, auf beiden stapelten sich Zeitschriften aus einer anderen Zeit, über dem Tisch eine kleine Einkerbung im Holz in der Wand, die als Bücherregal für die Comics diente, dann der Tresen mit fünf Hockern, die Besitzerin gleich dahinter, die ihm ein Lächeln schenkte und die hier, hinter diesem Tresen, der sicherlich einen Meter lang war, vielleicht ein wenig mehr, alles zubereitete: den Kaffee, die Toasts, die Pancakes, die Sandwiches, die Pasta. Hektisch bewegte sie sich hin und her zwischen der Kaffeemaschine, den Herdplatten, den Gästen. Würde er es nicht besser wissen, hätte er geglaubt, sie sei von einem kleinen hinterhältigen Wesen in Besitz genommen worden.
Als sein Kaffee vor ihm stand und er den Rauch der Zigarette von sich blies, holte er sein Telefon raus, suchte nach der letzten Nachricht von R, die er sich so oft schon durchgelesen hatte. Die Nachricht suchte ihn heim, ließ ihm keine Ruhe, kehrte immer wieder zurück zu ihm, dabei stand nicht einmal etwas Besonderes drin, es gab kein Geheimnis zu entziffern, kein Rätsel zu lösen, ich kann nicht mehr, das waren seine letzten Worte, bevor er verschwand, sich in Nebel auflöste, ihm nie wieder schrieb, sich nie wieder blicken ließ. ich kann nicht mehr, und dann Schluss, das war es. Was konnte R nicht mehr? Die Frage kreiste ständig in seinem Kopf herum, er fand keine Ruhe, ich kann nicht mehr. Diese unfertige Nachricht, ein Satz, dem der nachfolgende Teil fehlte, ohne Erklärung, ohne Rücksicht, kühl und flammend zugleich. Oh R, mein R, was konntest du nicht mehr? Nicht mehr hier in dieser Stadt leben? Nicht mehr aus dem Haus gehen, nicht mehr arbeiten, nicht mehr schlafen, nicht mehr? Nicht mehr mit mir sein?
Schnell trank er seinen Kaffee aus, spürte die Reste noch zäh auf seinen Zähnen, so wie er es mochte, zahlte und ging in Richtung Floristin, wo die Blumen im Schaufenster abwegige Formen annahmen, sich zu anderen Lebewesen verwandelten, tierhaft, mysteriös ragten sie aus allen Ecken, umzingelt von kleinen Statuen, die aus Ästen und grünen Blättern errichtet waren, als ob ein Kind komplett von einem Pelzmantel aus Wald bedeckt werden würde, die Farben der Blüten grell und reich an Kontrasten, ein Wimmelbild, in sich verschlungen, und doch war jedes Element deutlich zu erkennen, es hätte genauso in einem Museum hängen könnten, stattdessen standen die Blumen einfach hier, beängstigend und wunderschön zugleich für alle sichtbar, die an dem Geschäft vorbeikamen; er malte sich aus, wie er die Buschwindröschen, die Chrysanthemen, die Ranunkeln, die Pfingstrosen, die Hortensien, die Duftwicke und viel Grün, den Eukalyptus, die Aralienblätter, den Lederfarn, auswählen würde, wie die Farben Weiß, Lila, Gelb, Blau, Fuchsia miteinander harmonieren würde. Bestimmt würden einige behaupten, es sei zu viel, immer ist alles viel zu viel, aber: Wie diese Blumen später seine Wohnung strahlen lassen würden!
Kürzlich hatte er die Virginia-Anemone entdeckt, eine krautige Art mit weißen Blüten, die aber leider nicht hier, sondern nur an einem anderen Ort zu finden war. Bislang hatte H es nicht geschafft, die Anemone für ihn zu besorgen, aber sie würde nicht aufgeben, das hatte sie ihm versprochen. Sie schien schon draußen auf ihn zu warten, als er ankam, wirkte ganz aufgeregt, Jim, so nannte sie ihn immer, du wirst es nicht glauben, heute war sie hier. Sie strahlte, sie, die berühmte Autorin, in ihrem Laden, eine Schriftstellerin, die Bestseller auf eine Art und Weise schrieb, wie es nicht so oft vorkam, die etwas Unbeschreibliches bei den Menschen freisetzte, die ihre Bücher regelrecht verschlangen. Auch in seiner Wohnung stapelten sich ihre Bücher, einige noch sicher geschützt in der Plastikfolie. Seit R fort war, konnte er sich nicht mehr konzentrieren, geschweige denn ein Buch zu Ende lesen, es war, als nehme mit dem Verschwinden von R all seine Lebensenergie von Tag für Tag mehr ab, erst verlor er seine Konzentrationsfähigkeit, dann veränderte sich sein Körper, schleichend, er wurde dünner, sein Gesicht erschlaffte, die Falten um Mund und Stirn wurden zu in der Mitte durchtrennten Kratern, die Haut um die Augen stülpte sich in seinen Schädel zurück, auch sein Gang wurde anders, er bemerkte, dass er seinen Oberkörper beim Gehen nach vorn beugte, als ob er den Schmerz der Welt auf seinen Schultern tragen würde.
Und weißt du, was sie gekauft hat? Er wollte »Sonnenblumen« antworten, denn das bedeutete ihr Name und H sagte immer, dass es ihr in die Wiege gelegt worden sei, Blumen zu verkaufen, dass sie mit diesem Namen ja gar keine andere Wahl gehabt habe, als ein Blumengeschäft zu eröffnen.
Nein, antwortete er stattdessen. Sie hat Sonnenblumen gekauft, sie lachten beide und zum ersten Mal seit Langem fühlte sich sein Lachen nicht gezwungen an.
Sie ging kurz rein ins Geschäft, und als sie zurückkehrte, war ihr Gesicht verdeckt von den ganzen Bouquets, die sie in den Händen hielt, eingeschlagen in braunes Papier.
Jim, was hast du mit diesen ganzen Blumen vor?, fragte sie. Noch eine Person, die er vergessen hatte, einzuladen, warum hatte er nichts gesagt, sie war schließlich neben C der wahrscheinlich einzige beständige Kontakt zur Außenwelt? Einmal die Woche ging er aus dem Haus, um Blumen zu kaufen, obwohl sich in der letzten Zeit immer häufiger C darum gekümmert hatte, wenn er mal wieder keine Kraft hatte, sich anzuziehen und mit anderen Menschen zu interagieren; aber heute, heute war es anders, heute hatte er beschlossen, selbst aus dem Haus zu gehen, sich seinen Ängsten zu stellen, also würde er nun auch den Mut aufbringen, H zu sagen, wofür er die Blumen kaufte. Wie eine normale Person würde er ihr die Wahrheit sagen, nicht versuchen, eine Ausrede zu finden oder so zu tun, als ob er ihre Frage nicht gehört hätte, um anschließend zu beginnen, über etwas vollkommen anderes zu sprechen. Heute war alles anders.
H, hat dir C etwa nicht Bescheid gesagt? Sie organisiert eine Feier für mich und ich würde mich freuen, wenn du auch kommst.
Geschafft, das war nicht schwer gewesen, Hs Gesicht zeigte keine Verletzung. Natürlich komme ich vorbei, sagte sie, während sie ihm die Blumen überreichte. Geschafft. Er verabschiedete sich und machte einen Umweg auf dem Heimweg. Er ging durch die schmalen Gassen, an den Häusern vorbei, achtete darauf, die Blumen nicht zu zerdrücken, obwohl sie sein Gesicht verdeckten. An der Ecke legte er die Sträuße auf einer kleinen Mauer ab, atmete aus, nahm seine Kopfhörer aus der Jackentasche, machte das Lied an, das er seit Monaten in Dauerschleife hörte, und als die ersten Zeilen erklangen, beruhigte er sich ein wenig. The evil, it spread like a fever ahead. Er nahm die Bouquets, ging weiter die Straße herunter, langsam, ohne Eile, er wollte noch nicht nach Hause, wo er sich den Fragen von C würde stellen müssen oder ihr bei den Vorbereitungen helfen, also lief er immer weiter, während sich die Straße endlos verschwommen vor ihm aufbaute, ihm wurde kalt, vom Wind begannen seine Augen zu tränen und er versuchte, sich mit dem Papier der Blumen die Tränen abzuwischen, aber sie perlten auf der glatten Oberfläche ab und benetzen nur die Blüten, so schien es, warum weinte er, warum jetzt, dachte er und konnte gar nicht mehr aufhören zu laufen, er achtete nicht auf den richtigen Weg, er lief einfach, er lief, das Gefühl von Zeit entglitt seinem Körper, er zitterte jetzt, die Straßen wurden dunkler, verwinkelter, während das Lied immer und immer weiter durch die Kopfhörer in seinen Kopf drang. The evil, it spread like a fever ahead / It was night when you died, my firefly / What could I have said to raise you from the dead? Er lief und lief und lief, dabei immer die Blumen vor seinem Gesicht, als ihn das Gefühl beschlich, nicht alleine zu sein, es war nicht wirklich ein Gefühl, vielleicht eher eine Vorahnung, etwas in seinem Körper, das sich anspannte, er spürte eine Präsenz, er war sich sicher, etwas zu sehen, das sich vor seinem Blickfeld bewegte, er schob die Blumen zur Seite, um sein linkes Auge zu befreien, sah Umrisse, was genau es war, konnte er nicht sagen, waren es ein paar Äste, die der Wind verschob, oder war es eine Plastiktüte, die in der Luft wirbelte; er schob die Blumen vor das andere Auge, damit sein gutes Auge, das rechte, auf dem er eine Sehkraft von einhundert Prozent hatte, sehen konnte, was hier eigentlich vor sich ging, hier in dieser Straße, auf der weit und breit keine Menschenseele zu sehen war, etwas bewegte sich von links nach rechts, von rechts nach links und wieder zurück, es war gewiss keine Tüte, kein Ast, nichts, was er schon einmal gesehen hatte, es bewegte sich auf vier Beinen, eine Katze, dachte er, aber während das Wesen hin und her lief und er weiter die Straße herunterging, bemerkte er, wie groß es war, vielleicht ein Fuchs, er hatte es vor ein paar Wochen noch im Radio gehört, dass Füchse mittlerweile auch in die Städte kamen, über Straßen liefen, als ob nichts dabei wäre, sich auf Dächern herumtrieben, Schuhe vor den Häusern stahlen, das war es bestimmt, einfach nur ein Fuchs, der auf der Suche nach Essen war, und sobald er sich selbst davon überzeugt hatte, verlangsamte er seinen Schritt nicht, denn was sollte ein Fuchs ihm schon anhaben, der würde sich verziehen, sobald er näherkam, also kam er ihm näher, und als er ein paar Meter, vielleicht waren es auch mehr, so richtig wusste er es nicht, vor dem Fuchs stand, sah er, wie die Kreatur – es –, er fand keinen besseren Ausdruck als »es«, plötzlich auf zwei Beinen hin- und herlief, er erkannte Schnurrhaare, ein schwarz-weißes Fell und einen langen gegabelten Schweif, von links nach rechts, von rechts nach links, es hatte ihn nicht bemerkt, so schien es, konnte das sein, aber es, es fürchtete sich nicht, mit den Blumen in der Hand trat er noch weiter heran, und als es ihn ansah, oder lächelte es ihn an?, und er in seine schwarzgrün leuchtenden Augen sah, da hätte er schwören können … Nein, das konnte nicht sein, er starrte weiter in diese Augen, mit standhaftem Ausdruck, und je länger er starrte, desto sicherer wurde er sich. Ja, er war es, es gab keinen Zweifel. Sein Blick, den hätte er überall erkannt, er verlangsamte seinen Gang, wollte es nicht erschrecken, er näherte sich langsam, behutsam, und als er genau dort vor ihm stand, verschwand es, löste sich in Luft auf, von jetzt auf gleich, er schaute auf den Boden, um irgendeinen Anhaltspunkt zu finden, aber der Beton war tadellos, keine Flüssigkeit, keine Brandspuren, nichts, aber er hörte Musik in der Ferne, immer und immer wieder die gleiche Strophe.
We're all gonna die/ We're all gonna die/ We're all gonna die/ We're all gonna die/ We're all gonna die/ We're all gonna die/ We're all gonna die.
Was war er nur für ein Dummkopf, die Musik kam natürlich aus seinen Kopfhörern, aber konnte das Lied aus seinem Telefon wirklich einen Sprung haben wie eine Schallplatte, die wieder und wieder dieselbe Strophe wiederholte? Er zitterte, versuchte sich selbst einzureden, dass ihm seine Müdigkeit einen Streich gespielt hatte, dass sein Gehirn die Gedanken an ihn überlappt hat mit einer streunenden übergroßen Katze, er zu viele Geistergeschichten gelesen hatte, aber, ja aber, der Blick, er war sich sicher, so sicher wie noch nie, er war es, er war es. R. Sein R.
Alles dunkel. Ein Kribbeln stieg in seinem Körper hoch. Alles still. Es bahnte sich seinen Weg. Seine Augen geschlossen, sein Körper paralysiert. Aber er spürte es. Wie es langsam hochkroch, sich dann wie kleine Blitzschläge ausbreitete. Es geht wieder los, dachte er. Es geht wieder los. So lange hatte er es unter Kontrolle gehabt, aber jetzt, wie aus dem Nichts war es wiedergekehrt. Das Kribbeln. Dunkelheit. Er spürte seine Wimpern sich wie Scheibenwischer bewegen. Er schaffte es nur noch, sich hinzulegen, einfach dort auf dem Boden, es geschehen zu lassen, es einfach zu erdulden, sich seinem Schicksal zu unterwerfen. Er wusste, was nun passieren würde.
Vor vielen Jahren hatte er das schon einmal erlebt, in seinem alten Leben, dem Leben, das er geführt hatte, bevor er hierher gezogen war, bevor er Stille erlebte. Damals hatte er sich von Ort zu Ort gestoßen, von Person zu Person, verfolgt von Geistern aus seiner Vergangenheit, die er nie gerufen hatte, die sich aber trotzdem eingeladen fühlten; damals hatte er sich nach einer Möglichkeit gesehnt zu atmen, einfach zu sein, nicht verfolgt zu werden, wovon auch immer. Verpflichtungen? Menschen? Er hatte immer die Enttäuschung in den Augen der anderen gespürt, zwar hatten sie die nie ausgesprochen, aber gewusst hatte er es trotzdem, hatte empfunden, was sie sich heimlich dachten, was sie bei Kerzenschein in ihre Tagebücher geschrieben hatten (so hatte er es sich zumindest vorgestellt), er hatte es gewusst. Und das Kribbeln, das ihm keine Ruhe ließ, ihn hecheln ließ, ihn starr werden ließ, war nach und nach immer stärker geworden. Er hatte sich den Erwartungen nicht beugen können, die immer mehr, immer größer geworden waren. Auch seine Familie hatte ihn nie verstanden, ihre Akzeptanz, um von Liebe gar nicht erst zu sprechen, hatte sich für ihn nie aufrichtig angefühlt, nie bedingungslos. Er hatte versucht, es zu kompensieren, so wie viele vor ihm es schon getan hatten, seine Geschichte war nicht einzigartig, auch wenn nur er sie in genau dieser Version erlebt hatte; seine Familie, sie hatte alles von ihm erwartet und er hatte ihr alles gegeben, bis zur Selbstaufgabe, wie man es eben macht, wenn man ausgleichen muss, dass ein Versprechen nicht gehalten wurde, auch wenn er sich nicht daran erinnern kann, dieses Versprechen jemals gegeben zu haben; und wenn er ihnen schon keine eigenen Kinder geben konnte, so wie sie sich das vorgestellt hatten, dann musste er wenigstens sieben Tage die Woche vierundzwanzig Stunden für sie da sein; ihnen Geschenke machen, ihnen Geld geben, sich jegliche Beleidigung anhören, alles müde weglächeln; sie hatten sich ohnehin nichts mehr zu sagen, denn in ihren Augen hatte er sich zu weit von ihnen entfernt mit seinem Leben, seinem Desinteresse an den für sie wahren Dingen. Schon immer hatte er das Gefühl gehabt, nur verlieren zu können. Er hatte damals endlich etwas anderes fühlen wollen, nicht einmal Glück, so weit wäre er noch nicht mal gegangen, aber einfach etwas anderes, um dem Druck etwas entgegenzusetzen.
Und was war mit den Freundschaften gewesen? Er hatte die meiste Zeit niemanden ertragen können. Es kam ihm alles so kleinlich, belanglos vor, er wollte sich nicht mit den Gefühlen der anderen auseinandersetzen müssen. Seine Rolle war es gewesen, andere sich gut fühlen zu lassen, sie reden zu lassen (wie gerne redeten sie über alle ihre Probleme, im Minutenprotokoll wurde alles nacherzählt, der ganze Ablauf detailliert beschrieben), er hatte immer zugehört, hatte die richtigen körperlichen Signale gesendet und nicht über sich gesprochen; und als das Kribbeln begann und er nach Zeit und Raum fragte, hatten sie ihm Vorwürfe gemacht, er würde sich nicht melden, sich nicht interessieren, nicht da sein, hatten den Druck erhöht. Also hatte er alle seine Profile gelöscht, genau drei Menschen einen Brief geschrieben (C war einer von diesen Menschen; C, die ihn sein ließ, wie er war), eilig, mit verschmierter Tinte, hatte eine Abwesenheitsnotiz für seine Mails verfasst, ein Flugticket für den Tag darauf gebucht, den Computer ausgeschaltet und die Augen geschlossen.
Am nächsten Morgen war er in der Dunkelheit aufgewacht, hatte hastig seine Sachen (sieben Unterhosen, sieben T-Shirts, drei Hosen, vier Hemden, zwei Paar Schuhe) gepackt, zehn Bücher (nur Klassiker) aus seinem Regal herausgesucht, vierundzwanzig Bleistifte gespitzt und sie in sein Mäppchen gelegt, den Füller mit rabenschwarzer Tinte aufgefüllt, ein neues Notizbuch aus der Schublade geholt, mit Ledereinband und Goldschnitt am Papier, und auf der Bettkante gesessen und gewartet. Erst nachdem sein Wagen dann Stunden später gekommen war und als er endlich drin gesessen hatte, hatte er wieder atmen können.
Damals hatte er sich von seinem Ort entfernen müssen, fünfzehn Flugstunden, um das Kribbeln in seinem Körper endlich zu besiegen, und nun, nun war es wieder da, stärker denn je, wie es schien. Noch mal würde er nicht die Kraft haben, sich dagegen aufzulehnen, er würde es einfach über sich ergehen lassen, dachte er, möge passieren, was passieren soll. Er spürte, wie die Tränen langsam seine noch immer vibrierenden Lider und Wimpern benetzten, bis sie auf seinen Wangen, in der kleinen Kuhle dort, ein Rinnsal bildeten. Er streckte die Arme aus, roch den Asphalt unter sich, wahrscheinlich würde es gleich regnen, dachte er. Was ist mit den Blumen?, das war sein zweiter Gedanke, während das Rinnsal in der kleinen Kuhle zum Bach wurde, sich seinen Weg bahnte, um zum Fluss zu werden, zum Meer zu gelangen.
Hatte er das gerade alles nur geträumt? Es schmerzte ihn so sehr, daran zu denken, viel lieber wollte er einfach nur hier liegen. Sollte der Regen ihn reinwaschen von all seinen Sünden, seiner Schuld.
Als er die Augen öffnete, blendete ihn die Helligkeit des Himmels, er sah verschwommen. Die Tränen, dachte er, aber in dem Moment, da er sich ins Gesicht fasste, vermisste er seine Brille, sofort wurde er panisch, tastete seinen Körper ab, den Asphalt um sich herum. Hatte die Katze sie gestohlen? Er stützte sich auf der kleinen Mauer ab, nahm die darauf liegenden Blumen wahr und dann etwas Metallisches, seine Brille, er streichelte sie wie ein Baby, setzte sie auf und entdeckte einen Brief in dem Blumenstrauß. Langsam, langsam kam er wieder zu sich und ging nach Hause.
Der Geruch der kalten Luft, die auf den heißen Wasserstrahl der Dusche traf, erinnerte ihn an R, wie sie beide im Badehaus saßen, mit ihren kleinen weißen Handtüchern, quadratisch, kompakt gefaltet, auf ihren Köpfen, nicht in feinen heißen Quellen waren sie gewesen, sondern in den leicht abgeranzten Badehäusern am Rande der Stadt. Es war vielleicht das dritte oder vierte Date, R hatte ihm beigebracht, wie er sich zu verhalten hatte, wenn er in ein öffentliches Bad ging, wie er die Schuhe ausziehen musste, sich in den Umkleiden zu entblößen hatte, seine Kleidung ordentlich in den Schrank verstauen, sich den Schlüssel des Schließfaches um das Handgelenk binden, in den Duschbereich gehen, überhaupt jede Handlung, die R vormachte, wiederholte er. Das Betreten mit Seife, Schmutz oder Schweiß am Körper ist inakzeptabel und ein Grund für den Ausschluss aus der Quelle, hatte R ihm gesagt, es klang wie ein Spruch auf einem Warnschild, er hatte versuchte, ihm dabei in die Augen zu sehen, aber sein Blick war abgeschweift, auf den Körper von R, auf die Seifenblasen, die seine Haare an manchen Stellen umschmeichelten; wie er sich mit einem rauen Waschtuch gründlich abschrubbte und das Tuch all die Stellen seines Körpers berührte, die er noch nicht erkundet hatte. Seine Brust, seine Arme, seine Schenkel, er hatte sich Zeit gelassen, seine Schultern, seinen Rücken, seinen Intimbereich, seinen Po und dazwischen. Um dem Blick von R auszuweichen, hatte er begonnen, es ihm nachzumachen, er hatte sich auf den kleinen Plastikhocker gesetzt, die Schüssel genommen und sich Wasser über den Kopf geschüttet, im Hintergrund hatte das Wandgemälde eines Berges, vielleicht war es auch ein Vulkan, mit seiner weißen Spitze geflackert. Er hatte sich vorgestellt, wie das heiße Wasser unter der Stadt durch verwinkelte Gassen floss, nur darauf wartend, sich in einem Badehaus ausbreiten zu können, der Druck müsste kaum zu halten sein, während das Wasser verzweifelt versuchte, einen Ausgang, einen Ausweg aus dem Untergrund zu finden. Nach oben, ans Licht. R hatte ihm auch erzählt, dass die Gäste in den feineren Bädern ihre Tattoos abkleben mussten, selbst kleine Herzchen am Handgelenk, einen Stern auf dem Fuß, einen Anker auf der Schulter, einen chinesischen Schriftzug auf der Brust, ein dekoratives Arschgeweih, all das hatte keinen Platz dort, weil die Besitzerinnen nicht mit Kriminellen in Verbindung gebracht werden wollten. Er aber, nur sagte er ihm das nicht, liebte die öffentlichen Bäder der Stadt, gerade weil sie niemanden ausschlossen, nicht einmal die Kriminellen. Vor allem liebte er die feinen, auf dem ganzen Rücken sich ausbreitenden Tätowierungen der Männer – Drachen, Wächterlöwen, Kois, Tiger, die vor bösen Geistern schützen sollten; Dämonen, Trolle, die ihr Unwesen trieben und ganze Dörfer terrorisierten. Das alles hatte er ihm nicht erzählt, hatte R nur aufmerksam zugenickt, tief in seine Augen geblickt, war rot geworden und hatte den Blick von ihm fallen lassen, alles war noch zu frisch, er hatte ihm nicht das Gefühl geben wollen, sich schon komplett verliebt zu haben.
Als er nach Hause gekommen war, hatte er nicht mit C sprechen können, war geradewegs ins Bad gegangen, um jetzt unter der Dusche sich auf den ersten Tag zu besinnen, an dem er gewusst hatte, wie wichtig R einmal für ihn werden würde. Er hatte es gerade noch so geschafft, die Blumen in der Küche abzulegen, bevor er sich im Bad eingeschlossen hatte und nun zusammengerollt unter der Dusche saß. Er fühlte sich, als würde er den Verstand verlieren. Was hatte er da bloß gesehen? Er war sich sicher, dachte er, während die heißen Tropfen auf seinem Körper abperlten. Vielleicht war er doch noch nicht bereit für die Feier, vielleicht sollte er C bitten, alles abzusagen, damit er sich ins Bett verkriechen konnte. Das Kribbeln. R. Die Katze.
Er trocknete sich ab in seinem kleinen Bad, vermied dabei den Blick in den kleinen Spiegel über dem Waschbecken, und mit dem Handtuch um die Hüfte gebunden warf er sich im Schlafzimmer aufs Bett, er fühlte, wie das Laken die Tropfen seines Rückens aufsog. Er suchte sein Telefon, keine neuen Nachrichten, aber was hatte er auch erwartet?
Also las er wieder Rs Nachricht: ich kann nicht mehr. Ihm wurde schlecht.





























