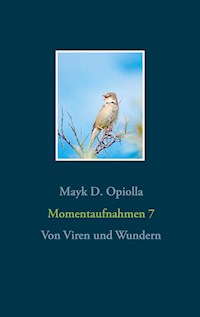Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auch in Band 5 der "Momentaufnahmen" werden die meisten der kurzen, tagebuchartigen Erzählungen von einer sinnlich-melancholischen Grundstimmung getragen. Es ist eine Zeit der Abschiede: Ein Hund tritt in das Leben des Ich-Erzählers und verschwindet wieder, eine langjährige Freundschaft zerbricht, ebenso wie eine ohnehin nur heimlich gelebte Romanze. Findet sich die Antwort auf all das Suchen und Winden, der ersehnte Halt und Trost vielleicht doch nur in der Liebe Gottes? Einen Lichtpunkt setzt die Konversion des Erzählers zum Katholizismus und macht das Thema "Glauben" zu einem der Schwerpunkte in diesem Band. Es geht um Rückzug und Resilienz, um Depression und Dreifaltigkeit, um Waldfrieden und Friedwälder, um Liebe und Loslassen, um Hunde und Herrchen, um Klüngel und Klerus, um Zölibat und Zärtlichkeit. Wie in den Vorgängerbänden wird die Passion des Ich-Erzählers für die Schönheit der Schöpfung in bildgewaltigen Beschreibungen der Umgebung deutlich: Sei es die Insel Langeoog, ein Dorf im ostfriesischen Nirgendwo oder ein Wald mitten im Ruhrgebiet. Weitere Handlungsorte sind die Insel Norderney, Bremen, der Dom zu Osnabrück, das Bergische Land sowie ein Zisterzienserkloster.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch:
Auch in Band 5 der „Momentaufnahmen“ werden die meisten der kurzen, tagebuchartigen Erzählungen von einer sinnlich-melancholischen Grundstimmung getragen. Es ist eine Zeit der Abschiede: Ein Hund tritt in das Leben des Ich-Erzählers und verschwindet wieder, eine langjährige Freundschaft zerbricht, ebenso wie eine ohnehin nur heimlich gelebte Romanze. Findet sich die Antwort auf all das Suchen und Winden, der ersehnte Halt und Trost vielleicht doch nur in der Liebe Gottes? Einen Lichtpunkt setzt die Konversion des Erzählers zum Katholizismus und macht das Thema „Glauben“ zu einem der Schwerpunkte in diesem Band. Es geht um Rückzug und Resilienz, um Depression und Dreifaltigkeit, um Waldfrieden und Friedwälder, um Liebe und Loslassen, um Hunde und Herrchen, um Klüngel und Klerus, um Zölibat und Zärtlichkeit. Wie in den Vorgängerbänden wird die Passion des Ich-Erzählers für die Schönheit der Schöpfung in bildgewaltigen Beschreibungen der Umgebung deutlich: Sei es die Insel Langeoog, ein Dorf im ostfriesischen Nirgendwo oder ein Wald mitten im Ruhrgebiet. Weitere Handlungsorte sind die Insel Norderney, Bremen, der Dom zu Osnabrück, das Bergische Land sowie ein Zisterzienserkloster.
Umschlagabbildung: Kirche St. Nikolaus, Langeoog. ©Mayk Opiolla
Meinen Eltern
Inhalt
Winter
Gefährte
Compassion
Knall
Am Schönsten
110
Türspalt
Distanz
Licht
Fest
Traumlos
Krähen
Frohsinn
Kulisse
Exerzitien
Erwachen
Fülle
Herzensgeiz
Nachglühen
Siedlung
Drama
Worte
Verlassen
Almosen
Stadtland
Goldener Oktober
Heimkehr
Stilles Glück
Winter
Es ist warm, beinahe frühlingshaft. Und doch ist November.
Kriechkiefern klammern sich an sandige Dünenränder. Entlaubte Brombeerranken strecken sich mit ihren Dornen wie dürre, warzige Finger über den Radweg. Die Sonne wärmt noch immer und taucht die Landschaft am späten Nachmittag in Rot und Gold. Das Gras zu meinen Füßen, über das in einiger Entfernung auch leise schnatternde Graugänse watscheln, hat nichts von seinem sommerlichen Sattgrün eingebüßt: Noch nicht.
Es ist ein schöner Tag, und so zieht es mich in die Natur, weil man so ein Wetter nicht umkommen lassen kann, egal ob man in Ausflugslaune ist oder nicht.
Schließlich kann es nun täglich umschlagen, und aus der milden, blaubehimmelten Pracht werden viele Monate kalter, karger Dunkelheit.
Über der Melkhörndüne, Langeoogs höchster Erhebung, ballt sich eine Wolke in reinstem Weiß. Unten, in Richtung Süden, breitet sich die See hinter den Salzwiesen wie ein silberfarbener Spiegel, darüber die Umrisse der Windräder auf dem Festland. Im Norden tost das noch immer sturmbewegte Meer. Von der Melkhörndüne aus sieht man das Wasser zu allen Seiten.
Der Wind weht heute nur frisch; es ist gut auszuhalten hier oben. Die Böen spielen mit meinem Schal, streichen über die Haut, verwirbeln die Haare. Die Natur kennt keine Berührungsängste, und ich wünschte, es wäre mit den Menschen ein wenig anders.
Manchmal, denke ich, hadere ich ja doch damit, maximal noch intellektuell von Interesse zu sein, auch wenn ich es im Grunde gar nicht anders will und auch keine Bemühungen unternehme, daran irgendetwas zu ändern.
Es hat zweifelsohne auch seine Vorteile, in erotischer Hinsicht tot für den Markt zu sein, aber zuweilen hätte man ja dennoch gern zumindest mal wieder jemanden im Arm. Es ist schwer, diese Form von Bedürftigkeit zuzugeben, man schämt sich. Aber so sei es, denke ich. Wenn Gott das will, hat es seinen Sinn, und es ist nicht zu hinterfragen: SEIN Wille geschehe.
Wie hätte ich, als ich mich noch als Agnostiker bezeichnete, getobt über einen solchen Satz! Eine Ausrede für Denkfaule — Denn ist es nicht allzu leicht, sich alles und jedes im Leben mit Gottes Willen zu erklären? Ist das nicht ähnlich unbefriedigend wie damals, als man als Kind auf Fragen nach dem „Warum?“ oft nur ein „Darum!“ als Antwort erhielt?
Aber es liegt auch viel Beruhigendes darin. Denn auf manche Themen im Leben, so lernt man, gibt es einfach keine Antworten. Vieles im Leben ist und bleibt unerklärlich. Und die romantisch-erotisch konnotierte Liebe gehört zweifelsohne dazu. Ich werde keine Antwort dafür finden, warum es davon in manchen Leben überreichlich gibt und in anderen Leben zumindest konventionelle Formen von Liebe überhaupt nicht oder nur in hömoopathischen Dosen stattfinden. Also, schlussfolgere ich, kann ich es auch gleich so sehen: Gott will es so. Und dann muss mir SEINE Liebe reichen.
Ein paar Regentropfen fallen plötzlich wie aus dem Nichts aus dem Himmel, in Ostfriesland ist das oft so. Sie versickern im sandigen Untergrund, kaum, dass sie fielen, ein paar glänzen noch Sekundenbruchteile in Zweigen wie eilig drapierter Weihnachtsschmuck: Auch dieses Fest ist jetzt nicht mehr weit.
Ich denke, dass Liebesglück meist ist wie diese kurzen Regengüsse: Da ist dann plötzlich dieses Gefühl von Geborgenheit, ein beiderseitiges Vertrauen, das man seit Ewig vermisste, diese Zärtlichkeit zwischen den Zeilen, ein hauchfeines Klingen von Zuneigung, ein Schimmer Hoffnung auf Ewigkeit oder zumindest viele Jahre.
Für einen Moment wäscht dieses Glück einem dann den Dreck ab, löst die Krusten alter Verletzungen, enthüllt neue, rosige Haut, heilt, füllt, polstert. Und dann ist man eine Weile immun gegen all die kleinen Betrübnisse des Alltags, weil man ja seine Arme hat oder zumindest die warme Umarmung seines Trostes, die Stärkung seiner Worte am Telefon oder im Brief.
Aber immer ist es zu schnell vorbei, aufgebraucht, verlebt, zerlebt, und das Glück versickert. Der Lieblingsmensch geht, empfindet nur Freundschaft oder liebt einen anderen, und man leidet, weil er nicht mehr da ist — oder zumindest nicht in der Form, in der man ihn gerne hätte.
Erneut wird Brachland aus der Liebe, durchsetzt von brackigen Tümpeln, von denen man wünschte, sie wären aus Tränen, aber Weinen kann man schon Jahre nicht mehr.
Die Dürre bringt dann die Furchen zurück: In das noch gerade lächelnde Gesicht, in den Acker. Die zarten Hälmchen der Setzlinge, in deren kümmerlicher Gestalt man schon die prachtvollen Pflanzen des nächsten Jahres erkannt hatte und von deren Früchten man träumte, sinken zurück in die Erde, untergepflügt mit der nächsten Fuhre idiotischnaiver Hoffnung. Und erneut erblödet man sich zu meinen, dass daraus mal irgendetwas wachsen könnte, obwohl man längst weiß, dass dieses ausgedörrte Stück Land einen niemals ernähren wird.
Die Aussichtsdüne füllt sich, die Leute wollen sich den Sonnenuntergang anschauen. Ich mache mich an den Abstieg: Zuviel Romantik für einen desillusionierten alten Mann.
Über Dreebargen ziehen Weißwangengänse. Ich denke an ein Lied von Robert Wyatt, in dem es übersetzt heißt:
Wir fühlen die Wärme Eures Atems nicht
hier an den eisigen Rändern der Erde
Ihr hört den Rythmus unserer Rufe nicht
in dem wir um das Kommen des Frühlings beten
(Robert Wyatt, „The highest gander“, Übers.: M. Opiolla)
Auf dem Rückweg halte ich an der Kirche, um für einen erträglichen Winter zu beten. Fast alle Opferkerzenplätze sind besetzt; ein verglimmender Kerzenrest, angezündet für irgendjemanden, tropft laut in die Stille.
Es ist kalt geworden mit Einbruch der Dunkelheit. Aber ich denke, dass es gut ist, dass ich jetzt friere. Denn so wird mir die Wärme meiner Wohnung willkommen genug sein: Willkommen genug, um kurz das Sehnen nach einer Art von Wärme zu vergessen, die ich mir selbst zu spenden nicht in der Lage bin.
Gefährte
Es ist eine sternenklare, kalte Nacht. Auf den Straßen ist es dunkel und absolut still. Um diese Zeit ist kaum ein Haus bewohnt, nur ab und an sieht man einen Lichtschein aus einem der Fenster: Feriengäste, welche die Einsamkeit des Inselwinters schätzen oder einer der wenigen Dauerbewohner in meinem Viertel.
„Geisterviertel“ werde es von einigen auch genannt, verplapperte sich mir gegenüber einst eine Insulanerin, weil dort gar niemand wohne im Winter.
Mir mache das nichts, sagte ich damals, es sei schön das Haus mal für sich zu haben; die Straßen, den Strand. Ohne das ständige Kommen und Gehen, ohne das zwangsläufige Mitanhören von fremdem Streit und Geplänkel.
Aber manchmal ist es schon ein bisschen unheimlich in diesen Winternächten, mit dieser gewaltigen Schwärze der Nacht über und um einem, welche die winzigen Lichtkegel der spärlich gesääten Straßenlaternen nicht zu durchbrechen vermögen. Am Himmel Myriaden von Sternen, die Milchstraße und einzelne Wolkenbänder wie silbrige Flüsse in der Dunkelheit. Still ist es. Nichts hört man außer dem Wind, dem eigenen Atem und dem leisen Aneinanderschaben der Kleidungsschichten bei jedem Schritt. Beim Fahrradverleih um die Ecke singt ein Fahnenmast, ein einzuholen vergessenes Werbebanner aus Segeltuch knattert mit jedem Angriff der Böen.
Irgendwas hat die Gänse geweckt, die zu Hunderten weit hinten in der Nähe des Deiches rasten. Ein Rufen und Schnattern geht durch die Nacht, dann kehrt erneut Ruhe ein.
Es ist kalt geworden. Hinter mir höre ich das leise Tapsen von vier Pfoten. Ein Hund folgt mir, und wenn ich stehen bleibe, bleibt er auch stehen. Manchmal überholt er mich auch ein Stück, aber dann dreht er irgendwann um und sieht mich fragend aus großen, treuherzigen, braunen Augen an. Es ist mein Hund.
Und ich sehe diesen kleinen, treuen Gefährten ebenfalls an und mich erstaunt täglich aufs Neue, mit welcher Intensität man ein Tier lieben kann.
Er nervt mich, wenn ich morgens noch im Tiefschlaf bin und er dann fiepend am Bett steht, weil er raus will. Er nervt, wenn ich für meine Arbeit fotografieren muss und er dann ins Bild rennt oder an der Leine zerrt, sodass alles verwackelt. Er nervt, wenn ich beschäftigt bin und er seine Nase zwischen meinen Arm und meinen Körper oder unter meine Hand drängelt, weil er gestreichelt werden möchte. Und noch immer kämpfe ich gegen Würgereiz an, wenn ich diese unsägliche Tüte über meine Hand stülpe und die Finger, nur durch hauchdünnes Plastik getrennt, um eine noch körperwarme Wurst Scheiße schließen muss, die dann langsam darin erkaltet, während ich verzweifelt nach einem Mülleimer suche — und dabei hoffe, unterwegs niemanden zu treffen, der mir zu Begrüßung die Hand reichen möchte.
Es nervt, wenn man für einfachste Wege plötzlich Ewigkeiten braucht, weil Monsieur jedem Grashalm untersucht, als sei er im früheren Leben Botanikprofessor gewesen, und es nervt, wenn ich nicht mehr gedankenlos mit dem Bürostuhl zurückrollen kann, weil der Hund natürlich immer genau dort liegt, wo man ihn versehentlich touchiert. Und was mich bei kleinen Kindern schon tangiert — dieses wortlose, minutenlange Anstarren — das bringt so ein Hund erst zur Meisterschaft!
Aber dann sehe ich ihn zusammengerollt irgendwo schlafen, in seiner herrlich beruhigenden, animalischen Schlichtheit, mit der er im Schlaf schmatzt und leise „wuff“ macht, und bin einfach froh, dass er da ist.
Klar, mag man sagen, so ein Hund liebt jeden, der ihm zu fressen gibt, ein warmes Zuhause und der ihn nicht schlägt. Und dennoch bin ich überwältigt davon, wie loyal so ein Tier wirklich ist. Jeden Morgen freut er sich schwanzwedelnd über meine Ansprache, obwohl ich ihn innerlich für die Uhrzeit verfluche, und wenn ich fort war, freut er sich beim Heimkommen, als sei ich Monate weg gewesen. Er sucht meine Nähe, als wäre ich das gütigste Wesen auf dem Planeten, allein dafür, dass er hier leben darf.
Selbst wenn ich ihn zurechtweise, weil er fremde Hunde nicht angehen soll oder aufs Bett springen, hat er mich Sekunden später wieder lieb, als sei nie etwas gewesen.
Ich hatte schon öfter einen Hund, aber das waren immer nur Pflegehunde zur Urlaubsvertretung, die wussten, wo sie hingehörten. Und ich wusste das auch. Wir mochten uns, sonst hätte ich die Hunde nicht beherbergt, aber es war ein eher höfliches Verhältnis: Eine Freundschaft und Wohngemeinschaft auf Zeit.
Das hier indes, scheint mir, ist deutlich mehr, und alle wissen das: Es ist Familie.
„Hast Du Platz für einen Pflegehund?“, schrieb eine tierliebe Freundin, „Sein Besitzer ist verschwunden und wahrscheinlich im Gefängnis. Wir wissen kaum etwas über den Hund; nicht wie er heißt und auch nicht, wann oder ob sein Besitzer jemals zurückkommt. Klar ist ist nur: Er braucht ein Zuhause. Und zwar jetzt.“
Als Anhang schickte sie ein Foto.
Ich schrieb mein „Ja!“, bevor ich es denken konnte: Das war mein Hund, schon auf den ersten Blick.
Eine Stunde später drückte sich der Hund ängstlich um die Beine der Freundin in meinem Hauseingang herum, traute sich kaum die Treppen hinab zu meiner Wohnung. Aber irgendwann war er dann drin, die Freundin ging, und ich saß da und hatte einen Hund.
„Gott fügt und fügt, ich freue mich so sehr für Dich“, schrieb mir der Lieblingsmensch aus der Ferne, bevor mir selbst klar werden konnte, ob ich all das hier wirklich wollte. Aber offenkundig nahm mir Gott die Entscheidung ab, und auch der geliebte Freund wusste, wie sehr ich Tiere mag.
Ich wollte ja immer einen Hund, aber es gab auch immer irgendeinen Grund dagegen. Aber nun galt es, den Hund um die Gründe herumzudrapieren, bis sie klein und nichtig wurden oder bis sich eine Alternative fand. Es ging ja nicht anders, das Tier brauchte mich.
Was ein aufregendes Jahr, denke ich, noch immer in ungläubigem Erstaunen. Aber mein Kontoauszug zeigt die abgebuchte Hundesteuer, die Tierhaftpflichtversicherung, das Honorar des Tierarztes: Der Hund ist real, und, im Gegensatz zu vielen Menschen in diesem Jahr, wird er bleiben. Er wird geduldig sein und anspruchslos, er wird verzeihen und mir treu ergeben sein. Er wird meinen Hygiene- und Ordnungssinn vor neue Herausforderungen stellen und mir irgendwann auf den Teppich kotzen. Er wird mich zu Unzeiten aus dem Bett fiepen, meine Freiheit einschränken und meinen Kontostand mit Regelmäßigkeit erröten lassen. Aber ich werde für ihn da sein und ich werde ihn lieben, weil ich nicht anders kann und er niemanden sonst hat.
Ich bin seine Heimat, sein Hafen. Das ist eine große Verantwortung. Man kann mit Hunden ja keine demokratischen Entscheidungen treffen. Ich muss autoritär sein, ihm gegenüber und gegenüber mir selbst: Jeden einzelnen Tag. Der Hund ahnt nicht, was ich über ihn denke. Er schläft arg- und sorglos zu meinen Füßen, und es ist schön, ihn in dieser Geborgenheit zu wissen; mit diesem Urvertrauen. Draußen dämmert ein neuer Tag auf der Insel, auf der im Winter für viele die Zeit stehenzubleiben scheint. Um uns herum tost das uralte, ewige Meer.
Compassion
Ich hatte die Kraft des „Irgendwann“ unterschätzt. Das Irgendwann war ein diffuses Donnergrollen in weiter Ferne, ein monotones Summen von Elektrizität irgendwo hoch über den Feldern. Das Irgendwann war anfangs präsent, leise zwar, aber man sah es. Doch dann gewöhnte man sich, und das Irgendwann zerfloss zu einem warmen, umschmeichelnden „Wird schon nicht.“
Irgendwann will er den Hund zurück.
Der kleine Gefährte liegt in sein Lammfell gekuschelt und schläft. Wenn ich seinen Namen rufe, der nicht der ist, den der Vorbesitzer ihm gab, steht er auf, kommt zu mir an den Tisch und sieht mich fragend an. Die letzten Meter zum Haus rennt er, wenn wir heimkommen, und er weiß, wo der Wäschekeller ist, in dem ich ab und zu verschwinde. Dann wagt er sich die Treppen hinunter und schaut nach mir, steckt das neugierige Näschen mit in die Trommel, das immer aussieht, als habe er aus einem Topf Puderzucker genascht. Der Hund kennt sich aus; er weiß, wo er wohnt.
„Es ist für ein paar Tage.“ „Zwei Wochen vielleicht.“ „Der Besitzer ist bis auf Weiteres verschwunden.“
Da war es also, das schöne, warme „Bis auf Weiteres“ und winkte mit fast so etwas wie einer Zukunft. Der Hund und ich. Wir beide.
Aber dann materialisierte sich das „Irgendwann“, baute sich kalt und drohend vor mir auf, mit einem Datum im Schlepptau. „Er will den Hund zurück.“
Mein Vater schickte eine DVD von „Tim und Struppi“: Der Lokalreporter und sein Hund, das seid ihr beide.
Ich brach in Tränen aus.
Du wusstest doch, dass der Hund nicht dir gehört, wurde geunkt, du hättest ihn ja nicht nehmen brauchen. Nein. Ich hätte ihn auch nicht lieben brauchen. Dann wäre er eine Sache, die man aufbewahrt und gegen einen angemessenen Obulus wieder abgibt. Dann wäre er ein Geschäft. Aber ich bin sein Zuhause geworden, jetzt, nach all der Zeit.
In meiner Lieblingszeitschrift GEO ist ein Bericht über eine Frau, die sich um Pflegekinder kümmert. Wie sie das schaffe, in dem Wissen, alle wieder hergeben zu müssen. Irgendwann, vielleicht. Vielleicht auch nie. Sie böte den Kindern ein gutes, glückliches Jetzt. Ums Morgen wisse man nicht. Nie.
Ich sehe den Hund an und denke: Dann hast Du bei mir eben die schönste Zeit Deines Lebens. Dann werde ich Dich mit Liebe und Fürsorge zuschütten, damit Du noch lang davon zehren kannst, solange es halt irgendwie geht. Aber dann schiebt sich, kalt und knirschend, dieser Riegel übers Herz, der sagt: Hör auf ihn zu lieben. Am besten schon gestern. Er bleibt nicht.
Mich erreicht die E-Mail eines Bekannten, seine Frau habe ihn verlassen. Ich fühle seinen Schmerz, höre förmlich aus den Zeilen, wie seine Welt vor mir zerbröckelt, noch weit entfernt davon, sich zu etwas Neuem zusammenzufügen. Der Mann tut mir Leid. Ich weiß, was er durchmacht. Und trotzdem, denke ich, ist man in diesem Leid so mutterseelenallein.
Ich kann ihm sagen, dass ich mit ihm fühle. Dass ich seine Hilflosigkeit verstehe, das Klammern an jeden Halm, um das Unbegreifliche begreiflich zu machen.
Es ist gut, wenn Menschen mitfühlen, denke ich. Und trotzdem: Das Leid nimmt einem niemand ab.
Man muss alleine durch. Mit Glück reicht einem jemand die Hand, mit Glück leuchtet einem jemand ein Stück des Weges. Und Gott? Natürlich ist Gott da, Gott fügt und führt, aber oft genug sind unsere Wege so verschlungen, unsere Trauer so gleißend, dass wir sein Licht nicht sehen und seine Hand nicht erkennen.
Und auch das Leid, so lehrte mich das Leben, ist wirklich niemals sinnlos. Sollte ich den Hund also hergeben müssen, wäre das Leiden entsetzlich. Aber ich nähme es an, besänne mich auf die wunderbare Zeit, die wir hatten, zöge Lehren daraus und sähe nach vorn: Zumindest nehme ich mir das vor.