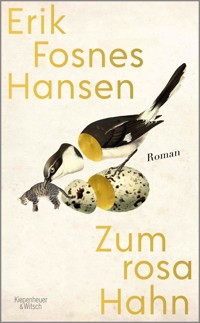9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jedes Leben ist eine Sammlung von Geschichten und Zufällen, die auf wundersame Weise einem Prinzip gehorchen. Davon erzählt Erik Fosnes Hansen in seinem Roman, der den Leser vom Norwegen unserer Tage auf eine schwedische Insel zur Zeit der 1900er Jahre und dann ins Italien der Frührenaissance führt. Mit kunstvoller Leichtigkeit spielt der Autor mit den Grenzen zwischen den Figuren und Epochen, zwischen Raum und Zeit, und schafft somit einen großartigen Roman über die vielen großen und kleinen Ereignisse und Zufälle, die die Welt vor ihrem täglichen Untergang bewahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 881
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Erik Fosnes Hansen
Momente der Geborgenheit
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Erik Fosnes Hansen
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Erik Fosnes Hansen
Erik Fosnes Hansen wurde 1965 in New York geboren. Er wuchs in Oslo auf, wo er heute lebt. Zwei Jahre studierte er in Stuttgart (und spricht hervorragend Deutsch), arbeitet als Rezensent und Literaturkritiker für die Zeitung Aftenposten und schreibt derzeit an einem neuen Roman. Der große Durchbruch, auch in Deutschland, gelang ihm mit dem Bestseller Choral am Ende der Reise.
Hinrich Schmidt-Henkel studierte Germanistik und Romanistik an der Universität Saarbrücken. Seit 1987 übersetzt er literarische Texte, Prosa, Gedichte und Theaterstücke aus dem Französischen, Norwegischen und Italienischen ins Deutsche u.a. Werke von Denis Diderot, Jean Echenoz, Tomas Espedal, Jon Fosse, Hervé Guibert, Michel Houellebecq, Henrik Ibsen, Erlend Loe, Jo Nesbø, Camille de Peretti, Guri Tuft und Tanguy Viel.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Jedes Leben ist eine Sammlung von Geschichten und Zufällen, die auf wundersame Weise einem Prinzip gehorchen. Davon erzählt Erik Fosnes Hansen in seinem Roman, der den Leser vom Norwegen unserer Tage auf eine schwedische Insel zur Zeit der 1900er Jahre und dann ins Italien der Frührenaissance führt. Mit kunstvoller Leichtigkeit spielt der Autor mit den Grenzen zwischen den Figuren und Epochen, zwischen Raum und Zeit, und schafft somit einen großartigen Roman über die vielen großen und kleinen Ereignisse und Zufälle, die die Welt vor ihrem täglichen Untergang bewahren.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: Beretninger om beskyttelse
© 1998 Erik Fosnes Hansen
All rights reserved
Aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel
© 1999, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Bavaria Bildagentur
ISBN978-3-462-30935-5
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Prolog im Hellen und im Dunkeln
I. Kapitel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
II. Kapitel
1. Kurze Übersicht über die Geschichte des Leuchtturmwesens
2. Fremde am grauen Morgen
3. Der Brunnen
4. Bericht über einen Schmetterling
5. Ein gelungener Spielabend
6. Muss der Assistent gemeldet werden?
7. Erinnerungen an eine Ehe (und an eine Liebe)
8. Eine praktische Vorrichtung
9. Die Stummheit
10. Josefa richtet sich ein
11. Eine Nachricht
12. Noch eine Nachricht
III. Kapitel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
IV. Kapitel
1. Zwischenspiel in der Unterwelt
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Übersetzung der Kapitelmotti
Für meine Mutter
Prolog im Hellen und im Dunkeln
Das Leben ist ein Vogel. Um vier Uhr betrug die Temperatur zwölf Grad. Bereits eine Stunde vor Sonnenaufgang begannen die Vögel in den Laubbäumen auf den Feldern zu singen, erst zaghaft, kleine Klangtropfen in der Luft, dann mit voller Kraft. Das Licht nahm mit den hauchleichten Lebensgeräuschen zu, eine helle Schicht legte sich auf die Oberfläche der Dinge. Laub und Gras schimmerten.
Die gewaltige Masse der Erde rotierte mit unvorstellbarer Kraft und Geschwindigkeit; der Terminator des Planeten, die Grenze zwischen Nacht und Morgen, eilte von Osten heran. Langsam erhob sich die Sonne am Himmel. Zugleich stieg die Temperatur um eineinhalb Grad. Blumen und Bäume waren mit einem Mal von einer unsichtbaren Pollenwolke umgeben. Mit besseren Augen, als wir sie haben, hätte man diese Wolken golden um alle Blütenkronen, alle Weidenkätzchen wirbeln sehen können. Während die Temperatur um weitere zwei Grad anstieg, begann auch das Erdreich Feuchtigkeit auszuatmen, die als unsichtbarer Dampf emporstieg, aus jeder Pore der Erde, jeder einzelnen Pflanzenzelle. Blätter und Halme reckten sich unmerklich, die Vögel sangen, und in den kleinen Sternennebeln aus Pollen und Düften rings um die Pflanzen begannen die Insekten ihre Arbeit mit geschäftigem Summen.
Hätten wir Augen, um das Unsichtbare zu sehen, ja, stünde überhaupt jemand auf der Freitreppe zum Vorraum der kleinen weißen Holzkirche und blickte über Wiesen und Felder, dann könnte er von all dem, was an diesem Morgen im Frühsommer geschieht, doch zumindest etwas spüren. Aber niemand steht dort.
Offensichtlich ist also niemand da, dem voll und ganz bewusst wäre, was heute auf diesem Stückchen Erde geschieht, bei der kleinen Kirche, hier, wo unsere Geschichte beginnen soll. Im Haselgestrüpp hinten an der Umfriedung aus Feldsteinen geht ein Rüsselkäfer seinen Beschäftigungen nach, doch fragen wir ihn nach Auskunft, wackelt er nur verwirrt mit dem Kopf und krabbelt weiter. Gleich daneben begegnen wir einem schniefenden Igel, der sich mit einem Hinweis auf seine Augen und die ihm ganz allgemein fehlende Übersicht entschuldigt, bevor er sich zur Ruhe begibt. Doch hoch oben in der Luft zischt ein Schwarm Turmschwalben umher; zwei von ihnen, sie heißen Kri und Kry, haben bereits mit der Arbeit begonnen und führen dabei ihre schrillen, kreischenden Gespräche. Und um irgendwo zu beginnen, um dafür zu sorgen, dass unsere Geschichte in Gang kommt, wollen wir eine Unterhaltung mit Kri und Kry versuchen, die ganz oben schweben und die beste Übersicht haben.
Kri und Kry (eilig): »Keine Zeit! Keine Zeit!«
Entschuldigung, ich will auch nicht lange stören, aber was gibt es heute?
Kri: »Na ja, dasselbe wie immer. Insekten, wissen Sie. Ich für meinen Teil wohne da unten unter der Traufe der Kirche, außerdem bin ich kürzlich Vater geworden, da habe ich eine Menge zu tun. Weit hinauf zum Essen heute. Weit hinauf. Entschuldigung, Moment mal …« (taucht jäh im Sturzflug nach unten) »… ah jaja. Eine fette. Eine Spinne. Die Kinder lieben diese Sorte. Schmecken wie …«
Kry: »Ich glaube, er meint was anderes, Kri.« (Beiseite:) »Er ist so furchtbar stolz auf die Kleinen. Das erste Mal, wissen Sie.«
Spinne?
Kry: »Ja, wissen Sie das nicht? Viele Spinnen bewegen sich durch die Luft fort, benutzen ihr Netz als Segel.«
Kri: »Juchhu!« (erneuter Sturzflug)
Kry: »Wir müssen in der Luft leben. Wir fangen Insekten und so. Wir werfen uns Windsäulen entgegen und drehen den Bauch zur Sonne, wissen Sie.«
Was für ein Verhältnis habt ihr zur Erde?
Kri (kommt wieder nach oben): »Immer noch nicht alles gefragt?«
Kry: »Ein unbestimmtes Verhältnis, muss ich sagen. Natürlich, wir sehen die Verdunstung und registrieren die Temperaturen dort unten und so. Sie haben Bedeutung für Auftrieb, Turbulenzen, die ganze Thermik, wissen Sie. Ein frisch gepflügtes Feld, kann man sagen, ist schwarz und feucht und gibt viel Auftrieb, wenn die Sonne drauf scheint, an einem Tag wie heute oder so ähnlich. Und natürlich verfolgen wir den Weg der Insekten durch die Luft.«
Kri: »Aha! Insekten!«
Kry: »Aber sonst halten wir doch eher Abstand, um ehrlich zu sein. Wir haben anderswo zu tun. Luftsäulen. Auftrieb über feuchten Senken im Gelände, wissen Sie. Das hat mit der Form unserer Flügel zu tun. Sind Sie vielleicht daran interessiert, noch etwas mehr über Aufwinde und so weiter zu erfahren? Eine große Stadt zum Beispiel steckt voller solcher Bereiche und bietet reizvolle aeronautische Möglichkeiten. Manchmal ausgesprochene Herausforderungen, könnte man sagen. Andere Aufwinde, zum Beispiel an Steilküsten, können regelrecht gefährlich sein. Ein Jugendfreund von mir, eine Passatsturmschwalbe namens Castro, der Ärmste, ist vor ein paar Jahren auf Teneriffa verunglückt, am Vulkan El Teide – Sie kennen vielleicht die starken Winde an den Hängen dort? Nein? Ein Windschacht bis hinauf in die Stratosphäre. Mein Freund war ein Abenteurer, kann man sagen, wissen Sie. Das hatte er von seinem Vater. Musste es versuchen, koste es, was es wolle, und dann war er vom Winde verweht, kann man sagen. Kam als Eisklumpen wieder runter, aber erst drei Wochen später.«
Kri: »Ach ja, der Süden. Ich freue mich schon auf die Reise und auf das Essen dort, exotischer als diese Kohlfliegen hier. Goldlaufkäfer. Bananenfliegen und so. Ägyptische Zikaden. Delikatessen.«
Kry (fährt fort): »Im alten Ägypten glaubte man, die Schwalben würden im Herbst nicht nach Süden ziehen, sondern sich im Nilschlamm eingraben und dort überwintern, wissen Sie. Eine grässliche Vorstellung für eine Schwalbe. Wir Turmschwalben können im Fliegen schlafen, brauchen nicht zu landen. Wissen Sie, über offener See erreichen wir sogar eine relative Fluggeschwindigkeit von bis zu …«
Danke, danke, sehr interessant. Aber beteiligen wir Kri doch noch etwas mehr an unserem Gespräch: Was geht heute dort unten vor?
Kri (hält im Flug nach unten inne): »Bitte was? Ja, nein, da unten liegt ein Toter und glotzt. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Passiert regelmäßig. Meine Kleinen haben sich schon daran gewöhnt. Dann kommen schwarz gekleidete Leute und stehen vor unserer Wohnung und weinen eine Zeit lang, wissen Sie, bevor sie mit diesen … diesen … diesen Dingern wegfahren. Entschuldigen Sie mich.«
Kry (etwas verschnupft): »Ich dachte, er wollte wissen, was wir tun, und jetzt geht es ihm nur um diesen Toten. Ja, die Menschen sind sich selbst immer die Nächsten. Sie wissen nichts von der Freude der Schwalbe in der freien Luft, wissen Sie. Aber nun gut, insoweit hat Kri recht, gestern Abend haben sie ihn gebracht, zusammen mit einer Menge Blumen.«
Also liegt er da schon die ganze Nacht?
Kry: »Die ganze Nacht. Aber lassen Sie mich noch etwas von der Thermik über der offenen See erzählen. Verstehen Sie, direkt über dem Wellenkamm, wenn Wind geht, dann entsteht ein …«
Kri (unterbricht seinen Kollegen): »Ich muss mich für Kry entschuldigen. Die Lebensklugheit der Alten. Flugkünste, wissen Sie. Ja, es stimmt, gestern haben sie ihn gebracht. Entschuldigung.«
War jemand bei ihm?
Kri: »Niemand, nur das Mädchen.«
Hat sie geweint?
Kri: »Sie hat geweint, wissen Sie.«
In der Kirche ist es immer noch dunkel. Unter dem Dach, in der Vierung, wo Kirchenschiff und Chor aufeinandertreffen, hängt das Votivschiff, das kostbar ausgeführte Modell einer Fregatte aus dem siebzehnten Jahrhundert, komplett mit Takelage und Bestückung. Die Kirche liegt nicht weit vom Meer entfernt, und die Gemeinde brachte die Ulrich Christians Kettung aus Kopenhagen am Pfingstsonntag 1721 an. Heute ist sie mit Trauerflor geschmückt, der mit den goldenen Löwenbannern von den Rahen hängt. Langsam schaukelt sie im Dunkeln, segelt, den Bugspriet nach Osten gerichtet (zum Altar und zur aufgehenden Sonne), durch die Nacht und in den Morgen, wie in hunderttausend Nächten zuvor.
Es ist dunkel. Blumenduft hängt in der Luft, süß und schwer.
Draußen geschieht dasselbe wie jeden Morgen, hier drin geschieht nichts. Das Leben ist ein Vogel. Und du bist der Zweig, der wippt und wippt.
Jetzt kommt das Mädchen in die Kirche, öffnet den Instrumentenkasten, setzt sich hin, ihr Cello zwischen den Beinen, und beginnt zu spielen.
Der alte Mann lag in seinem Sarg, er dachte und sah alles, was er nie zuvor gedacht und gesehen hatte. Tot zu sein war anders als alles, was er bislang erlebt hatte. Er lag in der stillen Dunkelheit und blickte zurück; diese Dunkelheit war wie warmes, erlösendes Wasser nach einem langen, langen Arbeitstag. Sich in die Wanne sinken lassen und lächeln und aah! Er spürte dem alten Oberschenkelhalsbruch nach; lustig, wie sich alles veränderte, dass jetzt nicht mehr bei der geringsten Bewegung die Schmerzen sein Bein durchzuckten, bis weit hinauf in den Rücken. Seltsam, ihm war gar nicht aufgefallen, wie wütend und unverträglich ihn das hatte werden lassen. Dieses weiche Dunkel war eine Wohltat, aah!, es ließ alle Mühsal, alle Wut von ihm abgleiten. Aah, zu spüren, wie ein Schmerz nach dem anderen verschwand. Durch die Dunkelheit hindurch sah der Tote all das, was wir anderen nicht erkennen können. Als wäre er drinnen und draußen zugleich, im Sarg und zugleich im Freien. Er war in der Zeit und außerhalb von ihr, und das war einigermaßen neu für ihn. Er konnte alles auf einmal sehen. Er vermochte den Farbenschimmer um die Flügel der Vögel zu sehen, die goldenen Bahnen der Insekten durch die Luft; er erkannte die Wirbel aus Feuchtigkeit und Pollen und ätherischem Dunst um jede Blüte auf der Wiese; von hier, wo er war, konnte er beobachten, wie die Sonne aufging und die Erde sich drehte, und er konnte das Gesicht des Mädchens in dem bläulichen Dämmerlicht dort draußen sehen; er hörte die Musik, die es spielte, aber vor allem, und das war wirklich neu, ungewöhnlich und bemerkenswert, anders als alles, was er jemals erlebt hatte: Er hörte nicht nur die Musik, die in der Luft schwebte und deren Vibrationen sich durch den Steinboden und die Holzbalken fortpflanzten bis zu seinem Sargdeckel, nein, er hörte auch die eigentliche, die gedachte Musik, die Musik hinter der Musik (und das war wohl auch besser so, denn das Mädchen spielte meist nicht sonderlich gut). Das war ganz ungewöhnlich wunderbar und ganz anders als alles andere. Ja. Er musste lächeln. Und sein Lächeln wurde zu einem Licht in dem freundlichen Dunkel, in dem er sacht schwebte. Anders als alles, was er je erlebt hatte, und er hatte allerhand erlebt, oh ja, ja, wirklich so allerhand. Er sah das Gesicht des Mädchens dort draußen inmitten der Musik, aber nicht nur ihr Gesicht, sondern auch das eigentliche (dahinter), und wieder lächelte er (zu lächeln war jetzt ganz anders) und dachte, oh ja, ja, aah, wäre ich noch jung, so jung, wie ich mich jetzt fühle, und da draußen mit dir (oder da drinnen, komisch, wie wenig Unterschied das noch macht, draußen oder drinnen, aah!), wäre ich da draußen mit dir, wäre jung und stark und braun gebrannt und sehnig, dann würde ich dich unterhaken und mit dir hinauslaufen, über die Wiesen, ich würde dich in tiefe Grubenstollen mitnehmen oder hinauf auf hohe Berge, um den Sonnenaufgang zu sehen. Ich würde dir (aah!) die ganze Welt zeigen, die mir einst gehört hat, die ich gottesgleich beherrschte, als ich jung war, ein junger Mann, und wie ein Jäger der Welt alles entriss, was sie an Geheimnissen und Reichtümern zu bieten hatte – und ich würde an dir riechen (der alte tote Mann schämte sich nicht mehr, so etwas zu denken), schnuppern, schmecken, lächeln. Ich würde gemeinsam mit dir zuschauen, wie der Morgen kommt.
Auf einmal wurde ihm klar, dass er die Welt schmerzlich vermissen würde, fast hätte er angefangen zu weinen, aber es war kein Weinen (es war jetzt anders, alles, aah!, alles war anders), es war etwas anderes.
Ihr Gesicht –
Trauer, dachte er, Trauer über alles, alles was
Aber er wusste, dass dieser Zustand nicht andauern würde, dass dies ein Zwischenstadium war und er selber bald aufbrechen würde. Noch ein wenig, ein kleines Weilchen würde er hierbleiben, um dann fortzureisen, zusammen mit dem Brausen des Lichts und dem Gesurre der Insekten. Noch ein bisschen. Er hatte alles andere abgelegt, als wären es Kleidungsstücke, und genauso würde er auch die Erinnerungen ablegen. Alles, was er im Gedächtnis trug. Und zwar nicht nur auf ihn begrenzt. Heute Morgen wusste er fast alles.
Jetzt beendet sie die Chaconne, legt den Bogen aus der Hand und packt das Instrument in den Kasten, geht in die Sakristei hinaus. Es ist in der Kirche hell geworden während ihres Spiels, der Tag ist da, und unsere Erzählung kann beginnen.
I.
1.
Tantus amor florum
et generandi gloria mellis.
Vergil: Georgica, IV
Der Alte war endlich tot, und es wurde eine prächtige Trauerfeier. An nichts hatte man gespart. Die Kirche war vom Altarraum bis in den Vorraum hinaus mit Blumen geschmückt, von nah und fern waren Kränze gekommen, von Kollegen und Konkurrenten, von Lloyd’s of London, dem Ministerium und dem Industrieverband. Sogar das Königshaus hatte einen Kranz gesandt. Und da der Alte seine schützende Hand über ein paar Maler gehalten hatte, waren auch Kränze von ihnen und vom Künstlerbund da. Die Familie war selbstverständlich mit großen und kleinen Gestecken vertreten, es gab Kränze von der griechischen und der japanischen Botschaft sowie von mehreren großen Handelshäusern aus dem Ausland. Einem unvoreingenommenen Betrachter all der Blumenpracht in der alten Kirche hätte es tatsächlich so erscheinen können, als wäre der Alte ein viel geliebter Mann gewesen, doch Kränze von Freunden hätte man vergebens gesucht, denn Freunde hatte er nicht gehabt. Jedenfalls nicht in den letzten Jahren. Er war ja sehr, sehr alt geworden, und seine wenigen Jugendfreunde waren lange vor ihm in die Grube gefahren. Auf seine Weise hatte der Alte gewiss auch dazu beigetragen, manchen Freunden ein vorzeitiges Grab zu bescheren, mit seinem nörgeligen, überkomplizierten Wesen, seinen ewigen Einfällen, Verrücktheiten, Launen und Wutanfällen, die jedem, der ihm nahestand, schlaflose Nächte und aufreibende Tage gebracht hatten. Er war einer jener Menschen gewesen, die andere aussaugen, ihre Kräfte für sich nutzen, und vielleicht war er darum so alt geworden. Geizig war er auch gewesen. In den letzten dreißig Jahren hatte er überhaupt keine Freunde mehr gehabt, und darum lag in dem Eichensarg dort oben beim Altar trotz all der Blütenherrlichkeit ein einsamer Mann, geachtet zwar um Macht und Ehren willen, aber doch einsam. Die Leute hatten sich vor dem Sarg verneigt, in der Reihenfolge ihres Eintretens, hatten sich vor den Bergwerksbetrieben verneigt, vor den Reedereiaktien und der Kunstsammlung, vor den Fruchtimporten und dem großen Anteilspaket an der Papierindustrie, doch niemand hatte sich vor ihm als Freund verneigt. Seine Frau war früh verstorben, Kinder hatte er keine, dafür eine große Schar von Neffen und Nichten, Großneffen und Großnichten und Verwandten zweiten Grades sowie zahllose entferntere Sprosse des Stammbaums, die sich jetzt erwartungsvoll in den vordersten drei Bankreihen drängten. Ein solches Familientreffen hatte es nur selten gegeben. Wirklich nahegestanden hatte ihm keiner. Und trotz aller schönen Gedenkansprachen, trotz der ungewöhnlich ausgefeilten Trauerrede – der Pfarrer leuchtete von der Kanzel herab wie eine sorgenschwere Apfelsine – hatte keiner ihn wirklich gekannt. Mit vielleicht einer Ausnahme. Und die war es, die alle fürchteten.
Freundlich und blass schien das Sonnenlicht zu den Worten des Pfarrers durch die Fenster, die Blumengebinde schimmerten in frühlingshaften Pastellfarben und versetzten die ganze Gemeinde in Feststimmung. Selbst die Mollklänge der Orgel konnten den Eindruck nicht zerstreuen, dass zwischen diesen weißen Holzwänden etwas Schönes, etwas Richtiges vor sich ging. Die Freude der Familienangehörigen wäre vollkommen ungetrübt gewesen, hätte da nicht ein wenig versteckt in der dritten Reihe dieses Mädchen gesessen.
Ab und zu schielten sie zu ihr hinüber; doch, ja, sie wirkte niedergeschlagen, aber nicht allzu sehr. Meist hielt sie den Blick auf ihr dunkelblaues Cordkleid gesenkt. Selbst genäht sah es aus. »Zu dumm, diese langen Ärmel«, flüsterte Tante Gussi Tante Ella zu, die auf einmal ganz dringend in ihr Gesangbuch schauen musste. Gussi konnte auch nie an sich halten. Ob das mit dieser Tätowierung wirklich stimmte? Den legendären Ring in der Nase hatte jedenfalls keiner entdecken können, den Peder immer den Halbstarkenring genannt hatte, was auch immer er damit meinen mochte. Offenbar ließ er sich für besondere Anlässe abnehmen.
»Heute, da wir uns verabschieden müssen«, sagte der Pfarrer. Mitten in der vordersten Reihe saß Onkel Christian im dunklen Anzug bedrückt neben seinem Bruder Peder. Direktor Christian Bolt war für die Führung der Geschäfte verantwortlich, und alle rechneten damit, dass er. Ja. Wer denn sonst. Er selber war sich da nicht so sicher. Er linste über die Schulter zu dem Mädchen, das dort hinten saß und in seinen Schoß blickte. Er sah nur die Haare, nicht das Gesicht. Gott weiß, was sich der Alte hatte einfallen lassen. Peder würde sich diebisch freuen. Christian Bolt war von der Vorstellung wenig erfreut. Und es schwante ihm, dass der Alte das eine oder andere ausgeheckt hatte, um ihn, Christian, zu ärgern. Die beiden Brüder waren in den Fünfzigern und sahen einander ähnlich wie zwei Aktendeckel. Peder war der Jüngere und hatte als stellvertretender Direktor kaum etwas zu tun; er war stets sonnengebräunt. Christian betrachtete die dunkle Hand seines Bruders, die neben seiner eigenen blassen auf der Bank lag, er fühlte sich müde und überarbeitet und spürte in Stunden wie dieser, dass er allzu schnell dem endgültigen Erbleichen zusteuerte. Peder sollte bloß nicht denken, dass ihm etwas erspart geblieben wäre. Die Arbeitstage im Dienst des Alten waren zermürbend lang gewesen, und der hatte ja nie sterben und schon gar nicht etwas aus der Hand geben wollen. Gott weiß, auf was für Ideen er gekommen war. Christian blickte noch einmal verstohlen zu dem Mädchen.
»Doch der Tod ist ein Freund«, tönte der Pfarrer, »der erlöst und öffnet.« Die Ansprache zog sich hin, und die Trauergemeinde blickte allmählich gen Himmel. Komische Sitte, dachte Tante Gussi, ein Schiff unter das Dach zu hängen. Draußen lockte der helle Frühsommermorgen, und schon für den Nachmittag hatte Advokat Holst die Testamentseröffnung im Haus des Alten anberaumt. Es gab so manches, was die Aufmerksamkeit von den Worten des Pfarrers ablenkte.
Trotz Verschwiegenheitspflicht und Diskretion war es der Familie zu Ohren gekommen, dass der Alte in seinem letzten Jahr einmal in der Stadt gewesen war, und zwar beim Rechtsanwalt. Plötzlich hatte er in der Tür der ehrwürdigen Kanzlei im zweiten Stock gestanden, hatte die Treppen ohne Hilfe erklommen und einen fürchterlichen Aufstand gemacht, weil die Sekretärin ihn nicht sofort erkannte, sondern im Gegenteil fragte, ob er einen Termin habe, und außerdem, weil Advokat Holst nicht über die telepathischen Fähigkeiten verfügte, um das unerwartete Auftauchen des Alten vorherzusehen, und demzufolge außer Haus war. Der Alte war wie ein Komet von der unberechenbaren Sorte, der meist durch ferne, unsichtbare Sphären zieht und sich und sein Licht nur alle Jubeljahre wieder der Welt zeigt. Mithilfe des Mobiltelefons wurde der Anwalt ausfindig gemacht; er saß gerade bei einem wichtigen Termin in einer Bank, die Konkurs gemacht hatte, und wurde blass, als er hörte, wer in seiner Kanzlei stand, dort tobte, dass das Mahagoni nur so widerhallte, und sich auch mithilfe von Pulverkaffee nicht zur Ruhe bringen lassen wollte. Advokat Holst verließ unmittelbar die versinkende Bank und fand sich bereits vierzehn Minuten darauf in der Kanzlei ein; sein persönlicher Streckenrekord. Er verschwand mit dem Alten im Besprechungszimmer, wo sie längere Zeit blieben. Der Anwalt hatte die Mappe mit dem Testament kommen lassen, und Andersen, das Faktotum des Alten, musste gemeinsam mit einem ehrwürdigen Kollegen des Anwalts irgendetwas bezeugen. Dann fuhr Andersen den Alten nach Hause. Das war das letzte Mal, dass man den Erblasser in der Stadt gesehen hatte. Wirklich, es bestand durchaus Anlass zur Sorge.
Der Pfarrer hatte manches aus dem langen und abenteuerlichen Leben des Alten zu erzählen, von damals, wie er, noch jung, in den dreißiger Jahren als Geologe in Afrika nach Gold schürfte und gleichermaßen Malaria und Mordanschläge überlebte, über die geheimnisumwitterten Jahre, in denen er sich angeblich im Fernen Osten herumtrieb, unterwegs in Sachen Kautschuk und anderen Verrücktheiten, und eine neue, revolutionäre Methode zur Destillation von Gummi erfand, die ihn noch reicher machte, bis zu der Zeit, als er während des Krieges in London wieder auftauchte und dadurch Aufsehen erregte, wie er bei König Haakon VII. auf Foleijon Park zum Lunch erschien, in Tropenanzug und Sandalen – mitten im Januar. Für die Ereignisse nach dem Krieg musste der Pfarrer dann seinen Spickzettel zu Hilfe nehmen. Dass der Alte bei Direktionssitzungen gern Gläser an die Wand feuerte und seine erschöpften Brüder vorzeitig ins Grab brachte, blieb allerdings unerwähnt. Stattdessen sagte der Pfarrer etwas über seinen Einsatz für die Künste. Nachdem der Alte hierher umgezogen war, auf den Familiensitz Ekelund, sah man ihn immer seltener in der Hauptstadt, doch die Handelsgesellschaft führte er nach wie vor mit eiserner Hand, und in regelmäßigen Abständen berief er die Familie ein, um ihr die Leviten zu lesen. In dieser Zeit entwickelte er einen Hang zur Wissenschaft und begann mit der Begeisterung eines senilen Alchimisten Geld für wahnwitzige Projekte zu verschleudern, Kernphysik, Zoologie, Gartenbau, und Ekelund mit merkwürdigen Tieren und Dingen zu füllen, bis er in seiner großen, undurchdringlichen Einsamkeit verschwand und sich vollkommen isolierte. Die Familie hatte zähneknirschend zugesehen. Aber auch darüber sagte der Pfarrer nichts.
In den letzten Jahrzehnten seines Lebens war er so gut wie unerreichbar gewesen, lebendig in seinen Studien begraben, auf dem prunkvollen Ekelund mit seiner Kunst, dem Garten und den Bienen.
Freilich – eine Ausnahme gab es. In seinem allerletzten Lebensjahr hatte das alte und tyrannische schwarze Schaf der Familie in seiner hochmütigen Einsamkeit Gesellschaft bekommen von einem schwarzen Lamm, einer etwas seltsamen Großnichte. Lea. Erst nach Monaten hatte die Familie erfahren, dass Lea jetzt draußen auf Ekelund wohnte, dem Alten im Garten und bei den Bienen zur Hand ging und ansonsten Andersen im Haushalt half. Es passte eigentlich haargenau zum Charakter des alten Bolt, dass er ausgerechnet sie ins Herz geschlossen hatte. Äußerst beunruhigend war das. Als Kind war sie recht niedlich gewesen, erinnerte man sich, ernst und ein wenig altklug, ein bisschen abwesend auch, hatte schwarze Schleifen im Haar getragen – immer schwarze Schleifen, die ihre verwitwete Mutter ihr band. Aber dann kamen die schwierigen Jahre, und die schwarzen Schleifen verschwanden unwiederbringlich. Wahrscheinlich glich Lea ihrer Mutter. Oder schlicht und einfach ihrem Großonkel. Wie auch immer: Irgendwie waren diese beiden wilden Triebe der Familie, der alte Mann und das Mädchen, einander begegnet, und nun warf die Familie verstohlene Blicke auf die Person in der dritten Reihe, während der Pfarrer sprach und sprach, über die Auferstehung und das Leben; immer noch schaute sie reglos in ihren Schoß, ihr Gesicht war kaum zu sehen unter dem hellblonden Haarschopf. Es schauderte die anderen bei dem unheimlichen Gedanken an die Symbiose der beiden im letzten Jahr auf Ekelund. Gott weiß, wohin so etwas führen konnte.
So kreisten die Gedanken der Familie.
»Und Gottes Frieden«, zitierte der Pfarrer, »der allen Verstand übersteigt, möge Eure Herzen und Eure Gedanken behüten.«
Lea dort in der dritten Reihe dachte an die stille Fahrt im Krankenwagen und an das Gesicht des Alten, so hilflos und ängstlich wie das eines Säuglings. Seine Hände hatten suchend nach ihren getastet. Die Reifen sangen unaufhörlich in der feuchten Frühlingsnacht. Und die seltsame Empfindung von Zeit, von unendlich viel Zeit, dass es mit nichts Eile hatte, wie sie da fuhren. Sie erinnerte sich an den eigenartigen, beruhigenden Blick, den er ihr zuwarf, als sie das Krankenhaus erreichten, freundlich und resigniert zugleich, während sie ihm sacht übers Haar strich. Es war klamm von kaltem Schweiß. Sie hatte es nie zuvor berührt. Lea dachte daran, was er ihr zugeflüstert hatte, kurz bevor sie mit den Schläuchen kamen, als alles auf einmal so schnell ging, und sein Blick wirkte wie von Rauch durchwölkt. Lea saß da, blickte in ihren Schoß und dachte, dass er als Einziger in der Familie wirklich zu ihr gewesen war, bis zum letzten Abend.
»Meine Brüder!«, zitierte der Pfarrer. »Ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich’s ergriffen habe. Eins aber sage ich: ›Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel.‹«
Lea sah ihren Großonkel vor sich, wie er ihr hinter seinem weißen Bart hervor etwas schroff und abwartend zulachte, während sie mit angststarren Händen zum allerersten Mal einen seiner Bienenkästen öffnete, er lachte, als fragte er sich, ob sie überhaupt zu etwas tauge. Lea wusste es selber nicht.
Taugte sie zu etwas?
»Ich frage mich immer wieder«, hatte er damals gesagt, wie aus weiter Ferne im Sonnenlicht jenes Tages, »woher das Bienenvolk schon vor Tagesanbruch wissen kann, dass genau heute der Klee blühen wird, und dorthin fliegt, und am nächsten Morgen wissen sie genau, heute ist die Zeit der Heideblüte gekommen, und brechen in eine ganz andere Richtung auf. Woher können all diese kleinen Tierchen gleichzeitig wissen, mit ihrem winzigen Gehirn, ohne allgemeine Kenntnisse, dass sie heute diese und morgen jene Wiese besuchen müssen?«
Die betäubten Bienen umsummten sie schläfrig, es roch kräftig nach Rauch und Bienenwachs. Die Zehntausende krabbelnder Insekten waren für Lea ein etwas unbehaglicher Anblick, ihr Haar sträubte sich leicht, aber das Gesicht des Alten wirkte unerschütterlich hinter dem feinen schwarzen Imkerschleier. »Überhaupt«, sagte er und ließ den Rauchbläser sinken, »geht es darum, zu wissen, ohne zu wissen.«
»Wissen, ohne zu wissen?«, musste sie fragen.
»Und wollen, ohne zu wollen. Wenn du zu stark willst, zerbröselt dir alles zwischen den Händen. Dann zweifelst du immerzu. Sobald du die Fäden aus der Hand gibst, kommt alles zu dir. Dann weißt du, ohne zu wissen.«
»Gilt das auch für Geschäfte, Onkel?«, fragte sie mit mildem Spott und bereute es sogleich, aber er schien es ihr nicht übel zu nehmen.
»Für die Geschäfte auch. Halt das bitte mal kurz.« Er gab ihr den Rauchbläser. Langsam und vorsichtig hob er eine Wabe heraus, von der es golden tropfte. »Es gilt eigentlich für alles, was man tut«, brummte er, »oder sollte es zumindest. Egal was. Pass jetzt auf, man muss sich ganz langsam bewegen, sonst werden sie aggressiv. Mach es mir nach.«
Aber Lea erinnerte sich auch an den allerersten Tag, als sie im Regen vor dem großen Haus gestanden und angeklopft hatte, ohne irgendetwas zu wollen, ohne zu wissen, wie sie hergekommen war, fast ohne zu wissen, wer sie selber war.
»Wer bist du überhaupt?«, bellte er. Er ragte in der Tür auf, hochgewachsen und mager, weißhaarig und Furcht einflößend stand er in Gummistiefeln da und musterte sie. In seinen Augen glommen Alter und prähistorische Wut. »Schau an!«, fauchte er, als sie ihren Namen gesagt hatte. Missbilligend betrachtete er ihren Rucksack, die durchnässte Kleidung. »Du kannst nicht hierbleiben. Ich empfange grundsätzlich keine Gäste. Andersen bringt dich zum Zug.« Was sollte sie darauf erwidern? Von frühester Kindheit an hatte sie gehört, wie unerträglich er war, schroff und geizig und familienfeindlich; hatte all diese Geschichten über die seltsamen Dinge gehört, mit denen er sich beschäftigte, hatte gehört, dass er Familienmitgliedern den Zeitaufwand für die Lektüre ihrer Briefe minutengenau in Rechnung stellte, all diese halblauten Andeutungen von Entmündigung und Zwangseinweisung. Doch ein Greis, der ohne fremde Hilfe zehn Bienenvölker und einen Park voller Treibhäuser versorgte, ließ sich nicht so ohne Weiteres entmündigen. Als Lea den Alten damals kennenlernte, war sie starr vor Furcht und wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie wusste nur noch, dass sie durchnässt war. Also sagte sie nichts. Der Alte bedachte sie mit einem unheilvollen Blick, machte auf dem Absatz kehrt und verschwand im Haus. Sie sah, dass er hinkte. Die Tür fiel schwer hinter ihm zu.
Dann, während sie auf der Schwelle saß und über den Kies der Auffahrt blickte, kamen ihr die Tränen. Sie klammerte sich an ihren Rucksack, umarmte ihn, als wäre er ein alter Reisegenosse, der alles gesehen hatte und alles verstehen würde. Als die Tür wieder hinter ihr knirschte, dachte sie, es sei dieser Andersen, der sie wieder in die Welt hinausbringen sollte, zurück in die Brandung, aus der sie sich eben an Land gerettet hatte. Aber es war der Alte selbst:
»Na gut. Es ist schon spät. Wahrscheinlich geht kein Zug mehr. Ich bin ein schlechter Gastgeber. Kommst du bitte herein.« Er bat nicht um Entschuldigung, das wäre nicht seine Art gewesen. Aber er sagte: »Wir haben ein Zimmer, wenn du dich damit begnügen willst. Bis morgen«, brummte er. Dann kamen ein paar starke Hände, sie gehörten Andersen, und halfen ihr auf die Beine. Vom Weg in den ersten Stock wusste sie später nicht mehr viel, erinnerte sich verschwommen an dunkle Möbel und einen Gobelin im Treppenhaus und außerdem an den Blick, mit dem der Alte ihr nachsah, als sie so zu Bett geführt wurde. Ein wenig bekümmert wirkte er. Ein wenig. Dann erinnerte sie sich an weiche Laken und daran, dass der Schlaf kam wie ein sanfter Kuss. Im letzten wachen Augenblick dachte sie noch: Hoffentlich ruft er nicht bei mir zu Hause an. Als sie aufwachte, hatte sie eine Nacht und einen halben Tag lang geschlafen. Leise flogen Bienen gegen die Fensterscheibe, das Zimmer war sonnendurchflutet. Draußen war alles grün und licht. Eine Zeit lang war es ruhig in ihr, sie schlüpfte aus dem Bett, schaute aus dem Fenster. Dort lag der Garten mit seinen Blumen, der Garten, von dem so viel Märchenhaftes erzählt wurde, und da, hinten in der Ecke, tapste etwas Braunes auf zwei Füßen umher, ein altersweises Augenpaar schaute sie an, Schreck im Blick. Dann verschwanden die Augen hinter Himbeersträuchern und kamen nicht wieder zum Vorschein. Die märchenhaften Berichte stimmten also.
Sie stand in T-Shirt und Slip da. Ihre Kleidungsstücke lagen auf dem Stuhl neben dem Bett, der Rucksack wartete daneben. Ein schlichtes, altertümliches Zimmer mit Waschschüssel und Nachttopf. Die Möbel waren alt und dunkel, Laken und Kopfkissenbezug weiß und gestärkt, den Bettbezug verzierte Damaststickerei. An der Wand hing ein kleines Aquarell mit einer lesenden jungen Frau, sonst nichts. Der Strich kam ihr bekannt vor, aber das Bild war nicht signiert. Auf dem Tisch stand ein Tablett mit einem weißen Tuch, darauf ein Teller mit vier Brotscheiben, zwei mit Kreuzkümmelkäse und zwei mit Leberpastete, dazu ein Becher Milch. Eine Thermoskanne mit Kaffee zog zischend Luft. In diesem Moment war sie fast glücklich, alles war leicht und licht und ruhig. Sie aß und blickte zu den Bienen hinaus.
Er hatte nicht bei ihr zu Hause angerufen.
Erde polterte auf den Sargdeckel. Alle erhoben sich. Lea lauschte. Sie überlegte, ob er in jener ersten Nacht wohl an ihrem Bett gestanden und sie beobachtet hatte, während sie schlief, ob er alles, was er wissen wollte, von ihrem nächtlichen Gesicht abgelesen hatte, von den kindhaften Unterwasserbewegungen, die der Schlaf uns verleiht, aus ihrer Mimik und den Gesten, die sie selber nicht kannte. Hatte er sie da auserwählt? Hatte er da alles begriffen? Hatte er an ihrem Bett gestanden und den Satz vom Zufall gesagt? Lea lauschte. Aus weiter Ferne hörte sie den Pfarrer, wie er den Segen sprach, näher hörte sie, wie der Alte sich über ihr schlafendes Gesicht beugte, er flüsterte in das Zimmer hinein (sie hörte beides zugleich), und sie wusste, dass er ihr Freund gewesen war:
»Der Herr segne und bewahre dich – Du kannst wohl doch eine Weile hierbleiben – Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig – Der Zufall – naja, sicher hat der Zufall dich hergeführt – Der Herr erhebe sein Antlitz zu dir und gebe dir Frieden – Man soll den Zufall nicht unterschätzen.« Aber sie wollte nicht weinen, nicht jetzt.
Die Trauerfeier war zu Ende. Der Alte sollte eingeäschert werden; es gab keine Zeremonie am Grab. Die Gäste traten gemessenen Schritts ins Freie, doch Lea war schon draußen, eilte allen voraus. Dort stand schon Andersen und erwartete sie mit dem Bentley; sie hatte ihn nicht darum gebeten, aber er wartete, stumm wie stets, aufrecht und fast etwas abwesend, die Schirmmütze unter dem linken Arm, die Rechte an der rechten Hintertür. Kurz wollte sie weiterlaufen, immer weiter über die knirschenden Kieswege, wie sie es schon einmal getan hatte, aber dann duckte sie sich folgsam in den Wagen, verschwand aus dem Blickfeld der übrigen Trauergäste, die noch auf der Kirchentreppe waren, Tanten, Onkel und Vettern äugten neugierig hinter ihr her ins Licht. Andersen warf die Tür zu, setzte sich hinter das Steuer und fuhr ab.
2.
Pfarrer Sørensen machte eine letzte Runde durch die Stuben auf Ekelund und reichte allen die Hand. Mein Beileid. Mein Beileid. Die Familie hatte sich über die Zimmer verteilt und studierte Bilder und Einrichtungsgegenstände; es war äußerst interessant hier, kaum einer von ihnen hatte je den Fuß in dieses Haus gesetzt. Manchmal besannen sie sich und senkten die Stimmen, aber bald ertönte ein neuer Bewunderungsruf, und alle reckten die Hälse nach einem weiteren kostbaren Gemälde, und da, noch eins, nach einer Chippendale-Kommode oder noch einer Anrichte; der Pfarrer fühlte sich beklommen beim Anblick dieses Schwarms schwarz gekleideter Flamingos. Zerstreut erwiderte man seinen Händedruck und sagte »Auf Wiedersehen« und »Vielen Dank für die Ansprache«, dann verschwanden die Gesichter wieder in der Möblierung. Serviererinnen schwebten mit Gläsern und Schnittchen umher. Das Parkett knarrte, es duftete nach teuren Zigarren. Der Pfarrer sah sich um, eine war da noch, von der er sich gern verabschiedet hätte. Denn wenn er an die Feier heute früh dachte – nein, ehrlich gesagt, daran dachte er eigentlich nicht. Er blickte in die Runde und sah sich die trauernden Hinterbliebenen an und bereute mit einem Mal den verfänglichen Fleiß, den er auf die Rede verwandt hatte. Er sollte alt genug sein, sich nicht mehr von der dicken Brieftasche eines Verstorbenen beeindrucken zu lassen, aber vielleicht war das nicht zu vermeiden. Nein, eigentlich dachte er viel eher an die Morgenstunde vor der Trauerfeier. Er hatte in der Sakristei gesessen und voller Begeisterung an seiner Ansprache gefeilt, als auf einmal Töne aus der Kirche erklangen. Er hatte nicht gewusst, dass jemand dort war.
Er war zur Tür zwischen Sakristei und Kirchenraum geschlichen, hatte hineingeschaut und sie mit dem Cello gesehen, oben beim Sarg. Kurz erwog er, hineinzugehen und sie anzusprechen, aber sein Einfühlungsvermögen bewahrte ihn davor. Das ist ein Abschied, schoss ihm durch den Kopf. Am besten, ich gehe. Er zog sich still und leise in seine Schreibstube zurück.
Er hatte noch genügend Zeit für seine Vorbereitungen. Selbst in sein Zimmer drang der Blumenduft, die Luft war schwer von ätherischen Ölen und Pollen. Er putzte seine Brille, feilte noch etwas an seiner Predigt herum, wollte eine verbotene Zigarette rauchen, doch der Blumenduft genügte schon. Die ganze Zeit hörte er die Cellotöne aus dem Kirchenschiff. Das Mädchen improvisierte jetzt völlig frei, das war nicht mehr Bach, nur noch bachsche Strukturen, lauter gebrochene Akkorde. Ihm wurde vom Zuhören fast schwindlig. Draußen stand die Sonne voll am Himmel, klares Morgenlicht herrschte. Dann blieb es lange still, bis er die Verschlüsse des Cellokastens klicken hörte. Sie kam in die Sakristei, erblickte ihn durch die offene Tür, stand da wie angenagelt.
»Sehr schön war das«, sagte Pfarrer Sørensen. »Werden Sie auch bei der Trauerfeier spielen?«
Sie errötete, schüttelte den Kopf. Dann verschwand sie wieder durch die Tür.
Kurz darauf betrat er die Kirche. Sie saß weiter hinten, im Querschiff. Er ging zu ihr. Sie saß da und schaute auf ihre Hände hinab, fast, als wäre ihr alles gleichgültig. Er konnte nicht feststellen, ob sie geweint hatte, aber es waren noch knapp zwei Stunden bis zur Feier, und der Pfarrer spürte eine leichte Sehnsucht nach menschlichem Kontakt.
»Soll ich Ihnen die Kirche zeigen?«, fragte er.
Sie standen oben im Kirchturm, die Schwalben flogen schreiend ein und aus. Lea streichelte mit der Hand über die bronzene Wölbung der großen Glocke. Glatt und kühl war sie, wirkte aber dennoch porös.
Hier steht etwas, sagte sie.
Stimmt, sagte der Pfarrer. Das ist eine alte Glocke. Können Sie es lesen?
Sie beugte sich im Halbdunkel darüber.
Ja, schon, sagte sie, aber ich weiß nicht, was es bedeutet.
Lesen Sie vor, dann übersetze ich es Ihnen.
DEUM LAUDO : VIVOS VOCO : MORTUOS PLANGO : FULGARA FRANGO
Es ist eine alte Glocke. Das ist Latein.
Ist das eine Liedzeile?
Nein, das ist der Glockenspruch. Er bedeutet: Ich preise Gott, ich rufe die Lebenden, ich beweine die Toten, ich zähme den Blitz.
Hm. Zähme den Blitz?
Ja. Benjamin Franklin hat den Blitzableiter erfunden, indem er bei Gewitter einen Drachen steigen ließ und den Blitz zur Erde leitete. Die Kirche protestierte scharf gegen solche neumodischen Sachen, denn es war seit über tausend Jahren Brauch, den Blitz zu zähmen und die Natur zu besänftigen, indem man Kirchenglocken läuten ließ, unablässig, solange ein Gewitter dauerte. Und das, obwohl viele Glöckner und Kirchendiener, die an den Glockenseilen hingen, umkamen, wenn der Blitz oben in die großen Bronzeglocken in den Türmen einschlug.
Hm, machte sie wieder.
Das ist eine alte Glocke und eine alte Kirche.
Ich glaube nicht an Gott. Absolut nicht.
Nein, nein.
Und jetzt werden Sie für mich beten, nehme ich an.
Unbedingt. Jeden Abend.
Danke für die Besichtigung.
Danke für die Musik. Bald kommen wahrscheinlich die ersten Gäste.
Wahrscheinlich. Ich muss zu meinem Platz zurück.
Da mittendrin?
Ja.
Warum so weit vom Sarg entfernt?
Ach. All diese Leute. Ich sollte vielleicht überhaupt nicht hier sein, aber ich dachte, scheiß auf die Leute.
Hmhmm.
Entschuldigung.
Ich habe gehört, dass der Alte in der letzten Zeit gut aufgelegt war.
Wie man’s nimmt.
Er hätte dich sicher lieber ganz oben neben dem Sarg.
Na ja. Aber jetzt ist er nicht mehr da und kann nicht mehr nörgeln.
De mortuis nil nisi bene.
Ach ja? Und das heißt?
Über Tote soll man nicht schlecht reden.
Aber muss man gut über sie reden?
Nein.
Eigentlich darf man nur so wenig wie möglich sagen.
Ja.
Man darf die Trauer den Glocken überlassen.
An dieses Gespräch dachte Sørensen zurück. Ach, da war sie ja. Lea stand in der Bibliothek, da waren am wenigsten Leute, mit einer von ihren Tanten, einer rosigen Frau in den Fünfzigern; als der Pfarrer das Gespräch unterbrach, wirkte das Mädchen erleichtert.
»Ach guten Tag, lieber Herr Pfarrer«, sagte die Rosige.
»Mein Beileid«, sagte Sørensen und ergriff ihre Hand in der Weise, wie er es gelernt hatte; er hob sie gewissermaßen ein wenig seinem Gesicht entgegen. Die Rosige entfernte sich. Von hinten wirkte sie ganz schwarz.
Lea nickte ihm zu.
»Ich glaube, dein Cello steht noch in der Sakristei«, sagte er.
»Kein Problem«, meinte sie. »Es gehört mir nicht.«
»Nein ?«
»Nein …« Sie zögerte. »Es war seins, wie alles andere auch. Er hat es für mich angeschafft.«
»Dann wollte er sicher, dass du es behältst.«
»Wirklich kein Problem«, sagte sie.
Der Pfarrer stand da und wusste nicht recht, was er sagen sollte.
»Es gibt so wenig, was man behalten kann«, sagte er und merkte sofort, wie dumm sich das anhörte.
Sie lächelte schief.
»Pfarrer zu sein, das muss Spaß machen«, sagte sie. »Da kommt man so viel unter die Leute.«
Der Pfarrer nahm sich gewaltig zusammen.
»Ja. Aber am meisten Spaß macht es manchmal, wenn man wieder weggehen kann«, sagte er.
Sie schaute ihn befriedigt an.
»Klopf ruhig bei mir an«, sagte er, »wenn du vorbeikommst, um dein Instrument zu holen.«
»Ich glaube nicht, dass ich das tun werde«, sagte sie. »Aber danke trotzdem.«
Bleierne Stille herrschte in dem großen, altmodischen Arbeitszimmer, dem Kontor, wie es im Hause genannt wurde. Mit einem gewissen Unbehagen sah die Familie sich um, die Begeisterung von zuvor hatte sich gelegt, jetzt war die Stunde des Ernstes gekommen. Sie ließen alle Teile des Raumes auf sich wirken, das Achteckfenster ganz oben, auf dem mittelalterliche Handwerkszünfte als Glasmalerei dargestellt waren, die Ölgemälde, einige davon ein Vermögen wert, ein Braque, ein Cézanne, ein Munch – ein prachtvoller Munch –, und acht kleine Akte von Zorn, frivolerweise direkt an der Wand hinter dem Bürostuhl platziert, sodass dem Unglücklichen, der auf dem Besucherstuhl saß, ganz wirr im Kopf hatte werden müssen beim Anblick von Wilhelm Bolts Bulldoggengesicht und den Verlockungen gleich dahinter. Es hatte immer so ausgesehen, als würden die Damen über den Ärmsten, der schwitzend dasaß, höhnisch lächeln, verführerisch und spöttisch: Du kriegst uns nicht, wir sind Wilhelm Bolts Harem – die Frauen hatten immer auf Wilhelm Bolts Seite gestanden! Das war so ungerecht.
Große Protokollbücher standen in den Regalen hinter dem Tisch, es gab Vitrinen voller Kristalle, auf einem Ecktisch stand ein großes altes Mikroskop, auf dem Schreibtisch befand sich eine Unterlage aus Leder mit Goldprägung. Darauf stützte sich jetzt der Anwalt; er saß im Bürostuhl und hatte die Papiere vor sich ausgebreitet.
Advokat Holst räusperte sich, schob seine Brille auf die Nasenspitze und begann:
»Es war der Wunsch des Erblassers, dass alle, die in seinem letzten Willen bedacht werden, sich unmittelbar nach der Trauerfeier zur Verlesung des Testaments in seinem Heim einfinden mögen. Wie Ihnen bekannt ist, übergab er bereits in den letzten Jahren vor seinem Tod beträchtliche Teile seines Vermögens an seine gesetzlichen Erben. Allerdings behielt er 51 Prozent der Aktien an der Bolt Holding AG, außerdem seinen Wohnsitz Ekelund samt Inventar sowie einige andere Vermögensobjekte. Die Wertpapiere stellen nicht nur den größten Vermögenswert dar, sondern der Besitzer der Aktien verfügt zugleich über die kontrollierende Mehrheit in der Bolt Holding AG.«
Etliche der weniger hellen Köpfe der Familie kamen ganz sichtlich schon jetzt nicht mehr mit, doch der Anwalt fuhr unbeeindruckt fort:
»Der Erblasser wünschte, dass das Aktienpaket bei Abstimmungen innerhalb der Gesellschaft einen Block bilden möge. Daher wandte er sich einige Monate vor seinem Tod an mich, um die Ambrosia Holding AG zu errichten, eine Holdinggesellschaft mit einem Aktienkapital von 910.000,– Kronen. Der 51%ige Anteil an der Bolt Holding befindet sich demnach nun in der Hand der Ambrosia AG, welche wiederum die Bolt Holding kontrolliert.«
Peder und Christian ganz vorn auf ihren Plätzen nickten anerkennend. Das klang klug und durchdacht. Etliche Clanmitglieder fühlten sich hingegen in die einschläfernde Predigt vom Vormittag zurückversetzt; dass es zum Mittagessen so guten Weißwein gegeben hatte, machte die Sache nicht besser. Ein Vetter gähnte laut und vernehmlich.
»Zugleich mit der Gründung der neuen Gesellschaft«, setzte der Anwalt mit einem tadelnden Blick auf den Schlaftrunkenen fort, »wurde ein neues Testament verfertigt, mit Datum vom 21. Februar dieses Jahres, und es lautet folgendermaßen:
›Testament. Alle früheren Testamente werden hiermit für ungültig erklärt. Ich, der Unterzeichnete Wilhelm Jeremias Bolt, geboren am 10. April 1912, ohne Leibeserben, Erbe meiner verstorbenen Gattin, verfüge letztwillig, dass nach meinem Tode mit meinem Eigentum verfahren werde wie folgt:
Mein Neffe Christian Bolt erbt 300 Aktien der Ambrosia AG, jede im Nennwert von 1.000,– Kronen. Mein Neffe Peder Bolt erbt 200 Aktien, meine Nichte Gussi Fricke, geborene Bolt, erbt 150 Aktien, meine Nichte Ella Bolt ebenfalls 150 …‹«
Ein erleichterter Seufzer fuhr durch die Versammlung, denn das verstanden jetzt alle; fast wäre Applaus laut geworden. Insgesamt ein ordentliches Testament, wohlanständig und korrekt, ganz wie man es von einem vernünftigen Menschen erwarten durfte. Das Dokument war ausführlich, die Verlesung zog sich in die Länge, denn es gab viele Wertpapiere zu verteilen. So, wie es sein sollte. Christian Bolt rekelte sich, ganz der Aufsichtsratsvorsitzende, auf seinem Stuhl, Ella und Gussi atmeten wieder regelmäßig, der Anwalt trug psalmodierend immer neue Prozentanteile und Summen vor, alles so, wie man es sich wünschen konnte. Manche schielten zu Lea hinüber, die am Rande des Zimmers auf einem Esszimmerstuhl saß und nach wie vor den Blick gesenkt hielt. Unmöglich zu sagen, ob sie enttäuscht wirkte. Aber was hatte sie eigentlich erwartet? Tante Ella hatte es ihr ja gesagt heute Nachmittag, als sie ein paar Gläschen Weißwein intus hatte:
»Meine liebe Lea, du hast ein paar Monate hier draußen gewohnt, und er war ja nun alt und all so was, nicht wahr, vielleicht hatte er sich ja geändert. Vielleicht war er nett zu dir. Aber das heißt noch lange nicht, dass du wissen kannst … man soll ja über Tote nichts Hässliches sagen, aber …«
»De mortuis nil nisi bene«, sagte Lea, »so heißt das auf Latein, glaube ich.«
»Ja, mein liebes Kind, aber du hast ihn nicht gekannt. Absolut nicht. Du ahnst ja nicht, wozu er alles fähig war. Wie ’67, als er den Wagen schickte, da warst du ja noch gar nicht auf der Welt, also er ließ einen Wagen kommen, einen Umzugswagen, und das Esszimmer abholen, das er mir drei Monate vorher geliehen hatte, als wir oben nach Ris gezogen waren. Wir saßen gerade bei Tisch.«
»Vielleicht hat er es gebraucht.« Lea fühlte sich etwas unsicher.
»Liebes Kind, das war nicht dieses Esszimmer hier, sondern ein viel einfacheres. Es hatte in seiner Stadtwohnung in der Gyldenløves gate gestanden, die er sowieso nie mehr benutzte. Und steht es vielleicht hier irgendwo? Oh nein, er hat es verkauft. Wir haben es jedenfalls seitdem nicht wiedergesehen. Er konnte niemandem irgendetwas gönnen. Absolut nichts. Ja, ich weiß, diese Maler hat er unterstützt, aber die gehören doch nicht dazu. Die mussten ja nicht vor ihm kuschen. Das mussten nur wir. Wie Peder immer sagt: Blut ist dicker als Terpentin.«
»Und was habt ihr ohne Esszimmer gemacht?«
»Wir konnten ihm ja nicht die Ohren volljammern! Wir haben vorsichtig nachgefragt, ob er das Esszimmer jetzt behalten wollte, und da kam eine Rechnung für den Transport und ein Brief, also der war so, dass – ach, guten Tag, lieber Herr Pfarrer!« Sie legte ihr Gesicht in nachdenklichere Falten, als Sørensen plötzlich bei ihr stand.
Nein, was hatte diese Lea eigentlich erwartet? Sie saß da auf ihrem Esszimmerstuhl, wirkte, als ginge sie das Ganze eigentlich nichts an; fast tat sie der Familie ein wenig leid, als ein Aktienpaket nach dem anderen wegging. Jetzt schaute sie auf, richtete den Blick aus dem Fenster, als hörte sie gar nicht zu.
Lea hörte tatsächlich nicht zu. Sie dachte über den Tod nach, heute, am Tage der Totenfeier.
Der Tod ist das, was sich stets wiederholt. Der Tod ist das, was sich stets wiederholt. Er ist der kalte, harte Schlüsselbund, der in deiner Hosentasche rasselt und die Türen zu all deinen Tagen öffnet, immer wieder und wieder gleiten die gezackten Messingschlüssel in Schlüssellöcher hinein und wieder heraus. Der Tod ist die Küchenschere und ihre ungezählten Schnitte durch Bindfäden, das Klappern von Messern und Gabeln in der Besteckschublade, er ist das Klingeln des altmodischen Weckers an Tausenden von Morgen. Er ist die Brille, die du abnimmst und zusammenklappst, abnimmst und zusammenklappst, immer wieder, er ist alles, was sich wiederholt, er ist tausend alltägliche, glänzende Dinge, die in schwarzer Dunkelheit schweben und klirren wie die Glieder einer Kette. Der Tod ist alles, was sich stets wiederholt. Lea hatte oft darüber nachgedacht; bei jeder der drei Beerdigungen, an denen sie teilgenommen hatte, war dieses leere, metallische Gefühl über sie gekommen. Der Tod ist das Klicken des Fotoapparats, er ist zehntausend Aufnahmen einer beliebigen Straße oder eines leeren Parks. So sah Lea den Tod, sie hatte eine gewisse Erfahrung mit ihm. Sicher weniger als andere, als der Alte zum Beispiel, aber sie hatte nie mit ihm darüber reden können. Nicht so. Aber er hatte etwas darüber gewusst, und auch deshalb tat es ihr gut, ihm nahe zu sein. In seiner knurrigen Einsamkeit, wenn er über das Mikroskop oder irgendwelche Kristalle gebeugt war, oder bei den Mahlzeiten im Esszimmer, umgeben von seinen Gemälden, immer war zu spüren, dass er um Dinge wusste, über die man nicht reden konnte. Er selber war wie kaltes, klirrendes Metall. Wie Münzen. Zu allen Menschen verhielt er sich wie Münzen. Auch zu ihr, am ersten Tag. Eigentlich stets. Wie sie selber. Sie war lange, fast immer schon so gewesen. So wollte sie von nun an sein, oder sie wollte, dass sie immer so gewesen war. Sie passten gut zusammen.
Aber sie hatte auch anderes bei ihm erlebt. Die behutsame Feierlichkeit, mit der seine Hände die Wabenrähmchen aus den Bienenstöcken hoben, eine Königin hervorsuchten, eine Tulpenzwiebel setzten. Und er zeigte ihr, wie es gemacht wurde. Dann war es, als entgingen sie beide miteinander für die Frist eines Augenblicks dem, was sich stets wiederholt. Über die Zeit hatten diese Momente im alten Bolt Früchte getragen. Mit einem Mal duftete er nach Rasierwasser, einem sehr alten Jahrgang. Zum Mittagessen erschien er mit Krawatte, er trug eine Blume im Knopfloch, ließ Andersen jeden zweiten Tag frische Orchideen in ihr Zimmer bringen. Er zog ihren Stuhl zurück, damit sie sich bequem hinsetzen konnte, ließ ihr den Vortritt, obgleich er so viel älter war. Das war ihr gemeinsames Spiel. So sah er es selber, aber auch darüber sprach er nicht, nie sprachen sie darüber. Er lächelte nur sardonisch, wenn er ihr die Tür aufhielt. Ein einziges Mal spielte er darauf an, als er eines Vormittags offensichtlich hoch vergnügt, wenn auch gedankenverloren, ins Treibhaus geschritten kam, wo Lea sich gerade um einige Stecklinge kümmerte. Er nickte kurz und fing gleich unglaublich geschäftig an, Tulpenzwiebeln in einer Kiste zu verlesen. Lea musste in ihrer Arbeit innehalten und ihn ansehen. Er wirkte leicht überdreht. Lange kramte er in den Zwiebeln herum, dann kam es: »Ich habe heute beim Standesamt angerufen.« Er nahm eine Zwiebel und betrachtete sie eingehend, er sah aus wie ein Laienschauspieler als Hamlet. »Wenn ein Großonkel seine Großnichte ehelichen wollte, so stünde dem nichts im Wege. Wollte das nur mal untersucht haben.« Er sah von der Blumenzwiebel auf wie ein Goldschmied von seiner Arbeit und warf ihr einen feierlich-abenteuerlichen Blick zu: »Der Ordnung halber, meine ich.« Dann widmete er sich wieder dringend den Tulpenzwiebeln. Lea schluckte.
Das war eine andere Seite des Todes, an die sie nicht gern erinnert wurde. Eigentlich hatte sich alles im letzten Jahr um den Tod gedreht. Das hatten sie wohl beide gewusst. Die nächtliche Fahrt im Krankenwagen war nur der Schlusspunkt gewesen. Lea dachte nicht gern daran. Sie wollte nur an das denken, was sich stets wiederholte. Nicht daran, dass sie im Treibhaus hatte schlucken müssen in dem Augenblick, als sie sich umschwärmt und warm fühlte, dem Augenblick, als sie spürte, wie er sie umsummte, einem Bienenschwarm gleich, und sie mit goldenen Fäden einspann. Eine Schwärmerei wie aus einer anderen Zeit war das, edel und würdig und lauter. Es tat ihr wohl, bei ihm zu sein. Gerade dass er seine Erfahrungen hatte mit dem, was sich wiederholte, dass er wie klirrend kaltes Silber sein konnte, dass es so vieles gab, über das er nicht zu sprechen brauchte, all das ließ sie auftauen. Er durfte gerne schwärmen. Damit tat er ihr nichts zuleide. Er würde bald sterben. Nachts träumte sie ein paar Mal, sie läge neben ihm, ganz still, und sähe zu, wie er tief schlief. Einige Male verschmolz dieser Traum mit einem anderen, dem Traum von dem anderen, aber das quälte sie nicht. Wenn sie gemeinsam über den Besitz wanderten, gab sie ihm die Hand, die in der seinen ganz klein und warm wurde. »Heute bist du mein Krückstock«, sagte er dann bisweilen, und das konnte auf dem ganzen Spaziergang das Einzige sein, was er sagte. An die Stadt dachte sie nie. Es war wie im Märchen. Kletterrosen umwucherten das ganze Haus wie Gestrüpp. Die Tage glitten ruhig vorbei. Abends sah Lea von ihrem Fenster aus, wie der Lichtkegel des Leuchtturms unten vom Meer her die Dunkelheit zerteilte, immer und immer wieder. Bei auflandigem Wind hörte sie den alten Klagegesang der Heulboje irgendwo weit draußen zwischen den schaumweißen Brechern. Der Ton begleitete sie in den Schlaf, in die Träume, atmete mit ihr.
So war es gewesen. Eine Gnadenfrist. Von jetzt an würde sie nur noch sein wie klirrendes Metall.
»Schließlich«, las Advokat Holst, »schließlich erbt meine Großnichte Lea Bolt I – in Worten: eine – Aktie der Ambrosia Holding AG im Nennwert von 1000,– Kronen.« Beim Klang ihres Namens schaute Lea auf, ohne zu wissen, wo sie war.
»Die Ekelund-Stiftung, welche zugleich mit der Ausfertigung dieses Testaments errichtet wird, erbt mein Wohneigentum Ekelund, Gemarkungsnummer x, Grundbucheintrag Nr. 2, samt Inventar und einer Summe von 10.000.000,– Kronen zum Unterhalt des Besitzes.«
Der Anwalt hielt einen Augenblick inne, schob die Brille auf seinem Nasenrücken ganz nach oben, bedachte die Anwesenden mit einem Rundblick. Dann fuhr er fort:
»Meine Großnichte Lea soll über diesen Besitz verfügen, solange sie es wünscht. Veräußern darf sie ihn nicht. Wenn sie den Nießbrauch nicht länger auszuüben wünscht oder nach ihrem Tode soll der Erlös aus dem Besitz für die Ausbildung der Nachkommen meiner Neffen und Nichten verwendet werden.«
Es wuchs eine so enorme Stille, dass keiner mehr die weiteren Ausführungen des Anwalts über Bankeinlagen und Barmittel richtig hörte, obwohl das alles sehr schön war; ein Teil ging an die nächsten Verwandten, meist an Christian, ein anderer wurde klug in Fonds angelegt, für regelmäßige Ausschüttungen an fernere Verwandte. Die Familie kam erst wieder zu sich, als der Advokat die letzte Salve abfeuerte:
»Da es mein Wunsch ist, die Werte der Ambrosia Holding AG in demselben Geist weiter betreut und geführt zu wissen, wie ich es getan habe, verfüge ich die Aufteilung der Wertpapiere in zwei Aktiengattungen, Klasse A und Klasse B. Die Aktien beider Klassen sind nennwertmäßig gleichgestellt, doch die A-Aktie, die meiner Großnichte Lea Bolt zufällt, ist eine Vorzugsaktie in dem Sinn, dass ihre Inhaberin alleinig über das Stimmrecht verfügt. Dividenden können lediglich ausgeschüttet werden, wenn die Inhaberin der A-Aktie …« Doch das war für die kaufmännisch geschulten Mitglieder des Clans zu viel, endgültig. Mehrere waren schon aufgesprungen; Lea sah verwirrt zu ihnen hoch.
»… Unterzeichnet: Wilhelm Jeremias Bolt. Schließlich steht hier noch: ›Die Unterzeichneten, Rechtsanwalt Bjørn Wexelsen, zugelassen beim Höchsten Gericht, und Viktor Andersen, Hausmeister, sind eigens als Zeugen zur Ausfertigung des vorliegenden Testaments hinzugezogen worden. Wir bezeugen, dass Wilhelm Jeremias Bolt das Testament in unser beider Anwesenheit und im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte unterzeichnet hat, und zugleich, dass das Testament ihm langsam und deutlich verlesen wurde, bevor er es unterzeichnete. Wir sind beide volljährig.‹«
»Das möchte man verflucht noch mal bezweifeln!« Onkel Christians Gesicht war blass wie eine Sommerwolke.
»Was bedeutet das denn nur?«, fragte Tante Gussi; auch sie war aufgestanden.
Lea sprang vom Stuhl hoch und blickte den Anwalt verständnislos an. Dann verließ sie eilig das Zimmer. »Was bedeutet das?«, wiederholte Tante Gussi etwas lauter.
»Das bedeutet, dass er dir die Esszimmermöbel noch einmal abgenommen hat«, meinte Peder sarkastisch. Dann lachte er kurz. »Genau davor hast du Angst gehabt, was, Christian, Bruderherz?«
»Er hat es einfach nicht lassen können«, sagte Christian.
Es gab einen überhasteten Aufbruch. Die Autos preschten mit Kavalierstarts über die Kiesauffahrt. Ein paar Vettern, denen das Ganze eher gleichgültig war, spazierten noch eine Zeit lang umher und leerten die hohen Gläser bis zur Neige, der eine oder andere äugte besäuselt und hoffnungsfroh, ob er vielleicht Lea zu Gesicht bekäme, aber dann wurde auch er von Andersen zur Tür geleitet.
Advokat Holst suchte bekümmert nach Lea, erst in der Bibliothek, dann in ihrem Zimmer. Das war leer. Hell und still war es hier.
»Scheiße«, sagte der Anwalt.
Andersen stand hinter ihm in der Tür.
»Fräulein Bolt ist ausgegangen«, teilte er mit.
Holst drehte sich um und musterte ihn mit scharfem Juristenblick.
»Und du hast das also alles gewusst, Andersen«, sagte er.
»Ja«, antwortete Andersen. »Aber streng genommen – wenn ich so frei sein darf – Sie auch, Herr Holst.«
»Ich ging davon aus, dass man sie informiert hätte. Aber niemand hat es ihr erzählt.«
»Nein«, sagte Andersen. »Das wäre gegen Herrn Bolts ausdrückliche Anweisung gewesen.«
»Hast du kein schlechtes Gewissen?«, fragte der Advokat.
Andersen schien einen Augenblick aus seiner Versunkenheit aufzutauchen, er sagte:
»Ich habe nicht darüber zu urteilen.«
Der Anwalt sann einen kleinen Moment darüber nach. »Ausgegangen, sagst du?«
»Ja«, sagte Andersen, »verduftet, durch die Tür. Ich weiß nicht, wo sie ist.«
3.
Lea saß in Jacobs kleinem Häuschen ganz hinten im Garten und redete leise mit ihm, versuchte ihn ein wenig zu trösten; seit dem Tod des Alten vor einer Woche war Jacob völlig außer sich. War nur tief betrübt herumgeirrt, hatte an seinen Füßen herumgespielt, kaum etwas gegessen. Nicht einmal mehr an den Pfingstrosenknospen war er interessiert; sonst knipste er die harten, runden Kugeln gern von den Stielen ab und warf mit ihnen wie mit Bällen. Schade um die Pfingstrosen, aber lustig für Jacob, obwohl es natürlich strengstens verboten war. Und jetzt wollte er nicht einmal das.
Am Morgen nach dem Todesfall war das Haus menschenleer gewesen, und als Lea am späteren Vormittag aus dem Krankenhaus kam, fand sie Jacob in stummer Verzweiflung in der Nähe des Treibhauses. Er hatte nichts zu sich genommen, nur ein wenig Wasser getrunken.
Und so ging es weiter. Gestern und heute hatte er sich ganz unmöglich aufgeführt, wegen der Vorbereitungen für den Empfang und der vielen fremden Menschen, die auf einmal überall in seinem Reich herumliefen, und Andersen hatte ihn in seinem Häuschen einschließen müssen.
»Du solltest es nicht so schwer nehmen, Jacob«, sagte Lea und kraulte ihm den Nacken. »Das ist nun mal der Gang des Lebens.«
Aber der Affe schaute nicht auf, ließ nur den Kopf hängen.
»Außerdem bist du nur ein Tier, und Tiere können nicht trauern, das ist wissenschaftlich erwiesen.«
Jacob hob den Kopf ein klein wenig und schaute sie vorwurfsvoll an.
»Nein, nein, aber du musst trotzdem etwas essen«, sagte Lea. »Du kannst Schnittchen mit Brie bekommen und Oliven und jede Menge feine Zahnstocher.«