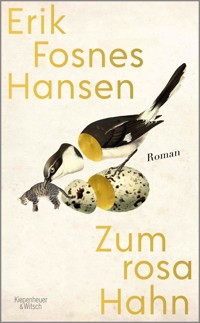
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine surreale Reise voller Überraschungen und Absurditäten – Erik Fosnes Hansens neuer Roman »Zum rosa Hahn« ist ein Meisterwerk der Fantasie. In einer Welt, die den Gesetzen der Realität zu trotzen scheint, treffen zwei reisende Goldmacher zufällig aufeinander und ziehen in die von Fürstin Clothilde regierte Stadt Jüterbog. Heimlich beobachtet von einem Hund und einer Katze, die sich fragen, was die Ankunft der Männer bedeuten könnte, entfaltet sich eine thrillerhafte Geschichte voller unerwarteter Wendungen. Bevor die Goldmacher Unheil anrichten können, treten weitere skurrile Figuren auf den Plan: ein krankes Mädchen und dessen unerzogener Bruder, ein Wachmann mit sprechender Warze sowie die gelangweilte Fürstin selbst. In diesem bildreichen Roman folgt eine überraschende Szene auf die nächste – wie in einem Traum, aus dem man nicht aufwachen möchte. Mit viel Humor und Einfallsreichtum erschafft Bestseller-Autor Erik Fosnes Hansen eine faszinierende Welt voller Satire und Fantasie. »Zum rosa Hahn« ist ein einzigartiges Leseerlebnis, das die Grenzen der Fiktion auf meisterhafte Weise auslotet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Erik Fosnes Hansen
Zum rosa Hahn
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Erik Fosnes Hansen
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Erik Fosnes Hansen
Erik Fosnes Hansen wurde 1965 in New York geboren. Er wuchs in Oslo auf, wo er heute lebt. Zwei Jahre lang studierte er in Stuttgart (und spricht hervorragend Deutsch). Seinen ersten Roman »Falkenturm« schrieb er im Alter von 18 Jahren, das Buch wurde gleich nach seinem Erscheinen 1985 in Norwegen als literarisches Ereignis gefeiert. »Choral am Ende der Reise« wurde zu einem internationalen Bestseller.
Ina Kronenberger übersetzt aus dem Norwegischen und Französischen, vornehmlich Belletristik. Zu den von ihr übersetzten Autor*innen gehören Per Petterson, Dag Solstad, Nina Lykke und Anna Gavalda.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Dies ist das lustigste, ungezügeltste Meisterwerk des Jahres … einfach brillant.« Adressavisen.
Mit einem verblüffend komischen und surrealen Roman begibt sich Erik Fosnes Hansen in das Reich der Fantasie und der reinen Fiktion. Eine thrillerhafte Geschichte, die in einer Landschaft spielt, die den normalen Gesetzen der Physik und der Realität zu trotzen scheint und dem Leser dennoch sehr real und greifbar vorkommt. Ein Buch, das ganz anders ist als das meiste, was Sie jemals gelesen haben.
Zwei reisende Goldmacher treffen auf einer Landstraße zufällig aufeinander und ziehen schließlich in die von Fürstin Clothilde regierte Stadt Jüterbog, in der die Untertanen durch Massage bei Laune gehalten werden. Heimlich beobachtet werden die beiden von einem Hund und einer Katze, die sich fragen, was die Ankunft der Männer bedeuten könnte. Bevor die beiden Goldmacher in der Lage sind, Unheil anzurichten, kommen weitere Figuren ins Spiel: ein armes, schwer krankes Mädchen und dessen unerzogener Bruder, ein Wachmann mit sprechender Warze sowie die Fürstin selbst, die so gelangweilt ist, dass sie sogar den Tod eines Untergebenen für etwas Abwechslung in Kauf nimmt.
Eine unerwartete Szene folgt auf die nächste in diesem spannenden und bildreichen Roman, in dem alles wie im Traum geschieht, aus dem man sich wünschte, nicht aufzuwachen.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: LANGS LANDEVEIEN MELLOM COTTBUS OG BERLIN
© 2020 Erik Fosnes Hansen
Published by agreement with Copenhagen Literary Agency ApS, Copenhagen
All rights reserved
Aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger
© 2022, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Julia Geiser
ISBN978-3-462-30145-8
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
Motto
Für Tor Åge Bringsværd
Mir träumte wieder der alte Traum
H.H.
1
Auf der Landstraße zwischen Cottbus und Berlin bewegten sich zwei Goldmacher. Sie waren ursprünglich nicht zusammen unterwegs gewesen, waren einander jedoch zufällig begegnet, an einer Stelle, an der die Landstraße auf der Luckenwalder Heide eine Kurve beschreibt, kurz vor Golmberg. Dem Jüngeren war plötzlich aufgefallen, dass der Ältere neben ihm ging; dieser musste ihn irgendwann eingeholt haben. Nach kurzem Gruß zogen sie gemeinsam weiter. Der Jüngere hatte für den Älteren eigentlich nicht viel übrig, ihm war aber auferlegt, einem älteren Kollegen seine Reverenz zu erweisen, also begleitete er diesen pflichtschuldigst. Die Landstraße war hier sehr sandig und weich wie ein Fischbauch, sie glitten leicht darauf entlang, während die Einsiedlerkrebse zur Seite schossen. Sie plauderten über dieses und jenes und widmeten sich dem Klatsch über Kollegen, wie umherreisende Goldmacher es gerne tun. Doch jetzt unterhielt vor allem der Ältere den Jüngeren mit Geschichten aus seiner Studienzeit in Wittenberg, als ihr Fachgebiet noch reichlich anders aussah als derzeit, und Wittenberg ebenso.
Der Jüngere langweilte sich immens. Als sie so weit nach Süden gekommen waren, dass sie Petkus erreicht hatten, sagte er unvermittelt: »Hier will ich nun nach rechts weiter, ich danke dem Meister für die Gesellschaft und das Gespräch.«
»Wohin willst du?«, fragte der Ältere.
»Nach Jüterbog«, antwortete der Jüngere, ohne recht zu begreifen, warum.
»Wie eigenartig. Sagtest du nicht, du wolltest nach Cottbus? Das wäre nach links.«
»Da hast du dich wohl verhört, Meister«, sagte der Jüngere, ohne nachgedacht zu haben, fügte aber rasch hinzu, »oder ich habe mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Vielleicht habe ich auch vergessen zu erwähnen, dass ich zunächst nach Jüterbog wollte.«
»Verstehe«, sagte der Ältere, eine Spur gekränkt. »Nun gut, junger Mann, dann lasse ich dich dein Glück allein in Jüterbog versuchen. Hast du deine Papiere in Ordnung?«
»Selbstverständlich«, sagte der Jüngere.
»Dann zeig mal her, zur Sicherheit nur.«
Mit einem kaum hörbaren Seufzer zog der Jüngere gehorsam die Fischledermappe mit seinen Papieren heraus. Der Ältere studierte die Papiere gründlich, während der Jüngere seine Ungeduld zu verbergen suchte, indem er die eintönig karge und wellige Landschaft betrachtete, die sie umgab, so weit das Auge reichte, hier und da von Landstraßen durchzogen, am Wegesrand von Bäumen gesäumt, unendliche Alleen.
»Gut, gut. Und mit der Apparatur ist alles in Ordnung?«
»In allerbester Ordnung, Meister.«
»Wie schön, feststellen zu können, dass die Jugend ihre Siebensachen in Ordnung hält. Dann leb wohl.«
»Leb wohl, Meister.«
An der Kreuzung verabschiedeten sie sich. Während der Jüngere in Richtung Jüterbog unterwegs war, bemerkte er eine gewisse Verärgerung – nicht nur wegen des Umwegs (in Cottbus erwartete ihn ein Mädchen), sondern auch wegen seiner mangelnden Geduld mit dem älteren Kollegen. Nur konnte er weiteres Geplauder mit einem Fremden nicht ertragen und wollte die Morgenstunde allein genießen.
Denn es war ein schöner Morgen. In allen Baumkronen entlang der Allee, deren gelber Sand hier mit einer dünnen Schicht kristallklaren, glitzernden Wassers überzogen war, sangen die Blauzeisige. Und es war, als bewegte er sich über einen schmalen, endlos langen Strand.
Im Norden hatte die Zentralbehörde in Potsdam soeben die alten großen und kunstvollen Zusatzsonnen entzündet, sodass sich goldene Strahlen majestätisch über dem Horizont erhoben und sich ihr Licht harmonisch mit dem Laub vermischte. Der Goldmacher summte im Takt mit der sanft schwingenden Straße und spürte, dass er mit seinem Dasein eigentlich recht zufrieden war, trotz des Umwegs und der Verärgerung, da hörte er auf einmal, wie sich von hinten jemand näherte. Ohne innezuhalten, warf er einen Blick über die Schulter.
Es war sein älterer Kollege. Pflichtschuldigst blieb der Jüngere stehen.
»Mir kam der Gedanke«, schnaufte der Ältere, als er ihn eingeholt hatte, »dass es doch ganz nett sein könnte, im Wirtshaus von Jüterbog gemeinsam zu Mittag zu essen. Dann könnten wir uns noch ein wenig unterhalten.«
»Ja, das wäre tatsächlich nett«, sagte der Jüngere. »Und gewiss auch nützlich«, fügte er so höflich, wie er nur konnte, hinzu, »unter fachlichen Gesichtspunkten.«
»Nun, nun«, entgegnete der ältere Goldmacher ohne übertriebene Bescheidenheit. »Das ein oder andere kann ich einem jüngeren Kollegen gewiss noch beibringen – unter fachlichen Gesichtspunkten. Womöglich gibt es spezielle Gebiete, auf denen du noch fachlichen Rat brauchen könntest?«
»Um die Wahrheit zu sagen, Meister«, bemerkte der Jüngere aufrichtig, »quäle ich mich wohl am meisten mit der Rhetorik.«
»Ah«, sein älterer Kollege zupfte sich nachdenklich am Spitzbart, der umgehend einen halben Zoll länger wurde, »die Rhetorik ist stets problematisch. Stets problematisch. Darüber sollten wir uns beim Essen eingehender unterhalten. Im Wirtshaus von Jüterbog haben sie einen ausgezeichneten Hirschbraten. Ganz ausgezeichnet. Vom Goldhirsch. Gefüllt mit Trauben und Karpfenzungen. Einen schönen Blick auf den Marktplatz hat man dort auch. Zum schwarzen Hahn, so heißt das Wirtshaus. Zum schwarzen Hahn. Und die Kellnerinnen sind üppig, junger Mann, äußerst üppig. Und ausgebildete Massagetechnikerinnen obendrein. Jede von ihnen.«
»Das klingt ja gut«, meinte der Jüngere, ohne sonderlich überzeugt zu sein.
»Die Rhetorik, ja«, sagte der Ältere. »Hör her. Nun will ich auf dem letzten Stück unseres Weges ein wenig schlafen, dann störe ich dich auch nicht weiter in deinen Morgengedanken, und zugleich will ich etwas über die rhetorischen Herausforderungen unseres Fachs nachdenken. Bist du so nett und weckst mich kurz vorm Ziel?«
Das versprach der Jüngere, und schon schlief sein Kollege ein. Während sie sich schweigend weiterbewegten, dachte der Jüngere resigniert, dass er sich zusammennehmen müsse, um nett zu dem Älteren zu sein. Er war ihm bisher erst wenige Male begegnet und mochte ihn nicht sonderlich, aber die Situation war nun einmal so, wie sie war, er musste das Beste daraus machen. Es kommt ja vor, dachte er bei sich, dass der erste Eindruck trügt. Man denke nur an den Mond.
Gestärkt von diesem Gedanken, versöhnte er sich damit, dass sie in Jüterbog zusammen zu Mittag essen würden, und fand ein wenig zu dem Frieden und der Zufriedenheit zurück, die er zuvor verspürt hatte, derweil sie der Stadt immer näher kamen.
Die Wachleute am Stadttor von Jüterbog hatten offensichtlich seit Tagen nicht genug zu tun, denn sie hüpften ein wenig auf der Stelle und warteten eifrig darauf, jemanden kontrollieren zu dürfen, zwischendurch massierten sie einander kameradschaftlich die Schultern. Als sie die beiden Goldmacher erblickten, grinsten sie erwartungsvoll. Bei ihrem Anblick wurde der jüngere Goldmacher nervös, wohingegen sein älterer Kollege von selbst aufgewacht war, sobald die Straßenränder sich auf dem letzten Stück ein wenig zu wellen begannen. Er blinzelte nur kurz, als sie vor dem Stadttor stehen blieben.
Die Wachen, sieben an der Zahl, klirrten munter mit den Waffen im Takt ihrer Hüpfer, die sich als sanftes Schaukeln auf die Straße übertrugen.
»Zuerst die Papiere!«, kam es barsch vom Kommandanten der Wache, einem groß gewachsenen, dunkelhaarigen Kerl in Kommandantenuniform mit Epauletten, die elegant baumelten, als er zwei Schritte auf sie zumachte. Er hatte dunkelblaue Augen und eine große, lebhafte Warze auf der Nase.
»Die Papiere, ja«, der ältere Goldmacher lächelte entgegenkommend. Aus der Innentasche fischte er seine eigene abgewetzte Mappe aus fettgegerbtem Dorschleder, die Insignien der Goldmacherzunft mit Iridiumoxid eingeprägt, und reichte sie dem Kommandanten, der sich darüberbeugte, als wären es heilige Schriftstücke. Seine Kollegen klirrten unterdessen weiter im Takt mit ihren Waffen. Zwischendurch brachen sie in mannhafte, aggressive Gesänge aus.
»Tja, hier ist ja alles in schönster Ordnung«, sagte der Kommandant mit säuerlicher Miene, faltete das letzte Dokument zusammen, legte es in die Fischledermappe und gab sie dem älteren Goldmacher zurück.
Die übrigen Wachleute stöhnten vor Enttäuschung, blickten jedoch gleich viel optimistischer drein, als sich der Kommandant über die Papiere des jüngeren Goldmachers beugte und kurz darauf den Kopf schüttelte.
»Oh, oh«, sagte er. »Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Nein, das sieht gar nicht gut aus.«
Der jüngere Goldmacher schaute ihn nervös an: »Stimmt was nicht mit meinen Papieren, Herr Hauptmann?«
»Sehen Sie selbst.« Mit gerunzelter Nase, sodass die Warze ein leises Knarzen von sich gab, und säuerlicher Miene hielt der Wachkommandant das Dokument hoch, damit die beiden Goldmacher und die Wachen es sehen konnten. Als sie das Problem erkannten, gaben die Wachleute einen Seufzer voll vergnügter Erwartung von sich. Das Siegel auf einem der Papiere war ein wenig ausgelaufen. Nicht viel, aber von einem Riss unten an dem Siegel rann ein dünner Streifen regenbogenfarbener Siegelflüssigkeit über das Blatt.
»Ja, das wiegt schwer, junger Mann«, sagte der Wachkommandant mit großem Ernst. »Gut möglich, dass wir Dinge mit Ihnen anstellen müssen.«
Hocherfreut nickten die Wachen.
Der jüngere Goldmacher musste schlucken, ihm fiel aber keine passende Antwort ein. Als er zuletzt nachgesehen hatte, war das Siegel unversehrt gewesen. Vermutlich hatte es einen leichten Riss davongetragen, als der Amtmann nach der letzten Kontrolle das Blatt gefaltet hatte. Eine andere Erklärung fiel ihm nicht ein.
»Lassen Sie mich mal sehen«, sagte der ältere Goldmacher, setzte die Brille auf, nahm das Blatt und studierte es. »Nun ja, Herr Hauptmann«, sagte er sodann, »das hier ist bloß ein kleiner Riss. Bei häufigem Gebrauch der Dokumente kann das schon mal vorkommen.«
»Spielt keine Rolle«, der Kommandant gab sich unbeeindruckt, »die Dokumente haben in schönster Ordnung zu sein. Das heißt, sie müssen sowohl schön als auch in Ordnung sein. Und das hier ist nicht in Ordnung, und schon gar nicht schön. Es ist, wie soll man sagen, ja, offen gestanden, ich will nicht drum herumreden: Das hier ist eine ästhetische Beleidigung.«
Die Wachen quittierten das Gesagte mit vergnügtem Brummen, manch einer rasselte bereits hoffnungsvoll mit den Kettengliedern an seinem Gürtel.
»Na, na«, sagte der ältere Goldmacher, »guter Mann, guter Herr Hauptmann, schauen Sie doch einmal genauer hin. Es ist ja nun kein wesentliches Dokument. Ganz und gar nicht. Es ist nur eine kleine Apparaturbestätigung, schauen Sie selbst. Wäre es eins von den Hauptdokumenten, könnte das Problem mit der ästhetischen Beleidigung von, wie soll ich sagen, gravierender Natur sein. Aber dies ist doch eigentlich ein zu vernachlässigender Schnipsel.«
»Ein Schnipsel?«, wiederholte der Wachkommandant mit militärischem Grimm. »Was wollen Sie damit sagen? Dokument ist Dokument, daran ist nicht zu rütteln.«
»Gewiss, gewiss«, erwiderte der ältere Goldmacher eifrig, »etwas anderes wollte ich gar nicht behaupten. Doch ein bisschen Nachsicht wäre angebracht. Ein Riss in einem Siegel kann schnell mal vorkommen.«
»Es ist die Pflicht eines jeden Einzelnen, seine Papiere zu jeder Zeit in allerschönster Ordnung zu haben«, entgegnete der Kommandant. Die Soldaten begannen einen kleinen Ringelreihen, dabei schwangen sie graziös die Ketten. »Und das gilt natürlich insbesondere für Goldmacher. Für Ausnahmen gibt es keinen Raum. Sie wissen genauso gut wie ich, dass für Ihre Zunft besonders strenge Regeln gelten, und Sie wissen auch, warum.«
»Natürlich, Herr Hauptmann, Sie haben ganz recht, aber hier liegt ein Missverständnis vor, das sich leicht aufklären lässt.«
»So?«
»Das wäre doch das Einfachste, oder?«
»Ich weiß nicht, ob meine Männer und ich daran interessiert sind, überhaupt etwas aufzuklären. Wir stehen hier, um unsere rechtschaffene Stadt und ihre rechtschaffenen Bürger zu beschützen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, wie ich zu sagen pflege. Das sagt auch der Dichter.«
Die Wachen nickten, alle gleichzeitig: »Das sagt auch der Dichter«, murmelten sie im Chor, und die Warze auf der Nasenspitze des Kommandanten gab ein höhnisches Kichern von sich.
»Außerdem«, schob der Kommandant hinterher und tätschelte beruhigend die Warze, »außerdem brauchen meine Männer Übung.«
»Gewiss«, sagte der ältere Goldmacher, »doch falls Sie sich irren, könnte es im Anschluss viel Papierkram und Aufwand nach sich ziehen.«
»Ich irre mich nicht. Das Siegel läuft aus. Wie jeder sehen kann.«
»Ja schon, aber wenn es sich als in schönster Ordnung befindlich herausstellt, also sowohl schön als auch in Ordnung ist, obschon beschädigt – welche Auswirkungen könnte das für Sie haben? Denn was sagt der Dichter noch gleich hierzu: Ein Schaden macht noch keinen Sommer.«
Das gab dem Kommandanten offenbar etwas zu kauen, aber seine Truppe war immer noch äußerst begierig darauf, an der Lebenssituation des jüngeren Goldmachers etwas zu ändern, und dieser dachte schwermütig: Mit mir ist’s vorbei. Doch der Wachkommandant überlegte gründlich.
»Nun«, meinte er schließlich, »was schlagen Sie vor?«
»Ganz einfach«, sagte der Ältere. »Sie nehmen eine technische Prüfung derjenigen Apparatur vor, auf die sich dieses Dokument bezieht, und wenn mit dieser alles in schönster Ordnung ist, können Sie beruhigt davon ausgehen, dass es sich um eine zufällige Beschädigung handelt.«
»Hm.« Noch wirkte der Wachkommandant nicht überzeugt, und die Augen seiner Männer glühten weiterhin vor Diensteifer, doch die Warze flüsterte ihm etwas zu. Nach einer Weile nickte er. »So machen wir es. Die Apparaturen, bitte. Von beiden.«
Beide Goldmacher beeilten sich, ihre Apparaturen zur Kontrolle vorzuzeigen. Der Wachkommandant untersuchte sie genau, prüfte mehrmals jedes Teil, dann zog er eine kleine, praktische Dienstlupe aus der Innentasche. Damit konnte er durch eigene Inaugenscheinnahme feststellen, dass die Apparaturen plombiert und tadellos versiegelt waren. Er musterte sie lange und gründlich, musste am Ende aber nachgeben:
»Gut, gut«, sagte er. »Es sieht doch ganz so aus, als wäre alles in Ordnung. Und das Siegel wurde wohl durch eine kleine Unachtsamkeit beschädigt. Diesbezüglich können wir uns wohl einigen.«
Enttäuscht stimmten die Soldaten ein Lied in Moll an, der jüngere Goldmacher fand indes die Sprache wieder und stammelte ein »Haben Sie besten Dank, Herr Hauptmann«, was dieser barsch parierte:
»Guter Mann, Ihr Siegel entspricht nicht den Vorschriften. Sie können sich glücklich schätzen, dass Ihr älterer Kollege sich für Sie eingesetzt hat.«
»Ja«, sagte der Jüngere, »na klar, na klar. Natürlich. Ich schätze mich glücklich.«
»Dazu haben Sie auch guten Grund, junger Herr«, sagte der Hauptmann. »Kulanz wird nur ausnahmsweise gewährt.«
»Ja«, der jüngere Goldmacher nickte demütig, »das sehe ich ein. Ich schätze mich glücklich.«
»So ist es schon besser. Dann kann ich Sie in unserer rechtschaffenen Stadt willkommen heißen, deren Polizeikräften ich als Wachkommandant diene«, sagte der Wachkommandant, nach wie vor streng, aber doch ein wenig entgegenkommender.
»Herzlichen Dank, Herr Hauptmann«, sagten die beiden Reisenden untertänig.
»Und?«, der Kommandant wandte sich an seine Truppe: »Wie heißt es weiter, Männer?« Widerstrebend sagten die Soldaten die vorgeschriebenen, berühmten Zeilen des Dichters hinsichtlich Willkommensgruß und Gastfreundschaft auf, dazu wedelten sie, dem Reglement entsprechend, mit ihren rot-weißen Diensttaschentüchern, wenn auch ohne wahre Begeisterung.
»So ist’s schon besser«, brummte der Kommandant. »Viel besser. Aber«, wandte er sich warnend an die beiden Besucher, »wir behalten Sie im Auge, solange Sie in der Stadt weilen. Stellen wir auch nur die kleinste Regelverletzung fest, wird die Apparatur auch nur ein einziges Mal falsch verwendet oder wird die zeitliche Begrenzung nicht eingehalten, dann wissen Sie, was geschieht. Goldmacher, die die Vorschriften verletzen, werden vom Gesetz streng bestraft.«
»Vielen Dank, Herr Hauptmann«, sagte der Ältere. »Das ist uns bekannt. Sie können sich auf uns verlassen. Seien Sie dessen gewiss. Sowohl mein junger Kollege hier als auch ich haben nur lautere und gesetzestreue Absichten. Und wir bleiben nicht lange.«
»Fürwahr«, pflichtete der Kommandant ihnen bei und stempelte ihnen nicht gerade behutsam Ankunftsdatum und Besuchszweck auf die Stirn. »Wie lange bleiben Sie?«
»Schwer zu sagen«, antwortete der Ältere für beide. »Jedenfalls nicht lange. Höchstens ein, zwei Tage.«
Zwei Wachmänner zogen den schweren Riegel des Stadttors beiseite, ein dritter blies in die Pfeife, was einen schrillen durchdringenden Ton nach sich zog.
Mit reibungslos gastfreundlichem Geräusch schwang das Tor auf.
Fröhlich lächelnd zogen die beiden in die Stadt ein, dabei winkten sie den Wachleuten, die begeistert zurückwinkten.
Aber
2
als sie einen gefühlt sicheren Abstand zum Stadttor erreicht hatten, blieben sie vor einem der vielen renommierten physikalischen Institute der Stadt stehen. Hier dankte der jüngere Goldmacher seinem älteren Kollegen überschwänglich. Er freue sich, gesund, ja, überhaupt mit dem Leben davongekommen zu sein. Doch der andere wischte den Dank mit einer leichten, wenn auch gönnerhaften Handbewegung beiseite.
»Kein Grund zum Dank, junger Mann«, sagte er. »Zunftbrüder müssen füreinander einstehen. Vielleicht lernt euereins das heutzutage bei der Ausbildung nicht mehr, wir seinerzeit schon.«
Der Jüngere nahm den Älteren näher in Augenschein. Und erst jetzt, im Lichte der Stadt, nachdem sie ihre Ruhe wiederhatten, konnte er erkennen, wie alt dieser war. Das Alter lag wie eine glänzende, wächserne Schicht auf manch einer Stelle seines Gesichts, auf den Erhöhungen zwischen den Falten, in den Spitzen des weißen Haares, in den Augenbrauen und den Locken seines Bartes. Wenn er lächelte, sah man, wie braun und von Trauer zerfressen seine Zähne waren.
»Das nennt sich Berufsetikette«, sagte der Ältere.
Vielleicht, dachte der junge Mann, vielleicht ist er so alt, dass er sogar noch einen der Gerechten Toten gekannt hat.
Von der Erleichterung überwältigt, dass ihm eine Veränderung seiner Lebenssituation durch die Soldaten erspart geblieben war, fiel der junge Mann dem Älteren jäh um den Hals. Fast weinte er vor Freude und Dankbarkeit.
»Aber, aber«, setzte der Ältere abwehrend an und klopfte seinem jüngeren Kollegen beruhigend auf die Schulter. »Ist schon gut.«
In einem Torweg nahebei saßen ein Hund und eine Katze und betrachteten die beiden Gestalten. Beide hatten sie helles, rötliches Fell, und nicht zuletzt aus diesem Grund waren sie befreundet und kamen gut miteinander aus. Doch trotz des Fells und obwohl sie einander schon lange kannten, konnte man sie nicht als enge Freunde bezeichnen. Dafür waren sie zu verschieden. Der Hund war besonnen und rational, die Katze rege und fantasievoll. Jedoch hatten beide zufällig mittwochs ihren freien Tag, und dann verfolgten sie miteinander das Treiben und alle, die kamen und gingen, freilich ohne dass sie in der Einschätzung des Gesehenen allzu oft einig wären. Die Katze hatte in der freitäglichen Magazinbeilage des Abendblatts zu viele Detektivgeschichten gelesen. Mittwochs war der zeitliche Abstand zur letzten Beilage so groß geworden, dass die Katze allmählich unter Rätselentzug litt. Und heute war eben Mittwoch.
»Möchte mal wissen«, murmelte sie skeptisch, »was die zwei da vorhaben. Gutes scheinen sie mir nicht im Schilde zu führen.«
»Fängst du schon wieder damit an«, seufzte der Hund.
»Ja, sieh sie dir doch mal an.«
»Ich sehe sie mir ja an«, sagte der Hund mit der Geduld eines Hundes.
»Psch«, fauchte die Katze. »Ich mag sie nicht.«
»Sie sehen doch ganz normal aus«, wandte der Hund ein. »Haben nichts Besonderes an sich.«
»Ja, aber sieh sie dir doch an.«
»Ich sehe sie mir ja an. An ihnen ist nichts verkehrt. Mal ehrlich, was siehst du, das ich nicht sehe?«
Die Katze musterte die beiden Fremden noch einmal, dann wandte sie ihrem Freund das Gesicht zu und sagte:
»Nein, die sind mir nicht geheuer. Ganz sicher bringen sie Unglück in unsere friedliche Stadt.«
Der Hund war von Natur aus gutmütiger und außerdem besser über gesellschaftliche Belange im Allgemeinen im Bilde.
»Dass du aber auch immer gleich das Schlimmste über die Leute denkst«, versuchte er seinen Kameraden zu beschwichtigen. »Die sehen doch richtig nett aus. Kein Grund zur Panik. Die Behörden haben alles im Griff. Sei unbesorgt.«
»Ich bin keineswegs panisch«, konterte die Katze. »Ich ahne nur, dass die beiden nichts Gutes im Schilde führen. Möglicherweise sind es Brandstifter. Ja, genau. Brandstifter. Sie sehen mir ganz danach aus.«
»Brandstifter, also wirklich«, schnaubte der Hund und stellte ein Ohr leicht auf.
»Na gut, dann eben Kinderschänder.«
»Selber Kinderschänder.«
»Taxidermisten. Das sind sie bestimmt. Darauf gebe ich mein Wort.«
»Taxidermisten?«
»Tier-Präparatoren«, erklärte die Katze ungerührt. »Das Wort habe ich dir schon mal erklärt.«
Der Hund blickte die Katze lange an. Bei dem Gedanken, die beiden Fremden könnten möglicherweise Angehörige dieser unerfreulichen Berufsgruppe sein, stellten sich ihm kurz die Nackenhaare auf, doch dann schüttelte er die Vorstellung von sich ab.
»Warum um alles in der Welt sollten das – Taxi–«
»Dermisten. Noch einmal: Ta-xi-der-mis-ten. Sie sehen mir ganz danach aus. Darauf gebe ich mein Wort. Das hier ist der Anfang eines Krimis.«
»Red keinen Unsinn«, sagte der Hund in dubio pro reo. »Wie kommst du auf so was? Sie könnten genauso gut Tierärzte sein.«
»Im Prinzip könnten sie alles Mögliche sein«, räumte die Katze pro forma ein. »Im Prinzip könnte jeder, der einem über den Weg läuft, Tierarzt sein. Aber nur, wenn man bei der Beobachtung seine induktive Intuition außen vor lässt.«
»Manchmal gehst du mir gehörig auf die Nerven«, murmelte der Hund träge.
»Darauf gebe ich mein Wort«, wiederholte die Katze. »Du hast eine schlechte Intuition; das war schon immer so, und das weißt du ganz genau.«
»Na, na«, sagte der Hund und lächelte fast unmerklich. »Hat deine unfehlbare Intuition nicht erst letzte Woche eine Astronomin erkannt haben wollen, also eine Person mit Berufsverbot, verkleidet als ganz gewöhnliches Waschweib? Und dann war es tatsächlich ein ganz gewöhnliches Waschweib?«
»Das spielt keine Rolle«, entgegnete die Katze verärgert, aber nicht zu verärgert, denn sie waren daran gewöhnt, sich niemals bei irgendetwas einigen zu können. »Ich sage es noch einmal: Das hier ist der Beginn eines Krimis. Darauf gebe ich mein Wort.«
Der Hund seufzte. Dann sauste er über die Straße und postierte sich so, dass er mit leicht zusammengekniffenen Augen lesen konnte, was auf die Stirn der beiden Fremden gestempelt war, die immer noch dort standen und sich unterhielten. Danach trabte er zurück in den Torweg.
»Goldmacher«, sagte er. »Umherreisende Goldmacher. Ganz gewöhnliche Vertreter ihrer Zunft.«
»Ha«, rief die Katze. »Was habe ich gesagt? Das lässt nichts Gutes hoffen. Darauf gebe ich mein Wort. Solche Goldmacher bringen immer Unglück.«
»Überhaupt nicht«, sagte der Hund phlegmatisch. In Momenten wie diesem fragte er sich öfter, warum er sich eigentlich die Mühe machte, seinem Kameraden zu widersprechen. Andererseits: Worüber sollten sie sonst reden?
»Darauf gebe ich mein Wort«, wiederholte die Katze. »Zwielichtige Gestalten.«
Die beiden Goldmacher begaben sich nun Richtung Marktplatz.
Die Katze sprang auf, reckte sich und wie um ihre Ansicht zu unterstreichen, sträubte sie mit einem eindringlichen Blick auf den Hund ihre Haare.
»Am besten folgen wir ihnen und behalten sie gut im Auge«, sagte sie.
»Ach komm«, wandte der Hund ein, »wir sitzen hier doch sehr gut. Schön im Schatten und –«
Aber ohne auf Antwort zu warten, strich die Katze bereits den Rinnstein entlang, zielstrebig hinter den beiden Fremden her. Resigniert erhob sich der Hund und trottete hinterdrein, wobei er sich immer wieder vorsagte, dass er an einem Mittwoch ja auch nichts Besseres zu tun habe.
Die beiden Goldmacher stiegen im Wirtshaus am Marktplatz ab. Seit dem letzten Besuch des Älteren hatte das Lokal seinen Namen geändert, es hieß jetzt nicht mehr Wirtshaus Zum schwarzen Hahn, sondern Hotel Zum rosa Hahn. Im Großen und Ganzen war es aber noch dasselbe Lokal, abgesehen davon, dass ein Teil des Interieurs nun rosa war. Beide bezogen Zimmer mit Blick auf die Kirche. Nachdem sie ihr Gepäck abgestellt hatten, trafen sie sich unten im Speisesaal. Die Einstellung des jüngeren zu dem älteren Goldmacher hatte sich jetzt umfassend geändert, und als der Oberkellner die Speisekarte brachte, bestand der Jüngere darauf, dass der Ältere ein Exemplar ohne ausgewiesene Preise bekam, damit er, ohne einen Gedanken an die Kosten zu verschwenden, seine Auswahl treffen konnte, denn er wollte ihn zum Zeichen seiner Dankbarkeit einladen.
Der Ältere protestierte, allerdings nur der Form halber, sodass der Oberkellner mit einer liebenswürdigen Handbewegung die Preise von einer der Karten strich, die Zahlen wurden daraufhin automatisch durch anmutige kleine Blümchen und Herzchen ersetzt.
Der jüngere Goldmacher war damit jedoch nicht zufrieden. Er war noch so jung, dass er Kleinigkeiten schnell als kränkenden Angriff auf seine Würde empfand.
»Hören Sie, Herr Oberkellner«, flüsterte er dem Mann zu, »das ist mein Freund und älterer Kollege, keine junge Dame, die ich beeindrucken will … Das sehen Sie doch selbst? Haben Sie keine weniger kitschigen Bildchen als Ersatz für die Preise?«
»Bedaure«, flüsterte der Oberkellner zurück. »Es sind alte Speisekarten. Andere Bilder sind nicht verfügbar. Entweder haben sie ihr Verfallsdatum überschritten oder das Ablaufdatum wurde von uns nicht verlängert, um ehrlich zu sein. Ich bitte um Nachsicht.«
»Hm«, murmelte der jüngere Goldmacher, weiterhin unzufrieden.
»Lassen Sie mich das in Ordnung bringen, der Herr«, flüsterte der Oberkellner, »wenn Sie gestatten.« Laut sagte er, an den älteren Gast gewandt:
»Die Blumen und Herzen, der Herr, sollen anzeigen, dass heute in unserer schönen Stadt Jüterbog der Blumentag begangen wird. Eine alte Tradition. Heute hat jeder ein Anrecht darauf, eine Blume geschenkt zu bekommen, alle schenken sich gegenseitig Blumen. Ich hoffe auf Ihr Verständnis.«
»Verstehe«, sagte der ältere Goldmacher eine Spur verwirrt.
»Sehen Sie her.« Der Oberkellner stellte eine Vase mit Knospen von Silbergardenien, Pilatus-Augen und Blausteinlilien auf den Tisch. Mit einer eleganten Handbewegung brachte er sie zum Blühen, und die beiden Gäste klatschten spontan Beifall, was man ja niemals vergessen sollte.
»Sehr schön«, sagte der Jüngere anerkennend, und der Oberkellner zwinkerte ihm zu, um zu unterstreichen, wie geschickt er das angestellt hatte.
»Was darf’s sein, die Herren?«, fragte er dann. »Etwas zu trinken zum Essen? Die Herren haben nach der langen Reise gewiss Durst?«
»Danke«, erwiderte der Ältere weltgewandt. »Ich nehme ein Bier. Ein hiesiges. Das schmeckt sehr gut.«
»Für mich dasselbe«, sagte der Jüngere. »Ich vertraue auf die Empfehlung meines Freundes. Er kennt sich in dieser Gegend besser aus als ich.«
»Ausgezeichnet, ausgezeichnet«, sagte der Oberkellner.
Zwei lokale Biere wurden gebracht. Sie hatten rosa Schaumkronen, die beim Kontakt mit der Luft im Speisesaal mit einem feierlichen Laut zerplatzten.
»Das liegt am Hopfen«, erklärte der Ältere. »In diesem Bezirk hier gibt es eine ganz spezielle Hopfenart. Wenn sie dem Sud zugesetzt wird und sterben muss, beschließt sie freiwillig, im Schaum in all ihrer Schönheit wiederaufzuerstehen. Der Dichter, seinerzeit in der Gegend hier auf Reisen, hat ihn einst dazu überredet. Und dabei ist der Hopfen bis heute geblieben.«
»Interessant«, sagte der Jüngere. »Davon hatte ich bisher nur gehört. Das ist wirklich lustig.«
»Und nur hier ist es geglückt«, sagte der Ältere. »Man hat vielerorts versucht, den Hopfen zu diesem Verhalten zu bewegen, allerdings erfolglos. Noch wird daran geforscht, warum es ausschließlich hier funktioniert, bislang jedoch ohne Ergebnis.«
Sie studierten die Speisekarten, aber nicht lange.
»Jüngerer Mann«, sagte der Ältere, »wie schon erwähnt, muss es hier der Goldhirsch sein.«
»Dann nehmen wir den«, sagte der Jüngere. »Und als Vorspeise?«
»Lass uns hören, was das Haus empfiehlt.«
Schon stand der Oberkellner am Tisch.
»Gestatten Sie mir, Ihnen eine Vorspeise zu empfehlen, die ihresgleichen sucht«, sagte er. »Normalerweise würde ich in dieser Jahreszeit Spargel nennen, denn er hat jetzt Saison, doch der diesjährige Spargel, vor allem der blaue, hat sich als etwas übellaunig erwiesen und beißt mit seinen gezahnten Blättern um sich, wenn man versucht, ihn zu ernten.«
»Das ist übel.« Aufrichtig bestürzt schüttelte der ältere Goldmacher den Kopf.
»Niemand weiß so recht, was dieses Jahr in ihn gefahren ist. Nun ja, geerntet wird er dennoch, aber die Wut verleiht ihm einen bitteren Beigeschmack.«
»Wie unerfreulich«, sagte der Ältere.
»Darum möchte ich ihn nicht empfehlen, obwohl er auf der Speisekarte steht und gerade Saison hat. Ich will ehrlich sein. Und lassen Sie es mich so sagen: Keine Sauce hollandaise ist mild und luftig genug, um diesen unerwünschten bitteren Beigeschmack ausgleichen zu können. Nicht einmal unser Meisterkoch Stefan bringt eine solche Soße zustande, obgleich seine Hollandaise so luftig ist, dass sie gehorsam zwölf Stunden durchhält, bevor sie zusammenfällt. Und für zwei seiner drei selbst kreierten Soßen ist er in Lyon mit Goldmedaillen ausgezeichnet worden: für die Mousseline-Sauce mit reinkarnierten Prärie-Austern, sous vide und sous dépression hergestellt, und für seine Béchamelsoße ganz ohne Mehl und Milchprodukte. Ich sage das nicht, um anzugeben.«
»Gewiss nicht.«
»Aber wir sind stolz auf ihn, unseren Stefan. Ganz klar. Die dritte Soße, für die er aufgrund der altmodischen Engstirnigkeit der Preisrichter keine Medaille bekommen hat, ist in meinen Augen sogar noch besser: die Sauce bâtarde, infiltriert mit dem Gelben aus Kolibri-Eiern. Äußerst arbeitsaufwendig natürlich. Aber unvergleichlich. Unvergleichlich. Wie auch immer! Ich empfehle den Herren eine schlichte Blumenkohlsuppe mit getrockneten Korinthen und ultrakurz pochiertem Seepferdchenrogen. Absolut ultramodern, und zugleich ultratraditionell.«
»Dann nehmen wir die Suppe«, sagte der Jüngere, »falls du einverstanden bist, Meister?«
»Nimm du sie«, sagte der Ältere. »Ich denke, ich nehme trotzdem den Spargel, um ein bisschen Bitterkeit zu verspüren. Das schadet sicher nichts.«
»Wie der Herr wünscht«, sagte der Oberkellner. »Und warum auch nicht. Warum nicht. Er hat schließlich Saison.«
Das Essen kam auf den Tisch, zusammen mit einer Karaffe Graublauburgunder, auf dem der Oberkellner bestanden hatte. Etwa alle zwei Minuten wechselte der Wein die Farbe von Grau zu Blau und zurück, beim Eingießen gab er ein angenehm klirrendes Geräusch von sich. Falls der Spargel bitter gewesen sein sollte, ließ der Ältere sich nichts anmerken, sondern aß ihn mit großem Behagen.
Als sie zum Goldhirsch kamen, wechselten sie, wiederum auf Anraten des Kellners, zu einem alkoholfreien, aber kurzzeitberauschenden Genever und einem Infrarot-Bier vom Fass, so schwer, dass sie die Krüge mit beiden Händen stemmen mussten. Der Kellner schnitt den Goldhirsch auf, dessen Kruste tatsächlich noch einen leicht goldenen Schimmer aufwies, die Trauben und Karpfenzungen entfalteten sich nebeneinander in wunderschöner Harmonie auf den meerschaumweißen und lagunenblauen Tellern aus Fischgrätfayence, Hanauer Manufaktur. Der Ältere hatte mit seiner Empfehlung nicht falschgelegen: Es war wirklich ein köstliches Gericht, und sie aßen mit gutem Appetit, einem Appetit, wie man ihn nur hat nach überstandenen großen Ängsten oder nach einer Beerdigung.
»Nun«, sagte der Ältere und schluckte eine zappelnde Karpfenzunge hinunter. »Die Rhetorik, über die wollten wir ja noch reden, oder nicht?«
»Doch«, seufzte der Jüngere, der sich für das Thema nicht im Geringsten interessierte.
»Wann hast du deine Vorstellung? Eigentlich müsste ich dich erst einmal in Aktion sehen, bevor ich dir guten fachlichen Rat geben kann.«
»Vorstellung?«
»Ja, du hast doch sicher eine Zeit für deine Vorstellung gebucht?«
»Ach ja …«
»Hier auf dem Marktplatz oder im Stadttheater? Soweit ich weiß, kann man sie in dieser Stadt nur an diesen beiden Orten abhalten«, sagte der Ältere und stach mit der Silbergabel in eine schamvoll errötende Traube.
»Nun, um die Wahrheit zu sagen …«, setzte der Jüngere verlegen an und errötete seinerseits.
Der Ältere musterte ihn eingehend, sagte aber nichts. Nach einer Weile räusperte er sich und befreite den Jüngeren aus der peinlichen Situation:
»Nun ja, man bucht die Zeiten im Rathaus. Wenn du Glück hast, ist noch etwas frei. Es ist ja noch keine Hauptsaison.«
»Das habe ich mir schon gedacht«, sagte der Jüngere, die Peinlichkeit ebenfalls überspielend. »Genau. Aber zur Rhetorik würde ich gern ein paar allgemeine Ratschläge hören, Meister«, seufzte er resigniert mit gesenktem Blick.
»Aha. Aha, würdest du. Gut, gut. Dann unterhalten wir uns vor dem Nachtisch und den Massagetechnikerinnen darüber. Hör gut zu.«
Der Ältere beugte sich über den Tisch und legte los mit seinen Erklärungen. Der Jüngere spürte sogleich, dass er sich wieder zu langweilen begann.
In gebührlichem Abstand saßen Hund und Katze im Schatten des Marktplatzbrunnens und betrachteten die beiden Goldmacher durch die offenen Fenster des Wirtshauses.
»Da sitzen sie«, sagte der Hund spöttisch, »und essen.«
»Pssst«, machte die Katze. »Siehst du nicht, dass ich sie beobachte?«
»Sie essen«, sagte der Hund verdrießlich.
»Sie sind verdächtig«, sagte die Katze. »Ich mag sie nicht. Sie werden Unglück bringen. Darauf gebe ich mein Wort.«
»Hast du keinen Hunger?«, fragte der Hund.
»Ich war mir meiner Sache noch nie so sicher«, sagte die Katze, ohne hinzuhören.
»Ich auch nicht«, murmelte der Hund.
»Sieh nur«, sagte die Katze. »Jetzt bestellen sie einen Nachtisch. Mein Gott.«
»Na und?«
»Leute, die schon zum Mittagessen ein Dessert bestellen, sind verdächtig«, behauptete die Katze. »Findest du nicht auch?«
»Doch, doch«, sagte der Hund resigniert, »kann schon sein.«
»Mörder bestellen zum Beispiel oft ein Dessert zum Mittagessen, das ist eine kriminologische Tatsache. Am besten bleiben wir hier und behalten sie im Auge.«
Seufzend sah der Hund sich um. Glücklicherweise hatte einer der Händler auf dem Markt eine Schale mit gekochten Kalbshaxen an seinem Stand. Der Hund ging zu ihm und fragte höflich, ob er eine Haxe haben könne. Der freundliche Händler gab ihm eine. Mit der Haxe in der Schnauze trottete der Hund zurück zum Brunnen, legte sich neben seinem misstrauischen Freund in den Schatten und begann, daran herumzukauen. Sobald die Katze in seine Richtung sah, schaute er eifrig zum Wirtshaus hinüber, als wäre er ganz bei der Sache. Und theoretisch, dachte er stoisch, während er seinen Hunger stillte, mochte die Katze ja auch recht haben. Vielleicht war es das Beste, die beiden Fremden nicht aus den Augen zu lassen. Außerdem, seufzte er innerlich: Heute hat man nun also seinen lieb gewonnenen freien Tag. Ansonsten ist man ein guter Planer, allerdings nicht hinsichtlich der eigenen freien Tage. Was bleibt einem dann anderes übrig, als mit der Katze Detektiv zu spielen.
Aber
3
an einem völlig anderen Ort der Stadt befand sich ein ungezogener Junge. Er war bösartig und ungezogen, und niemand wurde seiner Herr. Weder die Lehrer noch der Pfarrer oder der Wachtmeister; weder die strengen Nachbarsfrauen noch seine Freunde, und auch seine kleine Schwester nicht. Von Mutter und Vater ganz zu schweigen. Sein Vater war ohnehin eines Abends verschwunden, als es mit dem Jungen gar zu schlimm wurde; er wolle sich weiterbilden, hatte er gesagt, vom Schuhmacher zum Assessor am Höchsten Gericht, das werde seine Zeit dauern, und fort war er. Vier Jahre war das jetzt her. Da saß also die arme Mutter ganz allein mit dem ungezogenen Jungen und seiner kleinen Schwester, die zurzeit mit einem infektiösen Husten völlig isoliert in ihrem Zimmer lag und nicht nach draußen durfte, und so wurden sie mit jeder Stunde, die verging, ärmer. Sie wusste nicht mehr ein noch aus. Normalerweise sperrte sie den Jungen in das ehemalige Musikzimmer im obersten Stockwerk, wenn er wegen ungebührlichen Verhaltens aus der Schule nach Hause geschickt wurde. Sonst bekäme sie überhaupt nichts auf die Reihe von den vielen Dingen, die auf ihrem Zettel standen, müsste ständig darauf achten, dass er kein weiteres Unheil anrichtete. Neben den Aufgaben im Haushalt arbeitete sie als Näherin für die feinen Damen der Stadt. Wenn der Junge zu Hause war, brachte sie nicht mehr als einen halben Meter Saum zustande. Und auch um ihre Tochter konnte sie sich dann nicht kümmern, die zu jeder zweiten Stunde heißes geschleudertes Honigwasser mit teuren homöopathischen Tannentriebentropfen einnehmen musste. Die halfen zwar nicht, aber sie müsse sie einnehmen, sagte der Arzt, denn das, was tatsächlich half, konnten sie sich nicht leisten.
Heute war es besonders schlimm gewesen. Schon um elf Uhr vormittags hatte der Junge wieder vor der Tür gestanden, frech und aufsässig, die Schule habe ihn nach Hause geschickt, erklärte er, wollte aber nicht sagen, warum. Trotz ihrer Zweifel ließ sie ihn allein in der Küche essen und setzte sich wieder in ihr Nähzimmer; sie arbeitete gerade an einem Gewand aus feinstem, taufrischem Brokat und war mitten in einem besonders schwierigen Abschnitt, wo sie mit der dünnsten Sterlingsilbernadel und mit Platinfaden nähen musste. Doch schon nach fünf Minuten hörte sie aus der Küche einen jämmerlichen Klagelaut und ließ Nadel und Faden sinken.
Dort stand der Junge vor dem Käfig mit dem Kanarienvogel, eifrig damit beschäftigt, ihn durch die Gitterstäbe mit dem Stiel eines Kochlöffels zu drangsalieren. Weinend klagte der Kanarienvogel seine Not. Die Mutter entzog dem Jungen resolut den Kochlöffel und schickte ihn zurück an den Tisch, wo er weiteressen sollte. Dann ging sie wieder ins Nähzimmer, hörte jedoch gleich darauf abermals Geräusche aus der Küche. Diesmal schmiss der Junge Bröckchen des Brotteigs, der in einem Backtrog reifte, aus dem Fenster und auf unschuldige Passanten, und diesmal war es der Brotteig, der seine Not klagte, sobald der Junge ein Stückchen davon abzwackte. Wenn dann ein Bröckchen Teig in weitem Bogen durch das Fenster flog, kreischte es vor Höhenangst laut auf. Auch die Passanten schrien, denn die Teigbröckchen kletterten auf ihnen herum, um sich wieder zu vereinen und den Reifeprozess fortzusetzen, so wie es ihrer natürlichen Neigung entsprach.
Diesmal packte die Mutter den Jungen am Ohr und zerrte ihn ins Nähzimmer, wo sie ihn in eine Ecke setzte und ihm auftrug, zwei Schachteln voller verschiedenfarbiger Knöpfe zu sortieren. Damit wäre er eine Weile beschäftigt, hoffte sie, denn manche dieser Knöpfe waren von eher unbestimmbarer Färbung.
Dann versuchte sie, sich wieder auf die Arbeit zu konzentrieren, hatte aber erst wenige Andreaskreuzstiche mit der Silbernadel ausgeführt, als sie hörte, wie sämtliche Knöpfe in wilder Panik über die Bodendielen rollten.
Zornbebend sprang sie auf, um sich auf den Jungen in der Ecke zu stürzen, glitt jedoch auf einem kugelrunden Perlenknopf aus und fiel rücklings zu Boden. Dabei schlug sie mit dem Kopf auf und war für einen Moment bewusstlos.
Als sie wieder zu sich kam, tanzte der Junge mit einer ihrer Schneiderpuppen durchs Zimmer. Die Puppe protestierte wohlerzogen leise. Dabei verschmutzte er die hauchdünnen, zarten und ultramodernen, nervösen Stoffe, die sie über die Puppe drapiert hatte, um einer äußerst wichtigen Kundin ein neues Frühlingsgewand vorzuführen. Der Schneiderpuppe war das nicht recht, doch was half’s, Schneiderpuppen müssen sich in so vieles fügen. Die Stoffe aber würden sich nie wieder davon erholen. Das konnte die Mutter mit halbem, halb bewusstlosem Auge erkennen.
Sie rappelte sich mühsam hoch und schleifte den laut protestierenden Jungen die krumme, knarrende Treppe hinauf zum Musikzimmer, das nicht mehr in Gebrauch war, dafür aber – ihr gruselte und sie schämte sich sogleich bei dem Gedanken – voller Mäuse. Ohne noch ein Wort zu ihm zu sagen, stieß sie ihn in das Zimmer, knallte die Tür zu und verschloss sie mit zwei Riegeln sowie einem massiven Vorhängeschloss aus gehärtetem Stahl. Zugleich hörte sie, wie die Mäuse drinnen aufgebracht fiepten und der Junge angsterfüllt schrie. Es war zwar streng verboten, Mäuse ins Haus zu lassen, doch hier hatte sie der Natur und dem Verfall freien Lauf gelassen; für alles andere fehlte ihr die Kraft.
Geschieht ihm recht, dachte sie.
Dabei war er so ein hübscher Junge, mit seinen langen braunen Haaren und den dunkelblauen Augen, aber sein Benehmen war völlig daneben.
Sie ging zurück ins Nähzimmer und sammelte die Knöpfe auf. Die beleidigten ultradünnen Stoffe an ihrer Schneiderpuppe wagte sie nicht einmal anzuschauen.
Nachdem sie mühselig alle Knöpfe aufgelesen hatte, setzte sie sich wieder an die Arbeit, fand jedoch keine Ruhe. Es war immer wieder dieselbe Geschichte. Jeden Monat vergeudete sie unendlich viel Zeit bei abendlichen Treffen mit seinem Klassenlehrer, oft zu Zeiten, zu denen weder sie noch der Lehrer Lust hatten, sich in dem Schulgebäude aufzuhalten, was das Klima zwischen Schule und Zuhause nicht gerade verbesserte. Wie sehr sie das alles satthatte. Nachdem sie noch einmal die jammernde Treppe hinaufgestiegen war, um sich abermals zu versichern, dass die Tür zum Musikzimmer ordentlich verschlossen war, und nachdem sie ihrer kranken, infektiösen Tochter durch die Tür zugerufen hatte, sie habe eine Besorgung zu machen, zog sie Mantel und Schuhe an und verließ ihr ärmliches graues Haus, um sich zu der drei Häuserblocks weiter gelegenen Hans-Kohlhase-Mittelklasseschule (IECED Level 2 Secondary Education First Stage) zu begeben, jener Lehranstalt, welche die pädagogische Verantwortung für den Jungen innehatte und an der sie seinerzeit selbst Schülerin gewesen war.
Auf der Straße angekommen, brachte sie es nicht über sich, zurückzuschauen und einen Blick auf das Haus zu werfen, so ärmlich und grau war es geworden. Überall sonst in dieser Straße herrschten Wohlstand und Überfluss, Auswirkung des Glücksgefühls, das mit der förderlichen, spendablen Regierungsweise von Markgräfin Clotilde einherging; ja, die Wohlfahrtsvereinigung des Stadtteils hatte jüngst sogar mit dem Bau von Farbrinnen auf Höhe der Straßenbeleuchtung begonnen, die dort, wo sie bereits angebracht waren, munter überschwappten und Fassaden wie Bürgersteige in die leuchtenden Farben des Regenbogens tauchten. Einzig um ihr schmales Haus schlug die Rinne demonstrativ einen weiten Bogen. Ihr hatten die Mittel gefehlt, sich an der Maßnahme zu beteiligen. Als gerechte Strafe hatte die Stadtteilverwaltung vor der Sonne einen Schatten aufgestellt und an der Straßenecke einen Kältegenerator anbringen lassen, sodass das Haus stets im Halbdunkel lag und drinnen ein eisiger Luftzug über die Fußböden fegte. Ein Blick auf ihr einst so schönes Haus (den sie jedoch vermied) hätte in ihr nur die Erinnerung an den grausamen, traurigen Tag geweckt, als die Sozialarbeiter angerückt waren, um sämtliche Farbe von Fassade und Fensterrahmen zu entfernen, zugleich Löcher ins Fundament zu hacken und Sprünge in die Fensterscheiben zu klopfen. Darum verließ und betrat sie das Haus stets mit gebeugtem Nacken, wie es sich für eine bestrafte Bedürftige geziemte.
An alledem ist der Junge schuld, dachte sie bitter.
Und: Wenn nur sein Vater hier wäre.
Und: Zum Glück hatte sie ihre Tochter, das liebe, hilfsbereite Kind. Nur schade, dass sie so krank und infektiös war und von Minute zu Minute immer weiter dahinschwand.
Und: Übrigens war der Vater ein Schuft.
Und: Der Junge aß viel zu viel, ja, er würde ihnen noch das Dach über dem Kopf wegfressen. Wollte er denn nie aufhören zu wachsen?
Und: Der Junge stahl. Wie eine Elster.
So entfernte sie sich gebeugt von dem entstellten Haus, ohne die Gestalt zu bemerken, die ihr folgte.
In der Schule begab sie sich ins Lehrerzimmer, wo die Lehrer die große Pause bereits nutzten, um sich gegenseitig Reiki-Massagen zu verabreichen, gewiss dringend vonnöten. Sogleich entdeckte sie den Klassenlehrer ihres Sohnes, der zufällig im Anschluss eine Freistunde hatte und sie bat, noch einen Moment zu warten, während seine Muskeln unter den rechten und linken scapulae ausgestrichen wurden.
Danach nahmen sie zusammen in einem Besprechungszimmer Platz.
»Ja, ja«, hob er in verständnisvollem, doch zugleich resigniertem Tonfall an. »Da wären wir also wieder.«
»Ja«, seufzte sie zurück.
»Diesmal aber am Tage. Immerhin.«
»Ich dachte, ich komme am besten sofort. Was ist denn vorgefallen?«
Der Lehrer lehnte sich zurück und öffnete den obersten Knopf seiner strengen Magisterjacke. Er seufzte.
»Die Schweigepflicht verbietet mir, ins Detail zu gehen«, sagte er ernst. »Aber seien Sie versichert, es war schlimm. Wirklich schlimm. Besonders schlimm.«
Sie schaute ihn an. Ihn hatte sie selbst schon als Klassenlehrer gehabt. Er hatte sich nicht verändert. Als sei seit damals keine Zeit vergangen. Nur die Jacke war anders; heute, in Clotildes Zeit, waren die Jacken rosa. Er war noch ebenso energiegeladen und jugendlich wie damals. Ihr war bekannt, dass bei ihm dank seiner Verdienste der Alterungsprozess ausgesetzt worden war, dieser würde ihn nach der Pensionierung nur umso stärker einholen, dennoch verspürte sie Neid. Bald wäre er jünger als sie, falls er das nicht bereits war.
»Ich bin mit meinem Latein am Ende«, seufzte sie. »Ich komme nicht mehr mit ihm klar.«
Der Klassenlehrer seufzte zurück.
»Ich verstehe«, sagte er. »Es muss sehr schwierig für Sie sein.«
»Es kommt mir vor, als ob er einfach nicht lieb sein wollte.«
»Ja, er ist eine harte Nuss«, seufzte der Klassenlehrer. »Fast habe ich ihn selbst schon aufgegeben. Aber Sie sollten den Mut nicht verlieren.«
»Ich fürchte, das tue ich bald.«
Sie seufzten beide.
»Um Ihnen eine kurze Zusammenfassung seines Leistungsstands zu geben«, sagte der Klassenlehrer, »in Englisch sieht es nicht gut aus. Weder in Altenglisch noch in modernem Englisch.«
Die Mutter des Jungen seufzte. Sie wusste schon, was jetzt kam.
»In Deutsch läuft es auch schlecht. Ganz schlecht. Er hinkt im Stoff weit hinterher, in der Theorie wie in der Anwendung. Dasselbe gilt für den Stoff in Physiokratie.« Er seufzte.
Sie seufzte.
»Des Weiteren«, fuhr der Klassenlehrer fort, »macht er auch in Leibesübungen eine schlechte Figur, da er sich partout nicht einreihen will und kein Interesse an modernen Massagetechniken hat, nicht einmal an der Triggerpunktmassage. Auf diese Weise kann er seinen Leib nicht trainieren.«
»Das ist übel. Ich dachte, in dem Fach liefe es ein bisschen besser.«
»Mitnichten. Letztes Jahr vielleicht noch. Dieses Jahr nicht mehr. Des Weiteren: In moderner Ultraarithmetik und Ultrageometrie hinkt er weit hinterher. In angewandter Chemie sieht es auch schlecht aus. Etwas besser in den kleinen Nebenfächern, wie Eschatologie und Skatologie, wenn man ein bisschen Fantasie und guten Willen walten lässt. Vielleicht. Aber sogar in Allgemeiner Literaturwissenschaft, dem einfachsten Fach, steht es nicht gut.«
Er seufzte. Auch sie seufzte, den Tränen nahe.
»Es muss wirklich schwierig für Sie sein«, wiederholte der Klassenlehrer noch einmal.
»Was würden Sie mir raten?«
»In einer solchen Situation ist es nicht leicht, gute Ratschläge zu erteilen. Überhaupt nicht leicht. Ratschläge kann man zwar geben, doch es ist nicht gesagt, dass sie auch gut sind, egal, was man sagt.«
»Ich verstehe. Es muss auch für Sie schwierig sein.«
»O ja«, seufzte der Klassenlehrer.
Eine Weile schwiegen sie beide. Vom Schulhof her waren die gleichförmigen, beruhigenden Geräusche einer Klasse bei der Reihengymnastik zu hören, gefolgt von Mensendieck-Übungen.
»Und wenn Sie mir dennoch einen Rat geben würden?«
»Schwer zu sagen. Schwierig.«
»Schon – aber trotzdem. Wenn?«
»Tja«, sagte der Klassenlehrer. »Haben Sie schon einmal erwogen, ihn zu verkaufen?«
Sie verstummte, wusste nicht, was sie sagen sollte. Allein die Frage war schockierend, ja grausam. Dennoch musste sie sich fragen: Hatte sie es erwogen?
Tief in sich drin wusste sie die Antwort.
»Ja«, seufzte sie, »tief in mir drin habe ich es wohl schon erwogen.«
Der Klassenlehrer blickte sie aus großen, sanften Augen an.
»Es ist nicht leicht. Aber es gibt keinen Grund, es sich nicht einzugestehen. Wenn man es denn erwogen hat.«
»Nein«, sagte sie, »das ist sicher richtig.«
Eine Weile grübelten sie beide über das nach, was in ihrem Gespräch zutage getreten war. Es war schockierend und befreiend zugleich. Den Geräuschen nach zu urteilen, waren die Kinder draußen zu Massage übergegangen. Der Lehrer räusperte sich.
»Es ist natürlich ein längerer Prozess«, sagte er. »Er nimmt etliche Monate in Anspruch. Allerlei Formulare sind auszufüllen, alle möglichen Genehmigungen einzuholen. Doch man kann das Verfahren jederzeit unterbrechen. Jederzeit.«
»Ach ja?«
»Ja, falls eine Besserung eintritt. Oder wenn man sich ganz einfach umentscheidet. Oder wenn die finanziellen Verhältnisse sich zum Guten wenden. Um Ihre steht es nicht besonders gut, soweit ich weiß?«
»Beklagenswert schlecht.«
»Eben. Eben. Also, wie gesagt, das Verkaufsverfahren kann jederzeit unterbrochen werden. Es ist ja kein Zwangsverkauf, sondern eine freiwillige Sache.«
Sie dachte eine Weile darüber nach.
»Wie geht man vor?«, fragte sie schließlich leise.
Abermals räusperte sich der Klassenlehrer.
»Zunächst stellt man einen Antrag an den Elternausschuss.« Er flüsterte geradezu. »Dieser muss dem Verkauf zustimmen. Ich fürchte, in dem Ausschuss haben Sie nicht gerade viele Freunde. Nein, nein«, er schüttelte betrübt den Kopf, »Sie erscheinen ja nie zu den Elternabenden. Und wenn, dann zu spät. Und als wir auf dem Schulhof ein neues Himmel-und-Hölle gemalt haben, haben Sie die Felder falsch nummeriert.«
»Mich trifft keine Schuld«, protestierte sie, heftiger als gewollt. »Es ist einfach so viel zu –«
»Gute Frau«, sagte der Klassenlehrer freundlich. »Sie brauchen sich mir gegenüber nicht zu rechtfertigen. Ich bin hier, um zuzuhören. Und Ratschläge zu erteilen.«
Er blickte sie aus großen blauen Augen verständnisvoll an. Sie waren ebenso blau wie die Augen ihres Sohns, fiel ihr jetzt auf. Als junges Mädchen hatte sie für diesen Lehrer geschwärmt. Als Vater würde er den Jungen möglicherweise zur Räson bringen können, dachte sie. Sie wusste, dass der Klassenlehrer noch unverheiratet war. Wenn sie jetzt ihre Brüste vor ihm entblößen würde, würde er vielleicht um ihre Hand anhalten. Oder zumindest die Brüste massieren. Sie waren noch voll und rund, und wenn sie die beiden ordentlich darum bat, richteten sie sich nach wie vor auf. Jedenfalls aus bestimmten Blickwinkeln gesehen.
Doch jetzt war der Mittelstufenlehrer aufgestanden und zum Bücherregal gegangen, wo er die Formulare für den Antrag an den Klassenelternausschuss zwecks Verkaufsgenehmigung heraussuchte.
»Bitte schön«, sagte er fürsorglich und eindringlich, als er ihr die Papiere reichte. »Lassen Sie sich Zeit. Lassen Sie den Entschluss reifen. Ich gebe Ihnen diese Formulare nur, damit Sie sie schon mal haben. Es eilt nicht. Die Entscheidung«, sagte er eindringlich, »muss von Ihnen kommen.«
Als er das sagte, spürte sie, wie sich ihre Brüste in der Bluse zusammenzogen, wie im Schock.
»Danke.« Sie steckte die Formulare in die Handtasche. »Vielen Dank für Ihr Verständnis.« Ihre Stimme zitterte ein wenig.
»Gehen Sie nach Hause und versuchen Sie, sich ein wenig auszuruhen«, sagte der Klassenlehrer. »Das haben Sie sicher bitter nötig. Und vergessen Sie nicht, es ist Ihre Entscheidung. Sie sollten erst mal darüber schlafen.«
Sie bedankte sich abermals und ging.
Aber
4
sie ging nicht nach Hause.
In ihrer Verzweiflung beschloss sie stattdessen, den Oberpriester in der Kirche mit den beiden ungleichen Türmen aufzusuchen, der Kirche zu Unserer Heiligen Frau der Oberflächlichen Freuden, wo ihr Sohn derzeit den Konformationsunterricht besuchte und nächsten Winter konformiert werden sollte. Den einen Turm zierte eine Zwiebelkuppel, der andere lief spitz zu, sodass die Kirche immer etwas schieläugig wirkte.
Ihr war schmerzlich bewusst, dass es um den Unterricht des Jungen nicht zum Besten stand, dennoch hoffte sie, vom Oberpriester einen besseren Rat zu erhalten. Sie fand ihn hinter der Kirche, beim Friedhof, wo er eine Gruppe Unterpriester kommandierte, die in einer langen Reihe mit langstieligen Besen und Schrubbern die schwer zugängliche Seitenwand reinigten.
»Seien Sie gegrüßt, gnädige Frau, gesegnet sei der Tag«, sagte der Oberpriester säuerlich, als er sie erblickte. »Kommen Sie zur Beichte oder um sich für Ihren Sohn zu entschuldigen?«
»Um die Wahrheit zu sagen«, fing sie an, »bin ich gekommen, Heiliger Vater, Seelsorger, Oberhirte, um Sie um einen guten Rat zu bitten.«
»Ach«, sagte der Oberpriester immer noch säuerlich, »tatsächlich. In welcher Sache denn, wenn ich fragen darf?«
»In der meines Sohnes«, antwortete die Frau leise.
»Hab ich mir’s doch gedacht«, sagte der Priester. »Gut, gut. Dann kommen Sie mal mit in mein Büro in der Sakristei. Wären Sie so gebenedeit, mir zu folgen?«
Sie nickte andächtig.
»Im Übrigen, wenn ich es recht bedenke«, sagte der Oberpriester, »könnte ich ein wenig liturgischen Beistand gebrauchen.« Er schnippte mit den Fingern nach den scheuernden Unterpriestern: »Hic, Haec, Hoc und Hank: Mitkommen!«
Erfreut ließen Hic, Haec, Hoc und Hank die Schrubber fallen, falteten die Hände und schritten ihnen, ein paar passende Gebete murmelnd, feierlich voraus. Die kleine Prozession drehte eine rasche Runde um die Kirche, bevor sie die Sakristei durch die Automatiktüren betrat.
Drinnen herrschten angenehm sakrale Temperaturen und ein schönes, fein abgestimmtes, zähes Echo. Die Unterpriester stimmten sogleich einen Choral an, mit dem Echo als Kanon, während der Oberpriester und sein Gast in den hochfestlichen, hochlehnigen Priesterstühlen aus Guss-Mangan mit religiösen Symbolornamenten aus Wolfram Platz nahmen.
Der Oberpriester entzündete eine rosa Wachskerze, um den offiziellen Charakter des Gesprächs zu betonen, bemühte sich, sein Gesicht in die vorgeschriebenen Falten zu legen, und las den Segen. Die Mutter des Jungen neigte gehorsam den Kopf.
Der Priester gelangte zum Amen, das von den assistierenden Theologen in verschiedenen Tonarten wiederholt wurde. Dann sagte er:
»Es ist vernünftig von Ihnen, endlich zu mir zu kommen.«
»Danke«, sagte die Mutter des Jungen.
»Sie hätten schon längst kommen sollen.«
»Ja«, sagte sie, »aber man scheut sich eben.«
»Ja, das tut man«, sagte der Oberpriester salbungsvoll und der Chor wiederholte in einem beruhigenden, diatonischen Tritonus: »Das tut man, das tut man, das tut man.«
»Denn alle«, fuhr der Oberpriester fort, »können Gottes Rat gut brauchen.«
»Den brauche ich wirklich«, seufzte sie, vor Erleichterung den Tränen nah.
»Halleluja«, sang der Chor.
»Und jetzt, gute Frau, will ich Ihnen sagen, worin Gottes Rat in diesem Fall besteht.«
»O ja, bitte!«, brach es aus ihr hervor, wenn auch fast stumm vor Freude und dem Gefühl von Gnade.
»Nehmt Gottes Rat an«, sang der Chor in gregorianischen Wendungen.
»Ich habe nämlich mit Gott darüber beraten.«
»Haben Sie das, Herr Pfarrer?«
»Ja, und zwar unter vier Augen. Nach dem jüngsten Vorfall beim Konformationsunterricht erschien es mir geboten. Die Schweigepflicht verbietet mir, ins Detail zu gehen, aber Sie können es sich selbst vorstellen. Und um Ihnen die Vorstellung zu erleichtern, greifen wir wie stets zu visuellen Hilfsmitteln.« Auf sein Zeichen hin stimmten seine Helfer summend Johann Francks und Johann Crügers schönes Kirchenlied Herr, ich habe mißgehandelt, ja, mich drückt der Sünden Last an, Nr. 501 des reformierten Kirchengesangbuchs, während sie an der Querwand zugleich eine Lichtbildschau mit Aufnahmen aus der Rechtsmedizin vorführten, die mit beklagenswerter Deutlichkeit das Gesicht des Katecheten nach dem unbegründeten Angriff des Jungen in der letzten Stunde des Konformationsunterricht zeigten. Das letzte Bild war eine Makro-Aufnahme seiner Nase, deren Blau ins Schwarze überging.
»Der Herr ließ seine Diashow über euch leuchten«, sangen die Unterpriester in mixolydischer Kirchentonart, »Gehet hin in Frieden.«
»Nein nein«, korrigierte der Oberpriester, »wir sind noch nicht fertig. Sie müssen verstehen, gute Frau«, fuhr er mahnend fort, »dass ich ihn nicht zur Konformation zulassen kann. Vollkommen ausgeschlossen. Und Gott ist derselben Ansicht.«
(Chor: »Hört Gottes Wort.«)
»Gott hat ohne Umschweife zu mir gesagt: Der Junge kann nicht konformiert werden. Selbst wenn die Hölle gefrieren sollte. Das wäre gänzlich gegen die Vorschriften. Genau das hat Er gesagt, wörtlich.«
(Chor: »So lauten die Gebote des Herrn.«)
»Aber –«, begehrte die Mutter verzweifelt auf, »aber was soll ich denn tun? Oh Verehrter, Heiliger Vater, ich weiß nicht mehr ein noch aus!«
»Tja«, meinte der Geistliche, »hier brauchen wir wohl noch einmal Gottes Rat. Lasset uns beten.«
(Chor: »Herr, höre unser Gebet.«)
Alle falteten die Hände und verhielten sich eine Weile still, dabei blickten sie hoch zur Decke, wo zu diesem Behufe ein Zifferblatt angebracht war.
»Wir haben gebetet«, sagte der Oberpriester nach Ablauf von drei Minuten.
»Und?«, fragte die Mutter neugierig. »Hat Gott geantwortet?«
»Selbstverständlich hat Er geantwortet«, sagte der Priester verärgert. »Haben Sie es nicht selbst gehört?«
»N-nein«, sagte sie bedauernd, »leider nicht …«
»Er antwortet immer«, betonte der Oberpriester.
»Gottes Wort ist ewiglich«, sang der Chor.
»Er antwortet stets«, sagte der Oberpriester.
»Von Ewigkeit zu Ewigkeit«, sang der Chor, jetzt in dorischer Tonart, um den Ernst zu unterstreichen.
»Wenn man sich einer Sache sicher sein kann, gute Frau, dann, dass Gott antwortet, wenn man betet.«
»Ein feste Burg ist unser Gott«, stimmte der Chor an, »ia-ia-oh!«
»Ich konnte nichts hören«, sagte die Mutter des Jungen unglücklich.
»Aber wir haben es gehört«, beruhigte sie der Oberpriester. »Man braucht ein Semester Hörlehre an der Fakultät, dann ist es nicht weiter schwierig.«
»Ich verstehe, Vater«, sagte die Mutter demütig.
»Und in besagtem Fach ein Examen ablegen muss man auch, versteht sich.«
»Ich verstehe, Vater«, wiederholte sie. »Und was hat Gott gesagt?«
»Hm«, räusperte sich der Oberpriester, ein wenig beklommen, gefolgt von seinen vier Assistenten, die sich ebenfalls räusperten, jeder in seiner Tonart.
»Und?«, fragte die Mutter verwirrt.
»Männer, ihr habt doch auch gehört, was Er gesagt hat, oder?«, fragte der Oberpriester seine Jünger.
Diese nickten einstimmig.
»Gute Frau«, sagte der Oberpriester. »Diese Woche, aber nur diese Woche …«
Einer seiner Assistenten flüsterte ihm etwas ins Ohr.
»… vielleicht auch noch Anfang nächster Woche, aber das ist keineswegs sicher, diese Woche jedenfalls, gute Frau, haben wir ein Sonderangebot für Kinderbestattungen.«
Entsetzt blickte sie ihn an.
»Das Angebot der Woche!«, schmetterte der Chor.
»Ganz prachtvolle, rührende Kinderbestattungen«, fuhr der Priester fort. »Mit komplettem Knabenchor und gratis Solist. Ich garantiere, da bleibt kein Auge trocken, wenn kurz vorm Erdwurf auf den Sarg Bist du bei mir, Bach-Werke-Verzeichnis 508, gesungen wird.«
Sie antwortete nicht.
»Bist du bei mir, geh' ich mit Freuden«, hingerissen stimmte der Oberpriester die erste Strophe an. Noch immer antwortete sie nicht, obwohl er einen richtig schönen Tenor hatte.
Der Oberpriester blickte sie eindringlich an.
»Dazu Buketts aus Tigerlilien, ab zweihunderttausend Pesos aufwärts. Zu beiden Seiten des kleinen … des kleinen, kleinen weißen Sargs. Sehr bewegend.«
»Nutze die Chance«, sang der Chor mit der Kraft des Glaubens.
»Und«, fuhr der Priester fort, verärgert darüber, dass die Mutter des Jungen noch immer nicht einschlagen wollte, »ich bin überzeugt, dass ich beim Sarg noch einen Rabatt von bis zu fünfundzwanzig Prozent heraushandeln kann. Vorausgesetzt, er ist aus Sperrholz und nicht aus Eiche. Zwei Schichten Anstrich. Nein, drei.«
»Aber –«, setzte die Mutter des Jungen an, bevor sie wieder in Gedanken verfiel.
»Okay, sagen wir dreißig Prozent. Aber dann wird es nicht die übliche Ölfarbe, sondern einfache seidenmatte, wenn auch deckende Acrylfarbe. Zwei Anstriche. Den Farbton können Sie selbst bestimmen.«
»Der Herr gibt«, sang der Chor, »und heute gibt der Herr noch etwas mehr, gelobt sei der Name des Herrn!«
»Sie schlagen also tatsächlich vor …«, setzte die Mutter des Jungen erschrocken an.
»… eine Einschläferung, ja. Es ist wohlgemerkt nicht mein Vorschlag, gute Frau«, rügte er sie streng, »sondern der Vorschlag Gottes. Wohl das Einzige, was hier noch hilft. Gott ist stets so vernünftig.«
»Aber –«





























