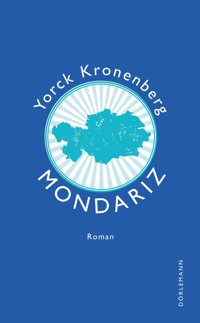
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mondariz ist eine – nach einem drohenden Vulkanausbruch – weitgehend verlassene Insel im südlichen Atlantik. Ein junger Musikwissenschaftler geht dort von Bord. Er ist auf der Suche nach den Werken des Komponisten José Diego Coimbra, der in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine eigene Tonsprache entwickelte und dessen Werk als verschollen gilt. Gleichzeitig spürt der Reisende seinen Erinnerungen nach: In Begleitung seiner ehemaligen Freundin hat er Mondariz bereits zehn Jahre zuvor be- sucht, zu einer Zeit, als die Leichtigkeit einer jungen Liebe sich in der Lebensart der Inselbewohner und der beeindruckend schönen Landschaft zu spiegeln schien. Auf Mondariz enthüllt sich dem Ich-Erzähler weit mehr als das Rätsel des Komponisten José Diego Coimbra. Die Auseinandersetzung mit dem Fremden verändert auch ihn selbst: die Sicht auf sein Leben – und das Verhältnis zu seiner vergangenen Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Yorck Kronenberg
MONDARIZ
Roman
Dörlemann
Alle Rechte vorbehalten © 2020 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung von Mike Bierwolf, unter Verwendung einer Grafik von ducu59us/Shutterstock Frontispiz: Porträt Yorck Kronenberg, © Barbara Dietl (www.dietlb.de) Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-975-1www.doerlemann.com
Inhalt
Yorck Kronenberg
Nach einer Seefahrt von Punta del Este aus erreichten wir im Morgengrauen des fünften Tages von Osten her die Insel Mondariz. Außer dem Bootsführer und mir waren nur zwei ältere Männer an Bord, deren Funktion mir nicht klar war. Sie trugen verschlissene Arbeitskittel und hielten Schraubenschlüssel in Händen, drehten sie in den Fingern und hielten sie sich hin und wieder vor die Augen. Die meiste Zeit aber saßen sie zurückgelehnt an der Reling, die Beine hochgelegt, die Lider halb geschlossen: Die See war ruhig und ließ das gleichmäßige Rattern des Motors und die daraus entstehende eigene Bewegung schnell vergessen. Die Nächte waren warm und sternklar, die Tage weitgespannt wie das Meer. Ich las Reiseberichte von Melville und Bruce Chatwin. Immer wieder zog ich auch das stockfleckige Manuskript aus der Tasche, als müsse das veränderte Licht mir Einzelheiten der Partitur offenbaren, die mir bisher entgangen waren.
Einmal, als das Papier in einer leichten Brise zu flattern begann, stellte ich mir vor, es würde zwischen meinen Fingern hindurchgleiten und vom Wind in die Höhe gehoben – die Blätter würden im Meer versinken und selbst ich, der vielleicht einzige Mensch, der sie studiert hatte, würde mich bald kaum mehr an Einzelheiten erinnern. Nur eine vage Ahnung würde bleiben, dass es den Zyklus jemals gegeben hatte: Klaviervariationen über ein eigenes Thema, verfasst von José Diego Coimbra. In der rechten oberen Ecke des Titelblattes stand das Datum: Mondariz, 8. Mai 1862. Ich umfasste das Manuskript mit einer Festigkeit, die das Papier zwischen meinen Fingern in Wellen legte. Mit gehaltenem Atem packte ich das Bündel zusammen und verstaute es in meiner Reisetasche. Erst dann lehnte ich mich zurück und überließ mich wieder dem leichten Schwanken des Bootes.
Die Insel sah im Dämmerlicht vor Sonnenaufgang aus wie eine einzige düster aus dem Meer aufragende Klippe. Erst im Näherkommen zeichnete sich die Siedlung am Hafen ab, darüber der Hang, dessen Grasbewuchs jetzt freilich von aufsteigendem Dunst verhüllt war. Als wir in das kleine Hafenbecken einfuhren, wurden die Gipfel vom ersten Licht des Tages erfasst. Wenig später tauchte die Sonne aus dem Meer auf, zwei vor Anker liegende Fischerboote warfen schwankende Schatten auf die zum Marktplatz hin ansteigende Kaimauer. Wie zu unserer Begrüßung begannen im Dorf die Kirchenglocken zu läuten.
Miguel wartete auf mich. Er ist älter geworden. Auf den ersten Blick bemerkte ich ihn in der Gruppe der Schaulustigen, die sich am Geländer zum Hafenbecken zusammengedrängt hatten, nicht einmal. Erst als er mich ansprach, verband sich das Bild des lächelnden Herrn mit meiner Erinnerung und trat noch im Moment daraus hervor wie ein klar artikuliertes Wort, das einen verblassenden Gedanken zusammenfasst.
Vielleicht hättest du ihn gleich erkannt, ging mir durch den Kopf.
Er wohnt noch immer in seinem Blockhaus am Waldrand, das jetzt, im strahlenden Licht des Morgens, wie aus einer anderen Sphäre auf das Dorf herabzublicken schien.
»Wie lange ist es her, dass Sie auf Mondariz waren?«, fragte er und legte mir die Hand auf die Schulter.
»Bald zehn Jahre«, gab ich zurück.
Ich sah mich um. Fischer mit Netzen und Angeln gingen über den Marktplatz auf den Hafen zu. Das Pflaster aus sandfarbenen, ungleichmäßig geformten Steinplatten dampfte im Sonnenlicht und selbst die Fassaden der hohen Gebäude, die den Platz einfassen, schienen von der Nacht taubeschlagen zu sein. Vereinzelte Fenster waren geöffnet, aus einem Hotelzimmer im dritten Stock blickte eine junge Frau auf den Platz. Das ganze Dorf wirkte trotz der unterschiedlichen Architektur homogen, als hätte man den felsigen Untergrund Quader für Quader abgetragen und dann in Form der Häuser und Gassen neu aufgeschichtet. Eine Möwe landete auf dem Platz und pickte nach einem fallengelassenen Köder. Ein Fischer drehte sich um und trat nach ihr, beugte sich dann aber nicht einmal hinab, um das Stück Fisch aufzuheben.
Ich wohne in einem Ganghaus in der Via Umbria. Die Gasse läuft in südlicher Richtung auf jenen Strandabschnitt zu, von dem aus wir damals häufig schwimmen gingen. Erinnerst du dich an unsere Begegnung mit den drei Jugendlichen, die dir hinterherschwammen und dich am Strand nach deiner Telefonnummer fragten? Ich hatte den Nachmittag über arbeiten wollen und kam genau in dem Moment dazu, als einer der drei anbot, dir das Schiffswrack im Westen der Insel zu zeigen. Er wurde verlegen, beugte sich hinab und strich eine Alge von seinem Oberschenkel – wahrscheinlich wollte er meinem Blick ausweichen. Du nahmst mich in den Arm, was seine Verlegenheit noch vergrößerte. Wir sind ihm später noch mehrfach begegnet und machten uns einen Spaß daraus, uns bei den Händen zu nehmen oder Arm in Arm an ihm vorbeizugehen. Wir waren verliebt.
Der Junge von damals wohnt nur wenige Häuser von mir entfernt, ich erkannte ihn sofort, als er in der engen Gasse auf mich zukam, die schlanke Gestalt, das schmale Gesicht mit den versonnen schwarzen Augen. Er hielt inne, durchwühlte die Hosentaschen nach seinem Schlüssel. Er musterte mich mit seltsam unbestimmtem Blick, hob dann halb die Hand, ohne sich aber zu einem wirklichen Gruß durchringen zu können. Als er Miguel hinter mir sah, rief er ihm einen Satz zu, den ich nicht verstehen konnte. Dann wandte er sich um und schloss eine Tür auf.
Später war aus dem Innern des Hauses Klavierspiel zu hören.
Das Haus, das Miguel mir zur Verfügung gestellt hat, ist schmal, kaum breiter als fünf Meter. Es besteht aus drei übereinanderliegenden Räumen: Im Erdgeschoss befindet sich die Küche mit Esstisch, außerdem ein kleines Badezimmer; darüber ein Arbeitszimmer mit aufklappbarem Sekretär, Sofa und großem Schrank. Unterm Dach steht das Bett, wie die übrigen Möbel aus massivem, zum Teil wurmstichigem Holz gezimmert. Die Räume sind besonders hoch. Wie Miguel mir erklärte, sind bei selber Höhe des Gesamtgebäudes in anderen Häusern bis zu fünf Stockwerke untergebracht.
In eine Straßenkarte zeichnete er mir verschiedene Sehenswürdigkeiten ein und markierte einen Lebensmittelladen. »Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie bei mir vorbei«, sagte er. »Ich helfe Ihnen gern.«
Ich erkundigte mich nach Coimbra, nach Zeitzeugnissen, nach seinen Kompositionen. »Wird Coimbras Nachlass auf der Insel verwaltet? Ist überhaupt noch etwas überliefert?« Kurz hatte ich die Befürchtung, Miguel werde mit einem Zucken der Schultern, mit einem einzigen Lächeln meiner Hoffnung ein vorzeitiges Ende setzen.
»Kommen Sie erst einmal an«, sagte er dann aber nur und hob beschwichtigend die Hand. »Wie lange werden Sie auf Mondariz bleiben?«
»Das Postschiff soll in zehn Tagen wieder in Mondariz sein. Ich habe mit dem Bootsführer ausgemacht, dass er mich beim nächsten Anlaufen der Insel gegen Mittag erwarten soll. Ich reise beruflich nach Bolivien weiter.«
Er nickte. »Kommen Sie erst einmal an«, wiederholte er.
Ich brachte die Koffer nach oben. Erst als ich mich auf das Bett gelegt hatte und die Augen schloss, bemerkte ich, dass der Boden noch immer unter mir schwankte. Wieder tauchte das Bild der Insel als düster aus dem Meer aufragender Block vor mir auf, eine einsame Klippe, die in alle Richtungen bis zum Horizont von der Endlosigkeit des Meeres eingefasst wird. Manchmal gingen diese Bilder in Traumeindrücke über, indem ihre Proportionen zu schwingen und flirren begannen und Teil eines Spieles wurden, dessen Ende und Sinn sich mir nicht erschlossen. Möwen kreisten über dem Boot und brachen ohne Anlass in gemeinsames Kreischen aus.
Vorhänge bauschten sich im Wind. Das Bettgestell knarrte leise, wenn ich mich umdrehte. Ab und zu waren Stimmen oder Schritte von der Gasse zu hören. Die Luft war frisch und kühl wie auf dem Meer.
Ich schreckte erst auf, als mein Mobiltelefon, das ich aus Gewohnheit neben mich auf den Nachtschrank gelegt hatte, zweimal laut piepte.
Ich hielt mir den Kopf, rieb mir den Schlaf aus den Augen. Wie ein Schmerz durchfuhr mich einmal mehr die Erkenntnis, dass wir nicht mehr zusammen sind, dass unsere gemeinsame Zeit vorbei ist. Vor zehn Jahren wäre ein solches Ende undenkbar gewesen, auf Mondariz sprachst du von Kindern, einer Familie, es war kein Entschluss, der uns aneinanderband, unsere Zusammengehörigkeit war jene Gegebenheit, die für uns beide nicht hinterfragbar war.
Warum habe ich dir überhaupt von meiner nochmaligen Reise erzählt? Die wenigen noch ausstehenden Aufträge für den Rundfunk habe ich verschoben. Es ist fraglich, ob ich noch einmal nach Berlin zurückkehren werde; seit dieser Saison bist du als Schauspielerin am Theater Dortmund unter Vertrag. In diesem Moment kam es mir vor, als hätte ich mich verirrt, als sei ich aus der Zeit gefallen, als gebe es niemanden mehr, der sich noch an mich erinnerte. Zehn Jahre lebt man miteinander und bemerkt die Veränderung nicht, lebt zehn Jahre lang immer auch den Beginn der gemeinsamen Zeit. Nach dem Bruch ist man mit einem Schlag zehn Jahre älter, reibt sich die Augen, Fremde behandeln einen nicht mehr wie den Jugendlichen, der man immer zu sein glaubte. Das Ende einer Liebe ist wie eine Zeitmaschine, dachte ich. Ich musterte die hohe Leiste am Fuß des Bettgestells und spürte, dass mir Schweiß auf die Stirn trat. Sonnenlicht zeichnete auf den Parkettboden neben mir ein helles Viereck.
Die Textnachricht lautete: »Bist Du gut angekommen? Premiere war sehr anstrengend. Hab Fehler gemacht, aber ok. Schön fragil. Pass auf dich auf. Schönen Tag auf unserer Insel! J.«
Unvermittelt hatte ich den Gedanken, dass mich kein Mensch mehr im Krankenhaus besuchen würde, sollte mir etwas zustoßen. Gab es auf Mondariz überhaupt ein Krankenhaus? Ich strich über den Boden und war erleichtert, als meine Hand gegen die Tasche mit der Partitur stieß. In diesem Moment kam es mir vor, als seien die Blätter das Einzige, was mir geblieben war.
Es war früher Abend, als ich das Haus verließ. In einigen Häusern brannte schon Licht, durch ein Erdgeschossfenster in der Via Inmaculada sah ich eine Familie am Tisch essen, die Kinder ließen die Beine baumeln, während der Vater mit großer Kelle aus einer Schüssel Suppe schöpfte. Die historische Schmiede ist zur Kneipe umgebaut worden, aus der offenstehenden Tür war Stimmengewirr zu hören, ein Mann am Tresen sang. ›Chirinos‹ steht auf einem über der Tür baumelnden Schild. Undeutlich erinnerte ich mich daran, dass Miguel uns damals von einem Schmied dieses Namens erzählte, der im sechzehnten Jahrhundert lebte und durch seine Visionen zur Inselberühmtheit wurde.
Ich überquerte den Marktplatz und ging auf das hell erleuchtete Hotel zu. Rafael de Hostos, der Wirt, begrüßte mich mit Handschlag und bot mir Schnaps an: »Ihre Rückkehr muss gefeiert werden!«
Ich bat ihn, einen Tisch nach draußen zu stellen, ich wollte auf dem Marktplatz zu Abend essen. Die wenigen Passanten sahen mich neugierig an, hielten sich aber in einiger Entfernung. Einmal wurde auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes ein Fenster geöffnet, es zeigte sich aber kein Gesicht zwischen den Vorhängen. Die Schatten wurden länger, endlich versank die Sonne hinter dem Berg. Eine Möwe landete auf dem Pflaster. Ich warf ihr ein Stück Brot hin.
Der Wirt servierte selbst. Er ist ein kleiner kräftiger Mann. Er trug zu seiner schwarzen Hose ein blendend weißes Hemd, er war glattrasiert, seine schwarzen Haare glänzten feucht und waren über der Stirn streng nach hinten gelegt. Breitbeinig blieb er neben dem Tisch stehen.
Was mich erneut herführe, fragte er. Sein Spanisch ist klar und verständlich, er ist den Umgang mit Fremden gewöhnt.
Ich erzählte ihm von dem Manuskript, das damals in meinen Besitz gekommen sei und das ich erst jetzt, nach all den Jahren, zum Ausgangspunkt einer Recherche machen wolle.
»Haben Sie mit Señor Gomez schon gesprochen?«, fragte er.
Ich nickte.
»Don Miguel wird Ihnen helfen.«
Ein prüfender Blick streifte mich, als er mir Wein einschenkte. »Arbeiten Sie für eine Universität?«
Ich schüttelte den Kopf. Ich führte das Glas zum Mund. Der Wein schmeckte fruchtig, hatte dabei aber eine ganz eigentümlich harzige Note.
»Wir bauen den Wein selbst an«, erklärte der Wirt. Er lächelte breit. »Es werden pro Jahr nur ein paar Fässchen davon auf Mondariz gekeltert.«
Als er das nächste Mal nach draußen kam, zeichnete sich am Himmel schon der Mond ab, während der ansteigende Hang von rötlich gefärbten Federwölkchen eingefasst wurde. Ich versuchte, Miguels Blockhaus auszumachen, konnte aber zunächst nicht einmal den Waldrand erkennen, so unterschiedslos düster war die Fläche. Rafael de Hostos lachte. »Warten Sie noch eine Weile, bis der Mond ganz aufgegangen ist. In manchen Nächten ist das Licht so hell, dass man sogar Don Miguel erkennen kann, wie er vor seinem Blockhaus auf der Bank sitzt. Nur die Farben wirken gegenüber dem Tag verändert, gedämpft, ausgebleicht.«
Er stellte das Essen auf den Tisch. »Werden Sie Ihre Forschungen zu Mondariz veröffentlichen?«
Er beugte sich über den Tisch und strich mit flacher Hand die Decke zurecht.
Wenn andere Werke des Komponisten hielten, was meine Partitur versprach, so konnte meine Arbeit durchaus von Bedeutung sein. Coimbra ist anderswo völlig unbekannt. Sein Leben stellt einen Sonderfall dar, muss es sich doch in weitgehender Isolation und abgeschnitten von den kompositorischen Strömungen der Zeit vollzogen haben.
Ich nickte. »Natürlich denke ich über eine Veröffentlichung nach. Es ist aber noch nichts definitiv.«
Im Lächeln des Wirts zeichnete sich der Stolz des Insulaners über das Eigene ab, eine fast kindliche Freude.
»Diese Arbeit ist der Grund, warum ich hier bin«, sagte ich.
Er wünschte mir einen guten Appetit und stieg die Freitreppe zum Hotel hinauf.
Es war schon Nacht, als ich den Heimweg antrat. Der Himmel war mit Sternen übersät, glitzerte und funkelte aus allen Tiefen, aus allen Zeiten in meine Gegenwart hinauf, machte mich selbst zum körperlosen Beobachter, die Insel zu einem Punkt im Ozean. Am Horizont waren Blitze zu sehen. In einigen Häusern brannte Licht, insgesamt aber war die Siedlung still, viele Häuser wirkten unbewohnt. Ich zog das Telefon aus der Tasche. Kein Empfang. Es war keine neue Nachricht eingegangen.
Ich ging früh schlafen, wurde aber oft wach. Der Himmel hatte sich zugezogen über Mondariz, das Licht von Blitzen, zum Teil reflektiert durch gegenüberliegende Fenster und die Fassade des Nachbarhauses, erleuchtete mein Schlafzimmer für Momente so hell, dass mir der Eindruck noch Sekunden später vor Augen stand, als das gewaltsame Durchbrechen des Donners die Insel erfasste. Ich machte die Fenster zu. Das Einsetzen des Regens löste die Spannung.
Ich ließ mich in die Kissen zurücksinken und schloss die Augen.
Deine Großmutter war seit Jahren verwitwet, eine kleine, dicke, aber besonders agil wirkende Frau. Ich mochte sie gern, habe sie aber nur während eines einzigen Besuches in ihrem Bergdorf an der österreichisch-slowenischen Grenze kennengelernt. Sie sprach so starken Dialekt, dass ich sie kaum verstand. Ich glaube, es war ihr achtzigster Geburtstag – zur Feier war die Familie aus Deutschland, aus Österreich, ein Cousin deiner Mutter mit Frau und Kindern sogar aus Amerika angereist. Das Haus, von deinem Großvater nach dem Krieg errichtet, wirkte baufällig. Dielen knarrten, durch die Fenster strich der Wind, an der Decke waren an mehreren Stellen Schimmelflecken zu sehen. Ich hatte kaum Kontakt mit ihr – während der Mahlzeiten setzte die alte Frau sich nicht etwa an den sorgsam gedeckten Esstisch, sondern zog sich nach dem Auftragen der Speisen gleich wieder zurück. Es sei in dieser Gegend so üblich, erklärte mir deine Mutter. Nur zum Festessen am Abend ihres Ehrentages nahm sie am Kopf der Tafel Platz und lächelte verschmitzt, als dein Vater einen Trinkspruch ausbrachte und die Versammelten auf ihr Wohl die Gläser hoben. Neben ihr saß ein dürrer Mann in zerschlissenem Sakko, den sie der Familie bis zu ihrem Ehrentag vorenthalten hatte: Konrad war ihr neuer Freund. Die beiden kannten sich seit zwei Jahren. Konrad wohnte im Altenheim im Nachbardorf. Bei schönem Wetter machten die beiden Spaziergänge miteinander. Zu ihrem Geburtstag hatte er ihr eine Reise geschenkt: Sie würden zusammen nach Wien fahren. So eingeschüchtert Konrad angesichts der Festgemeinschaft war, so strahlten seine Augen doch, sobald deine Großmutter seine dürre Hand nahm. Er strich sich verlegen über das stoppelige Kinn. Mehrmals hörte ich, wie er ihr zärtlich das Wort »Wien« zuflüsterte. Er war sein ganzes Leben lang niemals in der Hauptstadt gewesen.
Wir verlebten ausgelassene Tage. Kurz vor der Abreise nahm die alte Frau mich beiseite. »Ich war schon als junge Frau verheiratet und unsere Ehe dauerte Jahrzehnte. Aber ich war niemals so glücklich wie heute.« Sie vertraute ihr Geheimnis nur mir an. Vielleicht sah sie das eigene späte Glück im Glück des jungen Liebespaares gespiegelt, in unserem Glück. Es war das einzige Mal, dass sie mich ansprach.
Wenige Wochen später erfuhren wir von ihrer Krankheit. Zu ihrem Geburtstag muss der Krebs schon in einem fortgeschrittenen Stadium gewesen sein. Wir hatten darüber nachgedacht, ebenfalls nach Wien zu fahren und die beiden wie zufällig in einem Caféhaus zu überraschen.
Die Reise wurde abgesagt.
In dieser Nacht träumte ich ein Wiedersehen: In einem hell erleuchteten U-Bahn-Schacht stand deine Großmutter neben dem Fahrkartenautomaten, auf den ich zuging, wie damals winkte sie uns zu, sie trug Schwarz. »Dass wir uns endlich wiedersehen«, rief sie in der ihr eigenen Mischung aus Herzlichkeit und Ironie. Ihr Freund stand etwas abseits neben einem übergroßen Koffer, mit gesenktem Kopf und fallenden Schultern. Wie in einem Sog glitt ich auf sie zu und schreckte noch in der Bewegung aus dem Schlaf hoch. Ich hielt mir den Kopf, mein Atem ging in Stößen. Wie lange sie schon tot ist?, dachte ich immer, das Zimmer lag in tiefem Dunkel. Ich wischte mir die Stirn. Ich schlug die Decke zurück. Ich ging zum Fenster, tastete nach dem Griff. Der Regen hatte nachgelassen.
Ob Konrad noch am Leben ist? Was ist aus ihm geworden?
Als ich den Kopf hinausstreckte, schien es mir, als sei vom Ende der Gasse her neben dem Prasseln herabfallender Tropfen auch das pulsierende Rauschen des Meeres zu hören.
Der Tagesanbruch auf Mondariz vollzieht sich bei klarem Wetter in wenigen Sekunden: Die Sonne steigt aus dem Meer auf, Schatten der Nacht weichen Fanfaren von Licht, die den Osthang und die Siedlung noch im Moment erfassen. Beugt man sich weit genug aus dem Fenster meines Schlafzimmers, kann man zwischen den Gebäuden hindurch das Meer sehen, kann den Rotschimmer erahnen, der dem Morgen vorausgeht, eine leichte Verfärbung der Wasseroberfläche am Horizont nur, die zu dem Moment des Aufflammens kaum in Beziehung zu stehen scheint – derart unausdenkbar und gewaltig ist das tatsächliche Hervorbrechen der Sonne. Wind zieht durch die Gassen, streicht über Dächer und um Hauskanten und fließt in einer einzigen umfassenden Bewegung wie über ein unbedeutendes Hindernis über die ganze Insel hinweg. Vom anderen Ende der Siedlung her ist das Läuten von Glocken zu hören.
Dann vielleicht das Schlagen einer Tür, Schritte, die von den Wänden widerhallen, irgendwo bellt ein Hund. Aus einem Fenster dringen Stimmen.
Ich ging in die Küche hinunter, machte Kaffee und trug Kanne und Tasse auf einem kleinen Tablett ins Arbeitszimmer. Saß am Schreibtisch, vor mir ein Notizblock und die Klaviervariationen Coimbras, die zu analysieren ich mir für die erste Zeit vorgenommen habe. Immer wieder ertappte ich mich dabei, wie mein Blick zu schweifen begann, über Minuten lag meine Hand reglos auf dem Papier. Ich sah die Fassade des gegenüberliegenden Hauses und die Fensterscheiben, in denen sich das eigene Fenster spiegelte, die Vorhänge, dahinter eine Andeutung meines Gesichts. Für ein paar Minuten kritzelte ich Taktzahlen auf ein Blatt und bestimmte funktionsharmonische Fortschreitungen. Nur die Musik hörte ich nicht. So gut ich die Stücke auch kenne, bildete sich jetzt nicht einmal die Andeutung einer Melodie in meinem Kopf.
In diesem Moment war es mir, als sei alles umsonst, und die Verzweiflung darüber trieb mir Tränen in die Augen.
Der Einkaufsladen befindet sich in der Via Nicolás nördlich des Marktplatzes, nur ein paar Schritte vom Hotel entfernt. An die Innenseite der Tür ist eine kleine Metallspirale mit Glöckchen genagelt – bewegt sich die Tür, ertönt ein helles Läuten. Regalreihen sind bis unter die Decke mit solch unüberschaubarer Fülle von Waren angefüllt, dass vor dem Auge des Eintretenden eher zufällig einzelne Gegenstände hervortreten: Konservendosen, Angelhaken oder Köder aus eingelegtem Fisch; Taschenmesser neben Eimern und Batterien; in einem Drahtgestell finden sich Postkarten und schlecht gebundene Reiseführer, die vor Jahrzehnten verlegt wurden. Der Raum ist so überladen, dass schon allein dadurch jeder einzelne Artikel schäbig wirkt. Die oberen Borde sind mit einer dicken Staubschicht bedeckt.
Von einer Treppe im Hintergrund des Raumes waren Schritte zu hören. Gleich darauf trat Señora Batani hinter der großen mechanischen Kasse hervor in den Verkaufsraum.
»Was kann ich für Sie tun, Señor?«
Sie ist eine massige Frau mit dickem schwarzem Haarknoten am Hinterkopf, tiefschwarzen Augen und im Vergleich dazu auffällig bleicher Gesichtsfarbe. Sie trug Stoffpantinen und kaute – offenbar hatte ich sie beim Frühstück gestört. Sie nahm meinen Einkaufszettel entgegen und schritt die Regalreihen ab. Wieder und wieder spürte ich ihren neugierigen Blick auf mir.
Ich sah durch die großen Schaufenster hinaus aufs Meer. In der Auslage fiel mir eine geschnitzte Figur auf, die ich zunächst für eine Puppe hielt: Das Gesicht wirkte wie eine zu Holz gewordene Karikatur, pausbäckig, mit wulstigen Lippen, Stupsnase und kleinen Schweinsaugen. Der Körper steckte in einer genähten grünen Filzjacke, von den Händen blätterte Lack ab.
Ich erkundigte mich, was es mit der Figur auf sich habe.
Ich konnte ihr Spanisch kaum verstehen. Auf meine Nachfragen hin sprach sie langsamer.
Sie nannte die Figur Kaya, es handele sich um eine Art Talisman.
Sie lachte auf, als sie meinen angestrengten Gesichtsausdruck bemerkte.
In ihrem schwer verständlichen Dialekt schilderte sie ein Geistwesen, das aus Lust am Schabernack dafür sorge, dass der Schreiner am Morgen in der Haut eines Touristen erwache, während die Jungvermählte das Verhalten ihres Gatten nicht wiedererkenne.
»Verlieren wir uns nicht alle hin und wieder? Dieser Figur etwa am Abend eine Kerze anzuzünden stellt sicher, dass wir uns im Erwachen wiederfinden.«
Sie beugte sich über die Auslage nach vorn. Auf ihrer Strickjacke waren um den Kragen herum unterschiedlich große weiße Hautschuppen zu sehen. Sie sah mich fragend an.
Ich bedankte mich und schüttelte den Kopf.
Sie stellte die Figur in die Auslage zurück.
Gemeinsam gingen wir zur Kasse.
Sie nannte einen Preis.
»Bitte zahlen Sie in Dollar«, sagte sie.
Die Sonne stand jetzt etwa so weit über dem Meer, dass ihre Strahlen in Augenhöhe waagrecht auf mein Gesicht trafen. Wellen schlugen gegen die Kaimauer. Heftiger Wind wehte.
Ich machte einen Umweg über die Strandpromenade und ging von Süden her auf die Via Umbria zu. Der Sand schien vom Unwetter der Nacht noch immer feucht zu sein, an einigen Stellen aber war das Weiß bereits wieder so strahlend, dass es den Augen wehtat. Ein kleines Ruderboot lag auf dem Strand, zwei Männer hatten es umgedreht und untersuchten den Boden: fuhren mit den Handflächen über den deutlich hervortretenden Kiel und betasteten die davon wegstrebenden Spanten.
Ich blieb stehen und lehnte den Oberkörper gegen das Geländer.
Die Männer beachteten mich nicht.
Ich schloss die Augen. Das Geräusch der über den Strand auslaufenden Wellen erfasste mich so vollständig, dass ich vergaß, wo ich mich befand. Wind strich über meine Haut. Bei den ersten Hammerschlägen richtete ich mich auf; der Strand vor mir, das Meer, das Geländer, gegen das ich mich gelehnt hatte, tauchten so unvermittelt vor mir auf, als hätte ich während einer Redaktionssitzung die Augen geschlossen.
Die Männer ließen ihre Hämmer sinken, einer wies mit dem Finger auf mich. Die beiden tuschelten.
Ich nickte ihnen zu, hob meine Einkaufstasche vom Boden auf und bog in die Via Umbria ein.
Ich schrieb dir mit dem Mobiltelefon eine Nachricht und war selbst überrascht, dass das Gerät mir vollen Empfang anzeigte.
»Bin gut angekommen. Habe Miguel getroffen und den Jungen vom Strand, der Dir damals das Schiffswrack zeigen wollte. Erinnerst Du Dich? Heftiges Gewitter in der Nacht.«
Gleich darauf ging das Gerät aus. Als ich es wieder anschaltete, stellte sich keine Netzwerkverbindung her. Die Nachricht aber war verschickt.
Ich öffnete das Fenster.
Aus der Gasse war leise der Klang eines Klaviers zu hören.
Ich saß in der Küche am Tisch und blickte gedankenverloren auf das Bild an der Wand, als es an der Tür klopfte.
Zunächst dachte ich daran, das Pochen einfach zu ignorieren. Ich spürte die untergründige Panik, in der nicht allein mein Aufenthalt auf der Insel, sondern mein ganzes bisheriges Leben alle Richtung verlor. Ich dachte daran, wie häufig ich in Berlin an den Computer gehe, Nachrichten schreibe, telefoniere. Auf Mondariz habe ich nicht einmal einen zuverlässigen Internetanschluss.
Ich wollte arbeiten.
Als der Kessel auf dem Herd zu singen begann, stand ich auf und ging zur Tür.
Miguels dunkle klare Augen sind von tiefen Falten eingefasst, die Haut wirkt ledrig, wie gegerbt. Er trug ein weißes Hemd, das am Kragen offen stand und dessen Manschetten er umgekrempelt hatte.
Er hielt mir ein Päckchen entgegen.
»Für mich?«, fragte ich erstaunt.
»Für Sie.«
Wir gingen in die Küche.
Ich bot ihm einen Platz an und stellte zwei Becher auf den Tisch. Ob er letzte Nacht wach gewesen sei, wollte ich wissen.
Er nickte.
»Meist bleiben die Unwetter weit draußen«, erklärte er. »Von Mondariz aus kann man auch entferntes Wetterleuchten noch erkennen, Lichteruptionen, denen kein Donner folgt und die den Horizont nur zu streifen scheinen. Letzte Nacht lag das Zentrum des Gewitters über der Insel: Ich machte mir Sorgen. Gewitter können sehr heftig sein in dieser Gegend. Manchmal ziehen sie Springfluten nach sich.« Es entstand eine Pause. »Ich schloss erst nach Mitternacht die Fensterläden. Als ich erwachte, zirpten schon die Zikaden am Hang.« Er lächelte. »Wie haben Sie geschlafen?«
Ich erzählte von meinem Traum.
Es sei normal, dass Fremde auf Mondariz intensiv träumten, entgegnete er, vor allem in der Anfangszeit. Davon habe er oft gehört. »Vermissen Sie Deutschland schon?«
Ich zuckte mit den Schultern.
Miguel hat mich kein einziges Mal ausdrücklich nach dir gefragt, seit ich hier bin.
Über dem Tisch hängt ein Kruzifix; an der gegenüberliegenden Wand ein Ölgemälde, das so dunkel ist, dass man bei oberflächlicher Betrachtung keine Einzelheiten ausmachen kann.
Das Bild ist kaum größer als eine Miniatur, etwa so lang wie meine Hand. Die Leinwand wirkt wie rußbedeckt, als sei sie im Laufe von Jahrzehnten durch Küchendampf und Rauch angeschwärzt worden.
Ich bemerkte, dass Miguels Blick immer wieder zu dem Gemälde zurückkehrte. Nach einer Weile fiel auch mir der zarte Rotschimmer auf der Leinwand auf, eine Einfärbung wie von Wellen am Bildrand. Es sind nur Andeutungen, die aber die Düsternis noch im Moment in eine sehr konkrete und lebhafte Vorstellung überführten. Ich beugte mich vor und erkannte in dem Bild die Darstellung der Insel vor Tagesanbruch. Der Eindruck war so stark, dass ich unwillkürlich einen Schritt zurücktrat.
»Es ist die Ansicht von Westen auf die Insel«, kommentierte Miguel. »Sie sind von Osten gekommen bei Ihrer Anreise.«
Ich nickte.
»Ich kenne das Bild seit meiner Kindheit«, erzählte Miguel. »Mein Großvater hat es gemalt. Später hat er keinen Pinsel mehr angerührt. Er habe das Malen überhaupt nur aufgenommen, um diesen einen Eindruck aus seiner Jugend festhalten zu können, erklärte er, den Anblick der Insel nach schwerem Sturm. Großvater war mit einem Freund hinausgefahren. Der war bei dem Versuch, eindringendes Wasser abzuschöpfen, von Wellen über Bord gerissen worden. Großvater versuchte, ihn mit einem Tau zu retten: Der Seegang hob das Boot so hoch, dass der aus dem Wellental aufragende Arm schon im nächsten Moment im Wasser versank. Für eine kurze Zeit war es Großvater, als könne er durch den Schiffsrumpf das Pochen und Schlagen seines Freundes hören. Gischt schlug ihm ins Gesicht. Eine Welle riss das Boot zur Seite. Über Stunden klammerte Großvater sich an die Ruderpinne, bald auf die Planken gekauert, bald halb aufgerichtet, um das Schwanken des Untergrundes auszugleichen. Als sich das Boot Mondariz näherte, war die See glatt, der Sturm, der auch im Dorf schweren Schaden angerichtet hatte, einer völligen Windstille gewichen. Kein Laut war zu hören. Es war der 18. April des Jahres 1891.«
Ich zündete eine Kerze an und stellte mich neben das Bild.
»Sie haben recht, die Wand ist auch tagsüber eigentlich zu düster«, sagte Miguel. »Andererseits hat mein Großvater die Stelle selbst ausgesucht. Ihm gefiel das Licht und auch die Nähe zur Kochnische. Ich kann mich noch gut an die Gestalt meiner Großmutter erinnern, die in der Ecke stand und Obst einkochte. Ich hatte das Gemälde schon unzählige Male gesehen, an diesem Morgen aber fragte ich sie, ob Mondariz wirklich so ein gefährlicher Ort sei. Sie sah mich verwundert an. Später beugte sie sich selbst über das Bild. ›Es ist ein Wunder, dass es uns überhaupt noch gibt‹, murmelte sie. Das weiß ich noch wie heute.«
Ich goss Tee ein.
Ob er das Päckchen öffnen solle, das er mitgebracht habe, fragte Miguel.
Ich reichte ihm ein Messer. Er durchschnitt die Kordel.
»Damit Sie einen Ausgangspunkt für Ihre Arbeit haben«, sagte er.
Ich beugte mich über den Tisch.
Die Kerze begann zu flackern.
»Was ist das?«, fragte ich.
»Mehr ist von Coimbra bis heute nicht gedruckt worden«, erklärte Miguel. »Was Sie hier sehen, ist sein gesamtes publiziertes Werk. Es existieren noch ganze Kisten voller Handschriften. Das meiste aber dürfte unwiederbringlich verloren sein.«
Ich griff nach dem Packen von Partituren und zog sie an mich.
»Ist Coimbra wirklich ein so origineller Komponist, wie manche sagen?«, fragte Miguel. »Schon zu Lebzeiten wurde er von manchen zum Genie erklärt, während andere ihn als Plagiator oder Dilettanten abtaten. Es gab keine Instanz auf Mondariz, gibt sie bis heute nicht. Was meinen Sie?«
Für einen Moment konnte ich meinen Enthusiasmus nicht zügeln. Ich legte Miguel die Hand auf die Schulter, während ich mit der anderen bereits Papiere durchzublättern begann. Es waren Stücke in verschiedenen Besetzungen, Lieder, Kammermusik, Orchesterwerke. Das unerwartete Geschenk schien mir wie eine Antwort auf meine Zweifel, wie jener entscheidende Impuls, der mich vorantreiben würde.
»Ich will mehr erfahren«, sagte ich. »Es gibt in der Musikwissenschaft weltweit eine Tendenz, sich auf die Suche nach Randfiguren zu machen, nach Kleinmeistern, durch deren Werk sich dem Bild, das wir uns von einer Epoche machen, neue Facetten hinzufügen lassen. Tatsächlich zeugen die Klaviervariationen, die ich kenne, von einem autodidaktischen, ungestümen Zugriff. Dabei verfügt Coimbra über eine sehr klare Vorstellung der eigenen Mittel – nirgends wirkt der Klaviersatz überladen oder effekthascherisch. Er ist konzentriert, verknappt. Wer weiß? Vielleicht wächst sich meine Arbeit am Ende noch zu einer großen Monographie aus …«
Miguel lächelte. »Wollten Sie nicht gerade Tee machen?«
Ich fingerte ungeschickt am Teesieb herum, verbrühte mir die Finger.
Über Jahre hatte das Manuskript der Klaviervariationen in einer Schublade gelegen. Erst als du dich von mir zu entfernen begannst und ich unsere Gegenwart immer häufiger der gemeinsamen Vergangenheit gegenüberstellte, zog ich die Partitur wieder hervor. Jahre nach unserem gemeinsamen Mondariz-Besuch war sie zu einem Zeugnis unserer Beziehung geworden, einem Andenken. Ich fing an, den Zyklus zu üben, wollte dich eines Tages mit meinem Spiel überraschen.
Dann zogst du aus.
Inzwischen beherrsche ich die Stücke gut.
»Erkennen Sie Vorbilder?«, fragte Miguel.
Zunächst hatte mich die Stimmführung an Schumann, die Harmonik in ihrer Schroffheit an Mussorgsky erinnert. Solche Ähnlichkeiten sind aber eher zufällig und schwächen sich mit zunehmender Kenntnis des Werkes ab. Was die Komposition auszeichnet, ist die ungewöhnliche Architektur. Das Thema, nur wenige Takte lang, ist von äußerster Schlichtheit: eine einfache, getragene Melodie. In den bald kaum mehr voneinander abgesetzten Variationen entwickelt sich ein impulsives Wuchern verschiedener Stimmen, die sich oft bereits nach wenigen Tönen wieder zurückziehen und verklingen, während andere sie überlagern und in den Hintergrund schieben. Eine Polyphonie entsteht, deren Einzelglieder das übergeordnete Gesetz nicht zu kennen scheinen: Linien drängen einander gegenseitig ab wie Gedankensplitter, wie Auswüchse, die dem Licht entgegenstreben und bald selbst abgedrängt werden. Bei alledem baut die Musik sich immer mehr auf, der Satz wird dichter, immerwährendes Crescendo. An einer Stelle hat der Komponist über den schon ins Choralhafte gesteigerten Klaviersatz das komplette Sopranthema des Beginns geschrieben, nicht aber in das Klaviersystem, in das rechte und linke Hand notiert sind, sondern in eine eigene Notenzeile darüber. Es bleibt offen, ob dieser melodische Rückgriff gleichsam virtuell, also nur ›gedacht‹ zu bleiben hat, eine außerhalb der Wahrnehmbarkeit nur für den Interpreten aufscheinende Idee. Oder soll der Pianist singen? Mit zwei Händen spielen lässt sich die Stelle jedenfalls nicht. Dabei markiert sie den Höhepunkt des Stückes, den Übertritt von der Welt des Klangs ins Ideelle oder Transzendente. Die Geisterstimme verstummt nach wenigen Takten und taucht im Folgenden nicht mehr auf. Ein über Seiten andauerndes Decrescendo schließt sich an, ein Rückzug der Musik in sich selbst. Das Ende spiegelt die Schlichtheit und Trauer des Beginns – bis zum fast beiläufig wirkenden Verklingen zweier Stimmen auf dem Ton c.
Ich stellte die Kanne auf den Tisch.
»Ich kann diese Musik bisher schwer einordnen«, sagte ich. »Mir fehlte der Hintergrund, das Wissen über das Umfeld, dem sie entstammt.« Mein Blick glitt über die Notenblätter, die Miguel mir mitgebracht hatte. »Das ist es …«, stammelte ich. »Sie wissen nicht, wie sehr Sie mir geholfen haben.«
Ein Freund von mir hatte schon nach kurzem Blick auf die Klaviervariationen erklärt: »Es ist das Wesen des Dilettanten, nicht um die Grenzen zu wissen.« – »Ist es nicht visionär, sie zu missachten?«, hatte ich gefragt. Worauf er lachend entgegnet hatte: »Ich wusste gar nicht um deine Vorliebe für das Skurrile. Die Insel wird sich hoffentlich als interessanter herausstellen als ihr Komponist …«
Ich saß auf dem Marktplatz vor dem Hotel, die gedruckten Partituren lagen vor mir auf dem Tisch. Miguel hatte mir geraten, doch einmal Antonio zu besuchen, das ist der Junge, der damals in deiner Gegenwart verlegen wurde. Er selbst will mir in den nächsten Tagen das Haus des Komponisten zeigen, dort stehe bis heute ein Klavier, das aber alt und lange nicht mehr überholt oder gestimmt worden sei. Vielleicht könne man gar nicht mehr darauf spielen.
In der Mitte des Platzes war ein langer schwerer Holztisch aufgebaut, auf dem in Plastikwannen Fisch angeboten wurde. Auf einem weiteren daneben lagen Brote und verschiedene Käsesorten aus. Fischer schleppten vom Hafen schwere Holzkisten über den Platz und luden sie neben den Tischen ab. Sie wurden von den Umstehenden lautstark begrüßt, man klopfte einander auf die Schultern, schüttelte Hände, wie es gegangen sei, ob man das Gewitter gut überstanden habe … Einer der Fischer, ein junger Mann mit Dreitagebart und schief sitzender Schirmmütze, zog aus der Jacke ein Fläschchen und trank. Señora Batani stand am Brotstand. Sie öffnete einen Pappkarton und verteilte Gläser.
Rafael de Hostos erschien auf der Freitreppe und kam auf mich zu. Er begrüßte mich, indem er eine leichte Verbeugung andeutete. Ob ich schon gewählt hätte.
Ich schlug die Karte auf.
»Haben Sie Don Miguel noch einmal getroffen?«, fragte er.
Ich nickte. »Er will mir das Coimbrahaus zeigen.«
Der Wirt lächelte. »Gut. Ich dachte mir, dass er Ihnen helfen würde.«
Ich bestellte Fisch.
»Wollen Sie ihn selbst aussuchen?«, fragte Rafael. »Oder wollen Sie vielleicht ein Überraschungsmenü? Guten Freunden bietet unsere Küche diesen besonderen Sevice an. Schließen Sie die Augen. Lassen Sie sich von der Schönheit des Ortes verzaubern. Lehnen Sie sich zurück. Ihr leibliches Wohl ist bei uns in den besten Händen.«
»Ich suche selbst aus«, sagte ich.
Anstatt ins Innere des Hotels zu gehen, führte er mich zum Fischstand. Wir wurden von den Umstehenden durchgelassen und beugten uns gemeinsam über den Fang der Nacht.
Die Stimmung auf dem Platz hatte inzwischen den Charakter einer fiesta angenommen: Man trank Schnaps, stieß auf die Heimkehrer an, auf den Fang, auf das Vorüberziehen des Unwetters.





























