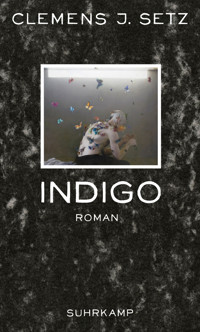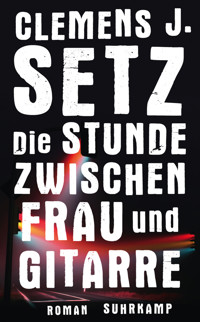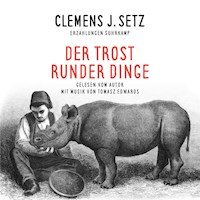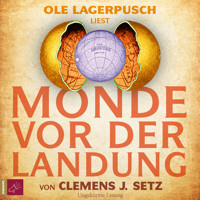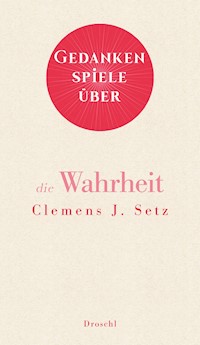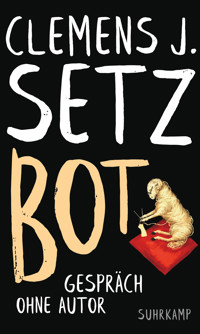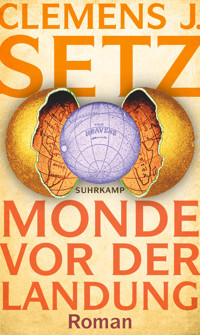
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Worms, Anfang der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Peter Bender, ehemals Fliegerleutnant des Deutschen Heeres, macht sich als Gründer einer neuen Religionsgemeinschaft und mit der Proklamation der sogenannten Hohlwelt-Theorie einen Namen: Die Menschheit lebe nicht auf, sondern in einer Kugel, außerhalb derselben existiere nichts. Benders Gemeinde bleibt überschaubar, dennoch wird er wegen der Verbreitung aufwieglerischer und gotteslästerlicher Flugschriften zu einer mehrmonatigen Kerkerhaft verurteilt. Als sich nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten herumspricht, dass seine Frau Jüdin ist, wenden sich selbst seine engsten Gefolgsleute von ihm ab. Die Benders verarmen, die Repressionen besonders gegen seine Frau werden bald unerträglich.
Bestürzend aktuell, von unüberbietbarer sprachlicher und gedanklicher Originalität: Dieser Roman erzählt von Querdenkertum und alternativen Wahrheiten und rekonstruiert eine so bewegende wie verstörende Lebensgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Clemens J. Setz
Monde vor der Landung
Roman
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagabbildung: FGCU Library's University Archives, Koreshan State Historic Site
eISBN 978-3-518-77552-3
www.suhrkamp.de
Widmung
Für C. und für S.
Motto
Von seinem erhöhten Standpunkt aus sah er die Menschen aus der Fläche innerhalb des kreisrunden Horizonts nach oben streben, zum Licht. In der irdischen Ebene waren sie miteinander und mit dem Dunkel darunter verbunden.
Peter Bender, Karl Tormann – Ein rheinischer Mensch unserer Zeit (1927)
Charlotte Bender, aus: Mein Kampf um Peter (1940), Manuskript im Archiv der ehemaligen Koresh-Gemeinde in Estero, Florida
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Motto
Erster Teil Der Himmel
Der Blick durch Linsen
Kindheit
Die ersten Menschen
Der Freiwillige
Der Weg zu Luther
Die ersten Monde,
1915
-
1917
Der Gang zu den Müttern
Der Schulhof in Posen
Anklage
Insekten vom Mond Pflücken,
1917
Der erste Kreis
Revolution in Worms,
1918
Das Erwachen
Revolution,
1919
Die Dinge
Das alternde Geld
Die Milliarden
Revolution,
1923
Karl Neupert
Zweiter Teil Die Erde
Die Wölfe
Auf dem Kongress
Trost
Die Vertikalreise-Gesellschaft
Kuckuck
Hasso
Die Magdeburger Pilotenrakete
Dear Koreshan Unity
Schlingen
Die Jungen
AN PETER BENDER, WORMS-ON-RHINE
Dr Vogeleys erstes Gutachten
Gefängnis Preungesheim
Krokodil
Die Mitinteressierten
Neues Gutachten
CHARLOTTE BENDER AN PROF. KREUDER
Frau Blun
On Cosmic Unity
Die letzte Stunde
Frankfurt
AN HARRY MANLEY
Irmin Love
Hedwig
RE: OUR COSMIC UNION
Robinson
Monde vor der Landung
Die Hohlerde nach Johannes Schlaf
Dear Peter Rock Bender
Wohin
Ein Wiedersehen
Annika Bell
Die Feier
Dritter Teil Die Leere
Dear Harry Manley here my last Plea
Harry Manley an Charlotte und Peter Bender
Dank
Bild- und Quellennachweise
Informationen zum Buch
Monde vor der Landung
Erster Teil
Der Himmel
Denn wir wohnten in irgendeiner Höhlung der Erde und glaubten, oben darauf zu wohnen, und nennten die Luft Himmel, als ob diese der Himmel wäre, durch welchen die Sterne wandeln.
Platon, Phaidon
What is the sky? The sky is the minds of the weak people, those who don’t want to go anywhere.
Laura Riding Jackson, A Last Lesson in Geography
Es war vermuthlich der Trieb zur Sicherheit, der diese Vorstellung bey ihm begünstigte, er dachte man wäre besser innerhalb einer Kugel aufgehoben als ausserhalb.
Georg Christoph Lichtenberg
Er ist klug wie ein Rad.
Elias Canetti
Der Blick durch Linsen
Wer in Worms lebt, lebt auf dem Planeten Erde. Dieser befindet sich mitten im All und kreist dort, wie jedes Kind lernt, als riesige Kugel um eine noch größere Kugel aus Feuer. Im Jahr 1920 allerdings lebte unter den rund fünfzigtausend Wormser Bürgersleuten ein Mann, auf den nicht einmal das zutraf. Er wohnte zwar ebenfalls, wie sie alle, in Worms, aber darüber hinaus nicht auf, sondern in einer riesigen Erdkugel, und das bei vollem Bewusstsein und ohne Protest.
Dabei bewegte er sich nicht etwa spiegelbildlich unterirdisch zu seinen Mitgeschöpfen dahin, nein, er existierte in direkter Nachbarschaft zu ihnen, verdingte und ernährte sich neben ihnen, kam ihnen sogar täglich in Kleidung und Hut auf der Straße entgegen. Ihn umgab dabei ein riesenhaftes und geschlossenes Erdenrund: der Hohlglobus. Wo andere Himmel und Sterne sahen, da sah er nur bläuliches Füllgas und bestenfalls apfelgroße Leuchtkörperchen; wo viele die nächste Galaxie vermuteten, da wusste er Australien. Mit Geschichten über Nord- oder Südpolexpeditionen konnte man ihn zur Raserei bringen. Dieser Mann war der ehemalige königlich preußische Fliegerleutnant Peter Bender, Weltkriegsverwundeter und Träger des Eisernen Kreuzes, von Beruf Schriftsteller.
Schon während seiner ersten Aufklärungsflüge über den fleckigen Sumpfgebieten an der Weichsel war ihm die optische Täuschung aufgefallen: die Krümmung der Erde. So nannten sie das. Und sie sah, das musste man zugeben, vollkommen überzeugend aus. Wie aus dem Lehrbuch. Eine schöne, weite Wölbung, die da unter ihm schwebte. Dass Stahl unter den richtigen Bedingungen so leicht werden konnte, dass er zu fliegen begann, war an sich schon recht bedenklich. In solchen Momenten war es ihm auch möglich, zu begreifen, warum die Menschen ängstlich oder wehmütig wurden, wenn sie im Traum von ihrer Heimat weggepflückt oder fortgeweht wurden.
Ihm selbst war das als Kind einige Male passiert. Die Träume, wenn es denn welche waren, ähnelten einander immer ein wenig, die Stimmung war die gleiche und auch die Farben – alles sah bemüht und künstlich aus, wie auf handkolorierten Fotografien. Farbe, wo gar keine sein sollte. Seltsam runde und unscharfe Ecken und Kanten. An manchen Stellen flimmerte die Farbe auch, wie die Ränder einer Öllache. Alle Menschen waren spärlich bekleidet und ihre Konturen unklar. Manche trugen ein grauweißes Funkgerätrauschen anstelle ihres Gesichts. Und er selbst bewegte sich wie in Siebenmeilensprüngen durch diese erstarrte Welt. Dann kam jedes Mal der Augenblick im Traum, wo er aus irgendeinem Grund in den Himmel blickte. Doch sogleich bereute er diese Entscheidung, denn sein Blick wurde vom strahlenden Blau magnetisiert und er daran in die Höhe gezogen. Er hatte das Gefühl, zu erblinden, und ein tunnelförmiger Wind erfasste ihn, ein rauer, gefräßiger Verbindungskorridor zwischen ihm und dem Äther. Er glitt davon, die Gebäude unter ihm wurden kleiner, der Marktplatz mit dem Obelisken war nur noch ein ernstes, undeutliches Bildchen wie auf einer Zigarrenkiste. In späteren Träumen verstand er, dass der unheimliche Windkorridor ein Fingerzeig gewesen war. Es war seine beginnende Erkenntnis, wie das Weltall in Wahrheit beschaffen war.
Vor dem Ludwigsdenkmal war alles schwarz von Menschen. Es gab Musik, Stände mit warmen Kartoffeln, und ein winziger Zeppelin, wie seine großen Brüder mit leichtem Schwebegas gefüllt, wurde von einem Mann mit Zylinderhut vorgezeigt. Das zierliche Luftschiff hing an einem kurzen Seil, und der Mann führte es sozusagen spazieren, so wie man es mit einem Hund tat, und erntete dafür Beifall. Das Wormser Volk erfreute sich des warmen Herbsttages. Das Laub auf der Straße war von der Sonne knusprig gebraten; wenn man darüberschritt, hatte man das Gefühl, es zu kauen. Vor dem Springbrunnen quälte sich eine Blaskapelle. Bender hatte Mühe, seine Nerven ruhig zu halten, während er sich durch den Tumult bewegte. Bei jedem Schritt war ihm, als käme der Erdboden immer um eine halbe Sekunde zu früh an seine Sohlen. Wenn diese Menschen nur wüssten! Wenn es nur in ihre Köpfe hineinginge, egal wie. Was würden sie dann tun? Würden sie immer noch frei umhergehen, sorglos und zugleich verplant wie Bienen? Das Rauschen der Wasserfontänen brachte ihm etwas Linderung. Außerdem der Wind, der über den Platz blies. Er beliefert die Menschheit mit Luft und sorgt dafür, dass wir nicht ersticken.
Im Lichtspielhaus in der Kämmererstraße gab es neue Filme, und aus diesem Anlass bewegte sich ein von einem lebendigen Straußenvogel gezogener Leiterwagen die Straße entlang. Auf dem Wagen befand sich ein weißes Transparent, auf dem »Lichtsspielhaus« stand, man hatte sich verschrieben. Bender starrte dem überzähligen s nach, der Buchstabe erschien ihm wie ein kleiner verirrter Rauchkringel. Neben dem Werbevehikel lief ein Mann, der fast nur aus Stirn zu bestehen schien, und pfiff eine volksliedhaft eingängige Melodie, hier und da rief er auch etwas über die Filme, die bald gezeigt würden. Ja, das schöne Lichtspielhaus. Nach der Rückkehr aus dem Osten waren Charlotte und er oft dort gewesen. In den Sommermonaten war der von dem kauzigen Drogisten Busch betriebene Kinematograph wenig besucht, die Wochenschauen flimmerten, von den nebeneinandersitzenden Pärchen mehr oder weniger unbeachtet, über die Leinwand, und der mitleidige Vorführer ließ gelegentlich sogar die Bühne verschieben, sodass man in der Dunkelheit zu zweit etwas geheimnisvollere, engere Raumverhältnisse genießen konnte.
Bender betrachtete den großen stelzenden Vogel, der, angeschirrt an sein bizarres Gefährt, langsam im sonnigen Staub des Neumarkts dahinschritt. So lachhaft und unernst seine Rolle hier auch schien, er war doch vollkommen eins mit der Welt, selbst wenn sie für ihn nichts als solchen Blödsinn vorgesehen hatte. Denn er war ein Geschöpf, das aus einem Ei geschlüpft war, und als solches Teil der ursprünglichen und edelsten Besiedelungsrassen der Erde: der geschuppten, der gefiederten und zuletzt der geflügelten Wesen. Sie alle waren einst aus einem kleineren Mond hervorgekommen, der irgendwo in der Nähe jenes – verrückterweise immer noch als »Äquatorial-Zone« bezeichneten – Gebiets der Erdschale niedergegangen und aufgebrochen sein musste, vor etwa dreitausend Jahren. Die farbenprächtigen, eigensinnigen Exemplare, man nannte sie Paradiesvögel, waren seither dort geblieben und kümmerten sich um die Dschungelbäume, während sich die anderen aufgemacht hatten, den Rest der Welt zu erobern. Sie waren von allen Wesen am längsten hier auf der Erde, und das konnte man an einem simplen Umstand ablesen: Sie hatten fliegen gelernt. So etwas dauert sehr lange. Der Mensch hatte es gerade erst vor einer Handvoll Jahren zum ersten Mal zustande gebracht, und auch da nur im Tausch gegen seinen inneren Frieden. Beinahe hätte Bender den Hut vor dem Strauß gezogen.
An der Kreuzung blieb der Vogel stehen. Der Besitzer schimpfte und zerrte an ihm. Als Antwort darauf begann der Strauß eigenartig hin und her zu wabern, er rollte den Kopf, als sei ihm schwindlig. Bender erinnerte das an einen Trick, den sie damals in der Staffel den jungen Fliegern beigebracht hatten: das heftige Hin- und Herwerfen des Kopfes, wenn man bestimmte Beschleunigungen nicht aushielt. So stellte man das Gleichgewicht wieder her. Manche steckten sich auch wachsgetränkte Watte in die Ohren, wie Odysseus. Die nordamerikanischen Indianer, so hieß es, drückten sich kleine Kieselsteine in die Gehörgänge und kletterten dann, unbeirrt von der Saugmacht der ringsum lauernden Tiefe, bis zu hundert Stockwerke in die Höhe, auf den Stahlgerüsten der aufblühenden Städte Chicago, New York oder San Francisco. Der Strauß eierte nun wild hin und her. Sein Besitzer zog ungeduldig am Wägelchen.
Was musste dieses Amerika für ein Land sein! Von dort war die Wahrheit in die Welt gekommen. Bender schaute in den blauen Himmel und peilte die ungefähre Richtung der Ostküste Amerikas an. Anfangs hatte er sich mit dieser Übung noch schwergetan, aber inzwischen wusste er recht genau, wie man schauen musste. Es empfahl sich, bei Tag zu üben, denn nachts war da als Ablenkung der Sternenhimmel. Seltsam, wie tröstlich es für einen Menschen sein kann, zumindest zu wissen, dass man in die richtige Richtung blickt, auch wenn das, was man anvisiert, selbst unsichtbar und unerreichbar bleibt. Sehstrahlen aussenden, darin allein lag eine gewisse Befriedigung, eine Art von Gebet. Wer weiß, vielleicht trafen seine Sehstrahlen direkt auf den kuriosen Coney Island Luna Park, diese offenbar das ganze Jahr über in Betrieb gehaltene Vergnügungsinsel auf der anderen Seite der Erdschale, das heißt da oben, etwas links, am westlichen Himmel, bei ungefähr vierunddreißig Winkelgraden. Wenn sich dieser Luna Park nun löste und zu ihm geschwebt käme, es wäre nur ein kurzer Flug. Ein Vergnügungspark, der über eine Stadt hereinbricht! Das kleine Worms, überschattet von einer schwebenden Insel voller windmühlenhaft winkender Riesenräder!
Bender war im Besitz einer amerikanischen Zeitschrift, in der fand sich ein Bericht über ein Museum in Coney Island, in dem man zu früh auf die Welt geworfene Kinder in Glaskästen, sogenannten »Infant Incubators«, betrachten konnte. Dies war eine erstaunliche technische Einrichtung, denn die eigentlich lebensunfähigen Kinder, die zum Teil aussahen, als wären sie aus Fischmaterial zu einer winzigen menschlichen Figur geknetet worden, gediehen in diesen Kästen ganz prächtig und holten in ihm die Wochen und Monate, um die sie durch die voreilige Geburt betrogen worden waren, in warm bestrahltem Vitrinenschlaf nach. Ihm waren die Tränen gekommen, als er in der Fantasie, denn anders konnte man unter der französischen Besatzung nicht reisen, vor einem dieser mumienähnlichen Geschöpfe stehen geblieben war und seine Hand an die Scheibe des leise brummenden Neugeborenen-Inkubators gelegt hatte. Dass den kleinen Wesen die Luft zum Atmen nicht ständig abhandenkam, wunderte und rührte ihn. Vielleicht brauchten sie ja nicht so viel. Wie Tiere im Winterschlaf. Oder junge Monde. Aus einem ähnlichen Atemluft-Sorgegefühl hatte er im Krieg immer offene Flugzeuge bevorzugt. Solche, in denen man unter einer neuartigen Glasverkleidung sitzen und steuern musste, waren ihm zuwider. Ach, gäbe es mehr solcher Artikel, mehr solcher Zeitschriften! Erst nach einer Weile bemerkte er, dass er von der Route, die am besten zum heutigen Tageshoroskop passte, abgekommen war. Schnell drehte er um, korrigierte die Abweichung und schlug den richtigen Weg ein.
Der Innenraum des Gasthofs Zur Trompete machte den Eindruck, als täte es dem Raum gut, sich einmal kräftig zu räuspern. Heiseres Licht. An der holzgetäfelten Wand hingen Postkarten, die alles Mögliche zeigten: Tänzerinnen, Karnevalsfiguren, Schauspieler, Wagners Siegfried, den Komiker Kabausche. Auf einer war der Mond abgebildet. Er war eine Sichel, gestochen scharf erleuchtet, aber im dunklen Bereich war der Rest des Mondes schwach erkennbar. Darunter die Erklärung Clair de Terre – Erdschein. Bender lachte nervös, dann schüttelte er den Kopf über diesen Unfug und hielt Ausschau nach dem Wirt. Je mehr er sich von dem vorbereiteten Text aufsagte, desto dunkler und plastischer wurden neben ihm die »Mondkrater«.
Im Gastraum roch es köstlich nach Braten und Schwenkkartoffeln. Ein Mann saß finster über eine Zeitung gebeugt, er trug einen leicht fleckigen Verband um Nase und Mund. Auf Kniehöhe summten Fliegen. Eine Kleinfamilie aß mit kräftiger Mimik gemeinsam an einem Stück Wild. Und in der Ecke saßen ein Kind und ein sehr alter Mann, vermutlich Enkel und Großvater, an einem winzigen Tisch. Das Kind zeigte vor, wie weit es seinen Daumen gegen das Handgelenk zurückbiegen konnte. Und dann versuchte es der alte Mann ebenfalls – und er konnte es! Bender stieß anerkennend die Luft aus.
Da der Wirt immer noch nicht erschien, setzte sich Bender an den Tisch neben dem Zeitungsleser. Er breitete vor sich das Flugblatt für seinen Vortrag aus und legte, einfach um das Schicksal ein wenig zu reizen, den Schlüssel zur Wohnung von Else, seiner Geliebten, daneben. Sie hatte wieder einmal geheult, als er heute Morgen von ihr gegangen war. Der Schlüssel hatte eine interessante Gussform, wie ein winziger Ritter sah er aus, oder vielleicht auch wie eine Mumie, im Profil betrachtet. Bender geriet ins Träumen. Ägypten, Geometrie, Gewerkschaften. Nach einer Weile kehrte er aus seinen Gedanken zurück in die von immer neuen Gerüchen heimgesuchte Gaststube. Er sagte »Jawohl«, allerdings im Anschluss an etwas Inneres, dessen genauer Inhalt im nächsten Augenblick schon wieder verraucht war. Endlich erschien der Wirt und fragte, was er haben wolle.
»Es ist mir gelegen«, begann Bender, »das heißt, ich bin Stegreif, also ich bin –«
Der Wirt bückte sich, eine Hand hinter dem Ohr. Der alkoholische Geruch des Mannes weckte eine plötzliche Erinnerung an die Weinpresse im Keller der Kindheit.
»Ich bin Vortragender«, sprach Bender etwas lauter. »Und es wäre mir sehr gelegen, wenn ich einen Saal mieten … Ja, wegen der Saalmiete wollte ich gefragt haben.«
Was war mit seinem Deutsch passiert? Es hatte sich in älteren Sprachschichten verheddert. Kein Wunder, dass der Mann nichts verstand.
»Ah, einen Vortrag wollen Sie halten? Welcher Art, wenn man fragen darf?«
Bender sah alles vor sich. Weltall, Erdenrund, die Wahrheit über Leben und Tod. Die erotische Revolution in Worms. Die Menschheitsgemeinde, das heilige Priesterpaar Peter und Charlotte. Er schüttelte den Kopf, machte eine Geste.
Der Wirt schien darüber nicht irritiert.
»Ich muss eigentlich nur wissen«, sagte er zu Bender, »ob Sie vor einer geschlossenen Gesellschaft sprechen werden.«
»Nein, öffentlich«, sagte Bender.
»Also öffentlich.«
»Und die Saalmiete. Wie viel …«
Der Gastwirt musste sich besinnen. Sein Blick wanderte nach oben. Sein linker Daumen, den er sich zur Untermalung intensiven Nachgrübelns an die Unterlippe legte, schien sich dabei aufzublasen. Er nannte einen Betrag. Bender stand auf, ergriff die Hand des Wirts und schüttelte sie. Einklang, dachte es in ihm. Einklang, bimbam.
»Politisch?«, fragte der Wirt.
»Was?«
»Wird Ihr Vortrag politisch ausfallen?«
»Nur im allerweitesten Sinn.«
Wieder kehrte der Daumen an die Unterlippe zurück. Nun ja, da müsste man möglicherweise doch zuerst eine Erlaubnis einholen, meinte der Wirt. Bei der Rheinlandkommission. Die sei nämlich für politische –
»Aber doch nur im allerweitesten Sinn«, wiederholte Bender. »So wie unser Gespräch hier in etwa.«
»Aha, aha«, nickte der Wirt, lehnte sich etwas zurück, obwohl da nichts war, was seiner Rückseite Widerstand hätte leisten können, und legte eine schwere Hand auf seinen Bart. Er schien Schwierigkeiten damit zu haben, den von Bender dargebotenen Vergleich zu deuten. So wie unser Gespräch hier. Ja, war dieses Gespräch hier nun politisch oder nicht? Gewiss, man hatte darin gerade die alliierte Besatzungsbehörde erwähnt. Aber genügte das bereits, um das Gespräch politisch zu machen? War ein Gespräch über die Frage, ob das Gespräch politisch sei, selbst bereits politisch? War darin automatisch der Krieg mitgemeint, die drohende Inflation, der Sozialismus? Vorträge über den Krieg waren natürlich eindeutig politisch und als solche untersagt. Aber konnte man der Katastrophe nicht auch ganz unschuldig gedenken, einfach ihrer Bedeutung nach? Aber was war die Bedeutung eines Begriffs? Bender fühlte die im Raum entstandene Deutungsmühle nun auch selbst.
»Ich verstehe«, sagte der Wirt schließlich.
»Unter anderem wird es um den Erdballglobus gehen«, sagte Bender leise.
»Um den …?«
»Wie das Erdenweltall beschaffen ist. Allerdings auch über die Revolution im Privaten.«
»Revolution?«
Ach, warum hatte er dieses Wort verwenden müssen!
Vom Nachbartisch kam ein leises Sprechgeräusch.
Bender blickte sich um. Erkannte man ihn bereits?
»Bitte?«
»Umkippen werden sie«, sagte der über die Zeitung gekrümmte Mann.
»Sprechen Sie mit mir?«
»Sie wollen den hier für Vorträge einladen?«, sagte der Mann durch sein Verbandszeug hindurch. »Da stellen Sie mal lieber kalte Tücher bereit, für die Damen.«
Der Wirt erwiderte nichts.
»Ich glaube nicht, dass wir uns kennen«, sagte Bender zu dem Fremden.
Der hob abwinkend die Hände und blätterte weiter in seiner Zeitung, kopfschüttelnd.
Also Revolution, soso, da bitte er allerdings doch um genauere Angaben, beharrte der Wirt. Bender fügte sich, drehte das vor ihm liegende Flugblatt um und zeichnete schnell eine kleine Orientierung auf das Blatt:
Der Wirt blickte, grübelte, ließ Zeit verstreichen. Dann stellte sich heraus, dass er mit dieser Art der Verdeutlichung überhaupt nichts anfangen konnte. Der Herr sei ihm auf jeden Fall herzlich willkommen, versicherte er (hier lachte der verarztete Zeitungsleser kurz auf), aber für die vorschriftsgemäße Meldung an die Rheinlandkommission sei doch ein bisschen mehr an Information nötig. Nicht über den wörtlichen Inhalt natürlich, nein, nein, der müsse nicht im Vorhinein festgelegt werden, nur eben der Grad an Politisiertheit.
Dieser Begriff gefiel Bender. Er lobte den Wirt und deutete noch mal auf die Orientierungszeichnung. Da. Am Tisch mit der Familie fiel jemandem das Besteck hinunter. Es wurde mehrköpfig geduckt und gekrabbelt, um es zu finden.
»Links«, sagte der Wirt.
Bender blickte fragend hoch.
»Nein, nein, nicht Sie – da unten.« Er deutete unter den Tisch nebenan. Die Gabel war inzwischen entdeckt worden. Aus ihr waren allerdings zwei Gabeln geworden. Man verglich und untersuchte sie, um zu erkennen, welche die ursprüngliche gewesen war.
»Die linke«, sagte der Wirt.
Er möge bitte an einen Fotoapparat denken, schlug Bender vor.
»Ein Fotoapparat«, wiederholte der Wirt. »Was?«
»Der hat vorne eine Linse, ja?«, sagte Bender und tippte auf seine Orientierungszeichnung. Dass die Leute immer solche Mühe hatten, die allgemeinen abstrakten Gesetze hinter den physischen Phänomenen des Alltags wahrzunehmen! Immer musste man alles haarklein ausbuchstabieren. »Und dann dahinter noch eine Linse. Und vielleicht noch eine.«
War er sich sicher, dass er nicht allmählich ein Fernrohr und keinen Fotoapparat beschrieb? Sei’s drum. Es ging ja bloß um das Bild.
»Also und dann oben – was ist oben?«
Der Wirt blickte fragend.
Unterdessen war am Nebentisch eine dritte Gabel auf dem Boden entdeckt worden. Man reichte sie staunend herum.
»Oben ist natürlich der Auslöser.«
»Richtig«, sagte der Wirt. »Da löst man aus.«
»Da entsteht das Bild.« Bender machte die charakteristische Geste. Der Wirt deutete mit dem Zeigefinger auf die unsichtbare Kamera.
»Der Apparat enthält also Linsen. Gut. Aber was enthält nun die Linse?«
Die Hand des Wirts ließ die Bartspitze los.
»Linse.«
»Die Linse«, wiederholte Bender. »Was enthält sie?«
»Na, die ist aus Glas.«
»Nicht nur«, sagte Bender. »Sie ist auch aus Arbeit. Jemand hat sie geschliffen. Linsenschleifer haben viel Arbeit in sie gesteckt.«
Die Vorstellung gefiel dem Wirt sichtlich, denn er deutete, diesmal allerdings zufrieden und mit einer bestätigenden Handflächengeste, auf die still vor ihnen im Raum schwebende Gespensterkamera.
»Wer schleift die Linsen? Was steckt in der Arbeit der Linsenschleifer?«
»Ah ja, ja«, entkam es dem Wirt.
Er ahnte nun allmählich, wie es weitergehen würde.
»Sie holen sich bloß die Polizei ins Haus«, sagte der verbundene Schädel mit der Zeitung.
»Und was steckt nun in der Arbeit der Schleifer?«, sprach Bender unbeirrt weiter. »Da finden wir den ganzen militärisch-industriellen Komplex, die Rüstungsindustrie, den Krieg, den Wunsch der Menschheit, zu überleben. Oder auch fremde Welten zu sehen.«
»Donnerwetter«, sagte der Wirt.
Aber man rief bereits nach ihm. Das heißt, Augenpaare suchten ihn, die Kellnerin stand neben ihm und wollte etwas. Leute mussten bezahlen, oder bestellen, oder etwas fragen, aber noch hing ja hier alles in der Luft, mitten in der Erklärung.
Bender fühlte, dass er zum Endpunkt seiner Erklärung springen musste. Es stecke, sagte er, am Ende immer der Krieg in allem. Und er legte, q. e. d., den Stift auf den Tisch: Jawohl, in allem der Krieg, der Staat, und vielleicht auch, allgemeiner, der Mensch mit seinem albernen Wunsch, weit weg zu gelangen, über sich hinaus, bis zum Mond, was weiß ich. Am Ende stecke in gewisser Weise einfach in allem der Mond. Selbst im Krieg. Selbst in der Arbeit der Linsenschleifer. Und im Fotoapparat. Und also ebenso in jeder Art von menschlichem Vortrag.
Die Zusage des Wirts tat Bender wohl. Nun durfte er, seinen gerechten Triumph genießend, ein wenig trödeln, bevor er nach Hause ging. Außerdem war es bestimmt gut, Elses Geruch (eine anregend nach Ziege duftende Schminke aus einer goldenen Dose), der gewiss noch an ihm haftete, etwas abstrahlen zu lassen. Wie rasch er diesen träumend durchs Leben schlurfenden Trompetenwirt aufgeweckt hatte! Eine Zeichnung hatte genügt, und die Essenz war in sein Bewusstsein übergegangen! Aber trotz solcher Kleinerfolge fühlte sich Bender im Allgemeinen ziemlich allein mit seinem Wissen. Christlichen Missionaren in zivilisationsfernen Winkeln der Erde musste es ganz ähnlich gehen. Verbündete und Aufgeklärte gab es natürlich, aber diese wohnten alle weit weg. Der große Karl Neupert in Augsburg und Johannes Lang in Frankfurt. Die beiden deutschen Entdecker des Weltbildes. Mehr als einen wachen Geist pro Stadt konnte Deutschland offenbar nicht aufbringen. Aber immerhin: ein Fortschritt. In diesem Augenblick stolperte ein Junge auf der Straße, wie zur Untermalung des Fortschritts, über seinen eigenen Schirm.
Der allererste Entdecker der Wahrheit war allerdings kein Deutscher, sondern der Amerikaner John Cleves Symmes jr. gewesen, ein Kaufmann aus New Jersey, der in der kurzen Zeit, die ihm auf der Erde vergönnt war (er starb mit achtundvierzig), überraschend tiefe Einsichten in ihre Natur gewonnen hatte. Während das von ihm betriebene Handelsgeschäft vor seinen Augen bankrottging, versenkte er sich, da ihm sonst nicht viel blieb, mehr und mehr in das Rätsel der Saturnringe. Ihr Studium bot ihm Trost und Zerstreuung. Darüber gelangte er allmählich zu der Einsicht, dass eine ganz ähnliche Struktur doch auch für die Erde existieren müsste. Wie war es möglich, dass dem fernen Saturn so eine stabilisierende Mitgift zugedacht worden war, aber der Erde, die aufgrund des ununterbrochen auf ihr geschehenden Unglücks doch umso mehr Halt und Aufheiterung benötigte, gar nichts Vergleichbares? Bestimmt gab es da etwas. Ja, es musste da sein, in den Nächten fühlte man es doch. Warum aber war es nicht sichtbar? Symmes’ Lösung: Die Saturnringe der Erde befanden sich in ihrem Inneren. Über Löcher in den Polen konnte man dorthin gelangen und sie betrachten. Das war auch die erste Lösung für das alte Problem, dass die geographischen Pole nicht an der Stelle der magnetischen zu liegen, ja sich sogar unabhängig von diesen zu verschieben schienen. Das, so Symmes, sei das Wirken der Ringe im Inneren, der konzentrischen Innenkugeln. Symmes plante eine Untersuchung des Inneren der Erde, aber kurz vor Beginn der Expedition verstarb er plötzlich unter mysteriösen Umständen – auch das natürlich ein Beweis.
Freilich war diese erste Theorie noch unvollständig. Sie stand auf dem Kopf. Ihr Vollender war schließlich Dr. Cyrus Teed, der sich ab einem gewissen Zeitpunkt, um es seinen späteren Jüngern leichter zu machen, in Koresh umbenannte, die hebräische Form von Cyrus. Dr. Teed war ein außerordentlich begabter Mann. Schon im Alter von dreißig, im Jahr 1869, war ihm vollkommen bewusst, dass er zu Höherem berufen war. In seinem Labor in Utica, New York, gelang ihm eines Abends die Transmutation der Elemente. Wie er später in The Illumination of Koresh festhielt, habe er Materie in Energie umgewandelt, und zwar durch »polaren Einfluss«. Da es aber noch nicht allzu spät war, machte er sich noch am selben Abend dieses außerordentlichen Tages daran, seine Experimente auch auf das Gebiet der Unsterblichkeit auszuweiten. Dabei geriet sein Körper aus Versehen in einen Stromkreis, der zwar nicht stark genug war, um ihn umzubringen, aber ihn für einen Augenblick ohnmächtig werden ließ.
Als Dr. Teed erwachte, war das Universum verwandelt. »Plötzlich fühlte ich«, schreibt er, »eine Entspannung am Hinterkopf, genauer: an der Rückseite des Gehirns, und eine eigentümliche Summ-Empfindung an der Stirn machte sich bemerkbar; dem folgte ein Gefühl wie von einer äußerst spannungsarmen Faraday-Batterie rund um jene Kopforgane, die man die Lyra, die Crura pinealis und das Conarium nennt. Aus dem Zentrum meines Gehirns strahlte auf meine Körperglieder und auf die auratische Sphäre meines Daseins [into the auric sphere of my being] und sogar mehrere Kilometer außerhalb meines Körpers eine Vibration aus, so sanft und zart und süß, dass ich nicht anders konnte, als mich diesem gütig oszillierenden Ozean aus magnetischer und spiritueller Ekstase zu fügen. Ich verfügte mit einem Mal über vorbewusste, vage Erinnerungen an natürliches Bewusstsein und Begierde.« Außerdem schwebte, wie er nun bemerkte, eine Kugel aus Leuchtgas im Zimmer. Sie verwandelte sich nach und nach in eine Frauengestalt, in der Teed Gott vermutete. Seine Schlussfolgerung: »I had formulated the axiom that matter and energy are two qualities or states of the same substance and that they are each transposable to the other. In this I knew was held the key that would unlock all mysteries, even the mystery of Life itself.« Seine letzte Einsicht an diesem Tag war, dass das Universum eine Zelle sei, ein Hohlglobus. Alles Leben existiert an seiner inneren konkaven Oberfläche.
In Naples, Florida, wurde schließlich diese visionär vermutete Gestalt des Universums wissenschaftlich belegt. Dr. Morrow hatte mithilfe des von ihm entwickelten Rektilineators nachgewiesen, dass sich die Erde konkav nach oben krümmt. Und warum verschwinden Schiffe am Meereshorizont? Ja, dieser Effekt lässt sich mit freiem Auge beobachten. In seiner Cellular Cosmogony nennt Dr. Teed dazu eine einfache Analogie: die scheinbare Konvergenz von Eisenbahnschienen in der Ferne. Alle Dinge, die in der Ferne liegen, verschmelzen optisch miteinander. Selbst zwei nebeneinanderher fliegende Ballone, schreibt er im Kapitel über Sehstrahlen, die nur hinreichend weit ins Firmament davonschweben, werden dort scheinbar zu einem Ballon. Das bedeute aber nicht, dass die Ballonfahrer miteinander körperlich verschmelzen, also sozusagen – um beim Bild des Schiffes am Horizont zu bleiben – »ineinander versinken«, nein, es sei natürlich eine durch die inneren Gegebenheiten unserer Sehorgane erzeugte Illusion. Man könne sich sogar die Mühe antun und die Gewänder und sogar die Körper der Ballonfahrer hinterher genau untersuchen. Nirgends werde man Spuren gegenseitiger Durchdringung feststellen! (Ging da jemand hinter ihm? Bender blickte sich um, stolperte beinahe …) Und bestreue man gar eine der beiden Ballonfahrergruppen mit einer »nachweisbaren Pulversubstanz, wie etwa Mehl«, so finde sich nach Rückkehr der Flugvehikel kein Stäubchen derselben auf der jeweils anderen Gruppe. Dasselbe Experiment lasse sich dann mit beliebig vielen Ballonen, Korb-Passagieren und verschiedenfarbigen Mess-Substanzen wiederholen und – ja, Bender musste feststellen, dass ihm tatsächlich jemand folgte. Es war der Mann mit dem verbundenen Gesicht. Er schwang beim Gehen einen Spazierstock.
Bender schritt eine Weile dahin, die inneren Stimmen nun ganz erloschen, nur noch auf den Verfolger hinter sich lauschend. Kam der Kerl näher? Oder lief er nur durch Zufall denselben Weg? Bender bog in die Andreasstraße ein, dann ging er langsam in Richtung des jüdischen Friedhofs, vorbei am Kreisamt, diesem erzdüsteren Gebäude voller Dämonen. Weit entfernt war ein aufheulender Motor zu hören, und für einen Moment erschrak er, weil er dachte, das Geräusch käme aus ihm, beim Ausatmen. Er tat so, als steuere er den Haupteingang des Friedhofs an, aber schwenkte dann, wie aus einem plötzlichen inneren Entschluss, nach rechts und überquerte eine Wiese. Wenn einer dir quer über eine Wiese folgt, dann will er was von dir, dachte Bender. Und tatsächlich schien die Gestalt mit dem Verbandskopf zu überlegen, ob sie ihm nachgehen wollte. Sie tat es. Bender wandte sich ab und eilte weiter. Bei jedem Schritt spürte er, durch den Grasteppich hindurch, die verlässliche Härte des Planeten.
Nun erinnerte er sich, dass er keine Ausweispapiere bei sich trug. Wohin schlug man am besten mit der Faust, um sich zu verteidigen? Manche sagten, der Adamsapfel sei die sensibelste Stelle. Aber der Verfolger hatte einen offensichtlich verletzten Kopf, also bot sich dieser als ideale Angriffsfläche an. Warum suchte der Kerl überhaupt eine Auseinandersetzung, während sein Kopf noch von Verletzungen heilen musste? Fühlte er sich – wusste er sich derart unzerstörbar? Das war nicht gut. Jenseits der Wiese lag der Kiosk von Herrn Lind. Perfekt, dort würde er sich aufstellen, da konnte ihm nicht viel geschehen. Herr Lind wäre Zeuge der Entführung. Entführung? Warum denke ich sowas? Wie soll einer mit verletztem Schädel mich entführen, dachte Bender und tat so, als müsste er lachen. Aus dem Kioskfenster leuchtete das gerötete, glänzende Gesicht von Herrn Lind, der seit dem nun bald ein Jahr zurückliegenden Grippetod seiner Frau zunehmend verwilderte. Manchmal sah man ihn am Ende des Tages neben seinem Kiosk stehen, wie von einem roten Rand umzeichnet, und nach Tauben treten.
Bender grüßte Herrn Lind und kaufte eine Abendzeitung. An einer Stelle des Asphalts wölbten sich die Wurzeln eines mächtigen Baumes, der, obwohl direkt neben der Wiese, seit Jahren von einem Betonkranz und einem Metallgitter umgrenzt lebte. Bender stellte sich direkt auf einen der rissigen Betonhöcker und ließ sich sozusagen vom Baum tragen, während er, seitwärts schielend und in seiner Zeitung blätternd, den auf ihn zuschreitenden Angreifer erwartete. Am besten erst mal ganz nah herankommen lassen. Dann einfach mit den Knöcheln der rechten Hand direkt auf die dunkelste Stelle des Verbands, seitlich am Kiefer. Außerdem bekam ja Herr Lind alles mit. »Herr Leutnant«, hörte er, »Sie hetzen einen aber herum. Und das mit meinem Bein.«
Als die sich so ankündigende Gestalt direkt neben ihm Aufstellung genommen hatte, zog Herr Lind mit einem Mal die Läden seines Kiosks nach unten. Verblüfft wandte sich Bender nach dem Geräusch um.
»Herr Leutnant?«, wiederholte der Fremde.
Bender tat so, als fiele er ihm erst jetzt auf.
»Bitte?«
»Nett von Ihnen, dass Sie auf mich warten. Ich bin nicht ganz so gut zu Fuß, wie Sie sehen.«
»Ich denke nicht, dass wir uns kennen«, sagte Bender und dachte dabei: Schau an, wie ruhig ich bleiben kann. Er konnte auf dem Hals des Gegners keinen Adamsapfel erkennen.
»Nein, nein«, sagte der Mann und zündete sich, die Flamme gefährlich nah an seinem Verbandszeug vorbeiziehend, eine spindelige Zigarette an, »und ich hoffe, Sie nehmen mir meine kleine Intervention vorhin nicht übel. Ich wollte mich dafür entschuldigen.«
Der Spazierstock des Fremden besaß am einen Ende einen frechen schwarzen Gummistoppel, der direkt auf Bender zeigte.
Der Mann überreichte ihm seine Karte. Florian Abt, Händler in Waren. Bender steckte sie kopfschüttelnd ein.
»Sie sind ein sehr begabter Redner«, sagte der Mann.
»Danke.«
»Nur«, eine kurze Rauch-Huste-Pause, »nur das mit dem Quadrat der Geschlechter, Herr Leutnant, also …«
»Ich bin schon lange nicht mehr Leutnant.«
»Weiß ich, weiß ich. Sie waren alles Mögliche seither. Ist auch Ihr gutes Recht. Also, die Quadratur der … na ja, jedenfalls das mit der Vielehe, oder der Liebe zwischen Vater und Tochter. Geht alles über meinen Horizont. Aber Ihr Talent als Redner! Außerordentlich. Wenn Sie irgendwann mit Ihrem Wort für eine gute Sache einstehen wollen –«
Ein Flugblatt wurde vorgezeigt. Das Rheinland den Rheinländern! Doppelt unterstrichen.
»Na, na«, sagte Bender. »Tun Sie das weg.«
Er bemerkte, dass er seine Zeitung vor lauter Anspannung zu einem kleinen, verkrümmten Schalltrichter zusammengerollt hatte.
»Es geht in unserer Gemeinde in erster Linie um spirituelle …«, begann er.
Herr Abt hob eine Hand, drei Finger abgespreizt.
»Drei«, sagte er. »Allein beim letzten Vortrag. Drei Damen, in den hinteren Reihen. Alle umgekippt. Fällt Ihnen vielleicht gar nicht mehr auf?«
Bender spürte: Ich werde rot. Und ein Juckreiz durchwanderte seinen Körper, wie eine langsame Scheinwerferfahrt. Er richtete seinen Blick zu Boden und sagte: »Damit habe ich nichts zu tun.«
Herr Abt schien amüsiert.
»Na gut«, sagte er. »Jedenfalls sind Sie ein Talent. Die Leute kippen um, wenn Sie reden. Sie gehören in große Braukeller. Ich war ja auch dabei, damals, achtzehn. Im Arbeiter- und Soldatenrat. Also, Herr Leutnant, sollten Sie je das Bedürfnis haben, für die richtige Seite einzustehen, auf der Rückseite der Karte finden Sie unseren Versammlungs-«
»Jaja, ich sehe schon, danke«, sagte Bender.
Herr Abt lachte und klopfte Bender auf die Schulter.
»Viel Glück für Ihre Gemeinde«, sagte er und verabschiedete sich.
»Gute Besserung«, murmelte Bender.
Seine inzwischen beinahe zu Brei zerknetete Zeitung immer noch mit beiden Händen festhaltend, wartete Bender noch einen Moment, ob der Laden des Kiosks nun wieder hochgezogen werden würde. Nein, er blieb unten. Bender verfluchte den feigen Herrn Lind. Schafe, alles Schafe! Und am Himmel, ja, natürlich, was sonst – da schwebte jetzt der Mond. Fantastisch. Alles perfekt organisiert. Bender versah den Mond mit Schimpfnamen. Das Ding besaß heute die Form eines menschlichen Ohrs. »Abnehmend« also, dieses lächerliche optische Verwirrspiel. Auf dem Weg zurück zum Gasthof Zur Trompete begegnete Bender der schwarzen Gummispitze von Abts Spazierstocks wieder, diesmal war sie ein briefmarkengroßes Bärtchen im Gesicht eines Obsthändlers, und später, beim Betreten des Lokals, fühlte er sie deutlich in seinem Inneren, direkt unter seinem Brustbein, als eine Art Maikäfer, der dort summbereit auf den entsprechenden Zauberspruch wartete: der Teufel.
Nach genauer Prüfung der hiesigen Klientel, erklärte Bender, sehe er sich leider gezwungen, diesem Lokal seine eben zugesagte Vortragstätigkeit wieder zu entziehen. Der Wirt nahm dies mit Verblüffung zur Kenntnis. Das ringsum tafelnde Schafsvolk hob kaum die trägen Blicke von den Tellern. Sehr bedauerlich, sagte der Wirt und wollte wissen, ob er sonst irgendetwas für den Herrn tun könne. Bender blickte in das Gesicht dieses verlorenen Menschen, mit einer Mischung aus Abscheu und Mitleid, dann sagte er, vor lauter widersprüchlichen Empfindungen in eine neutrale Sprache abrutschend: »Do your research.«
Kindheit
Geboren 1893 in Bechtheim, Kreis Alzey-Worms. Laut Dorfunterlagen am 29. Mai, allerdings später von ihm selbst auf den 30. geändert. Hier wächst das Kind auf, unter der Schirmherrschaft der Weinhänge, mit Sonne zwischen den wellig gekämmten Hügeln, mit Trauben im Schuh, im Bett, überall, und dem rötlichen Geruch der alten Ziegelei. Ein Kirchturm saugt einen Vogelschwarm aus dem Himmel. Ein Riese geht mit Sense und Eimer durch die Straße. Bei der Einschulung dann der in der Mittagssonne immer stärker werdende Geruch nach Schweinespeck, mit dem die Schuhe der ärmeren Dorfkinder zum Glänzen gebracht werden. Der Lehrer ist einer, der schwermütige Kinder so drollig findet, dass er sie immer zu zwicken beginnt, wenn sie weinen.
Der Junge lernt blitzschnell schreiben und lesen, er lernt, sich zu waschen und, auf Zuruf, sich zu beherrschen, er spielt mit Zinnsoldaten, nascht vom Kerzenwachs. Die Weinpresse im Keller macht ein Geräusch, das beim Einschlafen oft aus ihm selbst zu kommen scheint, vor allem, wenn sein Magen knurrt. Dann das muntere Geratsche der Elstern im Hof und das heidnische Gefühl beim Urinieren im Wald, zwischen Dornen. Und manchmal bei Hochdruckwetter: ein plötzlicher, stechender Schmerz in der Schädelnaht, dann spürt der Junge deutlich, wie sich in den Nachbarhöfen die Brunnen vertiefen. Ein Eiszapfen am Tor, wunderschön und helldurchsichtig im Tageslicht, dazu Hammerschläge aus einem nahen Haus. Oder der Sommer beginnt, und es liegen wieder vermehrt Kleidungsstücke in den Wiesen, und die Gebüsche prasseln vor Sperlingen. Und immerzu ernste Gespräche über die spätere Laufbahn des Jungen, mit der ewig gleichen Erzählung von den zwei tüchtigen Onkeln des Vaters, die beide zum Wohle der Menschheit Kaufmann geworden und seither irgendwo auf dem Globus verschollen sind. Es heißt, dass alle Kinder später einmal etwas werden. Was wirst du werden? Nach seinem ersten Becher Federweißer träumt der Junge die ganze Nacht von Nibelungenfahrrädern. Er weiß noch auf nichts eine Antwort. Unterdessen faltet sich das alte Jahrhundert, und ein frisches beginnt.
Am würzigen Kiesbettgeruch der alten Bahnstrecke erkennt er den Herbstbeginn. Er hat nun erste deutliche Muskeln vom Klettern und Laufen. Die Blätter fallen aus vollem Herzen und locken die riesige Spinne an, die tagelang im Fensterwinkel als Stadtwappen hockt. Der November bringt dann erste Fröste, und eine letzte Birne hängt mulmig draußen im Baum. Sie wird dem Jungen, je weiter sich die Kälte im Dorf ausbreitet, zu einer kecken und Mut spendenden Gefährtin. Mehrmals am Tag, auch auf dem Heimweg von der Schule, geht er zu ihr, um ihr sonderbares Schicksal zu bedenken. Am liebsten würde er sie läuten, wie eine kleine Hausglocke. Die Birne heißt vielleicht Gudrun, vielleicht Gesine. Sie ist bereits ganz erdfarben, verhutzelt, ihr Gewebe »weiß also schon alles«, aber noch reicht ihr Gewicht nicht zum Fallen.
Dann, bei einem Schulfreund, ein Nachmittag lang vor dem ersten Modellschiff. Wie fachmännisch da die Blicke werden, wie mutwillig die Gesten und Stimmen. Fast küsst Peter seinen Freund auf den haarflaumigen Nacken, als dieser sich über das prachtvolle Bastelwerk beugt. Als er dann gegen Abend aus dem Haus tritt, sieht er die Bäume in ihrem lichten schönen Leben wie riesige Menschen in der Straße stehen. Über all das hinwegbrettern, denkt er, rasend, brennend, in einem winzigen, die eigenen Körperkonturen genau einrahmenden Flugschiff! Er nimmt es sich vor, für später, als heilige Pflicht.
Dann 1904, die Wende im Leben, der grässliche Unfall des Großvaters Erich. Wenige Wochen nach der Einweihung der elektrischen Trambahn in Worms fährt dieser in die Stadt, gerät dort allerdings gar nicht unter die Räder des neuartigen Gefährts, sondern wird von einem der längst ausrangierten und nur noch eine Weile zur Zierde laufenden Pferde-Omnibusse überrollt. Das Bein entzündet sich, und Wundbrand beginnt drum rum zu wachsen, wie Efeu um eine Statue. Eines Morgens, nach einer Nacht voller Schmerzensschreie, holt man ihn mit dem Leiterwagen ab. Er kommt auf die Ladefläche und blickt, während zwei kräftige Männer ihn ziehen, staunend zu seinem Gehöft zurück.
Drei ganze Tage bleibt er fort, dann bringen sie ihn zurück. Er ist wieder da! Aber er lässt sich weder von seiner Tochter noch von seinen Enkelkindern anschauen. Er schämt sich sehr und versteckt seine untere Hälfte unter einer Decke. Als seine Angst etwas gewichen ist, darf seine Schwiegertochter ihm, der noch immer im Hof im geborgten Leiterwagen in der Sonne sitzt, genauen Bericht über die versäumten Tage geben. Dabei nickt er viel. Und nach einer Weile geht sein Blick in die Höhe, in die flämmchenhaft dünnen Spitzen der Pappeln auf der Straße, und sein Gesicht verzerrt sich.
Nun pocht auf einmal ein Holzbein durchs Haus.
An den immer früher mulmig werdenden Abenden singt die Mutter für den Jungen Lieder. Es war ein König in Thule ist darunter, und Peter merkt sich den Text, so wie das meiste, schon nach dem ersten Hören. Und dann eine ewig lange, stellenweise etwas derbe und alberne Ballade, in der allerdings ein anmutiger Vers über Bäume auftaucht: Sie stehen auf der Erden / Mit segnenden Gebärden. – Das gefällt ihm! Ja, den Satz kann man singen und in seinen Endsilben so unerhört auskosten und ausdehnen, regelrecht innerlich einstampfen kann man ihn. Er hebt sich den eingängigen Takt der Zeilen bis zur Schlafenszeit auf, indem er ihn beständig mit den Kiefern mahlt.
Nachts gibt es oft Schatten und Formen an der Wand. Aber nur selten ist etwas Deutbares dabei. Einmal eine Art Hase, der ihn lange ernst anblickt, ein andermal ein Schneckenhaus, das sich sehr langsam dreht. Die Mutter erzählt ihm eines Mittags, vermutlich weil ihr allmählich die Geschichten und Märchen ausgehen, vom heiligen Hieronymus im Gehäuse. Was ein Gehäuse ist, weiß der Junge. Es umgibt Nusskerne. Wie aber ist der heilige Hieronymus so klein geworden, dass er in eine Nussschale passt? Peter läuft hinaus vors Haus, randvoll mit Fragen, aber die Weinhänge und die Krähen wissen natürlich nichts, ebenso wenig die Wegränder, und der Weiher liegt ohnehin tagein, tagaus wie gepanzert da, spiegelklar und hellweiß unter dem Himmel, eine geschmolzene Ritterrüstung. Und alles so stumm, so auskunftsfeig, so abgekehrt und verschlossen. Wie kann das sein?
Und jeden Abend die Pflege des Beinstumpfs. Der Junge kann schon bald länger hinsehen, ohne innerlich zu verstummen. Schwarzbrot. So sieht es aus. Die Farbe bleibt ihm unbegreiflich, denn der Rest des Großvaters ist immer noch so hell, so gewöhnlich hautfarben wie früher. Wo also hört das eine auf, und wo beginnt das Neue?
Von der Elektrisch’ in Worms wird im Haushalt viel gesprochen, viel geschimpft, aber der Warn-Gehalt der Meinungen bleibt unklar. Denn es war ja gar nicht die neue Trambahn, die dem Großvater das Bein gestohlen hat. Soll man nun trotzdem vor der neuen Elektro-Erfindung Angst haben, die in der Riesenstadt Worms durch die Straßen rollt? Oder ist die alte, überholte Verkehrsform das eigentlich Böse? Oder ist diese erst durch die Ankunft der Elektrifizierten böse geworden? Wird vielleicht alles, was von elektrischen Strömen verschont bleibt, automatisch teuflisch, wenn Elektrisches in der Nähe ist? – Außerdem will ihm niemand verraten, wo das herrenlose Originalbein hingekommen ist. Stattdessen haben alle auf einmal Termine, selbst der Großvater, der doch eigentlich nirgends mehr hinmüssen sollte. Sie haben Ärger mit Ämtern, wo ihnen statt der vier dringendsten Fragen immer bloß eine fünfte, völlig neue und von gar niemandem gestellte Frage beantwortet wird, aber dies immerhin in einem so prachtvollen Deutsch, dass alle sich über den Amtsbrief beugen und ihn sogar bei Tisch laut vorlesen.
Mit zwölf liest er die Bücher von James Fenimore Cooper und später auch den Robinson Crusoe. Tagelang geht er beeindruckt umher und stellt sich vor, sein einziger Gefährte auf Erden sei dieser einzelne mysteriöse Fußabdruck am Meeresufer, den Robinson eines Tages entdeckt. In der Scheune im Hof sitzt der Junge und nutzt die Dunkelheit und Kühle, um sich die eben gelesenen Szenen in der Erinnerung noch einmal deutlich vor Augen zu führen. Später baut er sich sogar seinen eigenen Crusoe-Fußabdruck im Schlamm neben dem Teich. Im Roman wird erzählt, dass der Abdruck direkt am Meeresufer liegt. Also ist dort ein Fremder herumgelaufen. Aber wie – der Fremde hat nur einen einzigen Schritt gemacht und ist dann – ja, was? Weggeflogen? Mit Siebenmeilensprung auf einen ganz anderen Teil der Insel? Warum ist da nur ein Abdruck? Es ist einfach großartig, es macht ihn beim Lesen und Wiederlesen ganz wahnsinnig! Und da, vor der Haustür, der immer noch einsam dastehende Stiefel, in dem früher das Bein des Großvaters steckte. In dem Stiefel sind jetzt manchmal Frösche. Wenn er einen findet, bringt er das verirrte Tier hinaus zum Teich. Erst Stunden später fällt dem Jungen eine mögliche Deutung der Tiererscheinung ein. Aber da ist es bereits zu spät und die wiedergekehrte Seele des Beins unrettbar im Teich versunken. Man muss in Zukunft besser aufpassen.
Er liest die Nibelungensage, die größte Geschichte aller Zeiten. Kaum zu glauben, dass das alles hier spielt, praktisch direkt vorm Haus, in der täglich betrachteten Landschaft. Hagen, Siegfried. Brunhild, die mit Gewalt genommen wird. Wie das wohl aussieht? Jemanden mit Gewalt nehmen. Um die Hüfte? Und das Lindenblatt zwischen den Schulterblättern, fast spürt man es dahinten knistern, wenn man sich abends auszieht. Der Junge versucht, allen von dieser einen faszinierenden Figur zu erzählen, Hagen, denn er will nicht einsehen, dass ein Mensch so sein kann, so sein darf, das hätte doch früher bemerkt werden müssen – aber dann, als in der Schule die Nibelungen gespielt werden in einer kleinen Theaterrevue, da meldet er sich freiwillig für die Rolle des Hagen, allerdings nicht mehr mit Eifer, nicht mehr auf seine johlende, lernfrohe Art, sondern mit düsterem Nachdruck: »Frau Lehrerin, ich spiel den. Ich spiel den Hagen.« Da fällt ihm bereits – im Frühling wird er vierzehn – das Stirnhaar ins Gesicht, und auch die Stimme beginnt sich zu senken.
Eines Sommers beginnt er damit, seine Träume zu notieren. Aber nach und nach bekommen die Träume – oder der Teil seines Verstands, der sie nachts ersinnt – mit, dass sie immer gleich am nächsten Tag notiert werden, und ab da geraten sie ihm allzu ausdeutbar und merkspruchhaft. Bald träumt er fast nur noch Niederschreibbares. Beim Erwachen fühlt er sich dann unerholt, blutleer, betrogen. Schließlich verwirft er die gefährliche Übung, nachdem er eines Nachts allen Ernstes von einem nussgroßen Schreiber geträumt hat, der sich Träume notiert. – Zur gleichen Zeit werden ihm die meisten Mitschüler widerlich, ja fast verdächtig. Wie lammfromm und lernbegierig sie sich allem fügen! Und zu Mittag liegt ein Fisch mit fiebrig gequollenem Totengesicht vor ihm. Alles Zeichen, alles sehr deutlich.
Und in seiner Nuss hockt währenddessen immer noch der heilige Hieronymus, stecknadelgroß sein Glatzkopf, kleinwinzig und doch so riesengroß, ja gottgroß, denn er ist heilig. Wie man das wohl wird? Der Junge hebt einen Stein auf, zufällig ausgewählt, und Ameisen strömen darunter hervor, wie unter Magnetwirkung. Dann liest er weiter in den Nibelungen und erledigt die Hausaufgaben in Geometrie, während er an Mädchen in Röcken denkt. Die freiliegenden Zahnhälse frisch gespitzter Bleistifte! Als ein Hufeisenmagnet ins Haus kommt, läuft er damit herum und findet überall magischen Kontakt. Aber dann der Fehler: Er läuft damit hinaus in die Natur und hält das Gespensterbesteck an alle Dinge, an Blumen, Erde, Baumstämme, aber sie sind immun, alle! Sie neigen sich nicht, spüren keinerlei Anziehung, alles reglos und unverständig und dumm – so ein Betrug! Es funktioniert nur drinnen im Haus, mit dem Universum hat es gar nichts zu tun!
Der Großvater ist beim Rotwein eingeschlafen, beide Hände in Geborgenheit eingerollt, wie eine Katze. Bei seinem Anblick drängt es den Jungen, in die Nacht hinauszurennen. Stell dir vor, da jetzt hinaus – und der schwarze Himmel hängt voller Luftschiffe. In königlicher Gemütsruhe schweben sie da, pflastern den dunklen Himmel mit ihren Formen, und du stehst vor ihnen, und sie wissen nichts von dir. Dann, sonntags, mit der Angel hinunter zum Teich mit seinen hohen, immernassen Birken und den Ufern, die aus vollen Schilfkanonen feuern. Die Fische besitzen riesige Mäuler, aus denen gelegentlich Luftblasen an die Oberfläche blubbern. Die Fische wissen alles. Alle so hellweiß und durchschimmernd, wie aus Samenflüssigkeit geformt, nach dem Bleigießprinzip. Dann gibt es hier noch Libellen: winzig kleine, ferngelenkte Kettensägen, allesamt vom Teufel besessen. Peter versucht, sie in seiner Mütze zu fangen. Ein einziges Mal gelingt es, und er spürt die Elektrizität des für Sekunden im Stoff gefangenen Wesens, und er lässt es schnell wieder frei, schnappatmend lachend über das kleine Kunststück. Hieronymus, du in deinem Gehäuse. Warte du nur, denkt der Junge. Und er reckt die Faust in die Höhe. Jede Nacht spritzt er drei-, viermal in ein Stofftaschentuch.
Mit fünfzehn dann die erste Liebe, einen Nachmittag lang. Das Mädchen heißt Magda, und er bekommt ihre Schenkel ums Gesicht gewickelt, im Ringkampf. Er sagt ihr, er habe in der Schule gelernt (er ist ein Jahr über ihr), dass der Mond hohl sei, und sie glaubt es für eine Minute, worüber er sich köstlich amüsiert, »Haha du glaubst auch alles!«, bis er endlich wieder von ihr in die Mangel genommen wird. Sie drückt diesmal fester zu, und er kann nur noch grunzend atmen, hält aber dennoch triumphal still im Zangengriff ihrer kräftigen Beine. – Dann auf dem Fahrrad mit ihr durch den Regen, sie vorne auf der Lenkstange mit ihrem Puppengewicht, und er fühlt ihre Haut, ihre Arme, besoffen vom Geruch ihres Rückens, und ihr hüftlanges Haar weht ihm gottlob ins Gesicht, während er in die Pedale tritt und seitlich an ihr vorbeilinst, um nicht vom Weg abzukommen. Sie küsst ihn mit geschlossenem Mund und macht dabei Summgeräusche. Hinterher geht er erhöht durch die Dorfstraßen. So hatte der unbekannte Verfasser des Nibelungenliedes doch mit jedem Wort recht! Zuhause taucht er den Kopf unter Wasser, und das Leben ist gut und gerecht.
Noch ein Jahr wohnt der Großvater mit ihnen. Von ihm hat der Junge, abgesehen vom Zeichnen und Rechnen, auch die Schwermut gelernt. Denn schwermütig ist der Großvater, so wie andere musikalisch sind. Er schleppt sich mit einer gewissen Anmut durch jeden Tag, will von nichts etwas wissen und nimmt dennoch seufzend an allem teil, steht nickend und überfragt neben allen Verrichtungen, hat die Daumen in die Hosenträger gehakt und wendet sich, als die jeweilige Sache, ohne sein Zutun, erledigt ist, erleichtert ab und geht kopfschüttelnd davon. Was nicht bis in seine Schwermut reicht, davon erfährt er nichts, das geht ihn nichts an. Er gibt den Pferden schon lang keine Namen mehr. Auch das alte Fuhrwerk müsste repariert werden, aber es ist inzwischen Frühling, da wird das auch nichts mehr. Alle Menschen gehen mit aufrechten Oberkörpern umher, durch Hohlwege voll schwarzem Holunder. Es ist überhaupt ein Wunder, dass der alte Mann sich nach dem Unfall nicht sofort in eine Pyramide oder einen steinernen Sockel verwandelt hat. Als beweglicher Mensch jedenfalls hält er sich nur noch mit Mühe in der Welt, und dass sich nach dem Unfall tatsächlich ein Teil von ihm aus dem Staub gemacht hat, scheint er nicht als Ungerechtigkeit, sondern lediglich als eine Art von geglückter Bruchrechnung zu empfinden. Er stirbt im Herbst 1909.
Das Holzbein bleibt. Es hieß zeit seines Lebens immer nur »Das«. Gib das her, wo ist das, wo hast du das hingelegt. Jetzt lehnt es in einem Winkel. Straßenbahnen, Stadtverkehr, Omnibusse. Ein Glück, dass die Weinberge hier solch einen Unfug nie zulassen würden. Im Frühjahr des nächsten Jahres erscheint dann der Halley’sche Komet und bringt seinen Segen. Einige Leute verlieren darüber den Verstand. Aber da ist aus dem Jungen bereits ein großgewachsener Nietzscheaner geworden. Dazu natürlich Kant, Fichte, Schleiermacher. Eben alle Großen. Auch mit den Evangelisten und Aposteln steht er auf Augenhöhe, kann Seuse, Tauler und Meister Eckhart auswendig hersagen. Doch inmitten der silbergeädert religiösen Innigkeit hat sich in ihm die räudige Fledermausseele eines Heiden erhalten: Er träumt jetzt jede Nacht wüst und filterlos, schnaubt und speit auf offener Straße und starrt fremden Mädchen so lange nach, bis er den Klang ihrer Vornamen auf der Zunge erahnen kann. Er beginnt zu rauchen, ans Studium zu denken, er verliert seine Unschuld an Iris, die ihn einen Sommer lang abschätzig liebt. Auf seiner Oberlippe wächst ein dünnes Probebärtchen. Sein Blick wird beim Sprechen oft romantisch und drängend. Und sogar Verse kann der Halunke – gereimt, frei, was immer man will!
Die ersten Menschen
Herr Erdelmeier, der Briefträger, war ein rundlicher, anständiger Mann mit auffallender Barttracht: sehr kurz rasierte, an Tangramsteine erinnernde Kinn- und Backenpartien, die sich niemals veränderten. Der Bart durchlebte keinerlei Entwicklung, keine Jahreszeiten, keine Variationen. Er blieb symmetrisch, auch als eines Tages der Rhein zufror oder der Kaiser abdankte. Herr Erdelmeier kam morgens und abends durch die Schillerstraße, und immer zuerst an dem Haus von Frau Blun vorbei, einer älteren jüdischen Dame, die den Benders über die Jahre fest ans Herz gewachsen war. Sie war die Erste gewesen, die die frisch zugezogenen Eheleute willkommen geheißen und durch Lebensmittelgaben einige Zeit über Wasser gehalten hatte. Auch auf den kleinen Gerd hatte sie aufgepasst, als Charlotte mit dem zweiten Kind in den Wehen lag. Bender liebte Frau Blun mit der schlichten Verblüfftheit eines Enkelsohns. Die alte Frau besaß eine Katze, deren Tigerfell eine interessante Musterung aufwies, als versuchte die Flanke des Tieres irgendetwas zu buchstabieren, und eine rote Gießkanne, mit der sie jeden Tag auf den Friedhof zum Grab ihres Mannes ging (Grippe, 1918). Tagsüber hielt sie die Gießkanne angekettet vor ihrem Haus, direkt an der Gartenpforte, als hätte sie Angst, dass sie ihr gestohlen werden könnte. Aber wer stahl Gießkannen?
Wenn Herr Erdelmeier an Frau Bluns Haus vorbeiging, zeigte er bei einem bestimmten Fenster immer seine leeren Hände. Denn Frau Bluns namenlose Katze saß dort die meiste Zeit des Tages, und die leeren Hände bedeuteten: »Ich hab leider nichts für dich.« Hatte er der Katze irgendwann einmal etwas gegeben? Bender hatte es nie beobachtet. Das Tier selbst schien nie etwas zu erwarten, es saß bloß gern im Fenster. Niemand in der Gasse, nicht einmal Frau Blun selbst, konnte sich daran erinnern, dass der Briefträger der Katze je irgendeine Leckerei zugesteckt hätte. Aber dennoch schienen die beiden einander von irgendwoher zu kennen. Die Katze war sonst recht scheu und duckte sich weg, wenn jemand Fremdes an ihr Audienzfenster trat. Aber bei Herrn Erdelmeier blieb sie ruhig. Sie genoss seinen Anblick. Und er hatte nie etwas für sie.
Über Herrn Erdelmeiers Barttracht erzählte Frau Blun, dass er diese von seinem Vorgänger übernommen hatte. Der alte Briefträger war eines Tages, da das Jahrhundert gerade zu Ende gegangen war, plötzlich, zwischen zwei Briefzustellungen, ohne Schmerzgrimasse oder Protestlaut, auf der Straße hingefallen und dort leblos liegen geblieben. Man entdeckte nachträglich zwar allerlei chronische Leiden in seinem Körper, aber zwingende Ursachen für seinen plötzlichen Tod fanden sich keine, und ein neuer Briefträger übernahm die Route. Als sich der damals noch junge Herr Erdelmeier mit dieser Aufgabe betraut sah, folgte er, so wusste Frau Blun zu berichten, einem mitleidigen Impuls: Am Vorabend seines Dienstantritts setzte er sich mit einem Porträtbild des früheren Briefträgers vor einen Spiegel und gestaltete seine Frisur und seinen Bart nach dem verblichenen Vorgänger, damit die Welt den Riss nicht so spürte.
Charlotte war nicht enttäuscht, als Bender ihr von den drei missglückten Versuchen berichtete, einen Vortragsraum zu finden. Sie habe die neuen Broschüren an alle Gemeindemitglieder ausgeschickt. Bender dankte ihr. Was in der Post gewesen sei, fragte sie. »Ach, gar nichts. Dies und das.« Bender verschwieg, dass Herr Erdelmeier ihm sowohl einen Mahnbrief der Stadtverwaltung als auch einen Brief von Else, der nichts als ein frankiertes Rücksendekuvert enthielt, überbracht hatte. Else teilte ihm dadurch mit, er möge ihr den Schlüssel zu ihrer Wohnung zurückschicken. Sie machte offenbar wieder einmal »Schluss« mit ihm. Entzückend. Er zerknüllte das Kuvert und warf es in den Müll. Hinterher holte er ihren Schlüssel aus seiner Tasche und roch an ihm.
Im Mahnbrief stand auch nichts Neues. Bloß die wiederholte Aufforderung, die geplante Feier der sogenannten »Menschheitsgemeinde Worms« vor dem Lutherdenkmal zu unterlassen. Man drohte ihm mit Irrenhaus und Ordnungsstrafen. Bender zeigte dem Brief beim Lesen die Zunge. Die Dummheit dieser Leute tat ihm in der Seele wohl. Stell dir vor: sich dagegen zu wehren, dass Worms die Stadt der Menschheit wurde! Gegen die Menschheit zu sein! Dass die sich nicht schämten. Jaja, sie wollten am liebsten alles frei von Menschheit haben. Und ja, beim Universum hatten sie das auch geschafft, da lernte jedes Kind schon in der Schule, dass das da oben alles bloß aus Kugeln bestand, aus Wärme und Kälte und Schwärze und Kugeln Kugeln Kugeln, sonst nichts, nichts Menschliches, nur lauter in unergründlichen Kräftewirkungen einander für immer verfallene Riesenkörper, das Gegenteil von Menschheit. Die Heilung bestand in der, wie Bender es in seinen Vorträgen und Flugschriften nannte, »Weltallvermenschlichung«. Man musste ja schließlich, anders als die eitlen Physiker, eine Sprache verwenden, die jedes vernunftbegabte Kind begreifen konnte. Gerade Kinder beherrschten das Prinzip ohne Mühe: Ein verlorener Schal war betrübt und einsam, ein auf einen Zaunzacken gestülpter Handschuh dagegen lausbübisch und verwegen, eine Art Hase, und so weiter. Eine solche Vermenschlichung war, das sah er allerdings bald ein, im Falle des gängigen Weltbildes ein vollkommen heilloses Unterfangen. Da war eine winzige Kugel, umgeben von unendlichem Leerraum mit hier und da platzierten Nachbarkugeln und etwas größeren Hitzequellen, was, bitte, sollte das? Wie war es den Gelehrten der vergangenen Jahrhunderte gelungen, mit stets ruhigem Geist und ohne innere Gegenwehr vor einem solch trostlosen Modell zu hocken? Warum implodierten sie nicht alle? – »Ich gehe noch etwas spazieren«, rief er. Charlotte war erstaunt. Aber das Mittagessen sei doch gleich fertig. Frau Bluns Rezept, das er so gern möge. »Ich bin nicht hungrig«, sagte Bender. »Nur ein, zwei Stunden. Mir kommen Gedanken, ich muss spazieren.«
Der Weg zu Elses Wohnung führte ihn am Kiosk vorbei. Bender grüßte Herrn Lind, der ihn allerdings nicht bemerkte; er wirkte heute vollkommen erloschen, lehnte wie totgeschossen in seinem Bretterverschlag, neben ihm ein Becher heißer Schokolade. Der Mann durchlebte jeden Tag alle Jahreszeiten der Trauer, eine Art Leidenskarussell. Die Vorfreude auf Elses Umarmung machte Bender leichtsinnig, beinahe hätte er Herrn Lind im Vorbeigehen eine Münze in die Schokolade geworfen. Ob sie sich heute wieder, nach dem üblichen Begrüßungsstreit, auf ihn setzen würde, auf sein Gesicht, mit vollem Gewicht? Oh! Wie wenig sie in dieser herrlichen Stellung immer zu wiegen schien! Und hinterher würde er ihr aus seinem neuen Luther-Flugblatt vorlesen. Ein prachtvoller Tag wird das! Else war, wie Bender sich gern als erotikfördernde Zauberformel vorsagte, gelernte Schneiderin. Böhmisch-österreichische Herkunft, hochgebundenes Haar, kreischender Nieslaut. Und wenn sie sich streckte: deutlich sichtbare Rippen. Sie hatte als junge Frau in Wien gelebt, jener kuriosen, unernsten Stadt weit im Osten, die sich Bender immer wie eine weihnachtliche, mit Fruchtzucker kandierte Version von Kiew oder St. Petersburg dachte. Sie sorgte für ihren schwachsinnigen Bruder, Bruno, den sie allerdings jedes Mal, wenn Bender zu ihr kam, aus der Wohnung schickte oder im hintersten Zimmer verborgen hielt.
Der Tag war stürmisch, in dunkleren Gassenwinkeln bildeten sich Gespenster. Die Elektrische zog mit ihrem Metallknurren um die Häuser. Bender bog in die Eisbachstraße ein. Die Äpfel im Baum vor Elses Wohnhaus hingen heute so dicht wie die neunundneunzig Namen Gottes. Bender kontrollierte seine Taschen. Dann streifte ihn, als er die Tür mit dem verbotenen Schlüssel aufsperrte, der Schatten einer Krähe. Wie armselig das Leben in der zweiten Dimension sein musste, sah man daran, wie rasch und formelhaft sich solche Vogelschatten bewegten und wie kompliziert und anmutig dagegen das wirkliche Tier.
Im Türspalt: Elses scheues Gesicht. »Ich bringe dir nur den Schlüssel«, sagte Bender. »Ich dachte, ich mache es lieber persönlich.« Er hielt ihn hoch. Sie trat zurück und ließ ihn in die Wohnung. Vertrauter Geruch, nach Kaffee, nach ihr, nach der ziegenartigen Schminke, die sie immer auftrug. Aus dem Nebenzimmer Poltern, rasche Bewegung. Wie sah Else heute aus? Wunderschön. Vielleicht etwas verheult und kampfbereit. Und da: Brunos Stimme. Else ging schnell, begleitet von einem ungeduldigen Schnauben, nach nebenan. Bender hörte ihre Stimme, dann Schritte, dann fiel eine Tür zu, und Stille. Er lächelte. Er steckte sich Elses Wohnungsschlüssel für eine Sekunde in die Nase, drehte ihn dort. Außerdem: wachsende Erregung. Er verbarg sie geschickt vor Else, als diese zurück ins Zimmer kam. Verschränkte Arme, abwartender Blick. »Wollen wir nicht erst einmal auftauen?«, schlug er vor.
Sie hielt die Hand auf. Er legte den Schlüssel hinein.
»Deiner Frau geht es gut, ja?«, fragte Else.
»Danke, sehr gut.«
»Fein.«
»Else, was hast du denn?«
»In den letzten zwei Wochen haben wir uns ganze zwei Mal gesehen! Was bin ich für dich?«
»Wie?«
»Warum kommst du jetzt zu mir?«
»Na, wegen dir …«
»Ich meine, was ist deine Begründung, zu mir zu kommen?«
»Begründung … Aber Else, was sind denn das für profane Kategorien heute.«
Sehr gut, ein Streit! Das führte in den meisten Fällen binnen Minuten zu Erotik. Bender versteckte seine Erregung und tat so, als suchte er, um das Gespräch besser führen zu können, nach einer Sitzgelegenheit im Zimmer: probeweises seitliches Einknicken der Knie, ratloses Sich-Umblicken, hm, alles vollgestellt hier.