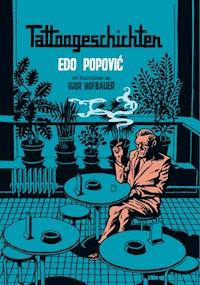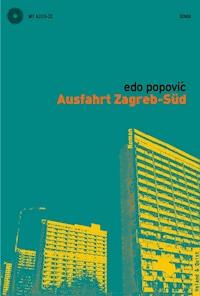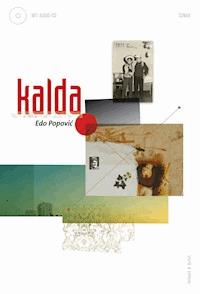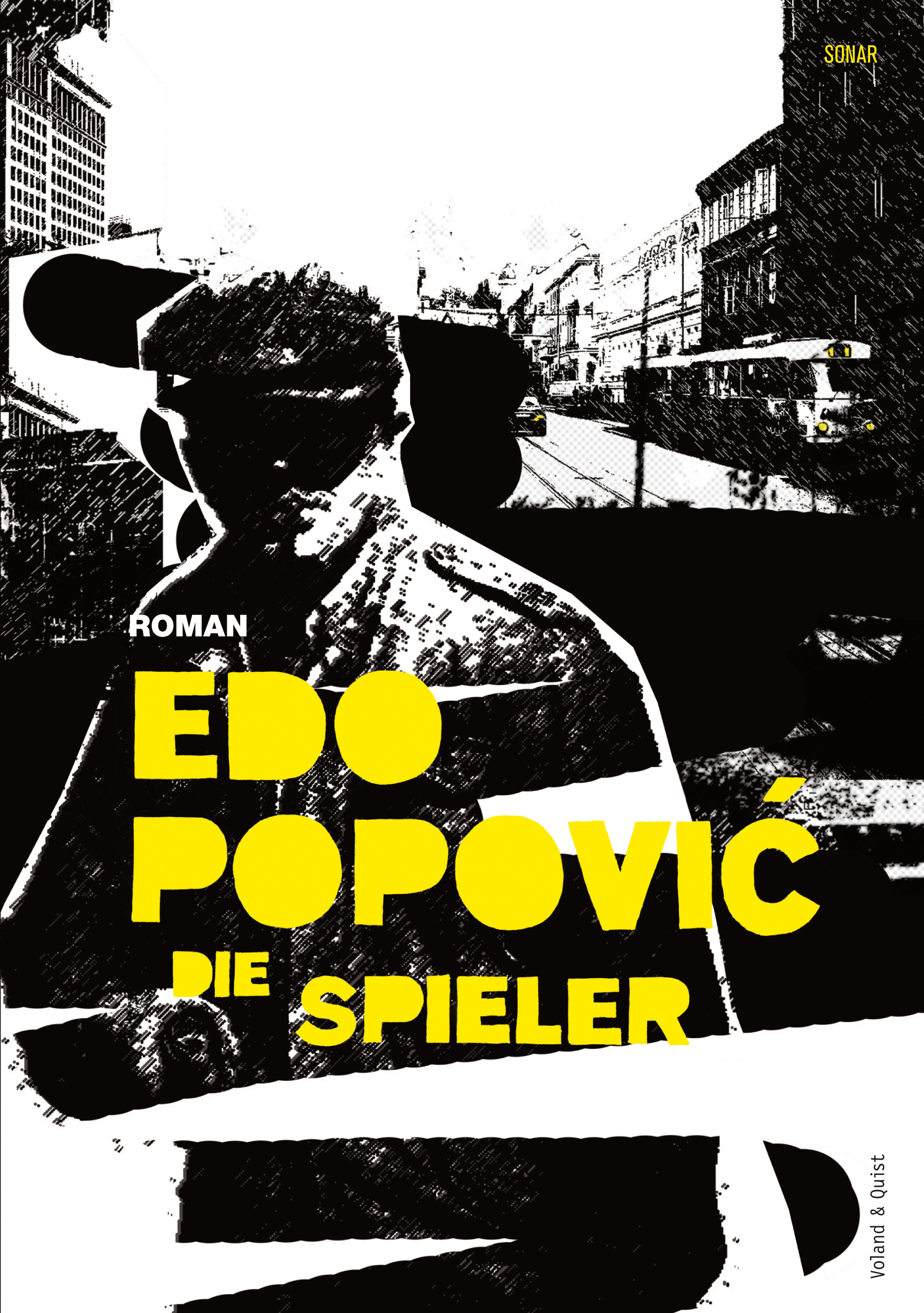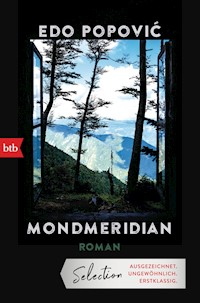
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Erde ist in Aufruhr: Mirko Graf fährt mit dem Zug nach Zagreb, in eine Stadt, die überfüllt ist mit Obdachlosen und Bettlern, Hungrigen und Arbeitslosen. Gut geht es nur den Angepassten und den Reichen. Mirkos Organisation ist auf der Suche nach den »Vergessenen«, Menschen, die angeblich in einem verborgenen Paradies irgendwo in Mitteleuropa leben. In diesem »Paradies« wiederum geht das Gerücht von den »Vergifteten« um, Menschen, die ihre Umwelt völlig zerstört haben. Leben sie alle mit einer Lüge? Kann es ein freies Leben geben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
Mirko Graf fährt mit dem Zug nach Zagreb, in eine Stadt, die überfüllt ist mit Obdachlosen und Bettlern, Hungrigen und Arbeitslosen. Mirkos Organisation ist auf der Suche nach den »Vergessenen«, Menschen, die angeblich in einem verborgenen Paradies irgendwo in Mitteleuropa leben. In diesem »Paradies« wiederum erzählt man sich Geschichten von den »Vergifteten«, Menschen, deren Leben von materieller Gier bestimmt ist, die keine Verbindung zur Natur mehr kennen und ihre Umwelt völlig zerstört haben. Glauben sowohl die einen wie auch die anderen an eine Lüge? Und wer hätte ein Interesse daran? Als geheime Dokumente auftauchen, macht sich Mirko mit zwei Mitstreitern auf in die Berge, um das Tal zu finden, in dem die Vergessenen angeblich abgeschieden von aller Welt leben …
Ein spannender, kompromissloser, visionärer Roman von einem der aufregendsten Schriftsteller aus Osteuropa, der den Menschen ebenso verzweifelt liebt wie die Erde und mit seiner Anti-Utopie grundlegende Fragen stellt: An welchem Punkt sind wir angelangt, und wohin gehen wir? Kann es ein freies Leben geben?
Zum Autor
EDO POPOVIĆ, geb. 1957, lebt in Zagreb. Er war Mitbegründer einer der einflussreichsten Underground-Literaturzeitschriften des ehemaligen Jugoslawiens. 1991 bis 1995 arbeitete er als Kriegsberichterstatter, dessen unideologische Reportagen ebenso angesehen wie gefürchtet wurden. Sein erster Roman »Mitternachtsboogie« avancierte zum Kultbuch seiner Generation. Mit den folgenden Romanen, u.a. »Der Aufstand der Ungenießbaren«, »Ausfahrt Zagreb-Süd« und »Stalins Birne«, seinen Erzählbänden und seinem Essay »Anleitung zum Gehen« wurde Popović zu einem der aufregendsten osteuropäischen Erzähler.
Zur Übersetzerin
ALIDA BREMER, geb. 1959 in Split, Kroatien, lebt seit 1986 in Münster und ist Autorin, Übersetzerin und Kulturvermittlerin zwischen Südosteuropa und dem deutschsprachigen Raum. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt.
Edo Popović bei btb:MitternachtsboogieAusfahrt Zagreb-SüdDie SpielerStalins Birne
Edo Popović
Mondmeridian
Roman
Aus dem Kroatischen von Alida Bremer
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel Mjesečev meridijan bei Naklada OceanMore, Zagreb.Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe Februar 2022
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 2015 Edo Popović
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022 btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © Stocksy/Jovana Milanko
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
CP · Herstellung: sc
ISBN: 978-3-641-22228-4V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Zu fahren in einer Kutsche aus Moos, zu verschwinden im Feuer des Meeres.
Vesna Parun, Reisen entlang des Mondmeridians
– Aber warum glaubt dann jeder an das Gravitationsgesetz?– Massenhypnose. In einer sehr orthodoxen Erscheinungsform als »Schulunterricht« bekannt.
R. M. Pirsig, Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten
Blicke auf die Leere vor deinen Augen.Wie kannst du sie hervorrufen oder ausschalten?
Huang-po, Der Geist des Zen
♠
Züge sind unsere zweite Haut. Während wir reisen, streifen wir sie über und wieder ab. Jemand, der in einen Zug steigt, ist nicht mehr derselbe, wenn er aussteigt, und wie könnte es auch anders sein. Ob wir zur Arbeit fahren, in den Urlaub, Freunde besuchen, wohin auch immer wir fahren, wir ändern uns. Dagegen kann man nichts machen. Das ist wie das Atmen, wie das Schlüpfen eines Schmetterlings, wie der Anak Krakatau, wie der Lauf der Sterne und der Sternbilder und all jene anderen zerbrechlichen, unsteten Dinge. Und dann sagt man, dass der Mensch heute den Schlüssel zum Leben in seinen Händen hält, zu grauen Haaren, zum Tod, dass die Märchen vom Jungbrunnen und dem ewigen Leben Wirklichkeit geworden sind, all diese Themen, die die Verrückten aus den Genetiklaboren laut hinausposaunen. Unsere überlegene Technologie, so sagen sie, und unsere Produkte werden euch die ewige Jugend schenken.
Dass ich nicht lache!
Ich bin der Meinung, dass wir nicht hier sind, um ewig da zu sein, sondern um ein wenig Spaß zu haben und dann abzutreten, um für andere Platz zu machen. Was für ein Gedränge würde hier herrschen, wenn die Menschen nicht sterben würden. Es wäre überfüllt wie in der Straßenbahn zur Hauptverkehrszeit, wir würden uns bis in alle Ewigkeit aneinander reiben und uns gegenseitig ins Gesicht pusten. Auch so treten wir uns schon gegenseitig auf die Füße und steigen übereinander hinweg, statt uns miteinander anzufreunden und das uns geschenkte Leben zu genießen, und wie würde es erst aussehen, wenn wir unsterblich wären? Wer würde sich ein solches Leben wünschen, wer wäre gern ein vakuumverpackter Tintenfisch? Nicht einmal die Berge sind ewig, ich habe zum Beispiel gestern gelesen, dass in Südtirol ein Felsen abgegangen ist. Tausende Tonnen stürzten ins Tal, es wird Tage dauern, bis sich der Staub gelegt hat. Es gab auch Tote. Wo sind jetzt die Herrscher über Leben und Tod, warum beleben sie die Toten nicht wieder, warum reparieren sie den Felsen nicht? Die Geschichten über die Unsterblichkeit betreffen letztlich – sollten sie überhaupt der Wahrheit entsprechen, was ich bezweifele – nur diejenigen, die über einen Haufen Geld verfügen. Nur sie können sich so etwas wie die Ewigkeit leisten, medizinische Versorgung, drei Mahlzeiten am Tag, zusammengesetzt aus gesunden Nahrungsmitteln, und ähnliche Extravaganzen. Von denen ganz zu schweigen, die sich, wenn ihr Herz, ihre Leber oder ein anderes Organ versagen, einfach Ersatz kaufen können von jemandem, der gerade gestorben ist, weil er nicht genügend Geld hatte, um sich zu kaufen, was bei ihm versagt hat. Und was dem Ganzen die Krone aufsetzt, diese Klugscheißer versuchen jetzt, kopflose Klone zu produzieren, die denen, die es sich leisten können, als Reserve dienen. Die dann in einer Speisekammer oder einem Kühlraum, was weiß ich, hängen und darauf warten, dass bei dem Typen irgendwas kaputtgeht. Widerlich. Als wären wir, sagen wir mal, ein Gerät, das sich aus verschiedenen Teilen zusammensetzt, und nicht ein kleines Universum, das seinen eigenen Platz im unendlichen Universum hat, zusammen mit den Tieren, den Pflanzen, den Mineralien, den Wolken, den Gewässern, den Kometen und Sternen, so wie es Leute formuliert haben, die klüger sind als ich. Einige Menschen wissen einfach nicht, wann sie abtreten sollen. Sie verstehen nicht, dass der Tod nicht das Ende des Lebens ist und dass die Geburt nicht das Ende des Todes bedeutet, sondern dass das Leben Leben und der Tod Tod ist, so wie auch der Frühling nicht der Tod des Winters und der Sommer nicht der Tod des Frühlings ist, und dass der, der zu leben versteht, auch weiß, wie man stirbt, denn Leben und Tod gehören zusammen, so war es schon immer.
Mal ganz im Ernst, wer würde sich wünschen, diese Scheiße um uns herum ewig ertragen zu müssen? Ich jedenfalls nicht. Zum Glück habe ich weder das Geld noch die Nerven dazu. Ich habe kaum genug für eine Rückfahrkarte, selbst so eine Zugfahrt ist für Menschen wie mich keine Bagatelle, sondern eine richtige Investition. Ich fahre zum UNKRAUT-Treffen. Ich bin völlig allein in einem Großraumwaggon und lese ein Interview in einer Zeitschrift, die ich auf dem Sitz gefunden habe.
Warum glauben wir, dass der Mensch die Erde und das Leben darauf vorangebracht hat? Genau das Gegenteil ist der Fall, der Mensch ist eine todbringende Bakterie, die Erde würde ohne ihn viel besser funktionieren. Während er in zehntausend Jahren den Weg vom Ackerbauern zum Biotechnologen zurückgelegt hat, zerstörte der Mensch über hunderttausend Tier- und Pflanzenarten. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass die Evolution, indem sie dem Menschen Sprache, Schrift, Werkzeuge und Technologien gegeben hat, die sich am Ende gegen die Menschheit richten werden, sich als ein intelligenter Prozess erweist, den die Erde in Gang gesetzt hat, um den Menschen loszuwerden. Die Evolution ist zugleich der Triumph und der Untergang der menschlichen Gattung.
Der Zug rast durch das breite Tal. Der Morgen ist schon vorangeschritten. An der Bahnstrecke stehen Wildrosenbüsche voller rosaroter Blüten und verrostete Güterwaggons. An einigen Stellen hat Ackerwinde den Drahtzaun verschluckt. Dann der Fluss, das Wasser wirbelt sanft um die grünen und roten Bojen. Das Wasser. Unser tägliches Wasser. Das Wasser des Ozeans, der uns erschaffen hat, aus dem wir gekommen sind, das Wasser in den Kammern unter der gespannten Haut des Bauches, in dem die Föten keimen. Aus Wasser kommen wir, Wasser sind wir und zu Wasser werden wir. Zu Regen, zu Wildwassern, die sich im Frühjahr durch Spalten ins Tal stürzen, zu eisigen, klaren Bächen in ihren Betten aus strahlend weißen Kieselsteinen. Zu Wasser in Steinbecken, an denen Hornvipern durstigen Vögeln auflauern. Es kommt mir in den Sinn, dass Züge der Haut einer Schlange ähneln. Das Gleis entfernt sich vom Fluss. Der Wind kämmt die Kronen der Trauerweiden und Pappeln, durch die man das Wasser erahnt. Das Wasser kräuselt sich und schillert, dann verschwindet es aus meinem Blick.
Ich spüre ein Kribbeln in den Beinen. Ich stehe auf, mache einige Kniebeugen und gehe in das Zugrestaurant. Nur zwei Fahrgäste, jeder an seinem Tisch an den entgegengesetzten Seiten des Waggons, damit sie bloß nicht der Versuchung erliegen, ein Gespräch zu beginnen und sich näherzukommen. Die Frau ist in ihren Laptop vertieft, der Mann starrt auf sein Handy. Aus den Lautsprechern, die in der Decke des Waggons versteckt sind, tröpfelt Musik, eine Schnulze, irgendein Typ jammert, er sei müde, müde, müde – müde davon, seinen Träumen hinterherzurennen, so sagt er.
Kaum ist er geboren, schon ist er müde.
Nicht von schwerer Arbeit,
nicht von der Suche nach Arbeit,
nicht vom Mangel an Geld,
oder von den schlaflosen Nächten voller Sex und Alkohol,
sondern davon, dass er seinen Träumen hinterherrennt.
Was für ein Mist.
Ich stehe an der halbrunden Theke. Der Kellner ist in einen Vorratsraum verschwunden, ich höre ihn dort herumrascheln. Es dauert eine Zeitlang, bis er sich zu mir schleppt und ich eine Tasse heißes Wasser bestellen kann.
»Nein danke«, sage ich, »ich möchte keinen Teebeutel, nur das heiße Wasser.«
»Ich werde Ihnen trotzdem den Tee berechnen müssen«, sagt er.
»Ich weiß«, sage ich, »aber ich will keinen gentechnischen Scheiß trinken, in den man wahrscheinlich Rattengene oder was Ähnliches eingebaut hat, um das Wachstum zu beschleunigen, so dass man jede Woche Tee ernten kann.«
Er sagt, dass sie auch Tee aus biologischem Anbau anbieten. Ich antworte, dass es eine Sache sei, was auf der Tüte stehe, und eine ganz andere, was wirklich drin sei. Der Kellner lächelt säuerlich. Hundertpro denkt er, dass er nicht dafür bezahlt wird, irgendwelchen Idioten zuzuhören, die ihm blödsinnige Lektionen erteilen. Er denkt bestimmt, dass ich mich mitsamt dem beschissenen Tee zum Teufel scheren soll.
Ich gehe zurück zu meinem Platz und werfe eine Mischung aus Bergkraut, Minze und Schafgarbe in das heiße Wasser. Das Wasser verfärbt sich blassgrün. Der Zug fährt durch eine Ebene mit wogenden Feldern. Am Horizont ein Windpark. Am tiefhängenden Himmel ziehen sich schmutzig graue Wolken zusammen.
Ich trinke den Tee und denke über das Treffen nach, zu dem ich fahre. Die Kommune UNKRAUT wurde vor fast dreißig Jahren gegründet, zu der Zeit, als die großen Konzerne ein Auge auf das Wasser geworfen hatten. Lange Zeit haben wir damals Lärm geschlagen, die Menschen aufgerüttelt, die abgezäunten Quellen und Abfüllanlagen besetzt. Alles vergeblich. Das Wasser wurde den Menschen geraubt. Erde und Luft wurden ihnen schon viel früher genommen.
Und dennoch kann man die Aktivitäten unserer Kommune nicht als völlig verfehlt betrachten. Wir glaubten, es sei wichtig zu tun, was wir für richtig hielten, ohne uns darum zu scheren, ob wir erfolgreich waren oder nicht. Erfolg kann sowieso nicht garantiert werden und ist deshalb im Grunde unwichtig. Die Schönheit des Tuns liegt schließlich nicht im Ergebnis, sondern im Tun selbst. Vom Kampfgeist der Kommune ist nicht viel übrig geblieben, heute beschäftigen wir uns vorwiegend mit publizistischer Arbeit und mit biodynamischer Landwirtschaft. Das Treffen, zu dem ich fahre, wurde einberufen, weil wieder eine Nachricht über die Vergessenen eingetroffen ist. Das sind Menschen, die angeblich in einem vergessenen Paradies irgendwo in Mitteleuropa leben, sie trinken Wasser aus Bächen, sie beackern nicht die Erde, sondern ernähren sich von wilden Früchten und Tieren. Mir stinkt die Geschichte, natürlich stinkt sie mir, die Menschen haben ihre Nase schon längst in die entlegensten Ecken der Erde gesteckt und ihre diebischen Finger hineingeschoben, und dass es jetzt einen verborgenen Ort geben soll, und zwar mitten in Europa, an dem wilde und freie Menschen leben sollen – na, so naiv bin ich dann doch nicht.
An der nächsten Station steigt eine Gruppe Kinder mit ihrer Lehrerin ein. Die Kinder sind ruhig, sie steigen ein und setzen sich in aller Stille und bleiben auch genauso still sitzen und blicken vor sich hin, als hätte man bei ihnen den Ton abgestellt. Ich höre allerdings nach einiger Zeit die Lehrerin. Sie erzählt ihnen etwas über ein Museum, das sie besuchen werden. Und dass sie dort sehen werden, wie die Menschen im zwanzigsten Jahrhundert mit ihren primitiven Technologien beinahe unseren Planeten zerstört hätten. Sie ist jung, sie sieht ausgezeichnet aus, Beine, Arsch, Titten, Gesicht, Augen, alles prima an ihr, nur ihren Blick kann ich nicht einfangen. Und was wäre schon, wenn ich ihn einfangen würde? Was würde passieren? Gar nichts. Ich würde nur eine spöttische Grimasse ernten, vermutlich nicht einmal das. Spott ist auch ein Gefühl, und Gefühle gehören heute zu den bedrohten Arten, wenn ich mich einmal so ausdrücken darf. Deshalb spüre ich in meinen Eingeweiden, in meinem Herzen, in meiner Unterhose keinen Energieschwall, keine Regung.
Der Zug fährt durch einen Vorort, durch Reihen von vierstöckigen Häusern mit Flachdächern, eins wie das andere, aber verschiedenfarbig angestrichen. Hinter den Häusern erstreckt sich eine weitere Reihe solcher Gebäude, und dann noch eine und noch eine. Aus dem Meer der vierstöckigen Häuser ragt eine Betonsäule in die Höhe, ein Träger für eine riesige Werbetafel. Darauf blitzen gerade rote Buchstaben auf: INDERQUANTITÄTSTECKTDIEQUALITÄT. Da bin ich also wieder angekommen in der virtuellen Welt. In der Welt der Trugbilder und der Gier.
Das lausige Zagreb, gibt es irgendjemanden, der diese Straßen je reinigt? Ein warmer Wind weht und bläst mir Staub in die Augen. Ich laufe gegen den Wind und blicke durch Augenschlitze, wobei ich den Kopf zur Seite wende. Ich bin dumm, weil ich nicht die Straßenbahn genommen habe, aber andererseits habe ich genug Zeit, und es schadet nichts, sich nach der Zugfahrt ein wenig die Beine zu vertreten. Das Treffen findet in dem Gebäude statt, in dem sich eine Suppenküche und ein Obdachlosenheim befinden. Eine halbe Stunde zu Fuß vom Hauptbahnhof. Es gibt viele Bettler auf den Straßen, ich habe den Eindruck, dass es mehr sind als beim letzten Mal. Alle paar Meter eine ausgestreckte Hand, ein Hut, ein Pappkarton oder eine Tasse und die Aufschrift: ICHHABEHUNGER. Oder: ARBEITSLOS. Oder: HELFENSIEMIR. Oder etwas Ähnliches. »Mein Herr, bitte hören Sie mich an …«, »Erbarmen Sie sich, mein Herr!« Ich war schon ein Jahr nicht mehr hier, hinreichend lange, dass man das alles vergisst. Ich lebe auf dem Land, mein Dorf gehört gewiss nicht zu den tausend begehrenswertesten Reisezielen auf der Erde, aber dort gibt es zumindest keine hungrigen Menschen. »Gehen Sie nicht einfach an mir vorbei«, sagt eine Frau mit einem Kind im Arm, die an der Wand eines Supermarktes lehnt.
Ich wende den Blick ab, obwohl ich jetzt mit dem Wind laufe. Ich hasse mich selbst, aber ich hasse auch sie. Warum stürzt sie sich bei so vielen Passanten ausgerechnet auf mich? Sie soll ihre Verzweiflung und ihren Hunger den anderen unter die Nase reiben. Zum Teufel mit ihr und ihrem Bastard. Ich betrete eine türkische Imbissbude. Im Schaufenster steht GMO-free.
»Was darf es sein?«, sagt der Mann hinter dem Tresen. »Alles ist sauber und natürlich. Das Gemüse ist heute früh in einem Garten in der Ägäis gepflückt worden, die Lämmer haben noch gestern auf anatolischen Steppen geweidet und sind dort herumgesprungen.«
Was für ein Lügner. Die Lämmer sind eigentlich Schafe, und die anatolischen Steppen haben sie vor wer-weiß-wie-vielen Jahren gesehen. Ihr gefrorenes Fleisch wurde heute Morgen aus dem Kühlwagen geholt, genauso wie das Gemüse. Wo sind jene Zeiten geblieben, in denen man in dieser Stadt Lammfleisch aus Bukovica, Gorski Kotar, von der Insel Pag oder von den Kornaten essen konnte und als das Gemüse der Saison aus Ravni Kotari ein Must-eat war? Ich nehme nur ein Stück Fladenbrot und gehe, ohne zu grüßen. Ich höre, wie der Mann etwas hinter mir herruft.
Es ist einfach, die Bettler abzuschütteln, ihnen aus dem Weg zu gehen, aber wie kann man die Erinnerung an sie abschütteln, wie kann man die Ohren verschließen vor der flehenden Stimme, die mir immer noch im Kopf nachhallt? Ich gehe zurück in die Imbissbude und bestelle einen Dürüm Döner.
»Ich wusste, dass du zurückkommen wirst«, sagt der Mann.
»Angesichts deiner außerordentlichen hellseherischen Fähigkeiten ist es ein wahres Wunder, dass du in dieser Kaschemme hängengeblieben bist«, antworte ich.
»Was nimmst du dazu?«, fragt er trocken.
»Alles«, sage ich.
Ich achte darauf, dass er nach alldem nicht in meinen Kebab spuckt, während er ihn zubereitet. Man kann alles Mögliche von Menschen erwarten, an deren Ego man gerüttelt hat. Ich beobachte abwechselnd sein Gesicht und die Metallbehälter mit den Beilagen, in die metallene Zähne greifen, sie schnappen das klein geschnittene Gemüse und schieben es in das Fladenbrot. Nun gehe ich zurück zu der Bettlerin mit dem Kind, ich bücke mich und reiche ihr den Kebab und einige Geldstücke.
»Ich hoffe, dass Sie keine Vegetarierin sind«, sage ich, ohne zu wissen, warum.
Sie sagt nichts, sie nimmt den Döner, wobei sie mir ruhig in die Augen schaut, keine Spur der flehenden Show von zuvor. Aber jetzt ist Trauer in ihnen zu erkennen. Und wer wird diesen Hunger stillen? Wer könnte ihre ausgehungerte Freude sättigen?
Danach fühle ich mich keinen Deut besser und auch nicht edler. Ich bin weiterhin ein gewöhnliches, heuchlerisches Scheusal. Mit meiner Geste habe ich nichts verändert, die Frau wird auch weiterhin an den meisten Tagen des Jahres hungrig sein, ich werde trotz allem immer etwas im Magen und in meiner Tasche haben, diese Welt wird ein grausamer, feindseliger Ort bleiben, und es gibt keine Barmherzigkeit und keine Wohltäter, die irgendetwas daran ändern könnten. Es gibt einen Überfluss, der einfach widerlich ist, den Überfluss der Supermärkte, vor denen die Hungrigen betteln. Und die Barmherzigkeit unterstreicht nur die Pervertiertheit der menschlichen Welt. Ich erinnere mich daran, wie es vor einiger Zeit populär war, Geld für schwerkranke Kinder zu sammeln, deren Eltern die Kosten der medizinischen Behandlung nicht aufbringen konnten. Doch es gab immer mehr Kranke als Geld, die Nachfrage war größer als das Angebot, und die Wohltätigkeit florierte. Kaum jemand fragte sich, woher all diese Krankheiten kommen, warum die Medikamente und die Behandlungen so teuer sind, warum alles so eingerichtet ist, dass eine medizinische Behandlung ein Privileg der Reichen ist. Was für eine beschissene Welt ist das nur, in der Leben und Tod von einer Tombola und vom fremden guten Willen abhängen? Eine ziemlich dumme Frage natürlich, denn das geht schon seit Menschengedenken so.
Die Armut, der Hunger und die Krankheiten sind keine negativen Begleiterscheinungen dieser Welt, sie gehören zu ihrem Wesen. Und deswegen werden sie unablässig produziert und gepflegt.
Das Betteln war einst – so erinnere ich mich – entweder Philosophie oder eine Arbeit, es gab nur wenige, die aus reiner Bedürftigkeit bettelten, so wie diese Menschen hier. Ich gehe durch ein Spalier von ausgestreckten Händen und kann jetzt nicht sagen: Hört mal zu, Freunde, mal halblang, ich habe einer eurer Kolleginnen einen Kebab gekauft und etwas Kleingeld gegeben, aber wenn ich euch allen helfen soll, dann werde ich selbst hungern müssen. Mich überkommt schlechte Laune, und ich werde nervös, und deshalb erinnere ich mich jetzt an jene Tage, an denen man nicht aus Not bettelte, sondern aus philosophischer Überlegung oder als Business. Es gab nie viele Bettler-Philosophen. Es waren Schnorrer, die dem bürgerlichen Leben bewusst den Rücken gekehrt hatten und in Kellern, verlassenen Gebäuden, auf Bürgersteigen und unter Brücken lebten; heute gibt es sie beinahe nicht mehr, sie sind zusammen mit der menschlichen Güte, der Freundlichkeit und Barmherzigkeit von der Bildfläche verschwunden. Was das Business betrifft, das waren gut durchorganisierte Firmen und Familienbetriebe, man arbeitete Tag und Nacht, auf der Straße, in Restaurants und Cafés, nur in den Shoppingcentern, in denen das Betteln verboten war, konnte man damit rechnen, in Ruhe gelassen zu werden, nur dort wurde man nicht von den ausgestreckten Händen belästigt. Obwohl mich die Verbraucherparadiese anwiderten und obwohl ich nie etwas darin gekauft habe, ergab es sich manchmal, dass ich in Versuchung geriet, vor allem in Momenten, in denen mir buchstäblich nach jedem Schluck Kaffee auf einer der Terrassen im Zentrum der Stadt eine Hand oder ein Zettel mit der Ausschrift TAUBSTUMMEWAISE unter die Nase gehalten wurde, es geschah also, dass ich in Versuchung geriet, aufzustehen und in das nächste Shoppingcenter zu fliehen, mich dort in ein Café zu setzen, um endlich, nach so vielen Belästigungen durch die Bettler, in Ruhe den verdammten Kaffee auszutrinken.
O mein Gott, wie sehr es hier stinkt. VonwokommtdieserGestanknur, fragte Gabriel gereizt. So beginnt ein urkomischer Roman aus dem vergangenen Jahrhundert, der mir sehr ans Herz gewachsen ist. Derartige Romane werden leider seit langer Zeit nicht mehr geschrieben. Der Gedanke daran lockt mir ein Lächeln ins Gesicht. Hier ist es allerdings ganz klar, woher der Gestank kommt. So wie es auch klar ist, dass nicht die Bewohner und Passanten die Ursachen des Gestanks sind, sondern der Bürgermeister. Probleme mit der städtischen Mülldeponie hat es in Zagreb schon gegeben, als ich noch ein Kind war. Der Bürgermeister verhinderte die Mülltrennung und den Bau einer neuen Mülldeponie, man sprach damals viel darüber, und es gab auch viel Lärm darum. Der gesamte städtische Abfall wurde an einer Stelle gesammelt, direkt am östlichen Rand von Novi Zagreb. Und jedes einzelne Ding, dass die Zagreber kauften und nicht aßen oder ausschieden, endete dort. Der Müllberg wuchs von Tag zu Tag, und meine Eltern scherzten manchmal, dass die Zagreber Alpen bald höher sein würden als der Berg Medvednica. Die Alpen wuchsen und stanken, und als ich in die Pubertät kam, war die Genehmigung für die Deponie schon längst abgelaufen, aber aus unbekannten Gründen war keine neue Mülldeponie angelegt worden. Wir wohnten damals im Stadtteil Utrine, und jedes Mal, wenn der Südostwind den stark säuerlichen Geruch dieser Alpen herüberwehte, rümpften meine Eltern die Nase, schmunzelten und sagten: Oh, da sind Sie ja wieder, Herr Bürgermeister. Seien Sie gegrüßt.
Wenig später biege ich in die Adžija-Straße ein und erblicke aus der Ferne die Schlange vor der Suppenküche. Noch einige Stunden bis zum Mittagessen, aber trotzdem stehen die Menschen schon in der Schlange. Ähnlich wie bei den Kranken und dem für ihre Behandlung gesammelten Geld gibt es mehr hungrige Mäuler als Portionen. Einige der Wartenden werden bestimmt heute hungrig bleiben.
♣
Mila träumt. In ihrer Wohnung, ganz oben, in der dreißigsten Etage eines Wolkenkratzers, liegt sie auf einer Matte aus Stroh von bioorganisch angebautem Reis und träumt. Das Schlafzimmer ist nach Osten ausgerichtet, die Außenwand des Raumes ist aus photosensitivem Isoglas gefertigt. Wäre sie wach, würde Mila sehen, wie eine riesige Sonne in der Farbe einer Roten Beete gerade aus einem schmutzigen Band am Horizont aufsteigt. Gewöhnlich ist sie um diese Zeit wach, betrachtet die Morgendämmerung, macht dann Yogaübungen, duscht sich und trinkt anschließend ein Glas Tee. Sie frühstückt später, meist in der Studentenkantine. Doch Mila schläft noch und träumt, während sie im Schlaf ab und zu zuckt. Sie träumt von einer Stimme. Die Stimme erzählt:
Seht! Nun fangen wir an. Wenn wir am Ende der Geschichte sind, wissen wir mehr als jetzt, denn es war ein böser Kobold! Er war einer der allerärgsten, er war der Teufel! Eines Tages war er recht bei Laune, denn er hatte einen Spiegel gemacht, welcher die Eigenschaft besaß, dass alles Gute und Schöne, was sich darin spiegelte, fast zu nichts zusammenschwand, aber das, was nichts taugte und sich schlecht ausnahm, hervortrat und noch ärger wurde. Die herrlichsten Landschaften sahen wie gekochter Spinat darin aus, und die besten Menschen wurden widerlich oder standen auf dem Kopfe ohne Rumpf; die Gesichter wurden so verdreht, dass sie nicht zu erkennen waren, und hatte man eine Sommersprosse, so konnte man überzeugt sein, dass sie sich über Nase und Mund ausbreitete. Das sei äußerst belustigend, sagte der Teufel. Fuhr nun ein guter frommer Gedanke durch einen Menschen, dann zeigte sich ein Grinsen im Spiegel, so dass der Teufel über seine künstliche Erfindung lachen musste. Die, welche die Koboldschule besuchten – denn er hielt Koboldschule –, erzählten überall, dass ein Wunder geschehen sei; nun könnte man erst sehen, meinten sie, wie die Welt und die Menschen wirklich aussähen. Sie liefen mit dem Spiegel umher, und zuletzt gab es kein Land und keinen Menschen mehr, welcher nicht verdreht darin gesehen wurde. Nun wollten sie auch zum Himmel selbst auffliegen, um sich über die Engel und den lieben Gott lustig zu machen. Je höher sie mit dem Spiegel flogen, umso mehr grinste er; sie konnten ihn kaum festhalten; sie flogen höher und höher, Gott und den Engeln näher; da erzitterte der Spiegel so fürchterlich in seinem Grinsen, dass er ihnen aus den Händen rutschte und zur Erde fiel, wo er in hundert Millionen, Billionen und noch mehr Stücke zersprang. Und nun gerade verursachte er weit größeres Unglück als zuvor, denn einige Stücke waren kaum so groß wie ein Sandkorn; diese flogen nun in die weite Welt, und wo jemand sie ins Auge bekam, da blieben sie sitzen, und da sahen die Menschen alles verkehrt oder hatten nur Augen für das Verkehrte bei einer Sache; denn jede kleine Spiegelscherbe behielt dieselben Kräfte, welche der ganze Spiegel besessen hatte. Einige Menschen bekamen sogar eine Spiegelscherbe ins Herz, dann aber war es ganz entsetzlich; das Herz wurde einem Klumpen Eis gleich. Einige Spiegelscherben waren so groß, dass sie als Fensterscheiben verwendet wurden; aber durch diese Scheiben taugte es nicht, seine Freunde zu betrachten; andere Stücke kamen in Brillen, und dann ging es nicht gut, wenn die Leute diese Brillen aufsetzten, um recht zu sehen und gerecht zu sein; der Böse lachte, dass ihm der Bauch wackelte, und das kitzelte ihn so angenehm. Aber draußen flogen noch kleine Glasscherben in der Luft umher …
Schon seit geraumer Zeit träumt Mila von dieser Stimme, sie war noch ein kleines Mädchen, als sie diesen Traum zum ersten Mal hatte. Sie erwachte, starr vor Angst und konnte danach lange nicht wieder einschlafen. Am Morgen erinnerte sie sich nicht mehr daran, was die Stimme erzählt hatte, nur die Angst war geblieben. Doch sie erzählte ihrem Vater nichts darüber und auch niemand anderem, irgendwie spürte sie, dass sie es für sich behalten musste. Seitdem besuchte diese Stimme sie häufig in ihren Träumen. Mila gewöhnte sich an sie, und immer häufiger erinnerte sie sich daran, wovon die Stimme gesprochen hatte. Einmal fragte sie sie:
Wer bist du?
Wenn die Zeit reif ist, wirst du es erfahren, antwortete die Stimme.
Mila erwacht schweißgebadet, obwohl die Temperatur und die Feuchtigkeit im Zimmer optimal eingestellt sind; die Klimaanlage funktioniert tadellos, doch einige Schweißtropfen glitzern auf ihrer Oberlippe. Sie wendet ihren Kopf zum Fenster. Sie ist erleichtert, denn die Scheibe ist heil und dort, wo sie hingehört. Warum hat sie bloß geglaubt, sie wäre zerborsten? Ach ja, der Traum. Was für eine schlimme Geschichte. Nur das Böse zu sehen, einen Eisklumpen zu haben, dort, wo das Herz sein sollte, wer würde gern in einer solchen Welt leben? Die Stimme hatte übertrieben. Bisher hatte sie noch nie eine solche Geschichte erzählt. Sie setzt sich auf der Matte auf und räkelt sich. Die Sonne steht ziemlich hoch, es ist vielleicht schon acht Uhr. In ihrem Schlafzimmer gibt es keine Uhr. Sie will nicht, dass sie durch irgendetwas an die Zeit erinnert wird. Außerdem sind Stunden sowieso ein Phantasieprodukt, denkt sie, in der Natur kommen sie gar nicht vor, genauso wie es in der Natur keine Tage und keine Monate gibt, und deshalb vertraut sie lieber ihrem inneren Zeitgefühl. Ihr Vater, Zoran Salar, verzieht immer das Gesicht, wenn das Gespräch auf die Zeit, die Natur und ähnliche Dinge kommt. Er betrachtet Mila als einen Sonderling, wie kommt sie bloß auf solche Ideen, wo hat sie sie aufgeschnappt?
»Nirgendwo«, sagt sie. »Ich weiß das einfach, ich spüre es, alles ist hier«, sie tippt mit dem Finger an ihre Stirn und ihre Brust.
Ihr Vater schüttelt den Kopf, er hat ihren Aikido-Lehrer in Verdacht.
Sie erinnert sich daran, wie ihr Vater einmal wütend geworden war, als sie sich über den Wald unterhielten. Sie saßen auf der Terrasse seiner Villa in Tuškanac, bei der die Architekten das Hightech-Innenleben eines Raumschiffs in eine Hülle aus der Epoche der Sezession gequetscht hatten – so beschrieb Mila ihre Leistung hämisch. Sie hasste dieses Haus voller teurer Fliesen, vergoldeter Wasserhähne und Designermöbel, jedes einzelne Stück, von dem schrecklichen Steinway-Flügel aus Rosenholz aus dem Jahr 1870 – erstanden auf einer Auktion in Hamburg, nie spielte jemand darauf, er diente nur zum Abstellen von Gläsern und Flaschen bei Partys – bis hin zu den Mülleimern, alle Gegenstände schrien ICHBINTEUERUNDICHBINETWASBESONDERES, Mila war erleichtert gewesen, als sie endlich sechzehn geworden war, was nach der Vorstellung ihres Vaters genügte, um in eine eigene Wohnung überzusiedeln, während sie glaubte, dass sie schon mit dreizehn reif genug gewesen wäre, dieses Haus zu verlassen. Als sie also einmal die alten Eichen im Garten der Villa betrachtete, kam das Gespräch auf das Thema Bäume und Wald. Für ihren Vater war ein Baum nur ein Rohstoff, Material, aus dem man Bretter, Möbel, Fußböden herstellen kann …
»Siehst du nicht auch die Schönheit der Bäume?«, fragte Mila.
»Schönheit?« Er lachte verächtlich auf, als wäre der Begriff der Schönheit ein dummer jugendlicher Irrtum, den man abschütteln muss – je früher, desto besser.
»Ja«, sagte sie. »Außerdem sind die Bäume ein Heim für Vögel, Eichhörnchen, Würmer, Spinnen und andere Lebewesen, ist es nicht so?«
»Wo hast du bloß diesen ganzen Blödsinn her?«, sagte er aufgebracht. »Der Wald ist dazu da, genutzt zu werden, eventuell noch, um darin einen Spaziergang zu machen, wenn wir die Zeit dazu haben.«
»Das ist kein Blödsinn«, sagte sie, »was meinst du« – sie zeigte auf die Eichen –, »wozu dienen die Bäume in der Stadt? Nach deiner Vorstellung bieten diese Eichen tagsüber Schatten, aber auch das nur, wenn es sonnig ist. Was bieten sie nachts? Wenn man die Anzahl der bewölkten Tage im Jahr berücksichtigt, dann sind die Bäume im Grunde überflüssig, sie nehmen nur Platz weg. Warum fällst du sie also nicht und machst daraus was weiß ich was?«
Ihr Vater lief rot an und sprang vom Tisch auf, sie hatte ihn noch nie so erlebt.
»Du redest … Du bist genauso wie …«, er winkte ab.
»Wie wer?«, fragte sie, wobei sie ihm direkt in die Augen blickte.
Aber er rannte von der Terrasse und ließ sie ohne Antwort zurück.
Und jetzt, während sie duscht, ihre morgendlichen Yogaübungen hat sie übersprungen, fällt ihr dieses Gespräch mit dem Vater auf der Terrasse wieder ein, und sie fragt sich, was er wohl dachte, als er sagte, sie wäre genauso wie irgendjemand, ohne dann auf ihre Nachfrage zu antworten. Hat vielleicht auch sie eine Mutter?
Wie alle Kinder aus ihrer Gesellschaftsschicht, aus jener Minderheit, der es an nichts fehlt und die fast im Überfluss erstickt, ist auch Mila durch künstliche Befruchtung entstanden, und sie war lange Zeit davon überzeugt, dass sie nur einen Vater hat. Von diesen Kindern sagt man, dass sie nicht geboren, sondern erschaffen seien. Aber dann träumte sie eines Nachts von einer Frau. Das Gesicht der Frau war ihr entglitten. Nach dem Aufwachen konnte sie sich nicht mehr daran erinnern. Es sind nur kleinste Fragmente in ihrem Gedächtnis zurückgeblieben, sie gehen durch einen Park spazieren, die Frau hält ihre Hand, die Hand der Frau fühlt sich warm an. Im zweiten Traum legt Mila ihren Kopf in den Schoß der Frau, die Frau streichelt sie, oder sie sitzen am Ufer eines klaren Bachs und essen winzige Pfirsiche, die Mila nie zuvor gesehen hat, der Geschmack des Obstes blieb an diesem Tag noch lange in ihrem Mund. Und dann hörte sie im Traum eine Stimme. Die Stimme sagte: Ich bin deine Mutter, Mila.
Nachdem sie angezogen ist, ruft Mila ihren Vater an und sagt, dass sie gern mit ihm frühstücken würde. Sie treffen sich in der Cafeteria gegenüber des Gebäudes der Firma SalarLab, die ihrem Vater gehört.
»Welchem Umstand verdanke ich diese Ehre?«, fragt er sie, nachdem die Kellnerin das Frühstück für Mila und eine Tasse Kaffee für den Vater vor ihnen abgestellt hat; er habe schon gefrühstückt, hatte er gesagt.
Mila fragt, wo ihre Mutter ist.
Ihr Vater blickt sie erstaunt an.
»Wie bitte?!«
»Wo ist meine Mutter?«, wiederholt Mila.
»Du hast keine Mutter«, antwortet der Vater verächtlich. »Du hast nur mich, so wie es sich für Menschen wie uns gehört.«
»Warum?«, fragt Mila.
»Warum, warum? Weil wir jeder nur einen Elternteil haben. Entweder eine Mutter oder einen Vater. Tiere und gewöhnliche Menschen haben beide Elternteile. Nur sie vermehren sich durch Paarung. Einst haben sich alle Menschen so vermehrt, aber zum Glück sind diese Zeiten vorbei.«
»Warum zum Glück?«, fragt Mila.
»Mein Gott, wie anstrengend du sein kannst. Die Paarung ist ein primitiver Vorgang, animalisch«, sagt der Vater und tut so, als müsse er sich übergeben. »Außerdem gibt es viele Krankheiten und andere Komplikationen, die einen Fötus im Unterleib, im Dunkel des Bauches ereilen können, fern von den Augen der Ärzte und der Biotechnologen, die sich darum kümmern, dass alles in Ordnung geht. Eigentlich bist du groß genug, damit ich dir zeigen kann, wo die Kinder gemacht werden.«
Nach dem Frühstück geht der Vater mit Mila ins Gebäude von SalarLab, und zwar in die Abteilung mit den Inkubatoren.
♥