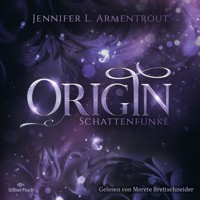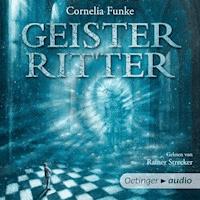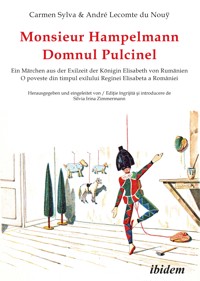
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Schriftenreihe der Forschungsstelle Carmen Sylva Fürstlich Wiedisches Archiv
- Sprache: Deutsch
In mehreren Märchen der Königin Elisabeth von Rumänien (1843-1916), die sie unter dem Künstlernamen Carmen Sylva veröffentlichte, finden sich autobiografische Aspekte, die an tragische Ereignisse aus dem Leben der ersten Königin von Rumänien und Gemahlin des Königs Carol I. von Rumänien erinnern: der Verlust des einzigen Kindes, die weitere Kinderlosigkeit, das Fehlen eines Thronerben für die Dynastie des Landes und das Exil der Königin in den Jahren 1891 bis 1894. Vor allem die Verbannungszeit war für die Königin in großem Maße von Leid, Verbitterung und dem Hadern mit dem eigenen Schicksal geprägt – davon legen einige literarische Texte und die Briefe aus dieser Zeit Zeugnis ab. Das Märchen Monsieur Hampelmann ist eine einfühlsame Parabel über Liebe und Hingabe, über die Bitternis der Verachtung auf der Erde und die Belohnung der schönen Seele, die in den Himmel erhöht wird. Zugleich stellt das Märchen eine literarische Verarbeitung der Exilzeit der Königin dar, indem der Märchenheld zum Alter Ego der Königin wird, der Freude schenken will und dessen Großzügigkeit bis zur Selbstaufopferung führt. În mai multe poveşti ale Reginei Elisabeta a României (1843-1916), publicate sub pseudonimul artistic Carmen Sylva, sunt împletite elemente autobiografice care amintesc de evenimente tragice ale destinului primei regine a României, soţia Regelui Carol I al României: moartea unicului copil, căsnicia fără de copii, lipsa unui moştenitor pentru dinastia ţării şi exilul reginei din anii 1891-1894. Îndeosebi în anii exilului, regina a fost profund marcată de suferinţă şi amărăciune şi de îngrijorare asupra propriului destin, după cum stau mărturie textele literare şi epistolare păstrate din această perioadă. Povestea Domnul Pulcinel este o duioasă parabolă despre dragoste şi devotament, despre amărăciunea desconsiderării pe pământ şi despre răsplătirea frumuseţii sufletului înălţat la cer. În acelaşi timp, povestea este o prelucrarea literară a experienţei exilului, în care eroul din poveste devine un alter-ego al reginei, dornică să aducă bucurie şi a cărei mărinimie merge până la jertfa de sine.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ibidem-Verlag, Stuttgart
Silvia Irina Zimmermann (Hg.)
Carmen Sylva & André Lecomte du Nouÿ
MONSIEUR HAMPELMANN
DOMNUL PULCINEL
Schriftenreihe der
FORSCHUNGSSTELLE CARMEN SYLVA
FÜRSTLICH WIEDISCHES ARCHIV
Herausgegeben von
Silvia Irina Zimmermann
Hans-Jürgen Krüger
Edda Binder-Iijima
Ralf Georg Czapla
Band 5
Die Schriftenreihe versteht sich als Publikationsforum der Forschungsstelle Carmen Sylva des Fürstlich Wiedischen Archivs Neuwied. Ziel ist es, die wissenschaftliche Beschäftigung mit Elisabeth zu Wied, der ersten Königin von Rumänien und Schriftstellerin Carmen Sylva, zu fördern. Die Bände der Forschungsstelle Carmen Sylva, die in loser Reihenfolge erscheinen, sollen neue Brücken in der interdisziplinären und interkulturellen Carmen-Sylva-Forschung schlagen und die Forschungsergebnisse einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen.
Silvia Irina Zimmermann (Hg.)
Carmen Sylva & André Lecomte du Nouÿ
MONSIEUR HAMPELMANN
DOMNUL PULCINEL
Ein Märchen aus der Exilzeit
der Königin Elisabeth von Rumänien (Carmen Sylva)
mit Illustrationen des Hofarchitekten André Lecomte du Nouÿ
O poveste din timpul exilului
Reginei Elisabeta a României (Carmen Sylva)
ilustrată de arhitectul Casei Regale André Lecomte du Nouÿ
1.
Königin Elisabeth im Exil (Hotel Danieli, Venedig, im August 1891). Buchdruck in:
Regina Elisabeta în exil (Hotel Danieli, Veneţia, august 1891). Fotografie imprimată în:
Elizabeth Burgoyne: Carmen Sylva. Queen and Woman, London: Eyre & Spottiswoode, 1941.
Inhaltsverzeichnis
Title Page
„Es war einmal eine gute Königin“ – Das Exil der Königin Elisabeth von Rumänien und seine literarische Verarbeitung im Märchen
„Das Märchen von der hilfreichen Königin” – eine Art Mythos der Königin Elisabeth
„Monsieur Hampelmann” – ein Märchen aus der Exilzeit der Königin
Jean-Jules-Antoine oder André Lecomte du Nouÿ? Die Identität des Illustrators des Märchens „Monsieur Hampelmann“
Die Freundschaft der Königin Elisabeth mit André Lecomte du Nouÿ, Hofarchitekt des rumänischen Königshauses. Belege aus den Briefen der Königin Elisabeth
Eine Königin, ein Exil und eine Geschichte über Hingabe und Belohnung
„A fost odată o regină bună” – Exilul Reginei Elisabeta a României şi prelucrarea lui literară în poveste
„Povestea reginei binefăcătoare” – o încercare de mitizare a propriei personalităţi
„Monsieur Hampelmann – Domnul Pulcinel”. O poveste din exilul reginei
Jean-Jules-Antoine sau André Lecomte du Nouÿ? Identitatea ilustratorului poveştii „Monsieur Hampelmann“
Prietenia Reginei Elisabeta cu André Lecomte du Nouÿ, arhitectul Casei Regale a României. Mărturii din scrisorile Reginei Elisabeta
O regină, un exil şi o poveste despre devotament şi răsplată
Märchen
Povestea
Monsieur Hampelmann
Domnul Pulcinel
Monsieur Polichinelle
The Story of Mr. Jumping Jack
Editionshinweise
Notă asupra ediţiei
„Es war einmal eine gute Königin“ – Das Exil der Königin Elisabeth von Rumänien und seine literarische Verarbeitung im Märchen
Einleitung von Silvia Irina Zimmermann
In mehreren Märchen und Geschichten für Kinder, die Königin Elisabeth unter dem Künstlernamen Carmen Sylva veröffentlichte, finden sich autobiografische Aspekte, die an ein tragisches Ereignis im Leben der ersten Königin von Rumänien und Gemahlin des Königs Carol I. von Rumänien erinnern: den Verlust des einzigen Kindes. Über den frühen Tod der Tochter Prinzessin Maria (1870-1874) hinaus, dem Kummer der Königin wegen der weiteren Kinderlosigkeit und dem Fehlen eines Thronerben für die Dynastie des Landes, bedeutete das Exil von Königin Elisabeth in den Jahren von 1891 bis 1894 einen weiteren überaus schweren Lebensabschnitt für sie. Die Verbannungszeit war für die Königin in großem Maße von Leid, Verbitterung und dem Hadern mit dem eigenen Schicksal geprägt, wie einige literarische Texte und die Briefe aus dieser Zeit davon Zeugnis ablegen. Aus dem literarischen Werk der Königin sind zwei autobiografisch geprägte Märchen besonders interessant: Das Märchen von der hilfreichen Königin und Monsieur Hampelmann. In beiden Märchen entdecken wir Hinweise auf das Schicksal und die Persönlichkeit der königlichen Autorin, und die Märchenhelden entpuppen sich als ein Alter-Ego der Königin, die Freude schenken will und deren Großzügigkeit bis zur Selbstaufopferung führt.
„Das Märchen von der hilfreichen Königin” – eine Art Mythos der Königin Elisabeth
Als eine romantische und empfindsame Natur, mit Leidenschaft für alles Schöne, von sprudelnder Kreativität und voller Begeisterung für den gemeinsamen Missionsgedanken1 an der Seite ihres Gemahls auf dem rumänischen Thron, wünschte sich Königin Elisabeth in ihrer Ehe mit König Carol I. von Rumänien vor allem Kinder, und sie litt wegen dieses unerfüllten Wunsches. Nach dem Verlust des einzigen Kindes blieb sie Zeit ihres Lebens untröstlich, und dennoch versuchte die Königin ihren Schmerz mit Literatur, Musik und Kunst sowie insbesondere mit zahlreichen Wohltätigkeitsprojekten zu lindern. Das Märchen von der hilfreichen Königin, das Königin Elisabeth im Jahr 1901 in dem deutschsprachigen Band Märchen einer Königin veröffentlichte und das in mehreren rumänischen Übersetzungen erschienen ist, erzählt die Legende einer Königin, die sich für die Leidenden opfert, aus dem Wunsch heraus, alle glücklich zu machen. Zugleich stellt das Märchen einen Versuch der Königin Elisabeth dar, ihr eigenes Schicksal mythisch zu erhöhen als eine mildtätige, liebende und hingebungsvolle Königin, die aber von der Freude einer erfüllenden Mütterlichkeit beraubt ist:
„Es war einmal eine gute Königin, die wollte alles Leid stillen, das sie auf Erden sah. Je mehr sie aber Gutes tat, desto mehr schien die Not zu wachsen. Ihre Mittel reichten nicht, den Armen zu helfen, ihre Worte hatten nicht die Kraft, die Trauernden vom Schmerz zu befreien, und ihre Hand konnte nicht alle Krankheiten heilen. Sie meinte aber, die Erde könne unmöglich so schlecht vom lieben Gott gewollt sein, sondern wenn seine Menschenkinder es nur richtig anfingen, so müssten sie glücklich werden. Da ging sie in die Kirche und betete ein Gebet, dessen ganze Kraft und Verwegenheit sie in jener Stunde noch gar nicht ermessen konnte. Sie betete, wie es auch andre Menschen in ihrer Torheit tun, die nicht wissen, was es bedeutet, wenn sie erhört würden.“2
Die Königin aus dem Märchen nimmt der Reihe nach alle Krankheiten der anderen auf sich, indem sie sie selbst erleidet. Solange sie die anderen dadurch heilt, ist sie zufrieden: „Niemals hörte man sie eine Klage äußern.”3 In dem Augenblick, als sie den Sohn einer armen Frau vor dem Tod rettet und infolge dessen ihren einzigen Sohn verliert und somit von dem größten Opfer selbst betroffen ist, verliert die Königin ihre Heilkraft, denn: „diesmal schien ihr der Himmel grausam, und sie hatte nicht die Kraft, sich für die andre Mutter zu freuen, die vor dem furchtbarsten Leid bewahrt worden war.”4 Erst nach einer langen Zeit der „Not und Zweifel”5, als sich ihr das Kind aus dem Paradies im Traum zeigt, gewinnt die Königin ihre Seelenruhe wieder, und sie erkennt und akzeptiert die göttliche Weltordnung:
„Du hast einen frommen Irrtum begangen, da du meintest, allem Weh auf Erden abhelfen zu dürfen. Und den musstest du im Staube sühnen. Denn die Erde ist so, wie Gott sie haben will, ein Bergwerk, ein Hochofen, ein Schmelztiegel, ein ganz kurzer Durchgang von einem Dasein ins nächste Dasein, das höher oder geringer ist, je nachdem was wir auf Erden gelernt. […] Da erwachte die Königin, und von Stund an zog Frieden in ihr Herz. Sie konnte wieder wohltun, trösten, erfreuen – heilen nicht! Und sie begehrte noch gar nichts mehr, sondern war still, zufrieden und breitete Ruhe um sich her.“6
Das Märchen von der hilfreichen Königin, das auf den ersten Blick nur ein Kindermärchen zu sein scheint, enthält darüber hinaus zahlreiche autobiografische Aspekte, die auf die Persönlichkeit und das Leben der Königin und Schriftstellerin Carmen Sylva – Elisabeth von Rumänien verweisen, und kann daher auch als ein Versuch der Selbstmythisierung der Autorin verstanden werden.
„Monsieur Hampelmann” – ein Märchen aus der Exilzeit der Königin
Aus den ersten Monaten des Exils der Königin Elisabeth in Italien, in Pallanza (vom 16. September 1891 bis zum 1. Juni 18927), ist ein weiteres Märchen als literarisches Zeugnis erhalten geblieben, das autobiografische und philosophische Elemente enthält: Monsieur Hampelmann, das in rumänischer Übersetzung den Titel Domnul Pulcinel (Herr Pulcinel) trägt. Die Erstausgabe des veröffentlichen Märchens erschien einige Jahre später und umfasste neben dem Märchentext in vier Sprachen (Deutsch, Rumänisch, Französisch und Englisch) die Faksimiles des von der Königin gemalten Titelblattes und der Märchenseiten in der Handschrift der Königin, in einer stilisierten Kalligrafie und mit Ornamenten für die hervorgehobenen Buchstaben zu Beginn der Textabschnitte, ähnlich wie in der mittelalterlichen Buchmalerei. Zusammen mit den von André Lecomte du Nouÿ ergänzten Zeichnungen auf den Handschriftseiten der Königin, von einer zarten Naivität, in dem Stil der Kinderbücher am Ende des 19. Jahrhunderts, ist Monsieur Hampelmann ein ansprechendes Buch sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Obwohl die Erstausgabe keinerlei Informationen liefert über das Erscheinungsjahr, den Ort und den Verlag (vermutlich 1898, im Verlag Carol Göbl in Bukarest8), erfahren wir aus einem Brief der Königin aus Segenhaus (bei Neuwied) am 12. Dezember 1892 an König Carol I., dass dieses Märchen im Jahr 1892 fertiggestellt worden ist: „Hampelmann gemacht, geschrieben, übersetzt fürs Ottohaus, das in Schulden steckt.”9 Und auf der letzten Abbildung von André Lecomte du Nouÿ finden wir die Datierung in Französisch: „PALLANZA 7 AVRIL 1892”.10
In ihrer ursprünglichen Form als eine Prachtausgabe ausgeführt, richtete sich die Erstausgabe des Märchens vornehmlich an Kinder aus adeligen und wohlhabenden Familien, die in frühester Kindheit in mehreren Sprachen erzogen wurden. Zugleich war es die Absicht der Königin, den Erlös aus dem Verkauf des Buches an das „Otto-Haus” für Waisen und taubstumme Kinder in Neuwied zu spenden, das der Schutzherrschaft ihrer Mutter Fürstin-Witwe Marie zu Wied (1825-1902) oblag, und das durch den Namen an den jüngeren Bruder der Königin Prinz Otto zu Wied (1850–1862) erinnerte, der mit nur 11 Jahren gestorben war.
Das Märchen der Königin Monsieur Hampelmann ist eine einfühlsame Parabel über Liebe und Hingabe, über die Bitternis der Verachtung auf der Erde und die Belohnung der schönen Seele, die in den Himmel erhöht wird. Man kann das Märchen wie eine fantastische Geschichte über einen beseelten Hampelmann aus Holz lesen, eine Art fröhlicher und naiver Harlekin, mit bunten Kleidern und mit einer Maske im Gesicht (eine der typischen Figuren des italienischen Volkstheaters, Commedia dell’arte). Im Märchen der Königin wünscht sich der Harlekin-Hampelmann, dem Kind, das mit ihm spielt, Freude zu bereiten, aber als seine Stricke reißen und er sich nicht mehr bewegen kann, stirbt er aus Schmerz darüber, dass das Kind ihn wegwirft.
Andererseits kann man dieses Märchen auch im Spiegel des Schicksals der Königin lesen, die sich mit Beginn des Sommers 1891 im Exil befindet, nachdem sie an der „Văcărescu-Affäre” mitbeteiligt war und den Heiratswunsch des Thronprinzen Ferdinand von Rumänien mit ihrer bevorzugten Hofdame Elena Văcărescu unterstützt hatte. Die ersten Monate ihres Exils verbrachte Königin Elisabeth in Italien, an einer Lähmung der Hände und Beine leidend11, als auch infolge ihrer Enttäuschung und Verbitterung, dass ihr idealistischer Plan, die deutschstämmige Dynastie in Rumänien durch die Verheiratung des Thronerben mit einer Rumänin einheimisch werden zu lassen, von der gesamten politischen Elite im Land abgelehnt wurde. Genauso litt die Königin unter der ihr auferlegten Trennung von Rumänien, und ihre Rückkehr sollte erst im Herbst 1894 wieder möglich sein. In den nächsten Exiljahren (vom 5. Juni 1892 und bis Ende Juli 1894) blieb Königin Elisabeth in „Villa Segenhaus“ bei Neuwied, dem Witwensitz ihrer Mutter Fürstin Marie zu Wied.
Der Briefwechsel des Königspaares aus der Exilzeit der Königin lässt somit eine Ehekrise erkennen, die die Dimension einer staatlichen Affäre gewonnen hatte. Auf der einen Seite zeigen die Briefe den Ärger und die Enttäuschung der Königin Elisabeth, dass nicht einmal ihr Gemahl Verständnis für ihren Plan hatte, so dass ihr am Ende eines Lebens voller Opferbereitschaft für das Land, alle eigenen Bemühungen zunichte gemacht erschienen. Auf der anderen Seite erfahren wir von den wiederholten Versuchen und Aufforderungen des Königs Carol I. an die Königin, ihre allzu pessimistische Auffassung zu ändern, um ihre Gesundheit wieder zu erlangen, und wieder die hingebungsvolle und liebevolle Partnerin an seiner Seite und auf dem Thron Rumäniens zu sein. Im Folgenden seien zwei Beispiele aus dem Briefwechsel des Königspaares am Ende des Jahres 1891 erwähnt. Aus dem Brief der Königin Elisabeth an König Carol I., aus Pallanza am 15. Dezember 1891:
„Ach! wie schwer! wie schwer fallen Deine Thränen wie siedendes Blei mir aufs Herz! Als was sollen wir denn aus dieser furchtbaren Leidenszeit hervorgehen?– Mein ganzes Leben hatte ich nur einen Gedanken: Freude zu machen, glücklich zu machen! Noch ehe ich sprechen konnte hielt ich den Schildwachen die Hände hin zum Kuß! Und mit 40 Jahren konnte ich nicht schlafen wenn eine Dienerin verstimmt aussah!– Und mich durfte Jeder kränken, so tief, so bitter, & hernach noch sagen, es sei meine Schuld daß ich gekränkt sei! Und nun entlocken meine Worte Dir Thränen, gerade als ich dachte, das Glück zöge bei uns ein, das lang entbehrte Glück! Aber ich fange an, ganz abergläubisch zu werden, daß ich Unglück bringe. Schon in der Jugend hatte ich Angst, mich noch einmal anzuschließen, weil Alle starben, die ich lieb hatte. Ach bitte, gut Ibi!12 sei nicht mehr traurig! Mir ist es einerlei ob ich traurig bin, ich bin es ja eigentlich immer gewesen, schon als ganz kleines Kind. Ich bin stets von dem Gedanken verfolgt gewesen, unglücklich zu machen! Auch in der Ehe dasselbe: Ach bitte! weine nicht! gieb mir nicht das Gefühl daß mein ganzes Leben verfehlt gewesen & all mein Mühen umsonst. Es bleibt ja dann gar Nichts mehr darin & ich würde mich fragen, weßhalb man mir das Leben auferlegt, das ich nie begehrt. Ich dachte, ich hätte es verstanden, als ich Talent genug hatte, um 10 Menschen zu erfreuen, & Geld genug um 10 Menschen zu helfen. Aber auch das war eitel! O bitte, weine nicht! Ich kann es nicht ertragen! Deine Elisabeth.”13
Aus der Antwort von König Carol I. an Königin Elisabeth, aus Bukarest, verfasst „Am Schlusse des Jahres 1891” bzw. nach der Datierung im Tagebuch14 des Königs schrieb er an diesem Brief angefangen vom 10. Dezember (alter Stil) bzw. 22. Dezember (neuer Stil) 1891 und sandte ihn an Königin Elisabeth am 18./ 30. Dezember 1891 zusammen mit einer Beilage: „Durch Beweise festgestellte Unwahrheiten von H.V.15“:
„Inniggeliebte Elisabeth! Mein rastlos Streben geht dahin Dein Herz u. Dein Vertrauen die durch beklagenswerthe Einflüße zeitweise von mir entfernt worden, wieder vollständig zurück zu erobern, ich scheue keine Arbeit keine Mühe selbst nicht das schwerste Opfer um dies von mir so heißersehnte Ziel zu erreichen und Dich aus sturmbewegter See durch gefährliche Klippen glücklich in den ruhigen Hafen des Friedens zu steuern. [....] In Deinem letzten Briefe sagst Du 'Als was sollen wir aus dieser furchtbaren Leidenszeit herausgehen?' ich antwortete 'als Helden'. Je größer die Kämpfe, desto entschloßener muß man ihnen entgegentreten, je schwerer das Schicksal desto muthiger muß man es tragen, verzagen darf man nicht. Der Himmel legt uns nicht mehr auf als wir tragen können. Vertraue also auf Gott und dann auf mich, der Dich auf dem Lebenswege, den wir noch zusammen zu durchwandern haben, liebevoll stützen und vor allem Ungemach schützen werde. Ich habe noch Kraft und Energie genug um die ganze Verantwortung gegenüber denjenigen, denen Du Dich verpflichtet glaubst auf mich zu nehmen. Ich bitte Dich innständigst alles Unangenehme auf meine Schultern abzuwälzen und Dir das Gefühl aus dem Kopfe zu schlagen, daß Du jemanden unglücklich gemacht. Allein wir sind fast unglücklich gemacht worden. Vergessen wir also die Vergangenheit mit ihren herben Eindrücken und blicken wir vertrauensvoll in die Zukunft, die uns noch manche Freude und Befriedigung bringen kann. Vorläufig mögen die friedlichen Gestade des Lago Maggiore mit seiner balsamischen Luft Dir Kraft geben und Zerstreuung gewähren und die aufopfernde vortreffliche Pflege des Sanitätsrathes Scharrenbroich Deine uns Allen so theuere Gesundheit wiedergeben, damit Du im Frühjahre nach Rumänien zurückkehren kannst, wo Du mit offenen Armen und Jubel empfangen werden wirst. Dies ist mein inniger Herzens-Wunsch am Schluße dieses schwer wiegenden Jahres. Zärtlich schließe ich Dich, theuere Elisabeth, in die Arme und bin zeitlebens Dein Dir aus tiefster Seele aufrichtig ergebener treuer Carl.”16
Die Versöhnung des Königspaares gelang letztendlich, jedoch beanspruchte die Genesung der Königin noch weitere Monate, so dass sie erst im Frühjahr 1894 den Rollstuhl verlassen und wieder gehen konnte. In der Zwischenzeit fand die Hochzeit des Thronfolgers Ferdinand mit Prinzessin Maria von Edinburgh am 10. Januar 1893 statt, und am 15. Oktober 1893 wurde das erste Kind des Thronfolgerpaares geboren, Prinz Carol, der spätere König Carol II. von Rumänien. Mit der Geburt des ersten Prinzen der rumänischen Dynastie im Land ging auch der größte Wunsch des ersten Königspaares von Rumänien, eine Dynastie in Rumänien zu gründen und zu konsolidieren, in Erfüllung. Voller Freude über die Geburt des Prinzen schreibt Königin Elisabeth an König Carol I. aus Segenhaus (Neuwied) am 22. Oktober 1893:
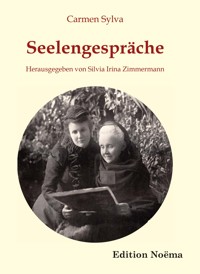
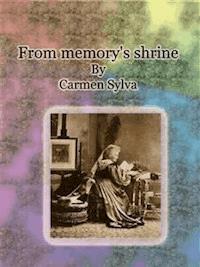
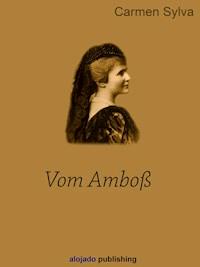







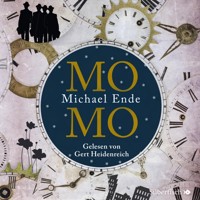



![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)