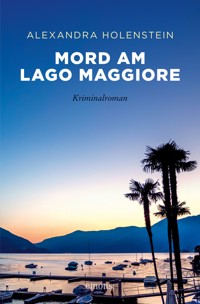
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sehnsuchtsorte
- Sprache: Deutsch
Der traumhafte Lago Maggiore als Kulisse für ein perfides Verbrechen: Eigentlich dürfte an einem idyllischen Ort wie Ascona gar kein Mord geschehen, und doch liegt Herbert Kummer vergiftet in seiner luxuriösen Villa. Tabea, die Schwiegertochter des Opfers, will nicht untätig bleiben und stürzt sich in heimliche Ermittlungen. Dabei deckt sie ein Geheimnis nach dem anderen über ihren Schwiegervater auf – und weckt nicht nur den Unmut der ermittelnden Kommissarin, sondern auch den des Mörders.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexandra Holenstein, im Südwesten Deutschlands geboren, lebt seit mehr als vier Jahrzehnten im Tessin, nahe dem Lago Maggiore. Nach einem erfüllten Berufsleben als Deutschlehrerin hat sie sich dem Schreiben von Romanen zugewandt.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Umschlagmotiv: mauritius images/Sina Ettmer/Alamy/Alamy Stock Photos
Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-157-7
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
In Erinnerung an meine Mutter, Irene Fiebig,
Im Juli
Oh, diese Schlaflosigkeit.
Insonnia, terribile insonnia.
Wann nur würden Hitze und Unrast ein Ende haben?
Inquietudine.
Erst wenn es vollbracht war. Ja, natürlich.
Erst dann würde sich wieder Schlaf einstellen.
1
Tabea
Ein halbes Jahr zuvor – Zürich im Januar
»Nur über meine Leiche.«
»Tabea, ich bitte dich!« Ludwig tauchte die mit einem zu groß geratenen Brotbrocken besteckte Gabel in die Überreste des Käsefondues. »Du tust so, als wäre es ein schwerer Schicksalsschlag, in eine Villa mit Aussicht auf den Lago Maggiore ziehen zu müssen.« Er hob die Gabel aus der inzwischen zähen Masse und betrachtete das umhüllte Brot wie ein Wissenschaftler den Gegenstand seiner Studie.
Mir war der Appetit vergangen. Ludwig zuzusehen, wie er den Mocken nun endlich in den Mund beförderte, bereitete mir Unbehagen. Das hatte, da musste ich fair sein, weder mit Ludwig noch mit dem vor zehn Minuten noch wohlschmeckenden Käse zu tun.
»Du weißt so gut wie ich, dass es nicht um die Villa geht, sondern um deinen Vater. Ich will meine besten Jahre nicht unter der Fuchtel eines Despoten verbringen.« Damit hatte ich ein bisschen zu tief in die Dramakiste gegriffen. »Über meine Leiche« würde niemand gehen, denn ich hatte nicht vor, zu einer solchen zu werden. Zumindest nicht freiwillig. Und auch wenn Ludwigs Vater Herbert nicht das war, was man gemeinhin als einen liebenswerten Menschen bezeichnete, so war er doch kein Despot. Zudem würden die vor mir liegenden Jahrzehnte schon deshalb nicht meine besten sein, weil die bereits hinter mir lagen. Ich war zweiundfünfzig. Über das, was nun kommen würde, sprachen nur clevere Werbetexter in wohlklingenden Superlativen. Aber es ging mir gut, und ich hoffte, wie die meisten Menschen, dass mir noch viel Zeit vergönnt war. Zeit, die ich als selbstbestimmter Mensch verbringen wollte. Ohne die Launen eines allein lebenden Pensionärs, dessen Angebot, uns Unterschlupf zu gewähren, garantiert mit einer saftigen Portion Eigennutz verbunden war. Nicht mehr als eine Geschossdecke würde uns von Herbert Kummer trennen.
»Hast du eine bessere Idee?« Ludwig schickte seiner rein rhetorischen Frage einen Seufzer hinterher, während er die Abdeckung über die nur noch schwache Flamme des Rechauds schob. »Uns bleibt nicht mehr viel Zeit zum Nachdenken. Noch einen Schluck Wein?« Er griff nach der fast leeren Flasche mit dem Chardonnay und hielt sie über mein Glas.
Statt einer Antwort bedeckte ich dies mit meiner flachen Hand. Mir war nach gar nichts mehr zumute. Nicht nach Käse, nicht nach Chardonnay und nicht nach besseren Ideen, die ich ohnehin nicht hatte.
Vor drei Monaten war uns unsere für Zürcher Verhältnisse günstige und zentral am Schaffhauserplatz gelegene Vier-Zimmer-Wohnung gekündigt worden. Die Erben der verstorbenen Frau Lienhard wollten die vier Wohnungen des Mietshauses zu Eigentumswohnungen mit gehobenem Standing umwandeln, von denen die Herrschaften Kummer, also wir, sogar eine erwerben durften. Das war zwar sehr zuvorkommend von den neuen Eigentümern, scheiterte aber an einem einzigen kleinen Hindernis: Uns fehlten für Designerküche, Marmorbad und Bodendielen aus Mooreichenholz exakt zweieinhalb Millionen Franken.
Und als wäre die Sache mit der gekündigten Wohnung nicht schon genug, hatte auch Henry, Ludwigs Freund aus Jugendjahren, plötzlich das Gefühl, es müsse sich etwas ändern. Er wollte Ludwig das als Fotoatelier gestaltete Lokal in der Froschaugasse nicht länger für eine symbolische Miete überlassen.
Vor fünfunddreißig Jahren hatte Ludwig seinen besten Freund aus dem eisigen Wasser eines nur zum Teil zugefrorenen Teiches gezogen und ihn vor dem Tod bewahrt. Neben jeder Menge unmittelbarem Dank hatte Henry sich Jahre später bei seinem Retter auch damit erkenntlich gezeigt, dass er ihm ein Ladenlokal in Zürichs Niederdorf zur Verfügung gestellt hatte. Die Räumlichkeit gehörte zu einem Gebäudekomplex, der Henry kurz zuvor von seinen Eltern vermacht worden war. Ludwig konnte auf diese Weise den Traum vom eigenen Fotoatelier verwirklichen. Und das für wenig mehr als einen Unkostenbeitrag. Die Großzügigkeit sollte jetzt, mehr als zwanzig Jahre später, ihr Ende finden. Auch Dankbarkeit kannte zeitliche Grenzen. Dafür hatte Henry natürlich eine andere Formulierung gefunden.
Nun saßen wir hier, am Esstisch unserer Noch-Wohnung, zerbröselten auf den leeren Tellern Brotstücke und dachten mal laut, mal still jeder für sich über das nach, was uns bewegte. Nicht zum ersten Mal, aber mit dem Damoklesschwert der schwindenden Zeit über uns.
Natürlich hatten wir uns umgeschaut. Nach erschwinglichem Wohnraum und einem neuen Fotoatelier für Ludwig. Voneinander abgetrennt oder unter einem Dach. Aber erschwinglich war in dieser Stadt nur wenig – und wenn es etwas gab, dann waren wir nicht die einzigen Aspiranten.
»Lass uns den Radius unserer Wohnungssuche um zehn, fünfzehn Kilometer erweitern. Wäre doch gelacht, wenn sich da nichts finden ließe«, schlug ich vor. Mein aus dem Nichts gezauberter Optimismus klang künstlich. Ich wollte mir selbst nicht zuhören.
Das ging Ludwig wohl ebenso. Er blies die Backen auf und ließ dann die Luft entweichen. »Und mein Fotoatelier soll ich in einem Industriegebiet oder Einkaufszentrum nahe der Autobahn unterbringen? Oder neben einem Kuhstall?« Die Frage war reine Rhetorik. »Ich brauche eine zahlungskräftige Klientel. Leute, die jeden Lebensanlass professionell fotografiert haben möchten: Kindergeburtstag, Gartenparty, Bootstaufe, den neuen Ferrari.«
Natürlich hatte Ludwig recht. Nach schwierigen Jahren, in denen vorwiegend ich mit meinem pünktlich eintreffenden Lehrerinnengehalt unseren Lebensunterhalt bestritten hatte, war er als Fotograf neuerdings wieder gefragt. Sein Atelier war perfekt gelegen. Die betuchte Kundschaft flanierte daran vorbei und hatte Lust, sich nach allen Regeln der Kunst ablichten zu lassen. Die Fototools ihrer Smartphones waren gut, aber nicht gut genug.
Insgeheim hatte ich meinem Traum, mein Pensum auf ein Minimum reduzieren zu können, schon freien Lauf gelassen. Verlockender noch: ganz auf null zu fahren. Endlich Zeit für mich zu haben. Zum Beispiel für meine Lyriketüden und Bonmots. Und nun?
»Und was ist mit mir?«, fragte ich Ludwigs breiten Rücken.
Ludwig war damit beschäftigt, Caquelon, Rechaud und Teller zu einem Turm gestapelt in die Küche zu tragen. Mein Anliegen hatte eine klägliche Note.
»Was mit dir ist?« Ludwig lief weiter in Richtung Küche, ohne sich umzudrehen. »Du findest doch überall locker eine Stelle«, rief er wenig später. »Auch im Tessin. Da suchen sie händeringend Deutschlehrer.«
Aha. Da hatte sich mein Mann also schon vorsorglich informiert.
Und was, wenn ich nicht händeringend gesucht werden wollte? Wenn ich gern ungestört geblieben wäre, mit ein bisschen Extrazeit für meine Gedichte und meine Kräutertöpfe auf dem Balkon?
»Du hast aber schon begriffen, dass Herbert uns prophylaktisch als Altenpfleger anheuern will?« Das war meine Trumpfkarte, die ich bisher noch nicht ins Spiel gebracht hatte.
Ich war Ludwig in die Küche gefolgt. Unsere schöne Zürcher Küche, die wir bis Mai zu räumen hatten. Aus deren Fenster wir auf eine belebte Straße hinabschauten, die auch jetzt, an diesem kalt-nassen Januarabend, von den dicht aneinandergereihten Straßenlampen und den ohne Unterlass vorbeifahrenden Autos ausgeleuchtet wurde. In der wir fast nie bei geöffnetem Fenster am Tisch sitzen konnten und die wir trotzdem liebten.
»Herbert ist topfit. Der wird hundert. Eher muss er sich um uns kümmern als umgekehrt.« Ludwig stand an der Spüle und kratzte die Käsereste aus dem Caquelon.
Dass sich Herbert um jemanden kümmerte, der nicht er selbst oder sein Basset Hound Bruno war, hielt ich für abwegig. Aber fit war er, der Sechsundsiebzigjährige, der seine Zeit stressfrei mit Müßiggang und Golf verbrachte. Immer aufs Neue erstaunte uns, wie wenig ihm seine alkoholischen und kulinarischen Übertreibungen anhaben konnten. In jedem Fall war Herbert von besserer Gesundheit, als die viel zu früh verstorbene Louise es gewesen war. Seine Frau, Ludwigs Mutter, hatte über die Jahre in zunehmendem Maß Trost beim roten Merlot gesucht.
»Er hat übrigens gesagt«, Ludwig drehte sich zu mir um, die Spülbürste wie ein Zepter in der Hand, »dass du im Garten so viel Fläche für den Gemüseanbau haben könntest, wie du willst.«
Darüber hatten sie demnach auch schon gesprochen, Herbert und Ludwig. Und obwohl ich in dem Angebot meines Schwiegervaters weiteren Eigennutz wähnte, verfehlte Ludwigs gut platzierter Köder seine Wirkung nicht. Einen richtigen Garten für den ökologischen Gemüseanbau wünschte ich mir schon seit Langem. Dagegen kam mein Urban Gardening auf dem Balkon nicht an.
»Das hat er gesagt? Der Alte wird ja richtig großzügig.« Dem sarkastischen Ton zum Trotz spross in mir ein Pflänzchen namens Zuversicht. Vielleicht hieß es auch Sinneswandel. Es war ein winziges Pflänzchen, aber mit guter Düngung, biologisch natürlich, konnte es gedeihen.
Wie es aussah, musste für einen Umzug auf die Schweizer Alpensüdseite wohl doch niemand über meine Leiche gehen.
2
Tabea
Zürich – im März
»Du musst das positiv sehen. Als Challenge. ›Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne‹ und so. Hesse, du weißt schon.«
Natürlich wusste ich. Und Jasper wusste, dass ich die Gedichte von Hermann Hesse liebte. Jasper war Champion im Positivsehen. Keine Ahnung, von wem er das hatte. Weder Ludwig noch ich konnten diesen Überschwang an Zuversicht aufbieten.
»Opa ist doch gar nicht so schlimm. Ein bisschen komisch kann er natürlich sein«, räumte Jasper ein, was immer noch eine Verharmlosung war, wie sie nur von jemandem kommen konnte, der ohnehin ganz andere Wege ging. »Und wenn er mit seinen schrägen Ideen kommt, nickst du zweimal und ziehst danach dein eigenes Ding durch.«
Ich nickte zweimal. »Du hast leicht reden.«
Ja, Jasper war unser Sohn, und doch schien es uns manchmal, als ob er das eigentlich nicht sein konnte. Hindernisse waren dazu da, umgangen oder übersprungen zu werden. Nach dieser Devise hatte er seine dreiundzwanzig ersten Lebensjahre hinter sich gebracht und vor nicht allzu langer Zeit einen mittlerweile florierenden Fahrradladen mit Werkstatt eröffnet.
»Klar habe ich gut reden. Ich komme euch aber gelegentlich besuchen. Versprochen.« Jasper grinste und strich mir mit seiner nicht ganz sauberen, von der Werkstattarbeit rauen Hand über den Unterarm. »Kann ich noch ein Stück von dem Kuchen haben? Zum Mitnehmen für Tom.«
Wir saßen bei Kaffee und Marmorkuchen am Tisch unserer Noch-Küche, in der sich ein Fluidum von Nostalgie ausbreitete. Spürbar bei mir, nicht bei Jasper. Der war nun mal ein Vorzeigemodell für das Leben im Hier und Jetzt. Ein Nachher gab es bei ihm auch, zum Beispiel bei der frühzeitigen Mitteilung, dass er nur auf einen Sprung bleiben könne.
»Und wie wird das jetzt praktisch ablaufen?« Jasper sah mich an mit diesen ungewöhnlich grünen Augen, deren Farbe er vermutlich seiner nordischen Urgroßmutter verdankte.
»Wir packen unser Zeugs zusammen«, ich wies auf die ersten gestapelten Kisten in der Küchenecke, »und ziehen peu à peu, ständig ein bisschen mehr, nach Ascona. Definitiv dann Ende April. Dann bleiben mir immer noch gut zwei Monate bis zum Schuljahresende, die ich als Pendlerin zubringen muss. Und für den September –«
Weiter kam ich nicht. Jasper war im Aufbruchmodus. Die mir noch zur Verfügung gestellte Zeit musste fürs transportfreundliche Einwickeln des Kuchens genutzt werden, denn Jasper durchquerte die Stadt mit einem Carbon-Rennrad, auf dem so etwas Unsportliches wie ein Gepäckträger keinen Platz fand.
Ich blieb noch ein wenig sitzen und lauschte seinem schnellen Schritt im Treppenhaus nach.
Eine Challenge. Ja, so konnte man das nennen. Vor allem für mich. Für Ludwig änderte sich nicht so viel. Auch mit reduzierter Auftragszahl und ohne eigenes Atelier konnte er weiterhin ohne einschneidende Veränderung seiner Arbeit nachgehen. Einige seiner Zürcher Kunden waren von seiner neuen Wirkungsstätte sogar begeistert. Ascona, wie praktisch! Da standen doch ihre Zweitresidenzen.
Bei mir sah das etwas anders aus. Zunächst mal musste ich meinen Italienischkenntnissen eine deutliche Verbesserung zukommen lassen, bevor ich im September im lokalen Kolleg ein halbes Pensum Deutsch unterrichten würde. Das Bild von Tabea Kummer, der Poetin mit dem in Tinte getauchten Gänsekiel in der Hand, deren lyrische Ergüsse in zahlreichen Gedichtbänden käuflich zu erwerben waren, wurde zur Lichtspiegelung am Horizont. Während ich noch immer tatenlos auf dem Küchenstuhl verharrte, betrauerte ich ein wenig die sich auflösende Vision.
Aber der Gemüsegarten, so sagte ich mir und stand endlich auf, der Gemüsegarten wird angelegt. Schon gleich im Mai. Und Zeit für ein kleines Gedicht, hie und da, würde wohl auch noch bleiben.
***
Für Frühlingsgefühle war die Zeit noch nicht reif. Die ersten Märztage gehörten zum Winter, auch wenn die Sonne die Seeoberfläche in einen riesigen Überwurf aus glitzerndem Paillettenstoff verwandelte, dazu ein fast schon lau zu nennendes Lüftchen wehte und ein paar Höckerschwäne so taten, als wäre das Wasser des unteren Seebeckens schon mal für sie temperiert worden. Die umliegenden Bergketten waren alle noch saisongerecht mit Schnee bemützt.
»Mit dem Zug sind es wenig mehr als zwei Stunden von hier bis nach Locarno, und du tust, als wäre es eine Expedition durch die Tundra.«
Seit einer halben Stunde saßen Mimi und ich auf einer der graugrünen Bänke am Mythenquai, tranken heißen Holundertee aus der Thermoskanne und besprachen zum gefühlt fünfzigsten Mal das, was Jasper am Vormittag ganz entspannt zur Challenge erkoren hatte.
Mimi war meine beste Freundin, hieß eigentlich Hermine, war Geografielehrerin und wohltuende Realistin, der es im Nu gelang, mir bei meinen nicht aus der Welt zu schaffenden gedanklichen Graufärbungen den Pinsel aus der Hand zu nehmen.
»Du kommst jeweils am Sonntagabend zu mir in die Tellstraße, wir trinken noch ein Gläschen zusammen, vermeiden, an den Montag zu denken, und freuen uns darüber, deine zwei Zürich-Nächte wie Teenager zu verbringen. Na ja, so ähnlich jedenfalls. Und Dienstag nach der Schule fährst du wieder zu deinem Ludwig in die Villa Felicità. Das Ganze beschränkt auf zweieinhalb lockere Monate.« Wie Mimi das beschrieb, bekam die Zeit von Mai bis zu den Sommerferien, während der ich nicht mehr in Zürich leben würde, den Nimbus einer Auszeit im Club Med. Es erwies sich als enorm praktisch, dass sich meine Unterrichtsstunden an der Kantonsschule Zürich Nord auf nur zwei Tage verteilten. Was mich bisher gestört hatte, wurde zum Vorteil.
»Überhaupt, Villa Felicità, wer kann so was schon als Adresse anbieten? Villa des Glücks. Nomen est omen. Du wirst sehen, ich werde öfter bei euch aufkreuzen, als euch lieb ist. Vor allem, wenn ich mal wieder eine Dosis Glücksgefühle gebrauchen kann.«
Wir lachten beide über so viel Schönfärberei, neben der sogar das sonnige Gemüt von Jasper verblasste.
Mimi, die sechs Jahre älter war als ich, lebte allein und tat das mit Vergnügen. Ich zweifelte nicht daran, dass ihr die Gesellschaft ihrer zwei reizbaren, aber auch anhänglichen Siamkatzen Simon und Garfunkel völlig ausreichte.
»Wie sieht eigentlich Ludwig eure Zukunft unter Vaters Dach? Ich meine, mich zu erinnern, dass er nicht gut auf ihn zu sprechen war.« Mimi war unvermittelt ernst geworden. Nicht bitterernst, aber nachdenklicher als zuvor. »Hat er ihn nicht irgendwann sogar mal für den Tod seiner Mutter verantwortlich gemacht?«
Seltsam, dass Mimi das erwähnte. Seltsam auch, dass ich nie mehr daran gedacht hatte. Weder daran, Mimi davon erzählt zu haben, noch an Ludwigs irgendwann mal im Gefühlsdusel hervorgebrachte Bezichtigung.
»Na ja, ›verantwortlich gemacht‹ ist vielleicht etwas krass formuliert«, erwiderte ich und fragte mich – jetzt erst? –, weshalb sich Ludwig bei solchen unter dem Deckel gehaltenen Regungen für die baldige räumliche Nähe zu seinem Vater hatte entscheiden können. »Es ging wohl eher darum, dass Louise ordentlich gebechert hat und Herbert an ihrem Kummer bestimmt nicht unschuldig war. Aber die These, dass sein Benehmen zu ihrem Herztod geführt hat, scheint mir ein bisschen gewagt.«
»Ludwig wird das wohl auch nicht so gemeint haben. Manchmal sagt man Sachen …« Mimi hielt inne.
»Ja, genau.« Ich nickte mehrmals. »Langsam wird’s kalt hier. Wollen wir gehen?« Mir war nach Aufbruch zumute. Fröstelnd schraubte ich den Deckel auf die Thermoskanne, deren Inhalt uns im Zusammenspiel mit der Sonne und unseren Gesprächen so lange warm gehalten hatte.
3
Tabea
Ascona – im Mai
»Du hast zwischen den Tomatensetzlingen zu wenig Abstand gelassen.« Herbert, den ich nicht hatte kommen sehen, stand neben dem Beet. Mit seiner stattlichen Größe erschien er mir aus meiner kauernden Perspektive wie das personifizierte Jüngste Gericht. »Das wird so nichts«, dröhnte das Sprachrohr Gottes.
Ich konnte mich nicht erinnern, Herbert je bei irgendeiner Gartenarbeit gesehen zu haben. Dafür war nämlich seit Langem Giuseppe zuständig, der mir auch das Stück Rasen nahe der unteren Grundstücksgrenze im Halbschatten der Kamelien zu einem Beet von sechs Metern Länge und vier Metern Breite umgestochen hatte. Nicht das geeignetste Stück Land – da gab es in Herberts Garten Besseres –, aber nun mal das, was mir der Hausherr zugestanden hatte.
»Welchen Abstand hast du denn bei deiner letzten Tomatenpflanzung gehalten?«, fragte ich mit unschuldiger Miene, in deren Genuss Herbert allerdings nicht kommen konnte, da ich mein Augenmerk erneut auf mein vollbrachtes Werk und auf das nächste Pflänzchen gerichtet hatte, das in exakt dem gleichen Abstand wie die anderen vier gesetzt werden sollte.
»Und was kommt da noch alles rein?« Herbert war ein versierter Nichtantworter, wenn es ihm in den Kram passte. Intensives Hecheln zeugte davon, dass auch Bruno, sein gut genährter Basset, der Inspektion beiwohnte.
»Vieles«, teilte ich der dunklen Erde und dem frisch geschaufelten Pflanzloch mit.
Vor drei Wochen hatten wir unsere neue Wohnung im Untergeschoss der Villa Felicità bezogen. Drei Wochen, in denen mir erste Häppchen von Herberts Willkommenskultur serviert worden waren.
»Ich habe Giuseppe gekündigt.« Auch im fließenden Themenwechsel war Herbert geübt.
»Wieso das denn?« Es war höchste Zeit, mich aus meiner kauernden Position zu erheben. Dafür gab es drei Gründe. Der erste: Herbert sollte nicht länger zu mir herabschauen dürfen. Der zweite: Meine Knie taten mir weh. Der dritte: Warum zum Teufel hatte mein Schwiegervater seinem seit so vielen Jahren zuverlässig und vermutlich unterbezahlt bei ihm arbeitenden Gärtner gekündigt?
»Warum?«, wiederholte ich, strich meine erdigen Hände an den hinteren Taschen meiner für die Temperatur viel zu warmen Jeans ab und sah Herbert an. Leider immer noch mit Unten-oben-Gefälle, denn ich reichte ihm nur bis zu den Schultern.
»Setzen wir uns irgendwo hin. Dann erzähle ich es dir«, sagte Herbert. »Wir müssen hier nicht in der prallen Sonne Wurzeln schlagen.« Er war es, der bestimmte. Ich mochte seine Imperative nicht, aber meine Neugier siegte.
Wir erklommen die Anhöhe zu dem Teil des Anwesens, den Herberts Eltern in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts als eine Art Lustgarten gestaltet hatten. Vorbei an einer verwitterten Nackten, die inmitten eines Teiches unaufhörlich Wasser aus einer ihren Schoß sittsam bedeckenden Amphore fließen ließ. Vorbei an tanzenden Engeln, über deren Häupter sich moosiges Grün zog, und vorbei an einem Pavillon mit Sitzbank für zwei, auf der ich mich mit Herbert nur unter Androhung der Todesstrafe niedergelassen hätte.
Auch Herbert schien dies nicht der geeignete Ort für ein Tête-à-Tête mit seiner Schwiegertochter. Mit dem keuchenden Bruno als Nachhut steuerte er eine im Schatten von dichtem Magnolienblattwerk stehende Holzbank an.
»Die müssten wir mal abschleifen und neu streichen«, informierte er mich, bevor er sich auf der Bank mit der abblätternden roten Farbe niederließ und mir mit einer Kopfdrehung zu verstehen gab, es ihm nachzutun.
Wie folgsame Adjutanten nahmen Bruno und ich zeitgleich Platz. Ersterer mit einem Plumps zu Herrchens Füßen, Letztere an Herberts Seite.
Wer war »wir«? Das Abschleifen von Bänken gehörte nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. »Also, du wolltest mir erzählen, warum du Giuseppe entlassen hast.« Mich bei Herbert meiner Lehrerinnenstimme zu bedienen hatte sich bewährt. Schließlich saß ich nicht zu meinem Privatvergnügen neben ihm. Auch wenn ich zugeben musste, dass die Bank vortrefflich platziert war. Es war ein Ort, den ich mir für meine kleinen Rückzüge merken wollte. Wie auf einer Theaterbühne mit seitlich gerafften Vorhängen zeigte sich zwischen zwei hochgewachsenen Kampferbäumen nichts Geringeres als der Lago Maggiore. Ein Seidentuch in changierendem Blau, umrandet von den mit allen möglichen Grüntönen prahlenden Ufern der gegenüberliegenden Seeseite und den Bergen des Gambarogno.
Dem Mann neben mir schien das sich vor ihm ausbreitende Panorama keine Regung zu entlocken. Aber im Grunde fiel mir sowieso nichts ein, was Herbert zu nennenswerten Gefühlsäußerungen bewog. Vom liebevollen Ziehen an Brunos fünfzig Zentimeter langen Hängeohren, dem Kraulen seiner fettunterlegten Halskrause und dem kaum hörbaren »Braver Bruno« mal abgesehen.
»Ich habe mir gedacht«, Herbert räusperte sich, »dass es Giuseppe auf seine alten Tage verdient hat, ein bisschen kürzerzutreten und nicht mehr alle drei Tage aus Italien hierherfahren zu müssen. Wir sind jetzt zu dritt, gesund und kräftig, und können die Gartenarbeit selbst in die Hand nehmen. Du hast ja schon gezeigt, wie dir das Grünzeug im Blut liegt.« Herbert wies auf das erdige Feld unterhalb unseres Sitzplatzes, wo ich gemäß seinen Kommentaren noch vor wenigen Minuten meinen Dilettantismus zur Schau gestellt hatte. Grünzeug mochte ich, aber im Blut lag mir nichts dergleichen.
»Giuseppe ist jünger als du.« Der Hinweis schien mir angebracht. »Hat er denn gesundheitliche Probleme?«
»Nicht dass ich wüsste, aber so weit muss es gar nicht erst kommen. Lassen wir ihn in seinem Häuschen in Cannobio in Ruhe seinen Lebensabend genießen. Meinst du nicht auch, Bruno?« Herbert strich dem Basset über den weißen Fellstreifen zwischen den Ohren. Der nach seiner Meinung Gefragte brummte und rollte sich zur Seite.
Auch ich hätte das Gespräch mit meinem Schwiegervater gern beendet. Ohne Brummen und Rollen, dafür mit Aufstehen und Verschwinden.
Still für mich fasste ich zusammen: Ludwig und ich sollten die neuen Gärtner in der Villa Felicità werden. Das von Herbert eingestreute »Wir« war reines Blendwerk. Keine Sekunde lang bezog er sich selbst in die eben ernannte Arbeitstruppe ein. Und Giuseppes glückliches Rentnerdasein im italienischen Cannobio lag ihm so wenig am Herzen wie die Zürcher Lehrtätigkeit seiner Schwiegertochter und deren noch bis Juli dauernde Tage der Abwesenheit. Nicht ein einziges Mal hatte er sich danach erkundigt.
»Was sagt Giuseppe dazu?«
»Was soll er schon sagen? Er versteht natürlich, dass es hier nicht vier Leute braucht, die an Büschen und Bäumen rumschnipseln. Ist ja auch nicht sofort. Ab und zu wird er schon noch kommen. Fürs Grobe. Auf, auf, Bruno!«
Herbert hatte gesprochen. Fürs Grobe. Mit ausholenden Schritten marschierte er davon, die Füße immer auf den Granitplatten, nie dazwischen oder daneben. Nur Bruno, der hinter ihm hertrottete, durfte die trittgenaue Gehordnung missachten.
Jetzt, da ich allein war, wollte ich noch ein wenig sitzen bleiben.
Nicht weit von mir, nahe dem nachbarlichen Grundstück, sah ich Giuseppe auf einer Klappleiter stehen. Rabiat, als habe er es mit einem niederzuzwingenden Eindringling zu tun, zerrte er an ein paar Brombeerruten, die sich erlaubt hatten, frech aus der Kirschlorbeerhecke herauszuragen. Aus einer Regung heraus winkte ich ihm zu. Obwohl es mir schien, als habe er zu mir hingeschaut, winkte er nicht zurück. Kurz darauf schob er seinen Strohhut zurecht, stieg von der Leiter und ging leicht hinkend davon.
Ich dachte an meine Tomatenpflanzen unten am Rand des Beetes. Sie mussten aus ihren Torftöpfchen befreit, in die Erde gesetzt und angegossen werden.
***
»Zu mir hat er nichts davon gesagt. Was denkt er sich dabei? Wir sind nicht seine Lakaien.« Ludwig kippte den im Glas verbliebenen Limoncino, selbst gebrautes Einzugsgeschenk von Herberts Haushaltshilfe Matilda, in einem Zug hinunter.
»Das wundert mich nicht. Herberts Art zu kommunizieren ist gewöhnungsbedürftig.« Eine himmelschreiende Beschönigung. Das war das Wohltuende in einer Beziehung. Ärgerte sich der eine, konnte sich die andere entspannen. Und umgekehrt.
Just in diesem Moment nahm mir Ludwig den Part der Empörung ab. Alles an ihm verströmte Unmut, von der in Falten gelegten Stirn bis zu den zusammengepressten Lippen. Nachdem ich ihm vom gekündigten Giuseppe und Herberts Ansinnen erzählt hatte, uns ersatzweise als Gärtner einzuspannen, war seine Stimmung von beschwingt zu not amused gekippt.
Vor einigen Stunden war er munter pfeifend von seinem ersten wirklich lukrativen Auftrag bei einem gut betuchten Kunden heimgekommen. Frau Zimmerli hatte Ludwig aufgrund einer Empfehlung kontaktiert. Das Ehepaar Zimmerli wollte das neu gestaltete Interieur seiner Villa im nahen Ronco nämlich auch dem weiter gestreuten Freundes- und Bekanntenkreis sichtbar machen. Schließlich musste sich die nicht geringe Investition lohnen. Was hatten sie davon, wenn außer ihnen kaum jemand sah, was sie sich leisten konnten?
Einen ganzen Tag lang hatte Ludwig Raum für Raum, Möbelstück für Möbelstück und die am Pool posierende Hausherrin fotografiert. Wir hatten uns über einem Teller Spaghetti all’Arrabbiata gefragt, wer wohl alles der Folter unterzogen würde, die komplette Bildersammlung nicht nur anschauen, sondern auch noch mit vielen Ahs und Ohs bestaunen zu müssen. Unser Mitgefühl hielt sich in Grenzen. Was zählte, war Ludwigs Einstieg ins lokale Geschäft. Schon mehrmals waren wir seit unserem Umzug nach Ascona auf unserem Terrassenplatz (ohne direkte Aussicht auf den See, aber außer Hör- und Sichtweite von Herbert) bei einem Glas Wein und Geplauder von dem wohligen Gefühl fortgetragen worden, mit dem Umzug das Richtige getan zu haben.
Heute Abend ein bisschen weniger. Da half das milde Lüftchen des Maiabends so wenig wie der süßlich einlullende Duft des weißen Jasmins.
Zu meinem eigenen Erstaunen war es mir gelungen, mit meinem Herbert-Bericht so lange an mich zu halten, bis der letzte Rest Pasta in unseren Mündern verschwunden war und die zwei Gläschen mit dem Zitronenlikör aufgetischt waren.
»Dann sprich mit ihm«, schlug ich vor. Mit Herbert deutlich zu werden, war Ludwigs Aufgabe. Das war zweifelsohne ein Vater-Sohn-Ding.
»Darauf kannst du Gift nehmen!« Ludwig griff nach den leeren Gläsern und stellte sie rigoros aufs Tablett.
»Na, na! Worauf soll Tabea Gift nehmen?«
Wir hatten ihn weder gesehen noch kommen hören. Herbert war hinter dem Jasminbusch hervorgetreten und näherte sich im Schlenderschritt, die Hände in die Taschen seiner abgewetzten Cordhose geschoben, unserem Tisch.
»Niemand soll Gift nehmen, Herbert.«
Aber wenn, dann am besten du, fügte ich gedanklich hinzu.
Kein Zweifel, die kurze Phase meiner relativen Gelassenheit hatte sich verabschiedet und ins Dickicht des dunklen Gartens davongemacht.
4
Ludwig
Ascona – im Juni
Sein Vater war ihm zunächst ausgewichen, um dann darauf zu beharren, dass Giuseppe nicht unglücklich sei, nun endlich mehr Zeit für sich zu haben. Eventuell würde er, Herbert, sich nach einem jüngeren Gärtner umsehen. Einem schnelleren und kräftigeren als Giuseppe. Auf Tabeas und seine Hilfe wolle er selbstverständlich nur kurzfristig zurückgreifen. Auch nicht sofort und nur für ein, zwei Monate. Vielleicht auch drei oder vier. Da habe die liebe Tabea wohl etwas falsch verstanden. Nein, er wisse ja, dass sie beide gelegentlich arbeiten müssten.
Ludwig glaubte nicht daran, dass Tabea etwas falsch verstanden hatte. Und dass sie beide nur gelegentlich arbeiten würden, hätte eine Korrektur verdient. Hätte. Bei seinem Vater war es sinnvoll, aus Gründen des Ärgermanagements über so manches hinwegzusehen.
Einige Tage später hatte Ludwig Gelegenheit, eine Kostprobe von Giuseppes Zufriedenheit über die Kündigung zu erhaschen. Es handelte sich um eine ungewöhnliche Art, seine Freude auszudrücken.
»Vaffanculo!« und »Figlio di puttana!« hatte er Giuseppe mit sich überschlagender Stimme im oberen Garten rufen hören.
Herbert hatte sich Ludwig gegenüber zu dem Vorfall ausgeschwiegen. Wer ließ sich schon gern zum Hurensohn machen?
Heute konnte Ludwig unerwartet über einen freien Nachmittag verfügen. Die Kundin hatte das Fotoshooting auf dem Sonnendeck ihrer Motoryacht abgesagt, weil es zu dem angestrebten Verlust von zwei Kilo Bauch- und Schenkelspeck nicht rechtzeitig gekommen war und sie zudem einen Bad-Hair-Day beklagte.
Mit der Astschere bewaffnet, hatte er sich an das Stück Kirschlorbeerhecke gemacht, das ihrem Sitzplatz am nächsten lag und von Giuseppe nach halber Arbeit unvollendet zurückgelassen worden war. Ludwig hatte sich vorgenommen, sich gärtnerisch auf das zu beschränken, was Tabea und ihm zugutekam. Da sollte sich sein Vater keinen falschen Erwartungen hingeben.
»Huhu, Herr Kummer!« Die Stimme kam von der anderen Heckenseite. Gleich darauf schoben sich eine goldberingte Hand und ein mit mindestens zwanzig Armreifen behängter Unterarm durch eine Öffnung im Geäst.
Der bizarre Anblick ließ Ludwig zurückweichen. Was sollte er tun? Die Hand schütteln? Hände und Arme ohne erkennbare Besitzerinnen waren ihm nicht geheuer. Er zog es vor, die dargebotene Extremität zu ignorieren.
»Ich bin’s, die Nachbarin. Olivia Herzig«, sagte die gesichts- und körperlose Stimme. Immerhin konnte er sehen, dass zu dieser Olivia viel pinkfarbener Stoff gehörte, der durch Äste und Blattwerk blitzte.
Ludwig erinnerte sich, die Frau von nebenan auf einem silbernen Motorroller auf der Strada Rondonico gesehen zu haben. Ohne Helm, mit wehendem Haar und einem wenig verkehrstauglichen Flattergewand bekleidet, war sie winkend und entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung an ihm vorbeigeknattert. Auch sein Vater hatte sie ein- oder zweimal erwähnt. »Crazy Olivia« nannte er sie.
»Ich komme mal rüber«, rief die so Bezeichnete und zog ihre Hand zurück. »Dann können wir auch gleich auf unsere Nachbarschaft anstoßen.«
Ludwig zuckte zusammen. Anstoßen? Er wollte nicht anstoßen. Mit niemandem. Er wollte ungestört an Ästen schnippeln und über ein paar Dinge nachdenken. Zum Beispiel über den Umgang mit seinem Vater. »Nein, nein. Machen Sie sich keine …« Mühe, hatte er sagen wollen. Aber der pinkfarbene Farbflash hinter dem Astwerk war verschwunden.
»Hier bin ich.« Olivia Herzig entstieg einem Oleanderstrauch, der die Kirschlorbeerhecke nach unten begrenzte. »Da ist eine Öffnung.« Sie wies ins Dickicht. »Ich passe da gut durch.«
Das war erstaunlich, denn Olivia Herzig war groß und kräftig gebaut. Ihre grellrosa Stoffhülle – ein Overall? – tat alles, ihre Ausmaße weithin leuchtend hervorzuheben.
Mit ausgebreiteten Armen kam sie auf ihn zu. Von ihren mit Glöckchen behängten Fußbändern und den ebenfalls mit Miniaturglocken gekrönten Spitzen ihrer Pantoffeln drang Geklingel zu ihm hin. In Ludwig stieg Panik auf. Das sah nach einer Umarmung aus, auf die er so wenig Lust hatte wie auf den eingeforderten Umtrunk. Er trat zurück, einen Schritt, zwei, noch einen, stolperte über eine Wurzel und landete unsanft auf dem Hintern, der sich keinerlei Polsterung erfreute. Wie das Gesamtbild verriet, mochte das bei Olivia Herzig anders sein. Das nützte ihm aber nichts.
»Oh, Sie Armer!« Sie reichte ihm ihre helfende Hand.
Obwohl er nicht an ihrer Kraft zweifelte, ihn mit einem Ruck zurück in die Senkrechte befördern zu können, ignorierte er das Angebot.
»Ganz der Vater«, verkündete sie, als sie sich auf Augenhöhe gegenüberstanden. »Diese fein geschnittenen Gesichtszüge. Die elegante Nase.«
Die Sache wurde ihm im Sekundentakt unangenehmer. Was war mit dieser Frau los? Hatte sein Vater mit seinem respektlosen »Crazy Olivia« recht? Ludwig war eigentlich nicht in der Stimmung, seinem Vater in irgendetwas recht zu geben.
Ihm waren Komplimente nicht fremd. Bei Fotoshootings erotischer Natur hatte er schon die eine oder andere Avance erlebt. Von Frauen und Männern gleichermaßen und durchaus mit ausgefallenen Schmeicheleien angereichert. Als Profi parierte er das mit einem Ausweichmanöver. Er war Fotograf, kein Callboy. Und seit einigen Jahren kam so was ohnehin nur noch selten vor. Nun war er also in die Fänge der pinkfarbenen Olivia geraten, die gut zwei Dekaden älter sein musste als er.
»Jetzt haben wir uns aber wirklich einen kühlen Trunk verdient.« Olivia Herzig hatte ihr Begehren nicht vergessen.
Auch wenn Ludwig nach wie vor nicht nach der Verlängerung ihrer Zweisamkeit zumute war, kam ihm das nun zupass. Er würde ihr ein Glas vom gekühlten Hibiskustee auftischen, ein paar unverbindliche Freundlichkeiten mit ihr austauschen und sie anschließend aus dem Garten komplimentieren.
»Da lang!« Er wies auf die Treppe, die zu ihrem im nachmittäglichen Schatten gelegenen Küchensitzplatz führte. Die schmiedeeisernen Gartenstühle – Überreste der großelterlichen Möblierung, die sie noch nicht ersetzt hatten – würden nicht zu langem Verweilen einladen.
Womit Ludwig allerdings nicht gerechnet hatte: Auf einem der beiden Stühle hatte sich schon jemand niedergelassen. Vor Herbert auf dem Tisch stand ein beschlagenes Glas, gefüllt mit exakt der rosa Flüssigkeit, die Ludwig seiner ungeladenen Besucherin anbieten wollte. Zu Herberts Füßen, auf dem kühlenden Granitboden, der ausgestreckte Bruno bei einem seiner zahlreichen Schläfchen. Man hatte es sich gemütlich gemacht.
Verwirrt nahm Ludwig den Küchenausgang in Augenschein. Hatte er die Tür offen stehen lassen und seinen Vater somit zur Selbstbedienung angeregt?
»Ein bisschen Zucker könnte nicht schaden.« Herbert wies, einen leichten Vorwurf in der Stimme, auf das mit Tee gefüllte Glas. Und zu Olivia gewandt, in höherer Tonlage: »Unsere schöne Nachbarin! Womit haben wir uns die Ehre verdient?« Seinem zuckrigen Lächeln, mit dem er vortrefflich zwei Liter Hibiskustee hätte süßen können, fehlte jede Wärme. Aber für so ein Detail schien Olivia nicht empfänglich zu sein.
»Herbert«, hauchte sie. »Was für ein Charmeur.« Sie ließ sich auf den freien Stuhl neben dem von ihrer Schmeichelei augenscheinlich unbeeindruckten Herbert gleiten, ohne ihn auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen.
Ludwig schien vorrübergehend in Vergessenheit geraten zu sein, was er nicht bedauerte. Und doch setzte ihm das Szenarium zu. Von der Bauchmitte zur Brust, von dort in den Hals spürte er Hitze aufsteigen. Ja, es war warm heute, sehr warm, aber mit den hohen Junitemperaturen hatte das Feuer in ihm nichts zu tun.
»Ludwig, in eurem Kühlschrank habe ich eine angebrochene Flasche weißen Merlot gesehen. Der würde uns jetzt bestimmt besser schmecken als dieser Gesundbrunnen.« Herbert hob das Glas mit dem Tee und hielt es mit einem zusammengekniffenen Auge prüfend in die Höhe. »Was meinst du?«
Was er meinte? Zum Beispiel, dass er es begrüßt hätte, wenn sich der Teufel persönlich seines übergriffigen Vaters annähme. Vorzugsweise sofort. Aber der Teufel tat ihm so wenig diesen Gefallen, wie Ludwig zum feuerspeienden Drachen wurde. Und doch musste er sich seiner inneren Glut entledigen. Er ging in die Küche, öffnete den Kühlschrank und ließ die ihm entgegenströmende Kühle auf sich wirken. Die erhoffte Linderung blieb aus.
***
»Und warum hast du nichts gesagt?«
»War nicht der Moment.« Ludwig kaute am letzten Bissen seiner Pizzahälfte. Tabeas Frage war berechtigt. Aber hätte er in Olivia Herzigs Anwesenheit eine Grundsatzdiskussion über die Regeln des Zusammenlebens in einem Haus vom Zaun brechen sollen? »Werde ich aber noch tun.«
Tabea nickte. Ludwig staunte über ihre Ruhe. Er hatte seine Frau in Locarno vom Bahnhof abgeholt. Trotz eines langen Arbeitstags und zweieinhalb Stunden Zugfahrt wirkte sie um einiges frischer und entspannter als er. Bei alledem hätte sie gute Gründe gehabt, ihn an die Zweifel zu erinnern, die sie Monate vor ihrem Umzug so oft geäußert und die er immer wieder weggewischt hatte.
Sie saßen an einem der dem See nahen Tische ihrer Lieblingspizzeria, der »Osteria Nostrana«, an Asconas Uferpromenade, tranken weißen Merlot, an dem sich Herbert zum Glück nicht vergehen konnte, und teilten sich eine Pizza Capricciosa. Obwohl die Saison noch nicht in vollem Gang war und der Abend bei leichter Brise im Vergleich zum Tag fast ein bisschen kühl ausfiel, hatten sie sich mit dem letzten freien Tisch begnügen müssen. Um sie herum aßen, tranken, plauderten und lachten Urlauber in bester Ferienlaune, um die Ludwig sie beneidete. Ferienlaune war auch die alles dominierende Stimmung gewesen, wenn sie Herbert in den letzten Jahren in der Villa Felicità besucht hatten. Nicht oft und auch nicht lange, seit seine Mutter tot war. Aber doch immer wieder.
»Und diese Olivia hat ihn richtig angehimmelt? Ist mir ein Rätsel, was eine Frau an deinem Machovater finden kann.« Tabea gab dem zwischen den Tischen hin und her eilenden Kellner ein Zeichen, ihnen die Rechnung zu bringen. »Ich dachte eigentlich, Herbert sei auf seine alten Tage zur Ruhe gekommen.«
»Na ja, es sah nicht unbedingt so aus, als hätte er Interesse an ihr. Aber ob er nun mit seinen sechsundsiebzig Jahren den amourösen Abenteuern Adieu gesagt hat …?« Ludwig dachte an die Affären seines Vaters und die nicht seltenen Anrufe seiner Mutter, wenn sie nach mehreren Gläsern Wein und mit schwerer Zunge ihre Dauerklage hervorgebracht hatte: »Erhatwiedereineandere.«
Jedes Mal hatte er ihr nahegelegt, sich von ihrem Mann zu trennen, doch endlich zu gehen. Sie war dann auch gegangen, aber anders, als Ludwig es gemeint hatte. Vom Sofa gekippt war sie. Einfach so. Und als wenn es noch ein weiteres Ausrufezeichen gebraucht hätte, hatte sich bei diesem finalen Akt ihr letztes Glas Rotwein über den hellen Berberteppich der längst verblichenen Schwiegereltern ergossen. Die Reinigung beim Spezialisten – mit unbefriedigendem Resultat – war Herbert ein Anliegen gewesen.
Herzversagen, hatte er vor zehn Jahren am Telefon mit schwacher Stimme gesagt und sich noch eine Weile in der Rolle des betrübten Witwers gefallen. Möglich, dass er tatsächlich um seine Frau getrauert hatte. Sein Vater und Gefühle, das war ein schwieriges Thema.
»Du denkst an Louise«, sagte Tabea, während sie in ihrer Tasche nach dem Portemonnaie suchte.
Ludwig antwortete nicht. Tabea hatte auch nicht gefragt, sondern einfach festgestellt.
Louise, seine talentierte Mutter, die in ihrem lichtdurchfluteten Atelier im obersten Stock des Hauses farbenfrohe Aquarelle gemalt hatte, wenn es ihr gut ging.
Ach, überhaupt das nun leer stehende Atelier. Wie ausgezeichnet es sich doch als Fotostudio eignen würde und mit welcher aufreizenden Beiläufigkeit sein Vater das Gespräch abgewürgt hatte, als er mit dem Vorschlag für eine neue Nutzung an ihn herangetreten war.
Ludwig ließ den Blick über den Lago Maggiore schweifen. Grauschwarz lag er vor ihnen, von den in der Dunkelheit nur als Konturen erkennbaren Bergketten umrandet; an seinen Ufern erhellt von den Lichtern der Häuser und Straßen der östlichen und westlichen Seeseite. »Wie schön es hier ist«, sagte er schließlich. »Sein kann. Sein könnte …«
5
Tabea
Zürich und Ascona – im Juni
Eine Ehe, eigentlich jede sehr nahe Beziehung, konnte manchmal wie eine Wippe sein, auf der zwei Menschen an ihrem jeweiligen Ende saßen. Einer unten, einer oben, je nach Gewicht und Schwung. Man hielt sich an einem Griff fest, stieß sich abwechselnd vom Boden ab und befand sich vorübergehend im Gleichgewicht. Doch mehrheitlich gab es entweder die Nähe zum Boden oder die luftige Höhe.
Als es um die Entscheidung gegangen war, unser Domizil von Zürich nach Ascona zu verlegen, war ich die dem Boden Nahe gewesen, und Ludwig hatte mir von oben seine Ermunterungen zugerufen und meine Bedenken zerstreut. Jetzt, fünf Monate später, schwebte ich in der Luft. Nun gut, »schweben« und »Luft« waren wirklich nur Metaphern. Und doch, meine zweitägige Pendelreise nach Zürich gefiel mir. Auch meine altvertraute und oft missliebige Arbeit kam mir plötzlich, zwei Wochen vor Schuljahresende, fast begehrenswert vor. Die zwei Abende bei Mimi, sogar mein wackliges Bett in der Abstellkammer ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung hatten den Charme einer Kurzreise. Ludwig hingegen begrüßte mich bei meiner Rückkehr oft mit saurer Miene und immer neuen Herbert-Geschichten. Er stieß, um beim Bild der Wippe zu bleiben, ziemlich oft mit den Füßen auf dem Boden auf.
»Eigentlich finde ich tausendfünfhundert Franken Miete happig«, sagte Mimi, nachdem ich sie auf den neuesten Stand der Ereignisse gebracht hatte. »Ich meine, Ludwig ist der Sohn. Da macht man als Vater doch einen Sonderpreis.«
»In Zürich wäre eine Wohnung mit Garten und in so einer Lage dreimal so teuer«, gab ich zu bedenken. »Und auch in Ascona müsste man dafür normalerweise mehr hinblättern.« Keine Ahnung, warum ich plötzlich meinte, Herberts Mietforderung herunterspielen zu müssen.
Wir saßen auf Mimis Minibalkon auf den ausnahmsweise nicht von Simon und Garfunkel beschlagnahmten Klappstühlen. Unsere noch bleichen Beine hatten wir – Gipfel der Bequemlichkeit – mit Kissen unterlegt auf dem Balkongeländer platziert. Kurz zuvor hatten wir uns vorgestellt, zwei Kreuzfahrtreisende mit nobler Verandakabine zu sein. Das Geländer war zur Reling geworden und die Straße unter uns zu nichts Geringerem als dem Pazifik. Nur den Martinicocktail mussten wir uns nicht ausdenken. Den konnten wir uns locker leisten.
»Stimmt. Das kannst du natürlich nicht vergleichen.« Mimi spann noch immer am Faden ihrer durchaus berechtigten Überlegungen zu unserer Miete. »Aber als Vater verlangt man doch eher einen symbolischen Beitrag, oder? Nicht dass ich da Erfahrung hätte.«
Mimi kam aus einfachen Verhältnissen. Elterliche Wohnungen in privilegierter Lage, weder günstig überlassen noch geschenkt, gab es bei ihr nicht.
»Dieser Herbert hat doch wohl Geld genug, nehme ich an.«
»Klar«, bestätigte ich ihre nicht besonders gewagte Spekulation. Herbert hatte noch nie den Drang verspürt, mit uns über seine Finanzen zu sprechen, aber als ehemals gefragter Treuhänder und Finanzberater, der seine Finger in vielerlei lukrative Geschäfte getaucht hatte, war Geld bei ihm garantiert keine Mangelware. Die Villa Felicità, die er als einziger Nachkomme der alten Kummers mit niemandem teilen musste, war mit ihren zweitausend Quadratmetern Land ein hübsches Sümmchen wert.
»Siehst du!« Mimi triumphierte, als hätte sie mich nach langem Ringen von etwas sehr Wichtigem überzeugt.
»Vor einem halben Jahr hast du so getan, als hätten wir mit Herberts Angebot das große Los gezogen.« Ich schmollte ein wenig, aber nur so pro forma. War ich nicht selbst diejenige gewesen, die kein gutes Haar an Herberts Beweggründen und Tun gelassen hatte? Und wenn ich ehrlich mit mir war, hatte mein Misstrauen nichts an seiner Kraft eingebüßt. Aber hier und jetzt, zweihundert Kilometer von Ascona entfernt, wollte ich Martini schlürfen und mich wie die Passagierin eines Luxusliners fühlen. Zumindest wünschte ich mir, mich ohne zwickende Gedanken auf die nahen Sommerferien und mein bestens gedeihendes Gemüse im Garten der Villa Felicità freuen zu können.
***
In Ermangelung meines persönlichen Chauffeurs – Ludwig war zu einem Shooting ins Engadin gefahren und kam erst später nach Hause – hatte sich meine Zugreise von Zürich nach Locarno um eine Busfahrt und einen schweißtreibenden Aufstieg in die Strada Rondonico verlängert. Ich lechzte nach einem Glas Zitronenwasser, eisgekühlt, und nach einer Dusche.
Am Tor zur Villa kam mir von dessen Innenseite eine gestylte Blondine entgegen, deren Frischegrad meinen eigenen weit übertraf. Wo bei mir Haarsträhnen in Bündeln an Stirn und Nacken klebten, gab es bei ihr nur luftig Geföhntes. Mit undefinierbarem Gemurmel, bei dem es sich entweder um einen Gruß handelte oder um das Fragment eines in ihre Smartwatch geraunten Telefongesprächs, schob sie sich durch das minimal geöffnete Tor, das sie gleich wieder hinter sich zuzog. Vielleicht hielt sie mich für eine in fremde Gärten lugende Vagabundin, der man schleunigst den Eintritt verwehren musste.
»Die ist immer so«, hörte ich eine Männerstimme hinter mir sagen, nachdem die Geföhnte außer Hörweite war. Es war Paul vom Feinschmeckertrio. »Ob ich dich ganz ungalant darum bitten dürfte, mir das Tor zu öffnen?« Er hatte tatsächlich keine Hand frei. Auf einer Tortenplatte und unter einer transparenten Abdeckung türmte sich eine Vielzahl hübsch anzusehender Himbeertörtchen, die er mit Gefühl transportierte.
Paul war Konditor, hatte früher mal eine gut gehende Patisserie in Zürich gehabt und war tragende Säule der kochenden und schlemmenden Dienstagsgruppe, zu der auch Herbert und ein gewisser Mario gehörten. Letzteren kannte ich nur flüchtig, wusste aber, dass er eine Segelyacht auf dem Lago besaß und, von der Yacht mal abgesehen, der am wenigsten Begüterte war.
»Wer war das denn?«, fragte ich Paul. »Und was meinst du mit ›immer so‹?«
»Na ja, ist vermutlich nicht die richtige Formulierung. Aber das erzähle ich dir ein anderes Mal.«
Der leicht abwärts führende Gartenweg zur Villa hatte seine Tücken. Paul, der vor mir ging, vollführte einen akrobatisch anmutenden Balanceakt, der seine gesamte Konzentration in Anspruch nahm.
Wir hatten das ebene Wegstück vor Herberts Haustür erreicht.
»Oder lass dir von Herbert über sie berichten. Wundert mich überhaupt, dass er sie euch noch nicht vorgestellt hat. Schließlich geht La Bionda regelmäßig bei ihm ein und aus. Giuseppe könnte sich eigentlich mal um den Weg hier kümmern. Da bricht man sich ja die Haxen.« Paul schien genug von dem Blondinen-Thema zu haben. Seine Unversehrtheit war ihm wichtiger.
Ich mochte es nicht, wenn jemand etwas andeutete und dann nicht weitersprach. Dazu war ich zu neugierig. Als kleinliche Revanche klärte ich Paul deshalb auch nicht darüber auf, dass Giuseppe sich hier bald um gar nichts mehr kümmern würde. Nicht um unebene Wege und nicht um wucherndes Gestrüpp.
»Warum seid ihr nicht bei dir?«, erkundigte ich mich.
Ich kannte Paul von früheren Besuchen und wusste, dass sein luxuriöses Zuhause alle zwei Wochen der Schauplatz eines Koch-, Ess- und Trinkgelages wurde. Er war Witwer wie Herbert und besaß eine Terrassenwohnung weiter oben am Hang, fünfzehn Minuten Fußweg von der Villa Felicità entfernt.
Seine mit jedem erdenklichen Schnickschnack ausgestattete Küche hätte auch einen Chef de Cuisine der Spitzenklasse ins Schwärmen gebracht. »Chez Paul« war denn auch der Ort, an dem Herbert, Mario und der Hausherr ihre kulinarischen Kreationen zur Vollendung brachten. Vom ersten mis en place bis zum finalen Verzehr. Vom ersten Glas bis zum letzten.
»Nein, fällt aus. Mario ist bei seiner Tochter im Piemont. Nur für zwei heize ich den Lavasteingrill nicht an. Ist sowieso zu heiß. Die Törtchen habe ich heute früh gemacht. Nicht totzukriegende Leidenschaft.« Er lachte und zuckte mit den Schultern, als müsste er sich entschuldigen. »Nur blöd, dass es dann niemanden gibt, der das Zeug isst. Und jetzt habe ich gedacht, dass vielleicht Herbert …« Er hielt inne. »Weißt du was? Nimm du sie einfach. Ich bringe sie schnell runter in eure Wohnung.«
Mir war nicht nach höflichem Protest. Zwar liebte Herbert Süßes, aber der konnte sich auch mal in Verzicht üben. Bei Ludwig und mir waren die Himbeerkreationen bestens aufgehoben.
Und so setzten wir unsere kleine Prozession fort und ließen Herberts Haustür auf dem Weg nach unten linker Hand liegen.
Das Grundstück der Villa Felicità hatte durch seine Hanglage nur wenig ebenes Terrain, das sich in Form von kleinen Rasenflächen, dem Lustgärtchen und einigen Sitzplätzen präsentierte. Unsere Wohnung, deren hinterer Teil eigentlich ein Kellergeschoss war, betraten wir durch eine seitliche Tür. Es waren die zwei Terrassen mit direktem Gartenzugang, die es uns mehr als alles andere angetan hatten. Zudem hatten wir uns erhofft, durch die gesamte Anordnung gründlich von Herberts weitaus geräumigeren Wohngeschossen abgetrennt zu sein. Dieser Glaube hatte sich als zu optimistisch, vielleicht sogar als naiv erwiesen. Womit wir nicht gerechnet hatten: Für Herbert war kein Weg zu beschwerlich, kein Pfad zu unwegsam, wenn es darum ging, bei uns aufzukreuzen. Ungebeten, unangemeldet und unerwartet.
Auf halber Strecke sahen wir Matilda auf einer Steinbank unter den hängenden Ästen einer Weide sitzen. Das war in mehrfacher Hinsicht verwunderlich. Zum einen, weil man Herberts Haushaltshilfe so gut wie nie sitzend antraf. Dazu war sie zu emsig. Zum anderen, weil es halb acht war und sie zu dieser Zeit längst im heimischen Cannobio hätte sein sollen. Ihr Arbeitstag war lang genug.
Die nach vorn gebeugte Matilda, der die Weidenäste übers dunkle Haar strichen wie die dünnen Arme tröstender Geister, gab ein trübsinniges Bild ab. Das stand im Kontrast zu ihrem fast immer frohgemuten Wesen, an dem die Launen des Hausherrn abperlten wie Wassertropfen auf den von ihr auf Hochglanz polierten Holzdielen des Wohnzimmers.
»Matilda?« Ich trat einen Schritt auf sie zu. »Tutto bene?«
Sie schaute zu mir hoch und nickte. Dass alles gut sei, stimmte allerdings nicht mit ihren rot umränderten Augen überein. Die Unsinnigkeit meiner Frage hätte mir schon vorher klar sein müssen. Man saß nicht mit hängendem Kopf unter einer Trauerweide, wenn einem nach Jubelgesang zumute war. Hier war etwas aus den Fugen geraten.
Das verstand auch Paul, der sich ungefragt neben Matilda auf der Bank niederließ, die Plastikabdeckung von seinen Törtchen hob und ihr die Platte entgegenhielt. Das war gut gemeint, aber ich konnte Matildas Kopfschütteln gut verstehen. Wer drückte schon bei akutem Kummer mal eben mit Sahnecreme unterlegtes Himbeergebäck in sich hinein? Das Frustessen – oder wohlklingender: emotional eating – kam meist in einer zweiten Phase der Trübsal. Bei dieser Theorie bediente ich mich meiner eigenen Erfahrung.
Weil ich physischen Beistand hilfreich fand, tat ich es Paul gleich und setzte mich ebenfalls neben Matilda, einfach auf der anderen Seite der Bank. Und da Paul die Törtchen nun schon mal freigelegt hatte, griff ich mir eines davon. Offenbar wirkte mein beherzter Zugriff anregend, denn auch Paul nahm sich eines.
Mit zwei Essern neben sich hatte wohl auch Matilda das Gefühl, so ein Törtchen könne, wenn schon nicht helfen, dann doch zumindest nicht schaden.
Für einen Moment sah ich uns sitzen, wie vielleicht ein Maler oder Fotograf uns gesehen hätte: ein Trio vom Zufall zusammengewehter Törtchenesser, dicht nebeneinander unter einer Trauerweide, in kauendem Schweigen vereint.
»Mi ha licenziata«, sagte Matilda endlich, nachdem sie den letzten Bissen runtergeschluckt und einen Himbeerkern aus einem Zahnzwischenraum geklaubt hatte. Sie wies zum mittleren Geschoss des Hauses, ungefähr dahin, wo sich Herbert vermutlich aufhielt, wenn er nicht irgendwo hinter einem Busch lauerte.
»Gekündigt«, übersetzte Paul für mich.
Ich nickte wissend. Mein Italienisch hatte erhebliche Fortschritte gemacht. Für so einen Drei-Wort-Satz brauchte ich nun wirklich keinen Dolmetscher.
Unsere Augen trafen sich über Matildas erneut gesenktem Kopf. Auch Ratlosigkeit konnte Verbindendes an sich haben. War Herbert vom Kündigungswahn befallen? Es war noch nicht lange her, da hatte er Giuseppe entlassen. Und nun seine Haushaltshilfe. Falls er jetzt auf die Idee kam, Ludwig und mich zum Bodenschrubben und Fensterputzen einzuspannen, dann konnte er sich auf etwas gefasst machen.
»E perché?«, fragte ich Matilda, wohl ahnend, dass es wie schon bei Giuseppe keinen stichhaltigen Grund gab.
»Mein Essen nicht mehr gut.« Die bisher zurückgehaltene Wut platzte mit geballter Kraft aus ihr raus. »Le mie pietanze sono le migliori in assoluto. Questo idiota non capisce una mazza.«
Ich verzieh der gekränkten Matilda ihre Übertreibung. Auch wenn sie, wie ich von früheren Besuchen wusste, wirklich ausgezeichnet kochte und ihre Tagliatelle al Ragù mindestens einen Michelin-Stern verdienten, betrieb sie ein bisschen zu viel des Selbstlobs. Mir war es ohnehin immer ein Rätsel gewesen, weshalb sich der mit bestem Ergebnis in der Küche hantierende Herbert auch noch bekochen ließ. Faulheit, war Ludwigs Hypothese dazu. Blanke Faulheit.
Was Matildas wütenden Ausbruch vom rein nichts verstehenden Idioten betraf, mit dem niemand anders als ihr schäbiger und demnächst ihrer Vergangenheit angehörender Arbeitgeber gemeint sein konnte, wollte ich nicht widersprechen. Wie es aussah, befand sich mein Schwiegervater entweder in einem Zustand geistiger Verwirrung, oder er gefiel sich als Ekel vom Dienst.
»Ich werde mit Herbert sprechen«, kündigte der etwas hilflos wirkende Paul an. »Gli parlerò.«
»Nützt nichts.« Matilda schüttelte so heftig den Kopf, wie das nur jemand tun konnte, der an die Kraft des Gesprächs nicht glaubte. Insbesondere, wenn es um Herbert Kummer ging.
Diese Sichtweise teilte ich mit ihr.
»Che bastardo!«, rief Matilda unvermittelt, griff nach der Handtasche zwischen ihren Füßen, stand auf und stapfte wegaufwärts davon.
War es das Törtchen, das den Elan in ihr freigesetzt hatte, war es die befreiende Kraft einer parolaccia, eines Schimpfworts? Oder sogar das karge Gespräch mit Paul und mir? In jedem Fall war sie außer Sichtweite, als Herbert mit dem ihm dicht auf den Fersen folgenden Bruno um die Hausecke bog. Die beiden kamen – und das gefiel mir gar nicht – von unten. In den Händen hielt er fünf prächtige Zucchiniblüten. Aus meinem Gemüsegarten.
»Warum hast du die abgepflückt?«, schrie ich.
Ich war aufgesprungen und lief dem Blütenkiller entgegen. Wenn überhaupt jemand so etwas tun durfte, dann ich. Was er in der Hand hielt, waren weibliche Blüten, die sich noch zu Früchten ausbilden sollten.
»Die will ich frittieren.« Mein Schwiegervater kommentierte seinen Frevel mit einem Lächeln.
»Dafür nimmt man die männlichen Blüten!« Meine Stimme hatte eine schrille Note, die mit Leichtigkeit ins Heulen kippen konnte.
Che bastardo, hatte Matilda vorhin unfein gesagt, womit sie garantiert nicht Bruno gemeint hatte, der zumindest ein reinrassiger Basset Hound war.
Bastardo, bastardo, bastardo.
6
Ludwig
Ascona – im Juli
Herbert hatte sich reuevoll gezeigt. Er hatte von einem weiteren Überraschungsauftritt aus dem Hinterhalt abgesehen, bei Tabea geklingelt, wie es sich gehörte, und ihr ein Kistchen mit acht Setzlingen entgegengehalten. »Aus biologischer Anzucht«, hatte er verkündet. Ganz so, als bestünde seine Gabe aus einer Kollektion weißer Alba-Trüffel. »Alles seltene Zucchinisorten. Romanesco, Gold Rush und Tondo chiaro di Nizza.«
Das hatte Ludwig nicht selbst erlebt. Tabea hatte es ihm mit schauspielerischer Untermalung berichtet.
»Jedenfalls sollen wir nachher zum Abendessen hochkommen. Zur Wiedergutmachung.« Sie erweckte nicht den Eindruck, als habe sich Herbert im Eilverfahren und mit ein paar raren Biopflänzchen rehabilitieren können.
Ludwig war erschöpft und gereizt. Der Fototermin anlässlich eines Kindergeburtstags hatte sich als Strapaze erwiesen. Die geladene Kinderschar, die sich weder von der eigens für sie aufgebotenen Gelateria auf Rädern noch von einem Zauberer und noch viel weniger von einem verzweifelt um Lacher bemühten Clown hatte beeindrucken lassen, war auch beim Shooting nicht in Stimmung geraten. Die Dame des Hauses hatte sich bei der schnellen Durchsicht der Fotoausbeute zu einem ungehaltenen »Das hätte ich auch selbst machen können« hinreißen lassen, woraufhin Ludwig ihr vorgeschlagen hatte, das doch das nächste Mal bitte zu tun. Damit hatte er zwar bewiesen, kein Kriecher zu sein. Geschäftsfördernd war es nicht.
In jedem Fall war ein Essen bei seinem Vater nicht das, was er sich für den schwülen Abend vorgestellt hatte. Andererseits bestand die Möglichkeit, dem Hausfrieden bei einem Glas Wein zur Regeneration zu verhelfen. Das war eine sehr optimistische Vision, wenn man davon ausging, dass von einem solchen nie viel vorhanden gewesen war und die spärliche Substanz durch Herberts barbarischen Zucchiniblüten-Überfall ins Minus gerutscht war. Aber Ludwig wollte die Gelegenheit beim Schopf fassen, einen erneuten Vorstoß bezüglich des ungenutzten Ateliers im Obergeschoss zu wagen. Ihm schwebte der Anbau einer Außentreppe vor. Eine leichte Metallkonstruktion, die sich gefällig an die vorhandene Bausubstanz anpassen und ihm damit zu einem eigenen Fotoatelier mit separatem Zugang verhelfen würde. Er wollte Herbert die Übernahme der entstehenden Kosten und eine, nun ja, doch eher im Symbolischen angesiedelte Mietzahlung vorschlagen.
»Wir sollten die Einladung als Geste seines guten Willens sehen«, sagte Ludwig mehr zu sich selbst als zu Tabea. »Lass uns eine Flasche von dem Barolo mitnehmen, den wir in Luino gekauft haben.« Ein exquisiter Tropfen kam bei Herbert immer gut an und konnte das Terrain für die Besprechung der Atelierangelegenheit planieren.
»Barolo?« Tabea sah aus, als wollte sie weder eine Flasche des edlen Getränks noch ihre wertvolle Zeit opfern.
Dafür hatte Ludwig Verständnis, aber sie mussten an die Zukunft denken. An ein friedliches Zusammenleben und das eigene Fotoatelier.
***
»Kommt rein, kommt rein!« Herbert trug Shorts und eine Latzschürze, was in der Kombination etwas merkwürdig aussah. »Ein Barolo Bussia 2017. Nicht übel.« Er nahm Ludwig den Wein aus der Hand, noch bevor er zum Überreichen kam. »Schuhe ausziehen«, ermahnte er seine Gäste, während er selbst sich mit seinen pinkfarbenen Pantoffeln mit Filzsohlen wieder auf den Weg in die Küche machte. Offenbar hatte er bereits an putztechnisch geeignetes Schuhwerk gedacht, denn für das Polieren des Holzparketts würde es bald keine Matilda mehr geben.
Ludwig war mit Tabea übereingekommen, Herberts unerklärliche Kündigungswut heute Abend nicht zu thematisieren. Die Sache mit dem Atelier hatte Vorrang.
»Ich muss hier noch ein bisschen was vorbereiten. Geht ihr schon mal auf die Terrasse.« Das war eine von Herberts nicht seltenen Anordnungen, die er ihnen aus der Küche zurief. »Heute Abend seid ihr meine lieben Gäste.«
Obwohl Ludwig durchaus vom Gastsein ausgegangen war, waren ihm die Flötentöne seines Vaters nicht geheuer. Tabea ging es offenbar ähnlich. Nur so konnte er sich ihre nach oben gezogenen Brauen erklären.
Sie durchquerten das weitläufige Wohnzimmer, dessen südöstlich ausgerichtete Fensterfront von den schweren, dunklen Samtgardinen befreit worden war, die Herbert tagsüber zum Schutz des Mobiliars vor dem Sonnenlicht zuzog.
Bruno, der auf seinem in Farbe und Material zu den Vorhängen passenden Hundebett lag und von dem nur für ihn platzierten Ventilator angeblasen wurde, machte außer dem leichten Anheben seines lang gezogenen Hundekopfs keine Anstalten, sie zu begrüßen.
Der Terrassentisch war gedeckt. Für vier Personen.
»Hat er zu dir gesagt, dass noch jemand eingeladen ist?« Die an Tabea gerichtete Frage geriet Ludwig lauter als beabsichtigt.
»Dann hätte ich das doch erwähnt«, zischte Tabea.
»Habe eine liebe Bekannte eingeladen.« Herbert besaß die Fähigkeit, wie ein Pilz aus der feuchten Walderde zu schießen. Hatte er nicht eben noch klappernd mit Geschirr hantiert? In den Händen hielt er ein Tablett mit drei gefüllten Gläsern und einem Schälchen Pistazien.
»Was denn für eine Bekannte?« Ludwig ließ das heute großzügig von seinem Vater eingeflochtene »liebe« weg.
»Setzt euch. Wir können schon mal anstoßen.« Herbert hatte offenbar nicht vor, ihm zu antworten.
»Was hast du uns denn da eingegossen? Sollen wir raten?« Tabea, die von Herberts Vorliebe für Schnäppchenkäufe wusste (vornehmlich wenn es um die Verkostung seiner Gäste ging) und nicht gern etwas ins Blaue hinein trank, wie sie es nannte, wirkte leicht gereizt.
Ludwigs Hoffnung auf günstigen Wind für die Ateliergeschichte schwand. Umso mehr, als eine vierte Anwesende der Sache nicht zuträglich sein würde.
Herbert ignorierte auch Tabeas Frage und überreichte jedem ein Glas. »Auf den Sommer«, sagte er. »Auf unser harmonisches Zusammenleben in der wunderschönen Villa Felicità.«
»Cincin«, sagte Tabea.
»Cincin. Auf dieses herrliche Fleckchen Erde und dieses großzügige Anwesen.« Im Gegensatz zu Tabea wollte auch Ludwig ein Scherflein zu Herberts Harmoniebeschwörungen beitragen. Ganz unverhofft hatte ihm sein Vater ein Fenster für sein Anliegen geöffnet. Jetzt, bevor diese mysteriöse Bekannte auftauchte, musste er die Sache anpacken. »Ähm, da wir gerade von der Villa Felicità sprechen. Du kennst doch meinen Freund, den Architekten Francesco Amato. Der hat eine wirklich raffinierte Idee, wie man mit einer eleganten Edelstahltreppe auf der Nordseite einen äußeren Zugang zum Obergeschoss für ein Fotoatelier schaffen könnte. Ein kleiner Durchbruch in der Wand, ein separater Eingang, und fertig wäre die Chose. Natürlich auf meine Kosten.«
Aus den Augenwinkeln nahm Ludwig Tabeas Verwunderung wahr. Ihren leicht geneigten Kopf, das etwas gezwungene Lächeln. Er war sich bewusst, sein Verlangen gehetzt vorgetragen zu haben. Mit einem großen Schluck kippte er ein erhebliches Quantum des süßlichen Spumante in sich hinein. Erst dann sah er seinen Vater an, dessen Augenmerk in die Ferne gerichtet war.
Entgegen Herberts Aufforderung waren sie alle stehen geblieben. Er selbst gegen die Brüstung gelehnt. »Versonnen« hätte Ludwig seines Vaters Pose genannt, wäre dieser nicht ein Mann, zu dem Nachdenklichkeit gar nicht passte. Herbert war ein Macher, kein Denker. Konnte es sein, dass er ihn gar nicht gehört hatte? Ein akustisches Problem? Eine vorübergehende Absenz?
»Anwesen in dieser Lage gibt es nicht viele. Diese Aussicht muss man auf sich wirken lassen. Immer wieder aufs Neue«, unterbrach Herbert Ludwigs Grübelei. »Wer weiß schon, wie lange wir das noch genießen können.« Und dann, als hätte er auf einen Kippschalter gedrückt: »Verdammt schwül heute. Könnte ein Gewitter geben. Vermutlich aber erst nach Mitternacht. Wir müssen uns vorerst keine Sorgen machen.«
Nein, Ludwig machte sich keine Sorgen wegen des Gewitters. Was interessierte ihn das? Wenn es nach ihm ging, konnten die Blitze im Minutentakt niedergehen. Sofort und genau hier. Wenn ihn etwas umtrieb, dann das anschwellende Bedürfnis, seinen Vater an den Schultern zu packen und zu schütteln. Ich habe eben mit dir gesprochen. Hörst du mich? Gesprochen! Kannst du mir, verdammt noch mal, einfach antworten?, wollte er rufen. So laut, dass man ihn noch unten an der Uferpromenade hören konnte. Doch er rief nichts, leerte stattdessen sein Glas und versuchte, Blickkontakt mit Tabea aufzunehmen. Es war wie verhext, auch sie schien sich plötzlich dem Zeitvertreib des In-die-Ferne-Schauens hinzugeben. Hatte er da irgendeinen Trend verpasst? Dabei war die Ausbeute bescheiden. Die hohe Luftfeuchtigkeit hatte alles in milchiges Licht gehüllt und den See mit einem Schleier überhängt. Vista lago in reduzierter Form.
Der Stoff seines Hemds pappte an Ludwigs Brust, als hätte er sich den Sekt nicht einverleibt, sondern in den Kragen gegossen. Sollte er doch kommen, der verdammte Gewitterregen, und ihm mit seinem prasselnden Nass nicht nur die Klebrigkeit, sondern auch gleich die Wut abspülen!
»Da ist jemand«, sagte die von Ludwigs Turbulenzen unberührte Tabea, die sich zur Terrassentür gewandt hatte.
Jemand. Wie es klang, war die Wortwahl kein Zufall.
»Unsere wunderschöne Kassandra Zweiglein-Bordoli!«, rief Herbert, um ein Vielfaches enthusiastischer, und ging auf die Blondine zu, die sich auf der Schwelle zur Terrasse – einen Arm lässig gegen den Türrahmen gelehnt, den anderen in die Taille gestemmt, ein Bein angewinkelt – in Pose geworfen hatte.
Von Herberts Damenbesuch hatte Tabea Ludwig schon bei anderer Gelegenheit berichtet. Kennengelernt hatte er die Frau, der sein Vater so eine überschwängliche Begrüßung zukommen ließ, jedoch noch nicht.
Sogar Bruno hatte sich von seinem ventilierten Hundebett erhoben und schnüffelte an dem mit Glitzersteinen besetzten Sneaker, mit dem die »wunderschöne« Kassandra bei allem Chic noch Bodenhaftung bewahrte.
***
Es wollte sich kein Schlaf einstellen.
Fulmini, tuoni, fulmini, tuoni. Blitze, Donner, Blitze, Donner.
Nahm dieses Gewitter denn kein Ende?
Und doch hatte die Schlaflosigkeit ihr Gutes, denn langsam entwirrten sich die Gedanken, die so lange ihr verästeltes Unwesen getrieben hatten.
Es musste eine saubere Sache sein. Ja, absolut sauber. Kein Blut. Nichts Abstoßendes.
Möglicherweise würde es Kollateralschäden geben. So war das Leben.
Heiseres Gelächter durchdrang die kurze Stille zwischen Blitz und Donner. War da noch jemand? Nein, niemand sonst konnte lachen über so etwas wie einen sauberen Tod.
Una morte pulita.
Nur diese eine Person, die keinen Schlaf fand. Aber das würde bald vorüber sein. Dann würde Ruhe eintreten.
Pace dell’anima.
Seelenfrieden.
7
Tabea
Im Juli





























