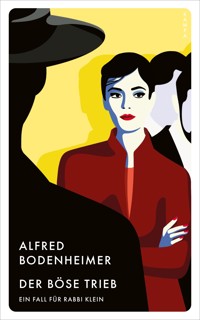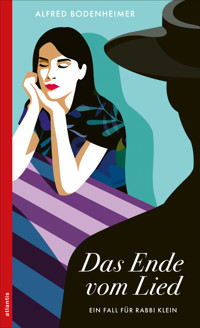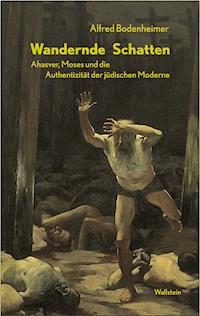Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Red Eye
- Sprache: Deutsch
Mitten im Lockdown werden die Knesset- Abgeordnete Ruchama Wacholder und ihr Ehemann Gil beim Spaziergang mit ihrem Hund Itztrubal auf offener Straße erschossen. Als lasteten die Corona-Pandemie und der völlige Stillstand des gesellschaftlichen Lebens nicht schon schwer genug auf den Gemütern, denkt sich Polizeipsychologin Kinny Glass. Der Fall geht ihr auch persönlich nahe: Kinnys Ex-Mann Ariel hat mit Gil Wacholder zusammengearbeitet. Auf dem Laufenden hält sie der leitende Ermittler Nissim - der allerdings nicht wirklich ihr »Neuer« ist, wie Kinnys Tochter Mia behauptet. Mehrere Zeugenaussagen deuten auf einen islamistischen Terroranschlag hin, doch der Wirbel um regierungskritische äußerungen von Ruchama Wacholder lässt eher ein parteipolitisches Motiv vermuten. Als der israelische Geheimdienst den Fall an sich reißen will, soll Kinny im Namen der Polizei verhandeln. Wenn man sie schon einspannt, wird sie wohl auch ein wenig ermitteln dürfen, entscheidet die Psychologin. Dass sie Iztrubal zu sich genommen hat, macht die Sache leichter: Gemeinsam mit dem Yorkshireterrier erlaubt sie sich trotz Ausgangssperre den ein oder anderen Spaziergang durch die leeren Straßen Jerusalems.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfred Bodenheimer
Mord in der Strasse des 29. November
Ein Jerusalem-Krimi
Kampa
1
Kurz nach Mitternacht hatte mehrfaches Sirenengeheul von Polizei- oder Krankenwagen sie geweckt, ziemlich lange und penetrant, offenbar in einem benachbarten Quartier. Aber ihr Telefon blieb stumm, also musste sie auch nicht mehr wissen. Sie schlief rasch wieder ein, doch um kurz nach drei Uhr wachte sie wieder auf. Es war kalt im Zimmer – ein Winter, der nicht zu enden schien.
Die letzten Wochen ihrer fast vollständigen Einsamkeit hatten bei Kinny Glass Spuren hinterlassen. Natürlich war sie dauernd über Videoplattformen und per Telefon mit allen möglichen Kolleginnen und Kollegen im Gespräch, und in einzelnen Fällen rief man sie auch persönlich dazu. Vor einigen Tagen hatte sie einen verzweifelten Familienvater am Sprung vom Balkon seiner Wohnung in einem der modernen Hochhäuser von East Talpiot hindern müssen. Sie hatte es am Ende geschafft und war nach vielen Stunden völlig erschöpft nach Hause gefahren.
Bis vor Kurzem hatte der Mann gut gelebt, hatte seiner Familie erst vor wenigen Jahren die hübsche Vierzimmerwohnung im vierzehnten Stock gekauft, sie war sein ganzer Stolz. Doch dann kam der seger, der Lockdown des ganzen Landes. Seine Frau wurde von dem Kleidergeschäft, in dem sie arbeitete, sofort entlassen – da sie erst gut zwei Monate dort arbeitete, hatte sie kein Anrecht auf Arbeitslosengeld –, und er musste sein Geschäft für Souvenirs und Ritualgegenstände schließen. Die Politiker hatten vollmundig Hilfe für alle wirtschaftlich Betroffenen angekündigt, doch die ohnehin schon berüchtigte Bürokratie der Ministerien und der Nationalen Versicherungsanstalt erwies sich als völlig überfordert von dem Ansturm, der sogleich einsetzte. Überhaupt war ganz unklar, ob, was und wie viel einem wie ihm überhaupt zustehen würde, während sich die Rechnungen unbeirrt und erbarmungslos auftürmten.
Er hatte keinen Ausweg mehr gesehen.
Auch Kinny hatte ihm keinen aufzeigen können. Sie hatte ihm lediglich in seiner Balkontür stehend, langsam sprechend (Regel eins der Panikbekämpfung) klarmachen können, dass er für seine Kinder da sein müsse. Verhungern würden sie nicht, das kam heute in Israel einfach nicht mehr vor, und irgendwann kam man auch wieder auf die Beine. Aber wenn ihr Vater sich umbrachte, würde das die Kinder ein Leben lang verfolgen.
Diese Vorstellung hatte offenbar gewirkt. Langsam, schluchzend, entkräftet war der Mann vom Balkongeländer, auf dem er rittlings gelegen hatte, auf die richtige, die sichere Seite hinuntergeglitten, wo ihn Sekunden später zwei Polizisten mit Atemschutzmasken und Handschuhen behutsam, aber entschieden gepackt und in die Wohnung getragen hatten.
Es war dieser Anblick, der Moment seiner Kapitulation und ihres Erfolgs – jener Moment, in dem sich jeder Polizeipsychologe normalerweise innerlich auf die Schulter klopfte und den Job an die Kollegen in den Kliniken weiterreichte –, der sie nicht mehr losließ und auch jetzt wieder einholte. Der Anblick des Mannes, ungefähr in ihrem Alter, zusammengesunken auf dem Boden seines Balkons, von dem er noch wenige Wochen zuvor zufrieden auf die unter ihm liegende Stadt geblickt haben mochte, ein kleiner König seines Reiches, war ihr erschienen wie ein Sinnbild des ganzen Landes, das den Boden unter den Füßen zu verlieren drohte. Sie musste auch an ihre Eltern denken, die natürlich zu den Risikogruppen zählten, mit einer Mischung aus Angst, es könnte ihnen etwas geschehen, und schlechtem Gewissen. Seit Langem konnte sie nicht mit ihnen sprechen, ohne genervt zu sein, und zugleich nicht an sie denken, ohne Schuldgefühle zu empfinden. Sie hatte das Bedürfnis, mit jemandem zu reden. Aber wen konnte man um vier Uhr morgens guten Gewissens anrufen? Sie wählte die Telefonnummer von Golan. Bei ihm war es jetzt neun Uhr abends.
Er hob nach wenigen Sekunden ab. »Um Gottes willen, Kinny, bei euch muss es doch mitten in der Nacht sein!«
»Vier Uhr. Ich kann nicht schlafen.«
»Welcome to the club.«
»Du leidest auch an Schlafproblemen?«
»Halb New York leidet an Schlafproblemen. Du weißt schon, the city that never sleeps.«
Er erzählte ihr, dass er ganze Nächte damit zubringe, Playlists mit Songs über New York zusammenzustellen, die er sich dann in den folgenden Nächten anhöre. Songs, in denen die Stadt lebe, pulsiere, schwitze und lache, während man in der Realität gerade die Autos auf der Fifth Avenue einzeln abzählen könne. Arbeiten? »Nach der Wiederauferstehung der Toten wird es vielleicht wieder ein paar Leute geben, die an einem guten Fundraiser interessiert sind.« Dass seine Frau Fiona, die Ärztin war, Sonderschichten in einem Krankenhaus schob, wo sie nicht im Entferntesten gegen das Virus ausgerüstet waren, verbesserte seine Gemütslage nicht.
»Und die Kinder?«
»Sitzen zu Hause und wissen nichts mit sich anzufangen.«
»Habt ihr denn kein Homeschooling?«
»Doch, aber miserabel organisiert. Dauernd kommen sie zu mir und fragen mich irgendwas, was sie nicht verstehen. Ich sage ihnen: Das kann doch nicht sein, wenn ihr in der Schule sitzt, könnt ihr mich auch nicht die ganze Zeit löchern mit irgendwelchem Zeug, das ihr nicht kapiert. Und das Vermögen an Schulgeld, das ich da reinstecke, kann ja nicht den Zweck haben, dass ich dann zu Hause mit ihnen unverständliche Aufgaben lösen muss, bei denen ihnen sonst keiner hilft.«
»Mit dieser Haltung bringst du sie nicht gerade weiter, mein Lieber. Für sie ist ja diese Situation auch eine Herausforderung. Und für die Lehrer sowieso.«
»Ja, Frau Diplompsychologin, das verstehe ich schon. Aber ich krieg das nicht hin. Den ganzen Tag tigere ich im Haus rum und mache nichts. Lese nicht, schaue nicht nach dem Garten – nicht mal mehr als zehn Minuten von irgendeinem blöden Film kann ich mir am Stück ansehen. Fiona, wenn sie mal zu Hause ist, ist derart von der Rolle, dass man mit ihr kaum reden kann.«
Golan wäre nicht darauf gekommen, Kinny nach ihrem eigenen Befinden oder dem Mias zu fragen. Auch nicht nach den Eltern. Das ganze Gespräch war nur eine Litanei seines Elends. Kinny wusste besser als jeder andere, dass sich hier Dinge aufstauten, die schrecklichen Dinge, die Golans Leben geprägt hatten, und dass soeben das Stückchen Normalität, das er sich aufgebaut hatte, ins Wanken geriet. Dennoch war sie fassungslos über seine Unfähigkeit, über etwas anderes zu reden als über sich selbst. Die Psychologin in ihr erkannte mühelos die Depression, doch als seine Schwester litt sie unter Golans Egomanie. Nach zehn Minuten beendeten sie das Gespräch. Kinny kehrte ins Bett zurück und heulte, um Mia nicht zu wecken, in die Kissen hinein. Sie konnte nicht mehr aufhören, es schüttelte sie, bis sie wie ein kleines Kind begann, nach Luft zu japsen.
Irgendwann schlief sie wieder ein und erwachte erholter, als sie erwartet hätte. Sie duschte ausgiebig, föhnte die Haare und zog sich an. Die Sieben-Uhr-Nachrichten, die sie sonst nie verpasste, hatte sie verschlafen. Deshalb erwischte Nissims Anruf sie völlig unvorbereitet.
»Was sagst du?«, rief, nein, schrie sie.
Nissim wiederholte den Sachverhalt etwas langsamer und ein klein wenig lauter, als wäre es ein akustisches Problem gewesen, weshalb sie zurückgefragt hatte, und nicht der pure Unglaube.
»Diese Nacht. Kurz nach Mitternacht. Ruchama Wacholder und ihr Mann. Vier Schüsse insgesamt. In der Straße des 29. November. Beide sind noch am Tatort verstorben.«
Ruchama Wacholder. Und ihr Mann. Gil. Klar, zunächst fiel der Name Ruchama, denn sie war eine nationale Bekanntheit: Knesset-Abgeordnete, ehemalige Ministerin. Kinny hatte zu den vielen gehört, die ihr politisch fernstanden und sie dennoch respektierten, ja, sogar bewunderten. Aber viel besser gekannt als Ruchama hatte sie natürlich Gil, mit dem Ariel, ihr Ex-Mann, sein Architekturbüro in Rischon LeZion aufgebaut hatte, bevor Gil der politischen Karriere seiner Frau zuliebe zur dortigen städtischen Baubehörde gewechselt war. Ein unabhängiger Architekt, das hatte Kinny bei Ariel gesehen, kannte in den ersten Jahren nur Sechzehnstundentage, entweder weil er sich abstrampelte, um an große Projekte zu kommen, oder weil er sie wirklich bekam. Wenn dann die Frau auch noch in die nationale Politik ging, musste jemand für die Kinder da sein – da war die Stadt als Arbeitgeber die bessere Option gewesen.
Wie oft hatten Ariel und Gil in den glücklichen gemeinsamen Jahren von Rischon die Abendstunden hindurch bei Kinny zu Hause gesessen, weil sie es nach neun Uhr abends im Büro einfach nicht mehr aushielten. Sie hatte ihnen noch etwas gekocht oder aufgewärmt und literweise Kaffee vorbereitet, während die beiden schon wieder über ihren Plänen und Berechnungen brüteten. Manchmal waren sie spätabends auch zu den Wacholders gegangen, aber seltener. Der Grund war, dass Ruchama, die damals noch das bescheidene städtische Erziehungswesen leitete, eine ziemlich schlechte Köchin war, wie Ariel Kinny anvertraut hatte. Sie schaffte es angeblich nicht mal, einen anständigen Kaffee zu brühen.
»Dann war das der Sirenenlärm, den ich gehört habe heute Nacht«, meinte Kinny nach längerer Pause, einfach um mal was zu sagen.
»Das dürfte so sein«, bestätigte Nissim in seiner gewohnt sachlichen Art. »Ist vielleicht ein Kilometer Luftlinie von deiner Wohnung entfernt.« Das war wohl richtig geschätzt. Das Viertel Katamon, in dem der Tatort lag, grenzte an die German Colony, wo Kinny lebte. Es waren zwei der begehrteren Wohnquartiere im westlichen Teil der Stadt, in denen man zuweilen mehr Englisch als Hebräisch hörte.
»Du weißt, dass ich die beiden gekannt habe, nicht wahr?«
»Ja, das hast du mir mal erzählt. Über deinen Ex-Mann, wenn ich mich recht erinnere. Deshalb habe ich dich auch angerufen. Weil ich dachte, es geht dir nahe.«
»Das ist lieb von dir.«
Einen Augenblick lang war es still zwischen ihnen.
»Kinny?«, hörte sie Nissims Stimme wieder. »Alles in Ordnung?« Wahrscheinlich gab es gerade niemanden auf der Welt, der so besorgt um sie war.
»Nein«, sagte sie. »Ich stehe echt unter Schock.«
»Kann ich verstehen.« Er zögerte einen Moment. »Ich muss leider weiter, Kinny, wir reden später, ja?«
»Warte!«, rief sie. »Was wissen wir denn bis jetzt?«
»Ziemlich viel und ziemlich wenig. Aber ich kann jetzt nicht die Ermittlungen vor dir ausbreiten. Ich muss wirklich weiter, die Sache setzt uns unter Stress. Ich melde mich.«
»Aber Nissim, du kannst mir doch wenigstens …«, rief sie noch in den Hörer, während bereits das Besetztzeichen ertönte.
»Was ist passiert?«, fragte Mia. Sie stand in T-Shirt und kurzen Hosen in der Tür ihres Zimmers, das ungekämmte Haar hing ihr ins Gesicht.
»Gil und Ruchama«, sagte Kinny und starrte vor sich auf die Platte des Esszimmertischs. »Sie sind erschossen worden. Heute Nacht. In Katamon. Mehr weiß ich nicht im Moment. Nissim wollte oder konnte mir nicht mehr sagen. Zu mir kommen sie erst wieder, wenn sie nicht weiterwissen.«
Ihre Tochter umarmte sie. »Das ist grauenhaft, Ima.«
Sie drückte Mia an sich und nickte schweigend. Sie spürte, wie eine Träne ihr die Wange hinunterkullerte, und wusste selbst nicht, ob es ein Ausdruck der Trauer war oder des Glücks, in diesem Moment ihre Tochter im Arm zu halten.
Mia und sie hatten einige Kämpfe hinter sich aus der Zeit von Kinnys und Ariels Scheidung. Später waren politische und weltanschauliche Konflikte hinzugekommen, und Kinny hatte, wider besseres Wissen, immer wieder an Mias Freunden rumgemäkelt, was die Atmosphäre nicht verbessert hatte. Sie hatte es als ein Geschenk empfunden, dass Mia vor Kurzem beschlossen hatte, für die Zeit des seger ihre WG in Haifa zu verlassen und zu ihr zu ziehen. Niemals hätte sie gedacht, dass sie wieder einmal für längere Zeit unter einem Dach wohnen würden.
»Ich muss mich anziehen und Rotem anrufen«, sagte Mia schließlich und ging ins Bad. Kinny ging in die Küche und stellte das Radio an. Die schockierende Nachricht hatte für den Augenblick sogar das omnipräsente Virus aus den Schlagzeilen verbannt. Während sich ihr alter Espressokocher erhitzte und Kinny darauf wartete, dass ihr Toaster zwei Brotscheiben wieder ausspuckte, fasste die Redakteurin für Polizeifragen von Reshet Bet zusammen, was bisher bekannt war. Kinny kannte die Redakteurin. Mit ihrer durchdringend nasalen Stimme hatte sie auch sie schon befragt, ja gelöchert. Sie besaß eine charmante, verbindliche Art, aber man musste genau achtgeben, dass man ihr nicht den einen Satz zu viel noch sagte, den man hinterher bereuen würde.
Das Paar, so fasste die Journalistin zusammen, hatte sich die letzten Tage über in der Jerusalemer Dienstwohnung von Ruchama Wacholder aufgehalten. Seit vielen Jahren hätten sie sich angewöhnt, spätabends zusammen noch mit ihrem Yorkshireterrier Itztrubal (an Hundenamen schien das israelische Publikum ein besonderes Interesse zu haben) eine Runde zu drehen, um auch nach randvollen Tagen wenigstens einige Minuten zum Gespräch zu haben. So auch letzte Nacht. Als sie schon fast wieder zu Hause angekommen waren, hatte jemand, der ihnen offenbar in einem Vorgarten oder hinter einem Auto aufgelauert hatte, insgesamt viermal auf sie geschossen und war dann zu Fuß geflüchtet. Es gab zwei oder drei Leute, die, von den Schüssen aufgeschreckt, aus dem Fenster schauten und jemanden wegrennen sahen, offenbar eine kleine Seitenstraße hinauf, die in eine Treppe mündete. Ein Augenzeuge hatte berichtet, er habe kurz vor den Schüssen oben an der Treppe beim Verkehrskreisel an der Eli-Cohen-Straße ein stehendes Auto mit laufendem Motor bemerkt, sei aber weitergegangen. Ob dies womöglich ein Fluchtwagen war, in dem ein Komplize auf den Täter gewartet hatte, konnte man vorerst noch nicht sagen. Offenbar gab es übereinstimmende Zeugenaussagen darüber, dass der Täter »Allahu Akbar« gerufen habe. Aufgrund der derzeitigen medizinischen Auflagen werde die Beerdigung auf dem Friedhof von Rischon LeZion im allerengsten Familienkreis stattfinden. Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen, fügte die Redakteurin hinzu, dürften zeitnah abgeschlossen sein, sodass einer Beisetzung noch am selben Tag, wie es der jüdische Brauch verlangte, nichts im Weg stehe.
Ob man aufgrund der Rufe des Mörders nicht von einem terroristischen Anschlag muslimischer Extremisten ausgehen müsse, fragte der Moderator.
Die Polizei, so meinte die Journalistin, halte sich dazu bedeckt. Es habe sich bislang jedenfalls noch keine der einschlägigen Organisationen zu der Tat bekannt. Außer ein oder zwei lauwarm applaudierenden Kommentaren aus Gaza und dem Libanon über den »überall, zu jeder Zeit aktiven muslimischen Widerstand« habe man von ihnen nichts vernommen. Doch auszuschließen sei nichts, zumal gerade jetzt zu Zeiten des seger und der medizinischen Notlage die Atmosphäre zwischen Juden und Arabern in Jerusalem so harmonisch und kooperativ sei wie seit Langem nicht mehr. Da gebe es immer Kreise, die an einer Störung dieser Harmonie interessiert seien. Und dann seien da noch die berüchtigten Einzeltäter, derer man über die Beobachtung der bekannten Gruppen nicht präventiv habhaft werden könne.
»Ein Einzeltäter, auf den oben beim Verkehrskreisel ein Auto wartet?«, brummte Kinny nervös vor sich hin. Aber auch das war vorerst ja nur eine Vermutung.
»Wir müssen doch davon ausgehen, dass die Opfer gezielt ausgesucht worden sind, nicht wahr?«, fragte der Moderator.
»Alles spricht dafür«, sagte die Redakteurin. »Wenn du einfach möglichst großen Schaden anrichten willst, dann gehst du mit einer Bombe oder einer Halbautomatik an einem normalen Freitagabend in die rammelvolle Dizengoffstraße in Tel Aviv, aber nicht mitten in der Nacht während des seger in eine Wohnstraße in Katamon. Es scheint, dass der oder die Täter gezielt ein prominentes Opfer ausgespäht und ermordet haben.«
»Aber warum gerade Ruchama Wacholder und ihren Mann?«, fragte der Moderator.
»Yaron«, sprach die Korrespondentin den Moderator direkt an, »du stellst wie immer die richtigen Fragen. Nur habe ich diesmal keine Antwort parat.«
Damit war das Gespräch zu Ende, und wie immer, wenn das Land trauerte, wurde etwas aus dem unerschöpflichen Arsenal melancholischen israelischen Liedguts präsentiert. Diesmal war es Meir Banais »Sha’ar harachamim«, ein Lied über das Tor des Erbarmens, jenes der acht Tore der Altstadt, das in anderen Sprachen den so viel pompöseren Namen »Goldenes Tor« trug. Doch auch die schönste Bezeichnung half nichts, das Tor war seit Jahrhunderten zugemauert und damit der einstmals einzige direkte Zugang durch die Mauer zum Tempelberg unpassierbar.
»Leb einmal, nur einmal / mit Grund, ohne Grund / mit Kraft, ohne Kraft / sha’ar harachamim«, sang Kinny mit, und das Lied stiftete ihr tatsächlich etwas Trost. Danach folgte eine eingespielte Trauerbekundung des Premierministers. Mit seiner tiefen, sonoren Stimme und den kunstvoll eingelegten Pausen, die jeder im Land schon bis zum Überdruss kannte. »Salz der Erde«, hörte Kinny, »zwei Kämpfer für unsere Demokratie … vorbildliche, selbstlose, der Sache vollständig hingegebene Israelis.« Dann kam die obligate martialische Drohung an den oder die Täter, die feierliche Versicherung, man werde nicht ruhen und jeden Stein umdrehen (eine besonders beliebte Formulierung öffentlicher Stellen, wie Kinny seit Längerem feststellte), bis man sie gefunden und dem Recht überantwortet habe. Kinny lachte bitter und stellte das Gesülze ab.
Sie fischte die Brotscheiben aus dem Toaster, steckte zwei neue ein, füllte zwei Tassen mit Kaffee und setzte sich an den Küchentisch, den sie inzwischen gedeckt hatte. Es war ein wundervolles Gefühl, für zwei Menschen den Tisch zu decken. Nissim, wenn er ab und zu bei ihr übernachtete, trank immer nur eine Tasse von dem grässlichen Elite-Instantkaffee, den sie bloß seinetwegen im Haus hatte, an dem er aber wie viele Israelis so hing, dass er sogar bei Auslandsreisen eine Dose einpackte.
Mias Gespräch mit ihrer Freundin Rotem schien länger zu dauern. Widerwillig begann Kinny zu trinken und aß einen Toast mit etwas Streichkäse. Es war Ariel gewesen, der vor gut einem Jahr auf Mias Bitten hin ein gutes Wort bei Ruchama eingelegt hatte, um Rotem, die an der Hebräischen Universität Politologie studierte, eine Teilzeit-Assistentenstelle in ihrem Abgeordnetenbüro zu vermitteln. Ariel pflegte seiner Tochter keine Wünsche auszuschlagen – eine Folge der Scheidung, wie Kinny meinte –, und die Gelegenheit, Mia und ihrer hübschen Freundin zu beweisen, dass er sogar Jobs in der Knesset einfädeln konnte, hatte er sich nicht nehmen lassen.
»Wie geht es Rotem?«, fragte sie Mia, als die nach zehn Minuten endlich in die Küche kam und sich hinter ihre Tasse lauwarmen Kaffees setzte.
»Ich habe das Gefühl, sie steht total neben sich. Ich dachte, sie würde weinen oder erzählen, was sie noch so gehört hat oder was auch immer, aber sie war total einsilbig. Gerade Rotem, weißt du, die du sonst nie zum Schweigen bringst.«
»Ist jemand bei ihr?«
»Ich glaube nicht. Die hockt allein in ihrer Bude und grübelt rum. Vielleicht solltest du sie mal anrufen, Ima. Psychologischer Beistand und so.«
Es waren wirklich schwierige Zeiten. Kinny konnte Mia nicht einmal raten, zu Rotem zu fahren und einige Stunden mit ihr zu verbringen. Sie versprach ihrer Tochter, Rotem bald anzurufen.
»Hast du inzwischen noch was gehört oder gelesen zu der Sache?«, fragte Mia.
Kinny erzählte Mia von dem Radiobericht. Dass Gil und Ruchama den Hund ausgeführt hätten, vom angeblichen religiösen Schlachtruf des Täters und den unklaren Umständen seiner Flucht.
»Und warum wollte Nissim dir das nicht erzählen?«, fragte Mia, während sie ihren Toast mit einer dünnen Schicht Butter bestrich.
Mia mochte Nissim nicht besonders. Sie sah ihn als illegitimen Konkurrenten ihres Vaters – obwohl die Scheidung Jahre her war, Ariel längst wieder geheiratet hatte (wogegen Mia aber nichts zu haben schien) und Kinny ihr schon tausendmal erklärt hatte, dass Nissim nicht ihr »Neuer« war, sondern einfach ein guter Kollege, dem sie manchmal gern nahe war.
»Nissim hatte keine Zeit zum Reden. Die sind so was von gestresst dort. Das ganze Land ist doch in Schockstarre nach einer solchen Tat. Die wollen lieber heute als morgen den Täter überführt sehen. Und die Regierung werden sie auch noch im Nacken haben.« Sie wollte noch eine Bemerkung zur Rede des Premierministers machen, ließ es aber bleiben.
»Wieso sind es immer die Besten, die dran glauben müssen?«, fragte Mia.
»Du hast recht«, sagte Kinny nach kurzem Nachdenken. »Wenn ich an Gil denke, fällt mir eine Redewendung ein, die ich während meiner Studienzeit in Deutschland gelernt habe: Ehrlich bis auf die Knochen.«
Sie erzählte Mia einiges aus der Vergangenheit, was diese damals als Kind nicht mitbekommen hatte. Als Gil aus dem Büro mit Ariel ausschied, ließ er sich nur das auszahlen, was er zu Beginn investiert hatte, obwohl das Geschäft inzwischen wesentlich mehr wert war. Er wusste, dass das meiste Geld in Projekten steckte, und wollte Ariel nicht in Liquiditätsprobleme bringen. Als er dann bei den städtischen Behörden angestellt war, überwies er jedes Mal, wenn Ariel und sie die Wacholders zu einem Abend- oder Schabbatessen eingeladen hatten, anschließend ein paar Hundert Schekel. Anfangs ärgerte Ariel sich darüber, aber Gil erklärte ihm, dass er jedem Verdacht irgendeiner Vorteilsnahme von einem privaten Architekten vorbeugen müsse. »Wegen einer Kürbissuppe und einem Teller Lasagne?«, fragte Ariel spöttisch. »Du vergisst den Wein und die Eistorte«, antwortete Gil in vollem Ernst. »Im Restaurant hätte das pro Person gut und gerne hunderfünfzig Schekel gekostet.« Und dann hatte er von seinem Großvater erzählt, der Buchhalter einer Firma in Königsberg gewesen war und kurz nach Hitlers Machtantritt entlassen wurde. Noch am Tag, als ihm seine fristlose Entlassung mitgeteilt wurde, blieb er bis in die tiefe Nacht im Büro und machte eine Zwischenabrechnung. Als er am Ende einen Fehlbetrag von achtundvierzig Pfennigen feststellte, zog er einen dicken roten Strich unter das Resultat und legte eine Fünfzigpfennigmünze daneben. Danach verließ er das Büro und warf den Schlüssel in den Briefkasten. »Lieber schenke ich dem Reich zwei Pfennige, als dass sie sagen können, der Jud hat uns bestohlen«, waren seine Worte.
»Aber wenn hier jemand gezielt getötet hat«, sagte Mia, »dann wollte er doch kaum Gil erwischen, sondern Ruchama. Gils Tod wäre dann fast so was wie ein Kollateralschaden, nicht wahr?«
»Keine Ahnung«, sagte Kinny. Aber natürlich deutete alles auf diese Sicht der Dinge hin. Sie überlegte für einen Moment, noch etwas über Ruchama zu sagen, aber sie hatte Angst, das Gespräch könnte zu politisch werden oder zumindest von Mia so verstanden werden. Das Letzte, was sie wollte, war, dieses Frühstück mit ihrer Tochter in eine politische Auseinandersetzung ausarten zu lassen. Denn Mia fand diese Regierung und den in mehreren Korruptionsfällen angeklagten Premier immer noch erträglicher, wie sie sagte, als die Heuchler, Verstaatlicher und Gutmenschen von links, die von nichts eine Ahnung und immer nur was zu meckern hatten. Es war zwecklos, sich hier zu verkämpfen, wenn man es schon einmal schaffte, so einträchtig zusammenzusitzen.
»Was ist wohl aus dem Hund geworden?«, fragte Mia unvermittelt.
»Das haben sie im Radio nicht gesagt«, lächelte Kinny. »Aber sie haben gesagt, wie er heißt. Itztrubal. Ein Yorkshireterrier, wie alle bisherigen Hunde der Wacholders.«
»Der arme Kerl. Vielleicht suchen sie ein neues Zuhause für ihn.«
Kinny schaute Mia von der Seite an. »Untersteh dich!«, sagte sie. »Ein Hund kommt mir nicht ins Haus.«
Mia räumte ihr Geschirr ab und schenkte ihr ein süßes Lächeln, bevor sie in ihr Zimmer verschwand. »Ich bin dann wieder am Arbeiten«, rief sie, bevor sie die Tür schloss.
2
»Ich hätte nie Geographie studiert, wenn ich vorher gewusst hätte, dass man da auch Statistik lernen muss.«
Dieser Satz fiel immer dann, wenn Jochi, Kinnys Mutter, kurz davor war, wegen ihres Mannes die Nerven zu verlieren. Im Statistikunterricht der Universität Tel Aviv hatten sie sich seinerzeit kennengelernt. Jochi Glass liebte alles, was mit Landvermessung zu tun hatte, war aber ganz besonders vernarrt in die Geographie und Landschaft Israels, am allermeisten die des Nordens. Über dreißig Jahre lang hatte sie am nationalen kartographischen Institut in Jerusalem gearbeitet, das sie fast zwanzig Jahre lang leitete. Ihr Mann Elizur war bei einer der größeren Versicherungsfirmen des Landes Statistiker gewesen.
Ob ihre Eltern eine glückliche Ehe führten, hatte sich Kinny während ihrer ganzen Jugend nie gefragt – obwohl zwischenmenschliche Beziehungen schon früh ihre ganze Leidenschaft weckten. Inzwischen war sie zum Schluss gekommen, dass sie diese Frage wohl gezielt umgangen hatte. Die Eltern hatten während ihrer Jugend so viel zu tun gehabt, dass sich das familiäre Zusammensein faktisch auf die Schabbat- und Feiertage und die obligaten Zwischenfeiertagsausflüge und Ferien beschränkt hatte, die sie kaum je außerhalb von Israel verbracht hatten.
Fast alle wichtigen Entscheidungen, die die Familie betrafen, hatte die Mutter getroffen. Der Vater widmete seine Freizeit vor allem verschiedenen Ehrenämtern, die er in der nahegelegenen Synagoge wahrnahm, und seinem Interesse für Politik. Als treuer Anhänger der Nationalreligiösen war er mit diesen im Laufe der Zeit immer mehr nach rechts gerückt. Anders als Mia, die den politischen Status quo guthieß, weil sie erwartete, dass er am besten geeignet sei, so etwas wie Wohlstand und eine gewisse Stabilität zu gewährleisten, war Elizur Glass Ideologe – mehr noch wahrscheinlich als die Abgeordneten in der Knesset, für deren Liste er jeweils stimmte. An Politik hatte sich seinerzeit auch der einzige handfeste Streit der Eltern entzündet, an den Kinny sich erinnern konnte.
Damals, in den neunziger Jahren, hatte die Regierung von Jizchak Rabin und Shimon Peres die Mutter beigezogen für den Entwurf von Karten, die nach dem Abkommen von Oslo die Aufteilung in einen israelischen und einen palästinensischen Staat vorbereiten sollten.
»Sie werfen unseren Staat den Feinden zum Fraß vor um ein paar freundlicher Worte der Amerikaner und Europäer willen, und meine Frau stellt dafür die Pläne zusammen«, hatte der Vater am Schabbattisch gewettert.
»Es ist unsere Regierung«, meinte die Mutter damals lakonisch. Sie hatte sich politischen Diskussionen seit jeher nach Möglichkeit entzogen, und niemand in der Familie war ganz sicher, welchen Listenzettel sie in der Wahlkabine in das blaue Wahlcouvert steckte.
»Eine schöne Regierung«, hatte der Vater weitergeschimpft. »Für so was haben sie überhaupt kein Mandat.« Das war ein weitherum hörbares Argument der damaligen rechten Opposition.
»Haben sie denn nur dann ein Mandat, wenn auch Doktor Elizur Glass sein ausdrückliches Einverständnis gegeben hat?«, hatte die Mutter entgegnet und die Diskussion über dieses Thema ein- für allemal beendet.
Doch all dies war lange her. Inzwischen waren die Eltern längst in Pension, und so sehr der Vater sich immer darauf gefreut hatte, Zeit zu haben, um sich noch mehr für seine Synagoge zu engagieren und mehr Schiurim zu besuchen – die Mutter hatte sich zuletzt auch darin durchgesetzt, dass sie kurz vor der Pensionierung eine kleine Zweitwohnung an den Hängen von Tiberias kauften, wo sie nun einen Teil des Jahres verbrachten. Von dort aus sah das Ehepaar Glass nun direkt hinunter auf den Kinneret-See (bis heute war ihre Mutter die Einzige, die Kinny bei ihrem offiziellen Namen Kinneret rief) und das am anderen Seeufer liegende Hochplateau des Golan, der seit seiner Eroberung im Sechstagekrieg für viele Israelis zur Erfüllung einer Suche nach fast menschenleeren und fruchtbaren Landschaften mit großartigen Ausblicken geworden war.
Kinny hatte ihre Eltern bekniet, nach Jerusalem zurückzukehren, als die Viruskrise sich abzuzeichnen begann, um sie in der Nähe zu haben, aber sie hatten sich geweigert. Es fehle ihnen hier an nichts, erklärten sie, und an diesem eintönigen Spruch hatten sie während der ganzen Wochen festgehalten. Das Essen ließen sie sich liefern, mit den Kleidern, die sie in Tiberias hatten, kamen sie aus, die Synagogen waren sowieso im ganzen Land geschlossen, sodass dem Vater auch seine Synagoge hier nicht mehr fehlte als in Jerusalem. Und medizinische Dienste, selbst ein Krankenhaus, gebe es in Tiberias schließlich auch.
Heute kamen die Eltern Kinny mit dem Anruf zuvor. Es war nicht ihre Mutter, sondern der Vater, der anrief.
»Wer war das?«, fragte er, nach nur knappem Gruß.
»Guten Morgen, Aba. Du meinst, wer die Wacholders umgebracht hat?«
»Ja. Wer war das?«, wiederholte er. »Was sagt die Polizei?«
Kinny versuchte ihm klarzumachen, was er ja eigentlich sehr genau wusste: dass sie nicht die Verkörperung der Polizei und das Ermitteln nicht primär ihre Aufgabe war. Sie wisse deshalb auch nicht mehr als das, was sie heute morgen im Radio gehört habe.
»Ach, mach dich bitte nicht lustig über mich. Was ihr den Medien sagt und was ihr wirklich wisst, sind doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Dein Freund hält dich sicher auf dem Laufenden.«
»Du meinst Nissim? Er ist nicht mein Freund.«
Sie mochte es nicht, wenn Nissim leichthin als ihr Freund betitelt wurde, schon gar nicht von ihren Eltern.
»Ist ja auch egal«, sagte der Vater. »Wichtig ist, dass ihr die Schurken rasch findet.«
»Die Kollegen tun ihr Bestes, glaub mir. Und wie geht es euch so?«
»Na, uns geht’s immer gut. Ima ist grade beschäftigt, sie ruft dich später an. Schönen Tag.« Und schon hatte er aufgelegt.
»Ja, Aba, mir geht’s auch gut, danke der Nachfrage«, brummte Kinny kopfschüttelnd in das Besetztzeichen ihres Telefons hinein. Ihr Vater konnte die Fürsorge selbst sein, aber mit zunehmendem Alter kam es bei ihm immer häufiger vor, dass er sich auf bestimmte Dinge fixierte und dann für eine Zeitlang alles andere aus dem Blick verlor.