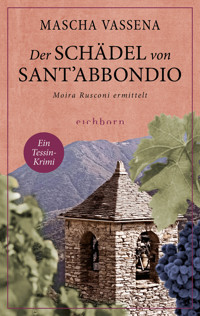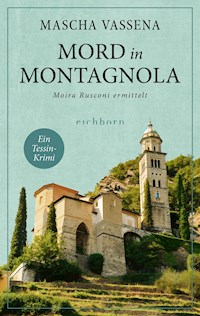
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Krimi
- Serie: Moira Rusconi ermittelt
- Sprache: Deutsch
Kaum kehrt Moira, Übersetzerin und frisch getrennt, nach Jahren in das Tessiner Dörfchen Montagnola zurück, wird ein Toter in einer Nevèra, einem der dort typischen historischen Eiskeller, gefunden. An den polizeilichen Ermittlungen beteiligt ist auch Moiras Jugendliebe Luca Cavadini, inzwischen leitender Rechtsmediziner des Kantons, der sie bald als Dolmetscherin um Hilfe bittet. Die Befragungen in der Dorfgemeinschaft gestalten sich schwierig, doch bald wird klar, dass es im beschaulichen Tessin nicht gar so friedlich zugeht, wie es zunächst den Anschein hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
Kaum kehrt Moira, Übersetzerin und frisch getrennt, nach Jahren in das Tessiner Dörfchen Montagnola zurück, wird ein Toter in einer Nevèra, einem der dort typischen historischen Eiskeller, gefunden. An den polizeilichen Ermittlungen beteiligt ist auch Moiras Jugendliebe Luca Cavadini, inzwischen leitender Rechtsmediziner des Kantons, der sie bald als Dolmetscherin um Hilfe bittet. Die Befragungen in der Dorfgemeinschaft gestalten sich schwierig, doch bald wird klar, dass es im beschaulichen Tessin nicht gar so friedlich zugeht, wie es zunächst den Anschein hat.
Über die Autorin
Mascha Vassena wurde 1970 geboren, studierte Kommunikationsdesign, war Mitherausgeberin einer Literaturzeitschrift und organisierte Poetry Slams. Nach dem Studium arbeitete sie als freie Journalistin und Redakteurin in Hamburg. Für ihre Texte erhielt sie mehrere Auszeichnungen, u. a. den Hamburger Literaturförderpreis und ein Stipendium der Akademie Schloss Solitude. Von ihr sind bislang der Erzählband Räuber und Gendarm sowie fünf Romane erschienen. Neben dem Schreiben hält sie Workshops für Autor:innen und ist als freie Literaturagentin tätig. Seit 2004 wohnt sie mit ihrer Familie am Luganer See und möchte nie mehr weiter als einen Spaziergang vom Wasser entfernt leben.
MASCHA VASSENA
MORD inMONTAGNOLA
Moira Rusconi ermittelt
EICHBORN
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen.
Die Figuren und die Handlung dieses Romans sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.
Eichborn Verlag in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
© Mascha Vassena 2021. Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb.
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Jan Wielpütz, Bergisch Gladbach
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
unter Verwendung eines Motivs von © Anton_Ivanov/shutterstock
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-2061-8
www.eichborn.de
www.luebbe.de
www.lesejury.de
PROLOG
Anfangs war er vor allem wütend gewesen. Aber die Zeit hatte ihn mürbe gemacht. Es drang kaum Licht durch die Türritzen bis auf den Grund seines Gefängnisses, und obwohl draußen die Sonne schien, war es hier unten kühl und klamm. Nachts fror er, trotz der Decke, die man ihm gegeben hatte, und die Fesseln machten ihn wahnsinnig. Er konnte nicht einmal aufrecht stehen, nur sitzen, und das Metall hatte seine Handgelenke inzwischen aufgerieben – zwei glühende Armreife, die sich täglich tiefer in sein Fleisch fraßen. Am schlimmsten war allerdings, dass er nicht wusste, wie lange er hierbleiben musste. Inzwischen war er sich nicht mehr sicher, ob er jemals wieder hier herauskommen würde oder ob seine Welt für immer aus einer Steinmauer bestehen würde, die sich in einem Kreis von viereinhalb Metern Durchmesser um ihn schloss.
Manchmal glaubte er zu träumen, so irreal erschien ihm seine Situation. Er hätte gerne die Wände berührt, um sich ihrer Echtheit zu versichern, doch die Kette, die an einem Ring im Boden befestigt war, hielt ihn zurück und verkleinerte seinen Aktionsradius auf wenige Meter. Er musste gebückt im Kreis gehen, um sich etwas Bewegung zu verschaffen, doch nach einiger Zeit schmerzte sein gebeugter Rücken dermaßen, dass er es aufgab. Stattdessen versuchte er, ein wenig Gymnastik zu treiben und die Blutzirkulation in Gang zu halten, indem er sich auf den Rücken legte und wie ein Käfer mit den Beinen strampelte.
Wer hätte gedacht, dass man so schnell seine Würde verlieren konnte? Seine Notdurft verrichtete er am äußeren Rand seines Bewegungsradius, möglichst weit von seinem Schlafplatz entfernt. Es gab nichts hier unten, was ihm Trost geboten hätte. Nichts, womit man sich ablenken konnte. Er war nie gut darin gewesen, mit sich selbst alleine zu sein. Wenigstens ein paar Zeitschriften hätte man ihm geben können, ein Brettspiel oder etwas zum Schreiben. Doch man wollte ihn bestrafen, ihn leiden lassen, und das auf unbestimmte Zeit.
Er war schon so weit, dass er dankbar für den heißen Tee war, der ihm in einer Thermoskanne gebracht wurde. Wenn er zwei bis drei Tassen getrunken hatte, fiel er in einen traumlosen Schlaf, erlöst davon, die Zeit bewusst wahrnehmen zu müssen, und erlöst von seinen Gedanken, die hier unten in der Einsamkeit und Stille endlos umeinanderkreisten.
Wahrscheinlich war dem Tee ein Schlafmittel beigemischt. Am liebsten hätte er die ganze Zeit so verbracht, ohne Bewusstsein. Doch das würde seinen Aufenthalt hier unten zu bequem machen und seine Strafe zu sehr erleichtern. Der Tee reichte nie, um sich für länger als einige Stunden aus der Wirklichkeit zu verabschieden. Dennoch gelang es ihm nicht, ihn so einzuteilen, dass er den ganzen Tag in einem angenehmen Dämmerzustand verbringen konnte. Er war zu gierig darauf, zumindest für kurze Zeit seine Lage vollkommen auszublenden.
Heute schmeckte der Tee anders. Es war dieselbe Sorte wie immer, Pfefferminz, aber der Aufguss hatte, obwohl gezuckert, einen bitteren Beigeschmack, der seinen Gaumen zusammenzog. Vielleicht war es diesmal ein anderes Schlafmittel.
Er setzte sich mit angezogenen Knien auf den Boden und wartete auf die Müdigkeit, und tatsächlich kam es ihm vor, als hätte er eine Zeit lang geschlafen, als er wieder zu sich kam. Doch er saß immer noch aufrecht da.
Sein Mund war so trocken, als hätte er Mehl gegessen. Er trank eine weitere Tasse von dem Tee, aber schon eine Minute später hatte er erneut unerträglichen Durst. Sein Herz raste. Er griff nach der Plastikflasche mit Wasser, die auf einmal so schwer wog, dass er sie nicht mehr hochheben konnte. Ausgerechnet jetzt musste er dringend pissen, verdammt! Er versuchte, aufzustehen, soweit es die Kette erlaubte, und zu dem Platz zu gelangen, an dem er sich erleichterte. Doch seine Beine gaben nach, und er fiel auf sein Gesicht.
Als er die Augen wieder öffnete, lag er auf einer Wiese, über sich einen blauen Himmel, an dem kompakte weiße Wolken dahinzogen. Er war frei! Welch eine Wohltat, endlich wieder Sonne auf der Haut zu spüren! Er genoss die Wärme, die über ihn floss, sein T-Shirt und seine Jeans durchtränkte und ihn vollkommen einhüllte. Nach einer Weile, von der er nicht wusste, ob sie Minuten oder Stunden dauerte, wurde die Sonne stechender, und er überlegte, sich in den Schatten einer Baumgruppe zurückzuziehen. Nur klebte sein Rücken im Gras fest, weil auf den Halmen winzige Saugnäpfe saßen. Die Sonne wurde unerträglich, und seine Mundhöhle war völlig ausgetrocknet. Dabei schien es in unmittelbarer Nähe einen Bach zu geben, denn er hörte ein leises Plätschern, was seine Qual noch steigerte. Mit aller Kraft riss er sich los, wobei Hautfetzen an den Saugnäpfen zurückblieben. Er stand auf und sah sich einem Mann gegenüber, der ungefähr halb so alt war wie er selbst, und obwohl er ihn bislang nur auf Fotos gesehen hatte, erkannte er ihn sofort. Er wusste nicht, wie es möglich war, dass der Mann nicht einmal eine Schramme aufwies, hatte er sich doch vor einen Zug gelegt und war von dessen Rädern säuberlich zerteilt worden.
Er wollte ihn fragen, was er hier zu suchen hatte, doch das, was aus seinem Mund kam, war nur unverständliches Gebrabbel. Der andere lachte, und da musste er selbst auch lachen, weil es so albern klang. Dann wurde das Gesicht seines Gegenübers plötzlich ernst.
»Leben ist das kostbarste Geschenk, und du hast es einfach sinnlos vergeudet«, sagte der Mann verachtungsvoll, und dann machte er einen Schritt nach vorne und schubste ihn. Er schrie und stürzte in eine blendende Helligkeit.
Jetzt war er wieder in seinem Gefängnis. Unter seinem Körper knackten bei jeder Bewegung die kleinen Körnchen des Fledermauskots. Nur waren es gar keine Körnchen, sondern winzige schwarze Käfer, die über ihn herfielen und bald seinen ganzen Körper bedeckten. Sie krochen in seinen Mund und seine Nase und jede andere Körperöffnung, und von dort breiteten sie sich in ihm aus. Er versuchte zu schreien, doch sie verstopften seine Kehle. Er spürte sie unter seiner Haut krabbeln und sah die winzigen Knötchen, die sich bewegten. Voller Panik und Ekel packte er den Plastiklöffel, den man ihm zum Essen gegeben hatte, und versuchte, damit seine Haut aufzukratzen. Plötzlich lösten sie sich auf und wurden zu einer Traurigkeit, die sich in seinem ganzen Körper verteilte.
Der Mann hatte recht: Er hatte sein Leben vergeudet. Er war nie der Mensch gewesen, der er hätte sein können. Er rollte sich zusammen und weinte um seiner selbst willen. Noch nie zuvor hatte er sich so verlassen gefühlt.
Jemand lachte. Als er hochblickte, stand auf der Treppe, die an der Wand entlang nach oben führte, wieder der andere. Er öffnete den Mund, und heraus kamen Dutzende kleine Fledermäuse, die durcheinanderflatterten und wuchsen und wuchsen, bis sie den gesamten Raum füllten. Ihre ledrigen Flügel strichen über sein Gesicht, und ihre hohen Schreie gellten in seinen Ohren. Dann verwandelten sich die Fledermäuse in Steine, die auf ihn herabprasselten und ihn unter sich begruben.
1
Die Haustür war unverschlossen. Moira stieß sie auf und hob ihren Rollkoffer über die Schwelle aus Granit. Im Alter von drei Jahren hatte sie sich daran das Kinn aufgeschlagen, und bis heute spürte sie die Narbe, wenn sie mit den Fingerspitzen darüberfuhr.
In der halbdunklen Diele roch es wie früher: nach angebranntem Kaffee und Pfeifenrauch. Das war der Geruch, den sie immer mit ihrem Vater und den Sommerferien im Tessin verbunden hatte, und er löste eine seltsame Mischung unterschiedlicher Gefühle in ihr aus. Sie war vor etlichen Jahren zum letzten Mal hier gewesen, doch plötzlich war alles wieder ganz nah.
»Papà, ich bin da!« Niemand antwortete, und Moira seufzte. Ihr Vater war wohl inzwischen ein wenig schwerhörig. Dann ließ sie vor Schreck fast ihren Koffer fallen: Durch die Tür zum Korridor schoss ein pelziger roter Blitz, stürzte sich auf ihre Beine und schlug seine Krallen in ihre Jeans. Moira musste lachen.
»Na, wer bist du denn?« Sie bückte sich und streichelte das Fellknäuel. Die Katze fauchte und krallte erneut nach ihr. Moira zog schleunigst ihre Hand zurück.
»Schon gut, wir lernen uns sicher noch besser kennen.«
Die Katze maunzte und starrte sie mit kieselgrauen Augen an, dann löste sie sich von ihrem Fuß und sauste unter den Dielenschrank. Moira ließ ihren Koffer stehen und ging durch den breiten, mit alten Fliesen ausgelegten Flur in die Küche. Hier war das Herz des Hauses. Auf dem großen Holztisch in der Mitte des Raumes lag ein Sammelsurium verschiedenster Dinge: aufgeschlagene Zeitschriften, mehrere Pfeifen, benutzte Weingläser und Kaffeetassen, ungeöffnete Briefe sowie drei bedenklich hohe Bücherstapel. Auf dem Gasherd stand ein Pastatopf, aus dem es nicht gerade gut roch, und in der Spüle türmten sich benutzte Teller. Nur von Moiras Vater war nichts zu sehen. Sie rief erneut nach ihm, aber auch dieses Mal antwortete ihr niemand. Die Stille war bleiern, und Moira begann, sich Sorgen zu machen. Schließlich hatte ihr Vater erst vor Kurzem einen leichten Schlaganfall erlitten.
Unter dem Tisch kam eine weitere Katze hervor – groß und schwarz – und huschte lautlos in den Flur. Moira folgte ihr ins Wohnzimmer, das gegenüber der Küche lag, halb darauf gefasst, ihren Vater tot auf dem Boden liegend aufzufinden. Wenn dem so sein sollte, hoffte sie inständig, dass die Katzen ihn nicht angefressen hatten. Doch zum Glück befand sich dort nur die schwarze Katze, die auf einen Sessel sprang, sich dreimal um sich selbst drehte und hinlegte. Dann entdeckte Moira auf dem Sofa eine weitere, grau getigerte Katze, die zusammengerollt auf einem sehr haarigen Kissen schlief. Sie öffnete nur kurz ein jadegrünes Auge und nahm ansonsten keine Notiz von ihr. Wie viele Katzen besaß ihr Vater eigentlich?
Moira sah sich kurz um, in der Hoffnung, einen Hinweis auf den Verbleib ihres Erzeugers zu finden. Es gab eine Unmenge von Büchern, die in den Wandregalen keinen Platz mehr gefunden hatten, sich auf dem Boden wie Stalagmiten auftürmten und die beiden dunkelblauen Samtsofas – deren Farbe unter einer Schicht von Katzenhaaren verblasst wirkte – in eine Art von Büchermauern umgebene Festung verwandelten. Zwischen den dunkel gebeizten Deckenbalken hingen graue Spinnweben. Moira nahm sich vor, ihrem Vater eine Putzfrau zu besorgen, ob er wollte oder nicht.
Als Nächstes sah sie im Arbeitszimmer an der Rückseite des Hauses nach, aber auch dort war er nicht. Allerdings hätte man ihn hinter den Stapeln deutscher Klassiker und Fachbücher über Literaturwissenschaft auch übersehen können. Es lag kein Staub auf den Werken, was bewies, dass Ambrogio Rusconi seinen Ruhestand keinesfalls untätig verbrachte. Moira fragte sich, ob ihm seine Arbeit als Literaturprofessor fehlte. Sie wusste so wenig über ihn.
Sie war acht gewesen, als sich ihre Eltern getrennt hatten und ihre Mutter mit ihr zurück nach Deutschland gezogen war. Später hatte Moira bis zu ihrem fünfzehnten Lebensjahr einen Teil der Sommerferien im Tessin verbracht, doch damals hatte sie andere Interessen gehabt als das Innenleben ihres Vaters. Und dann war sie so sehr mit ihrem eigenen Leben beschäftigt gewesen, dass nach und nach die Verbindung zwischen ihnen abgebröckelt war, bis sie nur noch aus kurzen, oberflächlichen Telefonaten zu Weihnachten und Geburtstagen bestand. Alle paar Jahre sahen sie sich für ein Wochenende, immer in einem Hotel auf halber Strecke zwischen Frankfurt und Lugano. Und so wäre es weitergegangen, hätte nicht zwei Wochen zuvor Ambrogios Nachbarin sie kontaktiert und ihr von dem Schlaganfall erzählt. Ihr Vater selbst hatte das nicht für nötig befunden. Moira hatte ihn sofort angerufen und war erleichtert gewesen, dass er klang wie immer.
»Ich komme bestens zurecht, mach dir keine Sorgen.«
Natürlich hatte Moira sich Sorgen gemacht. Und ihre Mutter zurate gezogen.
»Also, mein Problem ist das nicht!«, hatte Nelly ausgerufen. »Wir sind seit über dreißig Jahren geschieden, da kann wohl niemand erwarten, dass ich mich zuständig fühle!«
Moira hatte unterlassen, sie darauf hinzuweisen, dass niemand etwas Derartiges von ihr verlangt hatte. Ihre Mutter neigte zu dramatischen Auftritten, was in dem Buchladen, in dem sie arbeitete, des Öfteren zu denkwürdigen Szenen führte. Gerne spielte sie Rat suchenden Kunden die Handlung der Romane szenisch vor, oder sie pflückte den verdutzten Leuten ihre ausgewählten Bücher aus den Händen und verfügte, was sie stattdessen lesen sollten. Da der Buchladen noch nicht pleitegegangen war, vermutete Moira, dass die Kundschaft Nellys bestimmende Art mehr schätzte, als sie es tat.
»Du kannst doch von überall aus arbeiten, willst du nicht in die Schweiz fahren und nach ihm sehen?«, hatte Nelly gesagt. Und sie hatte recht. Als freiberufliche Übersetzerin war Moira mobil, und außerdem war ihr gar nicht unrecht, eine Zeit lang aus Frankfurt zu verschwinden. Vor einem halben Jahr hatte sie sich von Martin getrennt, und schon ein paar Wochen danach hatte er überall seine neue Freundin präsentiert. Es war geradezu unmöglich, den beiden in Frankfurt nicht über den Weg zu laufen. Auch wenn Moira die Beziehung beendet hatte, tat es weh, so schnell ersetzt zu werden.
Die Vorstellung, sich in sichere Entfernung in ein winziges Dorf oberhalb des Luganer Sees zu begeben, erschien daher durchaus verlockend. Außerdem hatte Moira ein schlechtes Gewissen, weil sie sich in den letzten Jahren kaum um ihren Vater gekümmert hatte. Deshalb hatte sie ihrer Mutter zugestimmt, was sie eigentlich mit einer Flasche Champagner hätten feiern müssen, so selten kam das vor.
»Aber wer kümmert sich um Luna, während ich weg bin?«
»Sie bleibt natürlich bei mir«, hatte Nelly gesagt.
»Ich weiß nicht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, sie einfach hierzulassen. Die Trennung war hart für sie, auch wenn sie sich nichts anmerken lässt.«
»Dann kann sie ein bisschen Ablenkung umso besser gebrauchen! Sie ist doch sowieso ständig hier, und wir müssen unbedingt Fotos für unseren neuen Instagram-Account knipsen. Oma und Enkelin rocken das gleiche Outfit – unsere Follower lieben das Konzept!« Sie fuhr sich mit großer Geste durchs Haar, und Moira musste lachen.
»Also gut. Wenn Luna möchte, habe ich nichts dagegen.«
»Wir werden wunderbar zurechtkommen.«
Moira schrieb Luna eine Nachricht auf dem Telefon und erhielt sofort Antwort in Form einer ganzen Reihe von Emojis, die aus verschiedenen Herzchen, Smileys, Feuerwerk und einer Tänzerin bestanden.
»Ich schätze, Luna ist einverstanden. Ich bleibe ja auch nur ein paar Wochen, bis papà wieder alleine zurechtkommt.«
Und so hatte Moira ihren Koffer und ihren Laptop gepackt und sich in den Zug nach Süden gesetzt, im Magen ein Gefühl aus Vorfreude, ihren Vater und das große alte Haus wiederzusehen, und der Angst, ihn als Pflegefall anzutreffen, auch wenn er am Telefon das Gegenteil behauptet hatte.
Moira blieb einen Augenblick am Fenster des Arbeitszimmers stehen und genoss den Blick über den großen Garten mit seinen Magnolien- und Mandelbäumen, die in voller Blüte standen. Am anderen Ende des Grundstücks befanden sich die Bienenstöcke – das Hobby ihres Vaters – und rechts davon das kleine Gästehaus, in dem sie als Kind gerne gespielt und so getan hatte, als lebte sie ganz alleine in der Wildnis. Es sah ein bisschen verfallener aus als früher, zog sie aber immer noch magisch an, so gemütlich wirkte es.
Später würde sie nachsehen, ob es bewohnbar war, doch zuerst musste sie ihren Vater finden. Auch in den anderen Räumen des Erdgeschosses traf sie ihn nicht an. Mit einem unguten Gefühl stieg Moira die Steintreppe hinauf in den ersten Stock. Durch die verglaste Gartenseite des Korridors fiel helles Licht herein. Hier war immer Moiras Lieblingsplatz gewesen, und tatsächlich gab es noch das alte Ledersofa an der Wand, auf dem sie unzählige Stunden in Bücher vertieft verbracht hatte. Auf dem Dielenboden lagen bunte Flickenteppiche, und an den Wänden hingen Aquarelle von Tessiner Landschaften, die vor vielen Jahren Moiras Mutter gemalt hatte. Moira kam sich wie eine Einbrecherin vor, als sie in das Schlafzimmer ihres Vaters spähte. Das Bettzeug war zerwühlt, und auf einem Sessel türmten sich diverse Kleidungsstücke. Auf dem Boden darunter lag ein Wäscheberg, in dem sich eine weitere Katze aalte, grau mit leuchtend grünen Augen.
»Du bist aber eine Schöne«, sagte Moira. Obwohl sie sich zunehmend Sorgen machte, kniete sie sich hin und kraulte die Katze hinter den Ohren. Die rollte sich auf den Rücken und streckte die Vorderpfoten in die Luft, wobei sie vernehmlich schnurrte.
Etwas widerwillig stand Moira auf. Wo steckte Ambrogio nur? Sie hatte ihm extra eine SMS mit ihrer Ankunftszeit geschickt. Halb erwartete sie, dass er aus einem Schrank springen würde, um sie zu erschrecken, was sie ihm ohne Weiteres zutraute, doch er blieb verschwunden. Sie durchsuchte auch die beträchtliche Anzahl von Zimmern im oberen Stockwerk ohne Ergebnis. Ziemlich ratlos stieg sie die Treppe wieder hinunter und holte sich in der Küche ein Glas Wasser. Es war herrlich frisch, so gut wie hier schmeckte Leitungswasser nirgendwo sonst.
Zufällig fiel ihr Blick auf das Chaos, das den Esstisch überzog. Sie entdeckte ein zerknittertes Blatt Schreibmaschinenpapier, das ihr zuvor nicht aufgefallen war. In Ambrogios großer, weit geschwungener Handschrift stand darauf: Bin im Il Mulino, komm auch.
Moira stützte sich auf den Tisch. Wider Willen musste sie lachen. Anscheinend war ihr Vater weit davon entfernt, ein Pflegefall zu sein. Das Il Mulino war die örtliche Osteria und schon früher Ambrogios liebster Ort gewesen, von seinem Schreibtisch einmal abgesehen.
Sie verließ das Haus, wobei sie in der Diele kurz aufgehalten wurde, weil der rote Blitz sich erneut auf ihre Füße stürzte. Sie nahm die kleine Katze vorsichtig am Nackenfell und setzte sie neben den Schirmständer. Das Tier sah sich verwirrt um und begann dann, sich zu putzen, als hätte es nie etwas anderes vorgehabt.
Moira nahm den Haustürschlüssel vom Haken neben dem Spiegel und schloss die schwere Holztür von außen ab. Auch wenn ihr Vater das anscheinend nicht für notwendig hielt, wollte sie es möglichen Einbrechern nicht allzu leicht machen. Es war bekannt, dass Banden über die italienische Grenze kamen, um im Tessin auf Raubzug zu gehen.
Bis zum Il Mulino, das im Ortskern von Montagnola lag, waren es zu Fuß nicht mehr als fünf Minuten. Moira genoss den kleinen Spaziergang durch die vertrauten Gassen. Hier hatte sich seit ihrer Kindheit und Jugend kaum etwas verändert. Die traditionellen Tessiner Häuser mit ihren dunklen Holzbalken und den Außengalerien in jedem Stockwerk lösten in ihr ein heimeliges Gefühl aus, und ihr wurde bewusst, dass sie diesen Ort vermisst hatte. Neu waren für sie die Schilder, die an jeder Ecke auf Hermann Hesse hinwiesen, der viele Jahre lang in Montagnola gelebt hatte. Anscheinend gab es jetzt einen Hermann-Hesse-Rundweg. Der Gemeinde war wohl klar geworden, dass ihr berühmter Einwohner jede Menge deutsche Touristen anlocken würde, und tatsächlich begegnete Moira auf dem Weg mehreren Grüppchen älterer Damen mit Reiseführern in den Händen, die Deutsch miteinander sprachen.
Ihren Vater fand Moira im Gewölbe des Il Mulino, wo er mit einem weiteren Mann um die siebzig an einem Tisch saß, vor sich mehrere Flaschen, die mit einer klaren Flüssigkeit gefüllt waren, und einer ganzen Reihe von Grappagläsern.
»Moira, mein Schatz!« Er stand etwas schwerfällig auf und breitete die Arme aus. Seine Bassstimme dröhnte, und sein grauer Bart zitterte, als er Moira anlächelte. Sie ließ sich von ihrem Vater umarmen und fühlte sich wieder wie ein kleines Mädchen. Er drückte sie fest, aber kurz und hielt sie dann an den Oberarmen ein Stück von sich entfernt, um sie zu betrachten.
»Ich hätte dich ja beinahe nicht erkannt! Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? Drei Jahre?«
»Fast dreieinhalb«, sagte Moira und begutachtete ihrerseits ihren Vater. Ambrogio Rusconi sah auf den ersten Blick alles andere als krank aus, doch auf den zweiten bemerkte Moira, dass er dunkle Augenringe hatte und seine Haut blass war. Auch schienen seine Gesichtszüge ein klein wenig verzerrt. Am Telefon hatte er bereits erzählt, dass seine linke Körperhälfte sich etwas taub anfühlte. Trotz seiner nach wie vor beeindruckenden Größe und Statur wirkte er ein wenig gebeugt. Schwer zu sagen, ob es an seinem Alter lag oder auch eine Folge des Schlaganfalls war. Moira wurde zum ersten Mal bewusst, dass die Zeit, die sie noch mit ihrem Vater verbringen konnte, begrenzt war. Es war gut, dass sie hergekommen war.
Ambrogio legte dem Mann neben sich die Hand auf die Schulter. »Kannst du dich noch an Vittorio erinnern?«
»Aber natürlich«, sagte Moira und wandte sich seinem Begleiter zu, »ich bin ja zur Hälfte bei Ihnen im Haus aufgewachsen. Ihre Frau hat immer so köstliche Sachen für uns gekocht. Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie?«
Vittorio Cavadini war der beste Winzer der Gegend und der beste Freund ihres Vaters. Außerdem der Vater von Luca, mit dem Moira schon im Sandkasten gespielt hatte. Ihrer ersten Liebe. Ihr wurde bei dem Gedanken ein wenig warm.
»Uns geht es hervorragend, die letzte Traubenernte hat einen großartigen Wein hervorgebracht, und der Grappa schmeckt dieses Jahr noch besser als sonst.«
Das war nicht exakt das, was Moira interessierte, aber sie wollte sich nicht zu auffällig nach Luca erkundigen. Sie hatte nie wieder etwas von ihm gehört, seit sie aufgehört hatte, ihre Ferien bei ihrem Vater zu verbringen. Sie hatte auch lange nicht mehr an ihn gedacht. Doch jetzt seinem Vater gegenüberzusitzen weckte Erinnerungen an ihren letzten Sommer, den sie in Montagnola verbracht hatte. Damals war Luca ein schlaksiger Teenager mit langen schwarzen Haaren gewesen, der auf einer alten Vespa durchs Dorf bretterte, eine verspiegelte Sonnenbrille auf der Nase und immer eine Zigarette im Mundwinkel. Moira musste lächeln, als sie daran dachte, wie unfassbar cool sie ihn gefunden hatte.
»Setz dich her, du musst unbedingt den Grappa probieren.« Ambrogio rückte für Moira einen Stuhl zurecht, und sie setzte sich. Vittorio schenkte eines der bauchigen Grappagläser halb voll und schob es ihr hin. Moira nippte vorsichtig. Sie war nicht daran gewöhnt, Hochprozentiges zu trinken, sondern bevorzugte Rotwein. Die zugleich samtweiche und leicht brennende Flüssigkeit glitt ihre Kehle hinab.
»Wirklich gut!« Sie hustete dezent und wandte sich ihrem Vater zu: »Ich bin zwar nicht als dein Babysitter hergekommen, aber ist Schnaps das Richtige, wenn man vor Kurzem einen Schlaganfall hatte?«
Ambrogio legte seine Pranke auf ihre Hand. »Ich nehme meine Medikamente und gehe zweimal wöchentlich brav zur Krankengymnastik, aber wenn ich das Leben gar nicht mehr genießen darf, ist es mir auch nichts mehr wert.«
»Salute!« Vittorio schenkte nach.
»Aber ihr solltet unbedingt etwas dazu essen. Sonst schafft ihr es nachher nicht mehr nach Hause. Außerdem will ich auch etwas verdienen, wenn ihr schon stundenlang hier herumsitzt.« Eine zierliche Frau Mitte fünfzig mit kurz geschnittenem grauem Haar trat an den Tisch und stellte eine große Platte mit Salami, Schinken und Weichkäse auf den Tisch, daneben einen geflochtenen Korb mit geschnittenem Brot. Sie reichte Moira die Hand. »Salve, Gabriella. Ich halte den Laden hier am Laufen. Willkommen in Montagnola. Ambrogio war schon ganz aufgeregt, dass seine Tochter ihn besucht. Er spricht seit Tagen von kaum etwas anderem.«
Moira gefiel die herzliche Ausstrahlung der Frau. Sie wirkte wie jemand, der die Dinge im Griff hatte.
»Warten wir mal ab, ob er es nicht bald bereut, wenn ich anfange, das Haus aufzuräumen.«
Gabriella lachte. »Wenn jemand das darf, dann du! So, ich muss wieder an die Arbeit.« Sie eilte nach draußen, wo sich eine Gruppe älterer Damen an einen Tisch gesetzt hatte.
»Warum hockt ihr beiden bei diesem schönen Maiwetter eigentlich hier drin?«, fragte Moira die beiden Männer.
»Damit ich mich nicht über solche wie die da draußen aufregen muss.« Ambrogio blickte auf einmal finster. »Diese Literaturgroupies treiben mich noch in den Wahnsinn. Alle naselang klopfen sie bei mir an die Tür und wollen wissen, ob Hermann Hesse hier gelebt hätte. Einmal waren sogar Amerikaner da, die ihn persönlich sprechen wollten, um sich ein Autogramm abzuholen!«
Moira lachte. »Die Menschen verehren ihn eben.«
»Dann sollen sie seine Bücher lesen, und zwar bei sich zu Hause.«
In der folgenden Stunde saß Moira mit den beiden alten Männern zusammen. Sie führten ein lebhaftes Gespräch, während sie verschiedene Grappasorten probierten und mit Genuss Gabriellas Imbiss verzehrten. Moira erzählte vor allem von Luna.
»Ich hoffe, meine Enkeltochter kommt mich auch mal besuchen«, brummte Ambrogio und wischte sich ein paar Brotkrümel aus dem Bart. »Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, war sie ein ganz kleiner Stöpsel.«
»Da war sie zwölf, papà. Du übertreibst also. Aber ich frage Luna gerne, ob sie in den Sommerferien ein paar Wochen mit mir hier verbringen will.«
Moira hatte bereits den dritten Grappa getrunken und fühlte sich ziemlich beschwingt. Nur ihre Zunge wurde etwas schwer, und sie hatte ein wenig Mühe, deutlich zu sprechen.
Es war ein eigenartig vertrautes Gefühl, neben ihrem Vater im Il Mulino zu sitzen, seiner Bassstimme und seinem dröhnenden Lachen zu lauschen. Als Kind hatte sie das oft getan, damals natürlich statt eines Grappas mit einem Glas Holunderlimonade vor sich. Sie hatte sich in der Nähe ihres Vaters beschützt gefühlt, und auch wenn sie inzwischen erwachsen war, hatte sie dieses Gefühl noch immer. Und erst jetzt merkte sie, wie sehr es ihr gefehlt hatte.
Vittorio stöhnte unvermittelt. »Da kommt das Suchkommando.«
Moira bemerkte, dass ein neuer Gast an ihren Tisch herangetreten war. Zwar nicht mehr ganz so schlank und langhaarig wie früher, aber dafür noch genauso groß und mit demselben offenen Blick.
Sie hatte in den letzten zehn Jahren vielleicht zweimal an ihn gedacht. Und dann auch mit der leicht amüsierten Nostalgie, die Jugenderinnerungen oft in sich tragen. Sie hatte ihn noch nicht einmal gegoogelt. Aber jetzt war er keine Erinnerung mehr, sondern stand leibhaftig vor ihr. Sie fühlte sich wieder wie mit fünfzehn in jenem endlos scheinenden Sommer, in dem sie unzertrennlich gewesen waren. Er war der zweite Junge überhaupt gewesen, der sie geküsst hatte, und der erste, bei dem es ihr gefallen hatte.
Luca nickte ihr zu. »Buona sera.« Keinerlei Anzeichen, dass er sie wiedererkannte. Hatte sie sich etwa so sehr verändert?
»Papà, Abendessen ist fertig. Du hast mal wieder dein Telefon zu Hause liegen lassen.«
»Das war Absicht. Das ständige Gepiepe geht mir auf die Nerven«, brummte Vittorio. »Und du hast offensichtlich deine Manieren zu Hause gelassen, oder erkennst du etwa Ambrogios Tochter nicht mehr?«
Lucas Augen wurden größer. »Moira? Okay, das ist ungefähr das Peinlichste, was mir je passiert ist.« Er grinste schief.
Moira hob einen Zeigefinger. »Aber wirklich! Ist ja nur fünfundzwanzig Jahre her, seit wir uns zuletzt gesehen haben.«
Luca breitete die Arme aus, und Moira stand auf, wobei ihr ein wenig schwummerig wurde. Sie umarmten sich unbeholfen. Moira entschloss sich zur Flucht nach vorne. »Die Schnapsfahne ist nicht meine Schuld! Ich bin gerade angekommen, und unsere beiden Väter haben nichts Besseres zu tun, als mich betrunken zu machen.« Sie setzte sich wieder, und das schwummerige Gefühl verging.
»Du bist entlastet, die Beweise sind offensichtlich.« Luca zeigte auf die Reihe benutzter Gläser. Dann setzte er sich neben Moira und betrachtete sie lächelnd. »Tut mir leid, dass ich dich nicht sofort wiedererkannt habe. Es klingt dämlich, aber ich hatte dich die ganzen Jahre über noch als Teenager vor Augen, wenn ich an dich gedacht habe.«
»Du hast an mich gedacht?« Der verdammte Grappa bewirkte offensichtlich, dass alles, was sie dachte, ungefiltert herausrutschte.
»Nicht nur das. Dein Vater redet ziemlich oft über dich.«
Hieß das, Luca wusste auch von ihrer Trennung? Sie richtete sich auf und hob das Kinn. Er sollte auf keinen Fall den Eindruck erhalten, sie sei auf Männerfang.
»Was erzählt er denn so?«
»Dass du als Übersetzerin arbeitest, verheiratet bist und eine Tochter hast. Klingt richtig gut.«
»Ja, alles perfekt.« Jetzt wäre der passende Moment, um ihre Trennung zu erwähnen. Aber es kam ihr nicht über die Lippen. Der Grappa hatte seine zungenlösende Wirkung anscheinend verloren.
»Du warst früher schon so sprachbegabt«, sagte Luca. »Ich kam mir immer richtig dumm vor mit meinem Bauernitalienisch und den paar Brocken Schulfranzösisch. Aber bei dem Vater liegt es ja auch nahe, dass du dich mit Literatur beschäftigst.«
»Nein, nein, ich übersetze keine Romane. Eher Bedienungsanleitungen und Handbücher. Ich kann dir sagen, was Ablassventildichtung auf Französisch heißt oder Belüftungsklappenhalterung auf Portugiesisch. Falls du dafür mal Bedarf haben solltest.«
Luca lachte, dann sah er sie nachdenklich an. »Wer weiß! So, jetzt muss ich aber meinen Vater loseisen, sonst enterbt mich meine Mutter.« Er stand auf. »Papà, trinkst du aus? Mamma hat Kaninchen mit Bratkartoffeln gemacht.«
»Ich hab keinen Hunger«, sagte Vittorio, verschränkte die Arme und sah seinen Sohn listig an. »Außerdem arbeiten wir, wie du siehst. Der Grappa muss fachmännisch verkostet werden.«
»Das habt ihr Experten ja auch ausgiebig getan.«
»Und ob!«, meldete sich Ambrogio. Er erhob sich. »Bin in Kürze zurück.«
Moira sah ihm nach, als er sich in Richtung der Waschräume begab, war aber beruhigt, da er nicht schwankte und auch sonst keine Anzeichen von Trunkenheit zeigte.
Sie richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf Luca und seinen Vater. Letzterer klammerte sich an einer Grappaflasche fest, als böte sie ihm Halt in einem Sturm. Für einen Winzer vertrug er erstaunlich wenig, allerdings wog er auch nur halb so viel wie Ambrogio. Wenn überhaupt.
»Richte deiner Mutter aus, ich komme nach Hause, wenn wir fertig sind«, sagte er.
»Papà, du bist betrunken.« Luca wandte sich an Moira. »Alkohol macht ihn störrischer als einen Esel.«
Moira beugte sich vor. »Vittorio, es tut mir furchtbar leid, dass deine Frau so schlecht kocht.« Sie legte eine ordentliche Portion Mitleid in ihre Stimme.
Der Winzer sah sie mit verwirrter Miene an. »Wie kommst du darauf? Meine Frau ist die beste Köchin im ganzen Dorf!«
Moira zuckte mit den Schultern. »Ich dachte, du willst nicht nach Hause, weil es dir nicht schmeckt. Welchen Grund könnte es sonst geben, sie mit dem Essen, in das sie sicher viel Mühe gesteckt hat, alleine zu Hause sitzen zu lassen? Aber ich habe mich wohl geirrt, und es sind andere Dinge, die dich von deinem Zuhause fernhalten.«
Vittorios ohnehin gerötetes Gesicht nahm eine noch intensivere Färbung an. Neben ihm stehend gluckste Luca in sich hinein und gab Moira ein Zeichen, weiterzumachen.
Der Winzer plusterte sich auf. »Meine Silvana ist die wunderbarste, schönste, klügste und liebevollste Frau, die man sich vorstellen kann.«
»Dann hast du großes Glück. Und du zeigst ihr sicher jeden Tag, wie sehr du sie schätzt.«
Vittorios Schultern sackten ab, und er ließ den Kopf hängen. »Viel zu wenig. Ich bin ein schlechter Ehemann.« Er nahm seine Schiebermütze vom Tisch und stand unsicher auf. »Luca, bring mich heim!«
Luca hakte seinen Vater unter und führte ihn zum Ausgang. Dort drehte er sich noch einmal kurz um und zeigte mit dem Daumen nach oben. Moira grinste und winkte ab.
»Wo sind denn die beiden Cavadinis?«, sagte Ambrogio, als er eine Minute später zum Tisch zurückkehrte.
»Dort, wo sie hingehören«, sagte Moira. »Und wir sollten vielleicht auch langsam mal los.«
»Richtig, die Katzen warten sicher schon auf ihr Abendessen.«
Gabriella packte ihnen die angebrochenen Grappaflaschen in eine Tüte und umarmte sowohl Ambrogio als auch Moira zum Abschied. »Wenn du ein bisschen Dorftratsch hören willst, komm einfach vorbei.«
Moira und Ambrogio schlenderten durch die jetzt touristenfreien Gassen. Die Sonne stand schon tief und legte einen goldgelben Schleier über die Häusermauern. Moira fühlte sich etwas unsicher auf den Beinen, Ambrogio dagegen war der Alkohol nicht anzumerken. Als sie über einen hervorstehenden Pflasterstein stolperte, legte er ihr den Arm um die Schultern.
»Fall mir nicht hin, Kind.«
Moira lehnte sich an ihn. Es fühlte sich ungewohnt an, und sie spürte Bedauern darüber, dass es nicht anders war. Sie nahm sich vor, in Zukunft den Kontakt zu ihrem Vater nicht noch einmal so schleifen zu lassen, auch wenn sie wieder in Deutschland war. Ambrogio hatte offensichtlich den gleichen Gedanken.
»Es ist schön, dich mal wieder für längere Zeit zu sehen, auch wenn ich sehr gut alleine zurechtkomme.«
Sie bogen in die Via Valdoro ein. Zwischen den Häusern hindurch hatte man einen herrlichen Blick über den Luganer See und die Stadt, die sich an seine Ufer schmiegte und die ihn umgebenden Hügel hinaufzog. Wolkenschatten zogen über die Wasserfläche und die grünen Hänge. In der Ferne erhoben sich die noch schneebedeckten Gipfel der Alpen. Der Anblick weitete Moiras Herz. Sie hatte nicht einmal gewusst, dass sie die Landschaft ihrer Kindheit vermisst hatte, aber jetzt hatte sie zum ersten Mal seit langer Zeit das Gefühl, zu Hause zu sein.
Sie erreichten die Casa Rusconi. Moira holte den Schlüsselbund hervor und reichte ihn an ihren Vater weiter. Ambrogio mühte sich eine ganze Weile mit dem alten Schloss ab. »Jedes Mal klemmt das Ding! Warum hast du überhaupt abgeschlossen? Hier gibt es doch sowieso nichts zu holen.«
Moira drehte sich um, weil die Tür des Hauses gegenüber aufgerissen wurde.
»Ambrogio, ist endlich deine Tochter gekommen?« Die Frau im Türrahmen sprach Deutsch mit Schweizer Akzent und hatte eine bemerkenswert heisere Stimme. Auf der rechten Seite ihres Kopfes sträubten sich zerzauste, rot gefärbte Locken, auf der linken Seite waren sie platt gedrückt, als hätte sie bereits geschlafen.
Ambrogio seufzte so leise, dass nur Moira es hörte, und drehte sich um. »Buona sera, Agnes.« Er stellte Moira der Nachbarin, Frau Tobler, knapp vor und wandte sich wieder dem Türschloss zu.
»Warst du schon wieder im Il Mulino? So kurz nach deinem Schlaganfall?« Die Frau reckte den Kopf aus ihrem Bademantel hervor wie eine Schildkröte aus ihrem Panzer. Ambrogio kämpfte weiter mit dem Schloss und sprach über die Schulter. »Vielen Dank, dass du so besorgt um mein Wohl bist, aber es geht mir gut, und meine Tochter ist ja jetzt bei mir. Du musst mich auch nicht mehr mit Essen versorgen.«
»Ach, das mache ich doch gerne!« Sie wandte sich an Moira. »Finden Sie nicht auch, dass man das Haus unbedingt einmal gründlich sauber machen müsste? Ich komme gerne morgen vorbei.«
»Nicht nötig!«, rief Ambrogio hastig. »Du hast schon so viel getan, und ich bin wirklich dankbar dafür.«
Die Nachbarin winkte ab. »Man muss sich schließlich gegenseitig helfen.«
»Vielen Dank«, sagte Moira und lächelte die Frau so strahlend an, dass ihre Mundwinkel steif wurden. »Das ist wirklich sehr nett. Allerdings passt es morgen nicht so gut, aber ich würde mich bei Ihnen melden, falls ich in den kommenden Tagen Hilfe brauche.«
»Jederzeit! Klingeln Sie einfach bei mir, und ich eile wie der Wind!« Frau Tobler kicherte mädchenhaft, was bei ihrer rauen Stimme eine sehr eigenartige Mischung ergab.
Ambrogio hustete. »Ich glaube, ich muss mich hinlegen, mein lahmes Bein schmerzt ganz furchtbar.« Endlich schwang die Tür auf. Er war schon halb eingetreten, aber Frau Tobler hielt ihn erneut auf.
»Ambrogio, ich brauche unbedingt deine Hilfe!«
Moiras Vater schloss kurz die Augen und drehte sich um. Die Nachbarin rang dramatisch die Hände.
»Meine Hesse-Briefe sind verschwunden!«
In Ambrogios Blick blitzte Interesse auf.
»Die Briefe, die Hesse an deinen Vater geschrieben hat? Ich habe dir schon immer gesagt, du sollst sie in einem Bankschließfach aufbewahren.«
»Ja, ja, ich weiß. Aber jetzt sind sie weg, und ich wollte sie doch morgen ins Museum bringen, wegen dem Hesse-Jubiläum. Sie sollten das Herz der Ausstellung sein!«
»Mit den Festlichkeiten habe ich nichts mehr zu tun, Agnes. Das weißt du doch. Roberto hat jetzt den Vorsitz im Dorfkomitee, wende dich an ihn.«
»Pah!« Frau Tobler reckte die Nase in die Luft. »Was weiß ein Bauunternehmer schon von Literatur? Ich bin sicher, die Briefe sind mir gestohlen worden. Es weiß hier jeder, dass ich immer vergesse abzuschließen.«
»Wahrscheinlich wirst du in deiner Einliegerwohnung fündig«, brummte Ambrogio.
Die Nachbarin stemmte die Hände in die Hüften. »Adrian ist ein anständiger junger Mann, der tut so etwas nicht! Außerdem ist er in der Deutschschweiz, und als er wegfuhr, waren die Briefe noch da! Du kennst dich doch aus, was würde ein Dieb mit handschriftlichen Briefen von einem berühmten Schriftsteller anfangen?«
Ambrogio stützte sich am Türrahmen ab. Wahrscheinlich schmerzte sein Bein tatsächlich.
»Er würde versuchen, sie zu verkaufen. Ich schreibe morgen mal ein paar Sammler an, die ich kenne, und frage nach, ob ihnen etwas angeboten wurde.«
Frau Tobler strahlte. »Danke, carissimo!« Sie zupfte neckisch an einer Haarsträhne in ihrem Nacken. »Ich revanchiere mich auch!«
»Nicht nötig!«, sagte Ambrogio schnell. »Ich gebe Bescheid, wenn ich etwas herausfinde.« Er ging ins Haus. Und Moira folgte ihm.
»Wir sehen uns beim Fest!«, rief ihnen Frau Tobler hinterher, bevor Ambrogio die Tür von innen zuwarf.
Moira lachte. »Die gute Frau Tobler ist ja hin und weg von dir! Soll ich das Aufgebot bestellen?«
Ihr Vater verdrehte die Augen.
»Seit ich aus der Reha zurück bin, hat sich die Frau in eine Klette verwandelt.« Schnaufend zog er seine Schuhe aus, wobei er sich an der Wand abstützte. Er ging voran, und Moira bemerkte, dass seine Bewegungen schleppender waren als zuvor. In der Küche ließ er sich schwer auf einen Stuhl fallen.
Moira setzte sich ebenfalls.
»Was für ein Fest ist das, von dem sie geredet hat?«
»Wieder so ein Zirkus, weil Hermann Hesse 1919 nach Montagnola gezogen ist. Demnächst feiern sie noch, dass ihm vor hundert Jahren eine Warze entfernt wurde! Ich wollte das Ganze ja würdig gestalten, aber das Dorfkomitee ist nur darauf aus, möglichst viel Spektakel zu veranstalten, um die Touristen anzuziehen.«
»Aha. Und daraufhin hast du das Handtuch geworfen?«
»Ich habe mich zurückgezogen«, sagte Ambrogio würdevoll. »Na, meine Süße, hast du Hunger?« Er beugte sich zu der grauen Kartäuser hinunter, die ihm um die Beine strich.
Nacheinander fanden sich auch die anderen Katzen ein und miauten im Quartett, als hätten sie seit Tagen nichts zu essen bekommen.
Moira stand auf. »Ich kann sie füttern, ruh du dich ein bisschen aus.«
Ambrogio sagte ihr, in welchem Schrank das Katzenfutter aufbewahrt wurde, und Moira befüllte nach seiner Anweisung die Steingutschalen. Erst als jede Katze vor ihrem Napf kauerte, kehrte Ruhe ein.
»Für wen ist denn der fünfte Napf?«
»Für Elfriede. Sie ist ziemlich scheu und kommt bestimmt nachher, wenn die anderen weg sind.«
»Elfriede? Süßer Name!«
»Süß? Etwas Respekt vor diesen einzigartigen Kreaturen, bitte! Die da sind: Herta, Ingeborg, Luise – und Marlen mit einem E.« Ambrogio deutete nacheinander mit dem Zeigefinger auf jede der Genannten.
Herta war die Graugetigerte, Ingeborg die große Schwarze, Luise der rote Blitz und Marlen die blaugraue Kartäuser.
»So hast du deine Lieblingsautorinnen immer um dich. Sind es wirklich alles Kätzinnen?«
»Selbstverständlich«, antwortete Ambrogio ernst. »Ich dulde doch keine Konkurrenz neben mir!«
Moira zog aus den Geschirrstapeln eine Moka-Kanne hervor, spülte sie und setzte einen Kaffee auf.
»In einer Sache muss ich deiner Nachbarin recht geben: Ein bisschen Hilfe beim Putzen und Aufräumen wäre möglicherweise gar nicht so schlecht«, sagte sie vorsichtig.
Ihr Vater brummte in seinen eisengrauen Bart. »Ach, ich brauche mein Durcheinander. Deine Mutter war zum Glück immer genauso unordentlich wie ich. Eine andere, die das mitgemacht hätte, hab ich nicht mehr gefunden.«
»Habt ihr mal geprüft, ob ich nach meiner Geburt im Krankenhaus vertauscht wurde? Ich glaube, ich war das einzige Kind der Welt, das freiwillig sein Zimmer aufgeräumt hat.« Die Kaffeekanne auf dem Herd begann zu zischen, und Moira drehte die Flamme ab.
Ambrogio lächelte und sah sie liebevoll an. »Du warst eben eine kleine Rebellin.«
Moira lachte. »Total aufmüpfig! Ich kann einfach nicht denken, wenn um mich herum alles durcheinander ist. Aber du hast recht: Geht mich nichts an, wie es bei dir aussieht.«
»Nun ja, da du ja einige Zeit bleiben willst, könnte ich mich schon bemühen, ein wenig mehr Ordnung zu halten. Vielleicht engagiere ich tatsächlich Agnes, um hier mal durchzuputzen.«
Der Kaffee tat Moira gut und vertrieb die Schwere, die der Grappa hervorgerufen hatte. Ambrogio zündete sich seine Pfeife an.
»Ich hoffe, der Rauch stört dich nicht, aber Kaffee und Pfeife gehören für mich einfach zusammen.«
»Kein Problem, ich mag den Geruch. Außerdem ist es ja dein Haus.«
Herta, die graugestromte Katze mit den grünen Augen, strich um Moiras Beine. Sie nahm das Tier auf den Schoß, wo es sich zusammenrollte und zu schnurren begann.
»Darf ich dich was fragen?«
»Natürlich, tesoro.« Ambrogio paffte dicke Rauchwolken in Richtung Balkendecke.
»Weshalb hast du Luca nicht erzählt, welche Art von Übersetzungen ich mache? Er dachte, ich übersetze Literatur. Schämst du dich für das, womit ich mein Geld verdiene?«
Ihr Vater zog seine buschigen Augenbrauen zusammen. »Keineswegs! Für ehrliche Arbeit muss sich niemand schämen. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, bei welcher Gelegenheit ich deinen Beruf erwähnt habe und warum ich nicht ins Detail gegangen bin. Aber ganz sicher schäme ich mich nicht für dich. Oder hältst du mich für einen arroganten alten Sack?«
»Ich dachte nur, du bist vielleicht enttäuscht, weil ich mit meinem Abschluss nichts angefangen habe.« Moira zog mit einem Fingernagel die Holzmaserung der Tischplatte nach.
»Du entscheidest selbst, was du mit deinem Leben tust. Aber es hätte mich für dich gefreut, wenn du deinen Traum verwirklicht hättest. Als Sprachwissenschaftlerin hättest du so vieles erlebt, so viele Erfahrungen sammeln können.«
Moira lächelte. »Vielleicht schreibe ich ja irgendwann noch meine Doktorarbeit. Sprachtabus der mongolischen Sprachfamilie. Dann lebe ich in einer Jurte und reite jeden Morgen zur Falkenjagd. Das habe ich mir als kleines Mädchen immer vorgestellt, seit ich die Abenteuer von Großer Tiger und Christian gelesen hatte. Das Buch war ein Geschenk von dir, weißt du noch?«
Ambrogio räusperte sich: »Zu deinem zwölften Geburtstag.«
»Ich wäre wirklich gerne Ethnolinguistin geworden«, fuhr Moira fort. »Aber das Leben hatte eben andere Pläne für mich. Ich bedaure nicht, dass ich Luna gekriegt habe. Wir haben es gut – und dank Martin hatten wir bisher auch keine finanziellen Sorgen.«
»Und wie sieht es jetzt nach eurer Trennung damit aus?«
»Martin zahlt freiwillig Unterhalt für Luna, obwohl er das als Stiefvater gar nicht müsste. Und ich nehme einfach mehr Aufträge an. Ich mag meine Arbeit. Komplexe Dinge einfach zu erklären, das liegt mir. Ich weiß eine Menge darüber, wie man Schwingschleifer, Schlagbohrmaschinen und TV-Boxen bedient.« Sie reckte das Kinn.
Ambrogio lachte so sehr, dass er husten musste. Herta schreckte hoch und glitt mit einem eleganten Sprung von Moiras Schoß.
»Wenn es dir gut geht, bin ich auch zufrieden, tesoro. Und wenn ich technische Hilfe brauche, werde ich mich an dich wenden.«
»Jederzeit! Sag mal, ist es dir recht, wenn ich im alten Gästehäuschen schlafe? Dann gehe ich dir auch weniger auf die Nerven.«
Ambrogio stieß eine Rauchwolke aus. »Hier im Haus gibt es genug Zimmer, aber wie du möchtest. Die Hütte ist nicht im besten Zustand, aber du kannst es dir ja einmal ansehen.«
Moira nahm ihn beim Wort, holte den Schlüssel zum Gästehaus aus der Küchenschublade und ließ ihren Vater mit den Katzen und seiner Pfeife in der Küche zurück. Draußen war es noch hell genug, dass sie sehen konnte, wo sie entlangging. Sie pflügte mit ihrem Koffer durch das hoch stehende Gras, das von wild wachsenden Wiesenblumen durchsetzt war, hinüber zum Gästehäuschen.
Die Tür klemmte ein wenig und knarrte laut, als Moira sie aufdrückte. Sie trat ein, legte den Lichtschalter um und erhaschte einen Blick auf ein schwarzes Katzenhinterteil, das im Türspalt der halb geöffneten Badezimmertür verschwand. Das Letzte, was Moira erblickte, war eine ungehalten wedelnde orangefarbene Schwanzspitze. Sie folgte der Katze, doch als sie das kleine Badezimmer betrat, war es leer. Das schmale Fenster über der Toilette stand offen, was erklärte, wohin das Tier entfleucht war. Das musste wohl die sagenumwobene Elfriede gewesen sein. Moira bedauerte, die Katze aus ihrer Zuflucht vertrieben zu haben, und nahm sich vor, ihr zum Ausgleich einen besonderen Leckerbissen aufs Fensterbrett zu legen.
Sie kehrte zurück in den Hauptraum, einer Kombination aus Küche und Wohnzimmer. Wenn sie als Jugendliche in den Ferien hier gewesen war, war das Häuschen ihr Reich gewesen, und es steckte noch jetzt voller Erinnerungen an diese Aufenthalte. An dem alten Holztisch hatte sie Tagebuch geschrieben, auf dem abgenutzten Ledersofa hatte sie stundenlang gelesen und auch ein paarmal mit Luca geknutscht. Beherrscht wurde das Zimmer von dem großen Kamin, in dessen Einfassung aus Stein zu beiden Seiten je ein Sitzplatz eingebaut war. Hier konnte man an Regentagen sitzen und eine Tasse Tee trinken, gewärmt durch die glimmenden Holzscheite. Wie geborgen sie sich an solchen Abenden gefühlt hatte. Zum Glück war es hier oben auch zu dieser Jahreszeit abends noch kühl, sodass sie Gelegenheit haben würde, ein Feuer zu machen.
Es war alles ein wenig verstaubt, aber sauber und erstaunlich aufgeräumt, abgesehen von dem Imkeranzug und dem dazugehörigen Hut, die auf dem Sofa lagen. Moira hängte den Anzug über eine Stuhllehne und legte den Hut auf den Esstisch, daneben ihre Laptoptasche. Dann zerrte sie ihren Koffer die steile Treppe, mehr eine Leiter, hinauf auf die Galerie. Es gab hier oben gerade genug Raum, um aufrecht zu stehen. Durch das runde Fenster im Dachfirst kam Licht herein, grün gefiltert durch den Oleander, der draußen an der Mauer wuchs. Auf dem Holzboden lag eine Doppelmatratze und darauf Daunenkissen und Federbett, die beide voller Katzenhaare waren. Moira war froh, dass sie in weiser Voraussicht eine Fusselbürste mitgenommen hatte.
Sie packte ihre Kleidung in die kleine Kommode, schüttelte die Bettwäsche vor der Tür aus und ließ sie offen, um frische Luft hereinzulassen. Dann setzte sie sich auf die Kaminbank und rief Luna an, um sie wissen zu lassen, dass sie wohlbehalten angekommen sei und es ihrem Großvater gut ginge. Doch Luna und ihre Großmutter waren gerade mitten in einem Fotoshooting, weshalb Moira freundlich, aber schnell abgefertigt wurde. Danach fühlte sie sich ein bisschen verloren, auch wenn sie sich freute, dass Luna anscheinend ohne sie zurechtkam. So frei wie in den kommenden Tagen hatte sie schon lange nicht mehr über ihre Zeit verfügen können, und wenn sie ehrlich war, freute sie sich darauf. Sie würde spät aufstehen, ausgedehnte Spaziergänge unternehmen, Zeit mit ihrem Vater verbringen, mit den Katzen spielen und an ihrem aktuellen Auftrag arbeiten, der Übersetzung einer Betriebsanleitung für eine Kettensäge aus dem Französischen ins Deutsche.
Sie hatte lange nicht mehr darüber nachgedacht, ob sie diese Arbeit gerne machte. Nachdem sie aus Lima zurückgekehrt waren, hatten die Übersetzungen ihr und Lunas Überleben gesichert, bevor sie Martin kennenlernte. Es war Moira wichtig gewesen, dass Luna in Deutschland zur Schule ging, doch sich einzugewöhnen fiel ihnen beiden schwer. Alles war zu ernsthaft, zu pünktlich, zu geplant, zu kalt. Moira vermisste die bunten Häuser von Lince, ihrem Stadtviertel in Lima. Manchmal kochte sie aus purer Sehnsucht ein lomo saltado, stand mit geschlossenen Augen am Herd und stellte sich vor, dort zu sein.
Sie hatte oft davon geträumt, zusammen mit Martin nach Lima zu reisen, damit er diesen Teil ihres Lebens verstehen würde, aber es war nicht dazu gekommen – und jetzt würde es das nie mehr. Sich zu trennen war schwerer, als verlassen zu werden, auch wenn man sicher war, das Richtige zu tun. Sie war diejenige, die Schuld am Ende der Beziehung und dem Durcheinander trug, das diese Entscheidung mit sich gebracht hatte. Nur allmählich war ihr bewusst geworden, dass sie wieder vollkommen frei war, zu tun, wozu immer sie Lust hatte. Natürlich mit Rücksicht auf Luna, aber sie musste sich nicht mehr an den Lebensentwurf eines anderen Menschen anpassen.
Auf einmal gab es Möglichkeiten, wo sich vorher nur ein gerader Weg ohne Abzweigungen erstreckt hatte. Allerdings hatte Moira keine Ahnung, welche davon sie wählen sollte. Darüber würde sie sich hoffentlich während der Zeit hier im Tessin klarer werden.
Doch nicht heute Abend. Sie ging wieder hinüber ins Haupthaus, wo in der Küche ihr Vater vor dem Herd stand und in einem Topf mit Minestrone rührte. Er verbat sich jegliche Hilfe. Moira setzte sich und holte ihr Handy hervor. Es war ihr insgeheim ein wenig peinlich, als sie in die Suchmaschine den Namen Luca Cavadini eintippte.
In der Ergebnisliste erschienen einige Websites, die ihn in Verbindung mit dem Weingut seines Vaters erwähnten, doch die meisten befassten sich mit seiner beruflichen Tätigkeit: Moiras Sandkastenfreund war der leitende Rechtsmediziner der Tessiner Kantonspolizei.
2
Moira wunderte sich, wie schnell sie sich wieder in Montagnola eingewöhnte. Auch das Zusammenleben mit ihrem Vater spielte sich ein. Sie ließen sich gegenseitig ihren Raum. Morgens frühstückten sie gemeinsam, danach legte er sich für ein Nickerchen noch einmal eine halbe Stunde hin. Moira kehrte dann in das Gästehäuschen zurück, um an ihren Übersetzungen zu arbeiten. Zum Mittagessen trieben sie meistens keinen Aufwand, sondern jeder schnappte sich aus Kühlschrank und Vorratskammer, worauf er Lust hatte.
Moira unterstützte ihren Vater, indem sie die Lebensmitteleinkäufe übernahm und ihn mit dem Auto zu seiner Physiotherapie nach Lugano brachte. Sie überredete ihn außerdem dazu, sie etwas Ordnung in der Küche und im Wohnzimmer schaffen zu lassen.
Ambrogio ging es gut, bis auf die leichte Lähmung, aber er wurde schnell müde, und die Aufgaben des alltäglichen Lebens überforderten ihn. Langfristig würde Moira eine Hilfe für ihn finden müssen. Schließlich würde sie in wenigen Wochen wieder nach Deutschland zurückkehren.
Sie vermisste Luna und erstaunlicherweise sogar ihre Mutter. Alle paar Tage unterhielten sie sich per Videochat. Luna schien fröhlich und ausgeglichen. Ein schlechtes Gewissen hatte Moira trotzdem. Auch für Luna war die Trennung ein tiefer Einschnitt in ihr Leben gewesen. Und nun war Moira, statt sich um Luna zu kümmern, Hunderte von Kilometern entfernt.
Abends gingen Moira und ihr Vater meistens hinüber in die Osteria und ließen sich von Gabriella bekochen. Die einfache, aber gehaltvolle Tessiner Küche schmeckte hervorragend. Gabriellas brasato – stundenlang gekochtes Rindfleisch mit Gemüse und Rotwein – war so zart, dass es auf der Zunge schmolz. Als Beilage gab es Polenta, den traditionellen Brei aus Maisgries, den ein Automat stundenlang in einem großen Kessel im offenen Kamin rührte. Dazu tranken sie Rotwein, natürlich aus Vittorio Cavadinis Produktion. Meist gesellte sich der Winzer selbst zu ihnen, und wenn sie alle Gäste versorgt hatte, setzte sich die Wirtin Gabriella ebenfalls an ihren Tisch. Insgeheim hoffte Moira, auch Luca würde sich einmal im Il Mulino blicken lassen, aber er hatte wohl Besseres zu tun.
Durch den gemächlichen Tagesablauf kam Moira zur Ruhe. Die Anspannung, die sich in den letzten, unerfreulichen Jahren mit Martin in ihr aufgestaut hatte, fiel nach und nach von ihr ab. Auch der Großstadtstress, der ihr erst jetzt bewusst wurde, löste sich allmählich auf.
Als beste Therapie entpuppten sich die Katzen, in deren Gesellschaft es unmöglich war, sich nicht zu entspannen. Sie hatten schnell Vertrauen zu Moira gefasst, nachdem sie sie einige Male gefüttert hatte. Nur die geheimnisvolle Elfriede blieb zurückhaltend und ließ nicht mehr als ihre orangefarbene Schwanzspitze sehen. Aber die Stückchen Thunfisch, die Moira gelegentlich auf das Fensterbrett des Gästehäuschens legte, verschwanden zuverlässig jedes Mal innerhalb kürzester Zeit. Nur Geduld, sagte sich Moira. Elfriede würde sich schon an sie gewöhnen.
Vier Tage nach ihrer Ankunft saß Moira gerade bei ihrem zweiten Becher Morgenkaffee, als die Türglocke anschlug, eine Eigenkonstruktion ihres Vaters aus einem antiken Toilettenzug und einer Kuhglocke. Moira erhob sich nur widerwillig, weil sie mit Signora Tobler rechnete, die jeden Tag mindestens einmal klingelte, um Kuchen vorbeizubringen oder ein Schwätzchen zu halten. Aber vor der Tür stand Luca.
»Ich brauche deine Hilfe, kann ich kurz reinkommen?«
»Na klar, bitte.« Sie trat zur Seite und ging ihm voraus in die Küche, so würdevoll, wie es ihr in dem alten, karierten Bademantel, den sie ihrem Vater entwendet hatte, nur möglich war.
»Kann ich dir einen Kaffee anbieten? Ist schon fertig.« Sie holte eine Tasse aus dem Schrank.
»Einen ganz schnellen, ich habe es leider eilig. Wir haben einen Leichenfund, und ich muss so schnell wie möglich dahin. Könntest du mich begleiten?«
»Entzückende Idee für einen Ausflug, aber ich glaube, nicht so ganz mein Ding.« Moira grinste und reichte ihm seinen Espresso.
Luca lachte. »Ich scherze nicht. Die Leute, die die Leiche gefunden haben, sind deutsche Wanderer. Wir brauchen jemanden, der ihre Aussagen übersetzt. Die Dolmetscherin, die das sonst macht, ist dummerweise krank.«
Moira wurde ernst. »Die armen Leute! Nur bin ich keine Dolmetscherin, sondern Übersetzerin.« Sie trank einen Schluck Kaffee.
»Das macht nichts, es genügt, dass du korrekt ins Italienische übersetzen kannst. Bitte, ich weiß sonst nicht, was ich machen soll. Niemand im Team kann gut genug Deutsch, ich schon gar nicht.« Er sah sie flehend an, und sie musste lachen. »Eigentlich wollte mir mein Vater heute zeigen, wie man die Honigwaben aus den Bienenstöcken holt, aber das wird wohl warten müssen.«
Sie stellte den Kaffeebecher in die Spüle und lief hinüber ins Gästehaus, um sich anzuziehen. Auf dem Rückweg sagte sie ihrem Vater Bescheid, der in seinem Imkeranzug wie ein Astronaut oder jemand vom Seuchenschutz im Garten herumstapfte, und wenige Minuten später saß sie neben Luca in einem knallroten Vintage-Sportcabrio.
»Toller Wagen! Was kompensierst du damit?« Es machte Spaß, Luca aufzuziehen, denn er revanchierte sich sofort: »Dass ich mich mit vorlauten Dolmetscherinnen herumschlagen muss.«
Moira lehnte sich zurück und genoss die Fahrt die kurvige Straße hinunter. Dann erinnerte sie sich daran, dass sie unterwegs zu einem Leichenfundort waren, und richtete sich wieder auf.
»Geht es um einen Mord?«
»Das wissen wir noch nicht. Erst einmal müssen am Fundort Spuren gesichert werden, und dann muss ich mir die Leiche genauer ansehen. Es könnte sich auch um einen Unfall oder um einen Suizid handeln.«