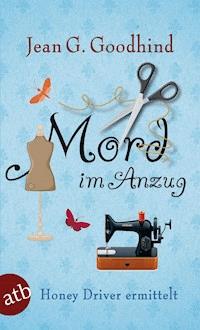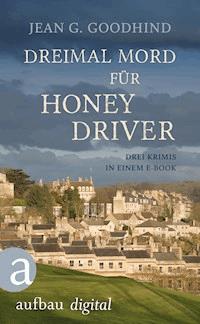8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Honey Driver ermittelt
- Sprache: Deutsch
Süßes, sonst gibt´s Grausiges!
Während einer völlig chaotischen Halloween-Party werden Doris und Boris Crook, die neuen Besitzer der Pension Moss End, ermordet. Honey Driver, Hotelbesitzerin und Verbindungsfrau des Hotelfachverbands von Bath zur Polizei, steht mit diesem Fall ziemlich allein da. Ihre Beziehung zu Inspector Steve Doherty steckt in einer tiefen Krise. Wo anfangen? Die ganze Partygesellschaft ist verdächtig - und alle waren maskiert ...
„Skurrile Handlung und viel britischer Humor.“ Brigitte.
„Eine moderne Miss Marple in bester britischer Krimitradition.“ Für Sie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Jean G. Goodhind
Mord zu Halloween
Honey Driver ermittelt
Kriminalroman
Aus dem Englischenvon Ulrike Seeberger
Inhaltsübersicht
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Informationen zum Buch
Über Jean G. Goodhind
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Prolog
Gavin Whitmore parkte sein rotes Royal-Mail-Postauto gegenüber von Moss End Guest House, schnappte sich das Paket, das er abliefern sollte, vom Beifahrersitz und setzte sich in Bewegung. Mit einem geschickten Tritt nach hinten pfefferte er die Tür des Lieferwagens zu, und schon war er unterwegs, flitzte mit seinen Reebok-Sportschuhen auf fünf Zentimeter dicken Sohlen schnell wie ein Windhund über die Straße.
Dann absolvierte er die übliche Routine für den Boten mit den schnellen Schuhen: den Pfad entlangrennen, das Paket zwischen Brustkorb und einem Steinpfeiler der Veranda einklemmen, an die Tür hämmern und warten.
Niemand machte auf. Kein Mucks war zu hören. Es war wirklich zum Verzweifeln. Er fluchte vor sich hin. Allerdings leise, falls doch jemand zu Hause sein sollte. Drei Mal hatte er jetzt schon probiert, dieses verdammte Paket zuzustellen, und immer noch ohne Erfolg.
Wenn er keine Unterschrift zur Bestätigung der Zustellung gebraucht hätte, so hätte er das Paket nur zu gern mit Schwung in eine der lächerlich großen Vasen gestopft, die zu beiden Seiten der Tür standen. Die Vorbesitzerin des Moss End Guest House, Miss Ginny Porter, hatte oft und begeistert Auktionen besucht. Welcher Teufel sie aber geritten hatte, diese Monstervasen zu ersteigern, konnte sich Gavin nicht einmal im Traum ausmalen. Die Dinger waren dickbauchig, so hoch wie er und ringsum mit nackten Gestalten verziert. Die musterte er eingehend, während er wartete, und fuhr mit dem Finger über eine wohlgerundete griechische Brust; na ja, zumindest sah sie griechisch aus. Jedenfalls irgendwie historisch. Und ganz schön gewagt. Wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen, diese antiken Griechinnen mal kennenzulernen.
Noch einmal an die Tür hämmern. Bum, bum, bum.
Wahrscheinlich ganz schön kalt, die alte Hütte, überlegte er, während er einen Schritt zurücktrat und an der dreistöckigen Fassade hinaufblickte. Das Haus war alt, das war nichts sonderlich Ungewöhnliches. Das waren viele Häuser in und um Bath, aber dieses hier wirkte noch dazu ein bisschen unheimlich, weil es etwas abseits vom Dorf stand und von Mauern umgeben war, die auch bei einem der Gefängnisse Ihrer Majestät nicht fehl am Platz gewesen wären. Man hatte die schmiedeeisernen Verzierungen am Tor hinter ihm mit einer Metallplatte verstärkt, die ein wenig zu groß war. So stand das Metall an den Seiten über und schrammte unangenehm an den Scharnieren entlang, wenn man das Tor öffnete und schloss – mit einem Quietschen, das einem kalte Schauer über den Rücken jagte.
Da war das grausige Geräusch schon wieder.
»Keiner zu Hause, Herr Postbote.«
Ehe sie noch ein Wort gesprochen hatte, war ihm klar gewesen, wer das gesagt hatte. Mrs Hicks wohnte in einem der Cottages auf der anderen Straßenseite. Ihr Häuschen war mindestens so alt wie dieser Kasten hier, wenn auch nicht annähernd so groß.
Die alte Dame stemmte ihr ganzes Körpergewicht gegen das mit einer starken Feder versehene Tor, um es aufzuhalten, und umklammerte mit beiden Händen ihren Stock. Leuchtend blaue Augen funkelten in einem Gesicht, das wegen ihrer Arthritis ein wenig schmerzverzerrt war. Gavin dachte, dass die Überquerung der Straße sie wohl einige Mühe gekostet haben musste.
Peregrine, ein grauer Kater mit orangen Augen, hatte den Schwanz und den ganzen Körper um die Knöchel der alten Dame gewunden. Er folgte ihr auf Schritt und Tritt.
»Wie geht’s denn so, Mrs Hicks?«
»Wie immer. Altwerden ist nichts für Feiglinge, wissen Sie.«
Gavin grinste. »Ach, Sie haben doch noch viele Jahre vor sich, Mrs Hicks. Viele Jahre.«
Sie lachte leise, und ihre Augen funkelten vergnügt.
Gavin beugte sich hinunter und kraulte den Kater hinter den Ohren. »Und wie geht’s dir, Peregrine, alter Junge?«
Der Kater schnurrte vor Begeisterung.
Der Postbote deutete mit dem Kopf auf das große alte Gebäude. »Wieder keiner da.«
»Sie könnten bei mir auf die Leute warten. Falls sie doch noch kommen sollten«, bot sie ihm an, und ihr Gesicht leuchtete in der Hoffnung, dass er ein bisschen Zeit haben würde. »Und wenn sie nicht auftauchen – na ja –, dann können wir es machen wie sonst.«
Gavin lächelte. Außer dem Kater hatte die freundliche alte Dame niemanden. Die meisten Bewohner von Northend waren Pendler, also genoss sie nur selten einmal Gesellschaft – jedenfalls tagsüber. Wahrscheinlich auch am Abend nicht, denn die meisten Leute kamen einfach nach Hause und sackten mit einem Gin Tonic auf einem Sessel zusammen oder spazierten auf ein Bier und ein Schwätzchen mit dem Wirt zum Northend Inn – oder sie gingen beim Glockenläuten in die Kirche. Komisch, dass die Städter inzwischen all die dörflichen Traditionen weiterführten, die die eigentlichen Dorfbewohner nicht mehr mochten.
»Wie wäre es denn mit einer schönen Tasse Tee?«, fragte Mrs Hicks und strahlte ihn an.
Er hatte richtig Lust auf ein Tässchen und schaute auf die Uhr. »Na ja, das könnte ich machen, aber nur auf eine Tasse und einen Keks.«
»Das Wasser hat schon gekocht.«
Mrs Hicks, der Kater und der Postbote wanderten im Gänsemarsch über die Straße.
Als Gavin Tee und Kekse intus hatte, fragte er Mrs Hicks, ob es ihr etwas ausmachen würde, die Empfangsbestätigung zu unterschreiben und das Paket dann gegenüber bei den neuen Besitzern der alten Hütte abzugeben, wenn sie sie sah.
»Mache ich gern. Ich muss mich ohnehin da drüben mal vorstellen«, antwortete sie, und ihre Augen leuchteten bei der Aussicht darauf, jemanden zu finden, mit dem sie sich unterhalten konnte.
»Sie meinen, Sie haben noch keinen Antrittsbesuch bei den neuen Besitzern gemacht? Das sieht Ihnen aber gar nicht ähnlich, Mrs Hicks, so gesellig wie Sie sind, Sie Partymädchen!«
Die alte Dame kicherte über seine Frotzelei. So machten sie es immer, denn sie nahm liebend gern Pakete für ihre Nachbarn entgegen. Gewöhnlich versuchte Gavin es drei Mal, Pakete zuzustellen, ehe er sie woanders abgab – meistens bei Mrs Hicks. Bisher hatte sich noch nie jemand beschwert, dass etwas nicht angekommen war.
Er bat sie, auf dem mattgrauen Bildschirm des elektronischen Geräts zu unterschreiben.
»Ich geh nur eben meine Brille holen.«
»Macht es Ihnen auch wirklich nichts aus?«
»Ach, überhaupt nicht«, antwortete sie und schüttelte den Kopf mit dem silbergrauen Haar. »Tagsüber erwischen Sie die ohnehin nie. Ich habe sie im Hellen noch nie gesehen, doch ich weiß, dass sie zu Hause sind, wenn es dunkel wird. Dann geht drüben das Licht an. Aber ich glaube, viele zahlende Gäste haben die nicht. Seltsam. Bei Miss Porter war immer ziemlich viel los.«
Gavin dankte ihr und machte sich fröhlich auf den Weg, den Kopf voller Melodien aus seinem iPod und in Gedanken schon bei seiner Freundin Rita, mit der er zusammenwohnte und die er heiraten wollte.
Als Gavin zu Mrs Hicks’ Cottage zurückschaute, saß der Kater auf einem Steinpfosten neben dem Törchen. Mit riesigen Augen starrte er dem Postboten nach, während der über die Straße zu seinem Wagen zurückging. Sobald Gavin sich wieder hinter das Lenkrad gesetzt hatte, schien der Kater das Interesse an ihm zu verlieren. Jetzt konzentrierte er seine ganze Aufmerksamkeit darauf, eine seiner mächtigen Pfoten zu säubern.
In der folgenden Woche wollte Gavin bei Mrs Hicks vorbeischauen und ihr die gute Nachricht bringen, dass Rita seinen Heiratsantrag angenommen hatte. Das alte Mädchen war eine unverbesserliche Romantikerin und hatte ihn gebeten, sie in dieser Sache auf dem Laufenden zu halten.
Aber jetzt machte sie nicht auf. Er schaute durchs Fenster ins Haus und sah keinen Feuerschein von dem alten Parkray-Kohleofen, mit dem sie heizte. Na gut, im Augenblick war es nicht sehr kalt, aber sie war ja nicht mehr die Jüngste und hatte den Ofen beinahe das ganze Jahr über an, allerdings auf der niedrigsten Stufe, damit sie nicht zu viel Kohle verbrauchte. Es war auch kein Lichtkegel von der Lampe auszumachen, die sie einschaltete, wenn sie lesen wollte, was sie ziemlich oft tat. Besonders gern mochte sie die Zeitschrift »The People’s Friend«, die er ihr vom Zeitschriftenladen an der Hauptstraße mitbrachte, die Northend vom Rest des Ortes Batheaston trennte.
Was noch besorgniserregender war: Von Peregrine war ebenfalls keine Spur. Entweder war Mrs Hicks im Krankenhaus, oder es hatte sich plötzlich jemand von der Verwandtschaft an sie erinnert und war mit ihr in die Ferien gefahren. Das war allerdings eher unwahrscheinlich. Sie bekam nie Besuch von ihren Verwandten, obwohl er wusste, dass sie einige hatte. Und sie würde niemals wegfahren, ohne dafür zu sorgen, dass sich jemand um den Kater kümmerte. Wenn sie nicht da war, musste er in eine Katzenpension.
Gavin schaute sich im Vorgarten um und hielt Ausschau nach Peregrine. Nichts. Nur für den Fall, dass der Kater im Garten hinter dem Haus war, ging Gavin über den Fußweg am Haus entlang. Eine Holztür in einem morschen Rahmen trennte den hinteren Garten vom Vorgarten. Gavin klopfte an das bemooste Holz, falls Mrs Hicks gerade hinten Unkraut jätete oder Wäsche aufhängte.
Das Tor hing lose an den rostigen Scharnieren und schrammte über die Steinplatten des Wegs, als er es öffnete. Im Garten war niemand, nur ein kleiner Schuppen und ein Mülleimer waren zu sehen. Ein Besen aus Weidenzweigen, mit dem man Blätter zusammenkehren konnte, lehnte hinter dem Tor an der Mauer.
Keine Spur von Peregrine.
Gavin war ein anständiger Kerl und hatte seine Pflicht tun und nachsehen wollen, ob es Mrs Hicks gutging. Aber sie war nicht da, also ließ sich das auch nicht überprüfen. Aber es war egal. Irgendjemand im Dorf würde ihm schon sagen können, wo sie war. Schlimmstenfalls war sie verstorben, und der Gedanke machte ihn traurig. Aber sie hatte ein langes, erfülltes Leben gehabt, überlegte er. Allerdings hätte ihm doch sicher jemand im Dorf was gesagt, wenn sie den Löffel abgegeben hatte. Und Peregrine war auch nicht da. Das war eigentlich die wichtigste Nachricht. Denn wo immer Mrs Hicks hinging, folgte ihr der Kater auf den Fersen.
Er zögerte ein wenig, ehe er wieder in seinen Wagen stieg, und schaute über die Straße zum Moss End Guest House. Die Mauer ringsum war so hoch, dass man nur die Fenster in den Obergeschossen sehen konnte, denn das Erdgeschoss war hinter der Mauer und dem mit der Metallplatte verschlossenen Tor völlig verborgen.
In den oberen Etagen brannte kein Licht in den Fenstern. Er hatte zwar bereits einige Briefe in den Briefkasten gesteckt, aber nie Anzeichen dafür bemerkt, dass jemand zu Hause war. Er überlegte, ob man dort überhaupt schon zahlende Gäste aufnahm. Eigentlich sah es nicht danach aus, wenn man bedachte, wie leer die Fenster wirkten, in denen sich nur die Cottages ringsum spiegelten.
»Ich habe da noch keine Menschenseele gesehen, und laut Mrs Hicks gibt’s da den ganzen Tag über auch kein Lebenszeichen«, sagte er zu Rita, als er nach Hause kam. »Die alte Dame hat gemeint, die hätten nur abends Licht an.«
»Wie bei Vampiren«, erwiderte Rita. »Wahrscheinlich sind die neuen Besitzer Vampire, schlafen bei Tag unten im Keller in Särgen und kommen nur nachts raus.«
Gavin prustete los und legte die Arme um sie. »Sei nicht so gottverdammt albern! Und jetzt gib mir einen Kuss, aber bitte schön vorsichtig, kein Blut saugen!«
Kapitel 1
Auf Einladung einer alten Freundin saß Honey Driver, Hotelbesitzerin und im Nebenberuf Verbindungsperson des Hotelverbands von Bath zur Kriminalpolizei, im Pump Room und gab die schicke Dame, die zu Mittag speist. Die Tischdecken waren weiß, die Atmosphäre war gesellig, und in einer Ecke spielte ein Trio irgendwas von Händel.
Dies war schon seit einigen Jahren eine gute Adresse für ein Treffen zum Mittagessen. Im achtzehnten Jahrhundert knüpfte man hier die gesellschaftlichen Netze, während man ein Glas lauwarmes Heilwasser trank und kurz im Thermalbad abtauchte. Heute genoss man Sandwiches mit hauchdünnen Gurkenscheiben, Kuchen mit glänzendem Zuckerguss und Rosinen-Scones, die vor cremiger Sahne aus Cornwall und Erdbeermarmelade nur so trieften. Der Tee war für Honeys Geschmack zu schwach, aber zumindest wurde er in einer Porzellankanne mit einem Teesieb und Würfelzucker serviert. Es würde auch nicht viel bringen, wenn sie den Tee in der Kanne ordentlich mit dem Löffel umrührte. Die beste Lösung wäre wohl, ein paar Stückchen Zucker mehr hinzuzugeben, beschloss sie.
Sie musterte ihre alte Freundin Alison Brunton über den Rand ihrer Teetasse.
»Du hast dich seit unserer Schulzeit überhaupt nicht verändert.« Sie spülte diese Halbwahrheit mit einem Mundvoll lauwarmen Tees herunter und versuchte dabei, nicht das Gesicht zu verziehen.
Alison lachte laut, wie es dem Teenager, der sie vor langer Zeit einmal gewesen war, besser angestanden hätte. Jetzt waren ihre Lippen mit Botox unbeweglich gemacht und mit rosa Lippenstift eingekleistert. »Nein, ich habe mein jugendliches Aussehen wirklich nicht verloren, oder?«, sprudelte sie hervor und zupfte neckisch an sich herum wie ein Teenager.
»Du siehst blendend aus für dein Alter«, bestätigte Honey. Alison wirkte ein wenig altmodisch, aber sie war eine alte Freundin, und ein wenig Schmeichelei gehörte zu den Überlebenstechniken, wenn man die vierzig einmal überschritten hatte.
In Wirklichkeit sah Alison wie eine lebensgroße Barbiepuppe aus: mit spitzem Busen und festgelackten Haaren, die ein wenig zu sehr in Richtung Glamour der achtziger Jahre frisiert waren. Es war alles da, vom lila Lidschatten bis zur Baywatch-Frisur. Außerdem trug sie Plateauschuhe mit zehn Zentimeter hohen Absätzen. Honey hatte sie darin schon mal laufen sehen und war erstaunt, wie gut Alison das schaffte.
Wie machte die das bloß?
Es ist ein Wunder, dass sie nicht umknickt, überlegte Honey, die viel lieber bequeme Schuhe mit niedrigem Absatz mochte. Mit flachen Schuhen konnte man entschieden schneller laufen, noch besser in Turnschuhen. Wen scherte es, wenn sie die zum Rock anstatt zur Jogginghose anzog? Nicht dass sie je joggen ging. Dagegen hatte sie eine ausgeprägte Abneigung.
Hohe Absätze waren nur zum Anschauen da, nicht zum Arbeiten. Wenn Detective Chief Inspector Doherty mal keinen Dienst hatte, dann sah der Detective mit der Lederjacke, dem schwarzen T-Shirt und den engen Hosen sich gern ihre Beine an. Wenn er Dienst hatte, eigentlich auch.
Alison, die dreimal in der Woche ins Fitness-Studio ging, tat gerade ihr Bestes, um Honey davon zu überzeugen, wie phantastisch viele Leute man dort kennenlernen konnte, besonders Leute männlichen Geschlechts.
»Da habe ich auch Maurice kennengelernt. Maurice Hoffman. Groß, stark und schön. O ja! Was für ein Kerl! Bauchmuskeln zum Niederknien.«
Honey dachte an Dohertys Bauchmuskeln. Die waren bretthart, aber sie hatte keineswegs die Absicht, deswegen vor ihm niederzuknien.
Alison tupfte sich gerade mit einer Papierserviette die botoxgespritzten Mundwinkel, auf denen immer noch Spuren des Brigitte-Bardot-rosa Lippenstifts prangten, obwohl sie einige Sahnetörtchen verputzt hatte.
»Maurice hat alles organisiert. Ich habe am 31. Oktober Geburtstag. Ich feiere im Moss End Guest House. Aus irgendeinem Grund haben sie zuerst abgesagt. Sie meinten, sie hätten das Hotel gerade erst übernommen und wären noch nicht so weit, dass sie Veranstaltungen abhalten oder Gäste aufnehmen könnten. Aber mein geliebtes Muskelpaket, mein süßer Maurice, hat darauf bestanden, er hätte schon vor Urzeiten bei der Vorbesitzerin reserviert. Sie haben sich zwar noch eine Weile geweigert, die Reservierung anzuerkennen, aber wenn sein Zorn geweckt ist, dann ist mein Maurice wie ein Löwe … grrr.« Alison machte eine Tatzenbewegung mit den Händen. Ihre Interpretation eines brüllenden Löwen war allerdings eher die Plüschtiervariante.
Honey knirschte mit den Zähnen. Maurice der Löwe, das war ja schon schlimm genug, aber diese Muskelpaket-Nummer, da kam ihr das Essen wieder hoch.
Alison merkte nichts. »Na jedenfalls, mein Liebster Maurice, der muskulöseste Mann, mit dem ich je das Vergnügen hatte …« Sie kicherte und tat, als müsste sie erröten. »Oje, bin ich aber heute ungezogen. Jetzt weißt du, was wir beide so treiben.«
Honey widerstand tapfer der Versuchung, Alison darüber zu informieren, dass das keine große Sache war und dass sie und der neue Mann in ihrem Leben im Bett auch nicht nur gefüßelt hatten. Stattdessen sagte sie: »Dein Freund Maurice Löwe hat ihnen also mit einer Klage auf Entschädigungszahlung gedroht, und sie haben nachgegeben.«
»Maurice Hoffman, nicht Maurice Löwe. Genau das haben sie gemacht. Du kommst doch, oder?«
»Natürlich«, antwortete Honey, die sich daran erinnerte, dass Alison schon in der Schule nicht die Hellste gewesen war. Besser gleich zusagen, ehe Alison noch vor ihr auf die Knie ging und sie anflehte, doch ja zu kommen. In Gedanken stellte sie gerade den Dienstplan ihres Hotels um, damit sie freihatte. Dabei streute sie geistesabwesend Salz in ihren Tee.
Alison bemerkte das und verzog schmerzlich das Gesicht, als hätte Honey eine schreckliche Untat begangen, aus Versehen einen Arm amputiert oder so. »Ach, Honey, du Ärmste! Soll ich dir eine neue Tasse besorgen? Also so was, nein so was!«, rief sie und winkte mit ausladenden Bewegungen einer Kellnerin zu, die ein viel zu schweres Tablett schleppte und am Nebentisch eine Gruppe von Amerikanern bediente.
Honey erkannte sofort, dass dies eine blendende Ausrede war, den schlabberigen Tee nicht trinken zu müssen, und tätschelte Alison sanft den Arm. »Ich habe gar nicht so viel Durst. Jedenfalls bin ich total gespannt auf deine Geburtstagsfeier. Was hast du geplant?«
Höchst begeistert, dass sie ihrem Lieblingshobby frönen und über sich sprechen konnte, wackelte Alison mit dem Po, wie das manche Leute machen, wenn sie sehr aufgeregt sind. Oder wenn die Unterhose kneift. Vielleicht hatte sie sich aber auch nur bequemer hinsetzen wollen. Doch Alison schien wild entschlossen zu sein, so lange wie nur menschenmöglich an ihrer Jugend festzuhalten, also lag es wahrscheinlich doch an einem Stringtanga aus Spitze.
Alisons Augen funkelten, und sie antwortete im Verschwörerton: »Es wird eine Themenparty, passend zum Datum meines Geburtstags.« Sie kicherte. »Rate mal.«
Honey gab sich redlich Mühe, so zu schauen, als wäre das Thema von Alisons Geburtstagsparty, die am 31. Oktober stattfinden sollte, für sie eine Riesenüberraschung.
»Geistlichkeit und geile Weiber? Kesse Gören, nackte Kerle?«
Alison schüttelte den Kopf, obwohl sie kurz innehielt und aussah, als dächte sie zumindest über die nackten Kerle ernsthaft nach.
»Keins von beiden.«
»Nicht mal die nackten Kerle?«
Alison leckte sich nachdenklich über die Lippen. »Vielleicht nächstes Jahr. Aber diesmal …«
Sie prustete ein Ta-ta-taaa heraus, das wohl einer Fanfare ähneln sollte. Bei ihr wurde jedoch nur ein müdes Mäusequieken daraus.
»Halloween«, kreischte sie mit der gleichen aufreizenden Piepsstimme, die sie schon als Teenager gehabt hatte.
»Cool. Das ist echt cool«, sagte Honey. Vorhersehbar hätte es eher getroffen, aber die Frau machte sich ja fast vor Aufregung in die Hosen – wie eine Fünfjährige, die gleich auf einen Schokoladenpudding losgelassen wird.
»Und du sagst fest zu?«, meinte Alison. Sie wartete Honeys Antwort gar nicht erst ab, sondern langte tief in ihre Handtasche – eine auffällige Kombination von Leopardenfell und Unmengen von Messingschnallen und Reißverschlüssen.
Sie brachte ein rosa Notizbuch zum Vorschein. Die Seiten raschelten, als sie mit ihren rosalackierten Fingernägeln blätterte. Sie zog einen Stift hervor – selbstverständlich rosa. Schlimmer noch, es baumelte auch eine rosa Miniaturfee daran, die beim Schreiben hin und her schwang.
»Wie könnte ich ablehnen? Wir sind doch alte Freundinnen«, antwortete Honey. Eigentlich hätte sie sich lieber ein Bein gebrochen, als zu dieser Feier zu gehen, aber dann überlegte sie, dass Alison in einer schwierigen Lebensphase war und ihre Freunde brauchte.
Honeys alte Schulfreundin war erst kürzlich in das Dorf Swainswick gezogen, das einen Katzensprung vom Stadtzentrum von Bath entfernt lag. Wäre sie samt Exmann, zwei Kindern, drei Katzen, einem Hund, einem Papagei und einem Au-pair-Mädchen aus Toulouse in Frankreich geblieben, dann hätte Honey die Entfernung als glaubhaften Grund für ihre Abwesenheit von der Geburtstagsparty angeben können. Aber wie die Dinge lagen, war Alisons Mann Andrew mit dem Au-pair-Mädchen und dem Papagei durchgebrannt. Das Au-pair-Mädchen war jung und hübsch, also konnte man durchaus verstehen, warum er mit ihr über alle Berge war. Beim Papagei lagen die Dinge schon anders. Laut Alison fluchte der Vogel wie ein Droschkenkutscher, aber Andrew hing an ihm, und wenn er ihn zurückgelassen hätte, hätte Alison ihn bestimmt einschläfern und ausstopfen lassen und ihm per Fedex hinterhergeschickt.
Honey nahm an, dass Andrew so etwas geahnt hatte, und da er den Papagei so gern hatte wie das Au-pair-Mädchen, wollte er wohl vermeiden, dass das arme Vieh aus Rache für seine, Andrews, Eskapaden ausgestopft wurde.
»Also. Als was verkleidest du dich?«, fragte Alison, und ihr Gesicht strahlte vor kindlicher Vorfreude.
Honey lächelte geheimnisvoll über das Schokoladen-Eclair hinweg, das sie gerade von der Etagere genommen hatte. »Wird nicht verraten. Streng geheim.«
Sie hatte nicht gelogen. Beinahe nicht. Denn ihr Kostüm war auch für sie noch streng geheim. Als was zum Teufel sollte sie sich verkleiden? Als Gespenst? Als Hexe? Irgendwas Unbeschreibliches, Violettes?
Das Geschenk würde kein Problem sein. Alison war schon immer eine unverbesserliche Schokoladensüchtige, und Honeys Chefkoch Smudger sah sich insgeheim als verhinderter Chocolatier. Handgefertigte Pralinen. Problem gelöst!
Aber das Kostüm? Auf keinen Fall würde sie da hingehen und ein Laken tragen, in das Löcher für die Augen geschnitten waren. Das würde beim geringsten Anlass verrutschen, und sie würde über den Saum stolpern. Genauso wenig würde sie sich in irgendwelche seltsamen Farben hüllen und Gummiteile umschnallen oder Masken aufsetzen oder eine Hakennase oder so was ankleben. Schon gar nicht wollte sie sich als Spinne verkleiden. Sie konnte Spinnen nicht leiden. Trotz des Themas war sie wild entschlossen, einen Anschein von Normalität zu wahren.
Ich möchte, dass man mich noch erkennt.
Die Kostümfrage ging ihr während des ganzen Rückwegs zum Green River Hotel durch den Kopf, das nicht weit von der Pulteney Street im Herzen der wunderschönen Stadt Bath lag.
Spinnen, Zombies, Kobolde, Kürbisse und Hexen mit Warzen auf der Nase – nichts davon sprach sie an.
Sie verbarg ihr Kinn tief im aufgestellten Kragen ihres Mantels und blieb stehen, damit der Wind eine Plastiktüte und ein paar Herbstblätter an ihr vorbeitreiben konnte.
Während sie so dastand, fiel ihr Blick zufällig auf eine Schaufensterauslage, die auf Finanzberatung durch EXPERTEN hinwies. Wie wäre es also mit einer Beratung durch eine Expertin für übernatürliche Erscheinungen? Wenn es um schauriges nächtliches Poltern ging, dann gab es eigentlich nur eine Person, die man fragen konnte. Sie war groß und dünn und schaute einen manchmal äußerst durchdringend an, manchmal aber auch so, als wäre sie gerade auf einer Umlaufbahn um den Mars.
Honey traf im Green River Hotel ein, einem Gebäude aus der frühen Regierungszeit König Georges, einem Gebäude voller Möglichkeiten, wenn sie nur das Geld dazu hätte, hier etwas zu machen. Sie schlüpfte gleich hinter den Empfangstresen und tippte auf dem Telefon 07 für Zimmer 7. Keine Antwort.
Anna hatte Dienst am Empfang. Ausnahmsweise war sie einmal nicht schwanger. Sie würde nicht mehr lange bei ihnen arbeiten, denn sie hatte gekündigt und wollte nach Polen zurück, wo sie das hier verdiente Geld in ein kleines Café investiert hatte, das im Augenblick ihre Mutter führte.
Honey legte den Hörer wieder auf. »Anna, hast du Mary Jane heute schon gesehen?«
Mary Jane war Dauergast im Green River und die hauseigene Professorin für paranormale Erscheinungen. Sie wusste alles, was es über Geister und Gespenster zu wissen gab. Sie sah selbst ein wenig überirdisch aus und war vor einiger Zeit aus Kalifornien angeflogen gekommen (mit American Airlines, nicht auf einem Besenstiel!) und nicht mehr zurückgegangen. Als Grund dafür gab sie an, dass sie in ihrem Zimmer zufällig einem ihrer dort spukenden Vorfahren begegnet war und beschlossen hatte, ihm weiter Gesellschaft zu leisten. Sie hatte sich in ihrem neuen Leben mit dem alten Gespenst so häuslich eingerichtet, dass sie auch ihr Auto, ein 1961er Cadillac Coupé, hatte nachschicken lassen. Der Wagen war rosa und hatte das Lenkrad auf der falschen Seite. Mary Jane fuhr demzufolge häufiger auch auf der falschen Seite.
»Ja«, antwortete Anna auf Honeys Frage. »Sie ist unter die Erde gegangen.«
Anna nahm einen Stapel Broschüren, klopfte ihn auf Kante und fächerte ihn dann zu einem eleganten Halbkreis auf, alles mit einer einzigen eleganten Handbewegung, die atemberaubend anzusehen war.
Einen Augenblick lang stand Honey da und bestaunte das Ergebnis. Das hatte sie noch nie so hingekriegt.
»Wie machst du das?«, fragte sie ungläubig.
»Fachtanz«, antwortete Anna. »Ich habe früher Fachtanz gemacht.«
»Fächertanzen«, korrigierte Honey, was sie häufig tat, obwohl Anna nun schon ein paar Jahre in Bath lebte. »Wo war Mary Jane, hast du gesagt?«
Anna deutete mit dem Kopf auf den Boden. »Unter der Erde. Sie ist unter die Erde gegangen. Es ist heute Morgen passiert – vor einer Stunde.«
Plötzlich lief es Honey kalt über den Rücken. »Du meinst …« Sie brachte die restlichen Worte nicht über die Lippen. War Mary Jane, die die siebzig weit hinter sich gelassen hatte, endlich mit Sir Cedric vereint, dem Ahnen, mit dem sie täglich Kontakt hatte?
»O Gott! Was ist passiert?«, rief sie dann und erwartete die Antwort, Mary Jane und ihr rosa Cadillac wären zusammen auf dem großen Parkplatz im Himmel gelandet.
»Sie ist unter die Erde gegangen, weil Adrian gesagt hat, dass es da gruselig ist und dass da unten jemand wäre. Sie ist immer noch da unten. Adrian hat gekündigt.«
Annas Erklärungen zu folgen war manchmal ein wenig, als versuchte man, durch Sirup zu waten. Es ging langsam voran, aber schließlich kam man doch an.
Da Adrian ein Getränkekellner-Lehrling war, beziehungsweise wohl eher gewesen war, bedeutete das wahrscheinlich, dass Mary Jane sich im Keller aufhielt. Er war kein besonders talentierter Getränkekellner gewesen, aber dass er so plötzlich gekündigt hatte, warf doch eine Frage auf.
»Warum ist er gegangen? Hat er Angst vor Spinnen oder so?«
Das hätte sie verstehen können. Denn der Keller war ein wahres Spinnenparadies. Überall hingen Netze wie zerrissene Leichentücher.
»Nein. Er hat gesagt, es wären Soldaten gewesen. Er meint, die hätten kurze Lederröcke getragen und Rüstungen, die klirr, klirr gemacht hätten, als sie durch den Keller marschierten.«
»Oh, wenn das alles ist.«
Honey atmete erleichtert auf, dankte Anna und wagte es, die aufgefächerten Broschüren vorsichtig mit einem neugierigen Finger zu berühren. Dann machte sie, dass sie wegkam, als alles sofort wieder unordentlich verrutschte.
Der Keller war ein finsterer Ort, hauptsächlich weil eine Reihe von Gewölben verhinderte, dass der ohnehin schwache Lichtschein sich weit ausbreitete. Weiße Farbe blätterte von den Ziegelmauern, und in dunklen Ecken lauerten Spinnen. Manche waren groß – sehr groß!
Hier wurden Wein, Bier und aussortierte Möbelstücke aufbewahrt, die noch zu gut für die Müllkippe waren, außerdem die Steuerunterlagen, die niemals wieder das Tageslicht erblicken würden; das Papier schimmelte fröhlich vor sich hin, von der Feuchtigkeit angegriffen, von Mäusen und diversen Käfern angenagt.
Dass römische Soldaten durch den Keller marschierten, war bisher nie vorgekommen. Honey erinnerte sich nicht, dass irgendjemand je solche Gespenster erwähnt hätte, nicht einmal Mary Jane, die sogar noch mit Schnupfennase eine Geistererscheinung erschnüffeln konnte. Allerdings war Mary Jane ja auch noch nie im Keller gewesen.
Honey tastete sich die kalte Steintreppe hinunter, duckte sich unter Spinnweben hindurch und hielt Ausschau nach ihren langbeinigen Freundinnen, die immer gerade dann krabbeln, wenn man es am wenigsten erwartet.
Das hier war mitnichten ihr Lieblingsort, und das Spiel »Verliese und Drachen« hatte nie sonderlich weit oben auf der Liste ihrer Lieblingsbeschäftigungen gestanden.
Aber keine Sorge! Adrian, dieses Weichei! Er war eher der nervöse, schlanke Typ mit langen Händen und sehr schmalen Fingern. Keineswegs starken Fingern. Hätte der überhaupt eine Magnum Champagner halten können? Nicht dass sie viele davon verkauften, aber man konnte ja nie wissen.
Ein kalter Luftzug wehte die Treppe hinauf und blähte ihren Rock zu einem Kuppelzelt auf. Gleichzeitig klatschte sie sich mit der Hand in den Nacken, der merkwürdig prickelte. War da etwa eine Spinne gelandet? Wenn ja, wo war sie dann jetzt?
Honey wackelte mit dem Hinterteil, in der Hoffnung, das achtbeinige Geschöpf loszuwerden, das ihr möglicherweise gerade hinten in die Bluse gefallen war.
Eine Glühbirne zischte und ging dann flackernd aus. Honey blieb stehen, ihr Fuß schwebte über der untersten Stufe in der Luft. Ihr Herz machte nicht etwa Riesensprünge in ihrem Brustkorb. Das Pochen erinnerte eher an Morsecode. Sie konnte die Sequenzen, kurz-kurz, lang-lang, leicht entziffern. Die Nachricht war, dass sie auf der Stelle hier abhauen sollte.
Gürtet die Lenden!
Dieser Rat kam aus dem Nichts, und er war nicht sonderlich hilfreich. Es war nicht leicht, inmitten all dieser Spinnweben Tapferkeit zu beweisen, wenn überdies die Glühbirnen ohne ersichtlichen Grund ihr Leben aushauchten. Trotzdem war es gerade noch hell genug, um ein bisschen was zu sehen.
Honey holte tief Luft und rief Mary Janes Namen. Der hallte zurück. Die darauf folgende Stille war schlimmer als jedes Echo. Diese schreckliche Leere. Als wartete die Stille nur darauf, von lauten Geräuschen erfüllt zu werden, dachte Honey.
Da! Schlurfen!
Ihr Herz stand still. Ihr Gehirn befahl ihr, so schnell wie möglich die Treppe hinaufzurennen. Aber ihre Füße schienen in Beton zu stecken.
Sie stand stocksteif da. Zunächst war da nur diese Stille. Dann wieder Schlurfen.
Vielleicht eine Maus, redete sie sich ein. Mit einer Maus konnte sie fertigwerden. Bitte, bitte, keine Ratte! Sie hasste Ratten. Wie zum Teufel konnten Leute Ratten als Haustiere halten?
Ratten! Es konnten Ratten sein. Das Rascheln, das Schlurfen, es war viel zu laut für das ängstliche Tierchen aus Robert Burns’ Mäusegedicht. Dieses Tierchen hier war weder verschreckt noch winzig; es hörte sich an, als wäre es ziemlich riesig.
Honey kniff die Augen zusammen und versuchte, ihren Blick zu konzentrieren. Da wurde ihre Aufmerksamkeit auf eine besonders dunkle Ecke gelenkt. Sie hörte ein weiteres Geräusch; schwere Atemzüge, als probierte jemand, irgendwo freizukommen. Hoffentlich hatte niemand hier unten im Dunkeln einen Vampir begraben. Sie versuchte sich daran zu erinnern, ob sie je im Keller einen Sarg gesehen hatte. Nein. Das längliche Ding, das rechts von ihr auf einem Edelstahltisch stand, war kein Sarg, sondern eine alte Truhe für Wolldecken, die früher einmal im ersten Stock an einem Treppenabsatz in der Ecke ihren Platz hatte. Da passten nur warme Decken rein. Wenn ein Vampir drin ruhte, dann musste es ein sehr kleiner sein. Und mit einem sehr kleinen Graf Dracula konnte sie fertigwerden, überlegte sie.
Kleiner Vampir oder kein Vampir, jedenfalls hatte ihr Herz inzwischen von Morsecode auf Trommelfeuer umgeschaltet. Ihre Zunge war trocken wie Sandpapier, als in der finsteren Schwärze am anderen Ende des Kellers etwas die Form veränderte. Sofort die Treppe hinauf und ans Tageslicht zu stürzen, diese Reaktion schien plötzlich eine sehr hohe Prioritätsstufe zu haben, aber Honey wollte noch einmal abwarten. Es musste einfach Mary Jane sein.
Zunächst sah es aus, als kröche dort etwas Buckliges auf allen vieren herum. Plötzlich erschien ein bleiches Gesicht aus dem Dunkel: Mary Jane.
»Honey! Hab ich dich erschreckt? Meine Taschenlampe ist ausgegangen.«
Mary Jane kam ins Licht und richtete sich zu voller Länge auf. Da sie über eins achtzig war, fegten ihre gelackten Löckchen – diesen Monat orangefarben – die bröckelnde weiße Farbe von der Decke. Kleine Placken regneten ringsum herab. Es sah aus, als stünde sie in einer Schneekugel, und jemand hätte gerade heftig geschüttelt.
»Mary Jane! Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht.«
Die kalifornische Professorin streifte sich die Spinnweben aus den Haaren und von den Schultern. »Das war nicht nötig, meine Liebe. Es ist dir vielleicht entgangen, aber ich bin nicht die Sorte Frau, die sich im Dunkeln fürchtet. Oder vor Gespenstern. Oder vor Geistern. Oder sonst welchen übersinnlichen Erscheinungen.«
Honey spürte, wie ihr jede Menge Steine vom Herzen purzelten.
»Hast du was Interessantes gefunden?«
Sie fragte das, als gäbe es in diesem Keller nichts, wovor sich die gute alte Honey Driver fürchten würde.
»Könnte sein, dass dein Hotel auf einer alten römischen Begräbnisstätte gebaut ist. Oder sogar auf einem Schlachtfeld. Wir müssen ein paar Nachforschungen anstellen.«
»Da wird sich Lindsey aber freuen.«
Honey hatte sich immer gewundert, dass sich ihre Tochter mehr für alte Geschichte als für junge Männer interessierte. Sie hatte zwar durchaus schon die eine oder andere Liebelei gehabt, o ja. Aber wenn auf historischem Gebiet etwas Interessantes auftauchte, dann hatte ein Typ in noch so engen Jeans bei Lindsey schlechte Karten. Jetzt würde Lindsey die nötigen Recherchen unternehmen.
»Wie überaus interessant. Du glaubst also, dass die hier begrabenen Soldaten immer noch in die Schlacht marschieren?«
»Die armen Kerle. Die sind vielleicht nicht mal bis in die Schlacht gekommen. Sind unter Umständen Opfer einer Seuche geworden. Entweder das, oder die Eingeborenen haben ihnen die Kehle durchgeschnitten, ehe sie auch nur ihre Schwerter zücken konnten.«
»Na, wenn es nur längst verstorbene römische Soldaten sind, dann muss man sich ja keine Sorgen machen«, meinte Honey leichthin. Römische Legionäre waren weit weniger furchterregend als Spinnen und eingebildete Pelztierchen.
»Tee«, sagte Mary Jane, ohne weiter darauf einzugehen, wer oder was noch im Dunkeln lauern mochte. »Ich brauche jetzt einen Tee. Wenn ich einen Spuk erforsche, kriege ich immer einen Riesendurst.«
Honey hätte etwas Stärkeres vorgezogen, aber es war ja noch heller Nachmittag. Außerdem war sie ohne Spinnweben aus dem Keller gekommen. Ein echter Bonus!
Über die Tische im Restaurant waren bereits schöne weiße Decken gebreitet. Mary Jane strich mit einer faltigen Hand über das glänzende Leinen, nachdem sie ihre erste Tasse Tee heruntergestürzt und Honey ihr sofort nachgeschenkt hatte. Es war Honey völlig gleichgültig, dass Mary Jane bei jeder Bewegung eine Spur aus feinem weißen Putz und Kohlenstaub hinterließ.
»Da unten ist ein Tunnel«, sagte Mary Jane, nachdem sie ihre zweite Tasse Tee heruntergekippt hatte. »Ich glaube, ich war schon ziemlich nah am Ende, als meine Taschenlampe den Geist aufgegeben hat. Verdammt schade. Ich bin sicher, ich bin da auf was gestoßen. Ich konnte die Schwingungen spüren. Da unten sind irgendwelche alten Knochen, lass es dir gesagt sein. Vielleicht hat der Tunnel eine Verbindung zu denen unter dem Römischen Bad. Vielleicht sogar zu den unterirdischen Gängen in der Milsom Street.«
Honey verkniff sich die Bemerkung, dass ihrer Meinung nach die einzigen alten Knochen, die dort unten gewesen waren, Mary Jane gehört hatten.
Weitere Wölkchen aus Putzbröckchen und Staubteilchen stoben durch die Luft, als Mary Jane ihren Tee trank und an einem Zitronenkuchen aus eigener Herstellung knabberte.
»Trotzdem bin ich wirklich froh, dass du heil und unversehrt bist«, meinte Honey. »Als Anna sagte, du wärst unter der Erde, habe ich mich gefragt, was sie damit wohl meinte. Du weißt doch, dass sie immer die Wörter durcheinanderbringt.«
Mary Jane lachte glucksend, und ihre Augen funkelten. »Du hattest Angst, ich wäre nicht mehr da?«
Honey merkte, wie ihr warm im Gesicht wurde. Wie konnte sie denn zugeben, dass sie geglaubt hatte, Mary Jane hätte sich zu ihrem Ahnen Sir Cedric im Jenseits gesellt?
»Ich würde dich wirklich vermissen …«, hob Honey an und wollte noch sagen, wie peinlich es ihr war und wie leid es ihr tat, angenommen zu haben, dass Mary Jane verstorben war, aber Mary Jane gab ihr keine Gelegenheit dazu.
»Sei nicht albern«, trällerte sie und schaute Honey mit ihren blauen Augen freundlich an. »Du solltest doch wissen, dass ich dich nie verlassen und in die USA zurückgehen würde. Sir Cedric wäre ja wirklich untröstlich, wenn ich das täte. Schön, dass es dir auch so gehen würde.«
Honey atmete tief aus. Puh! Was hätte sie mit ihrer Bemerkung für ein Unheil anrichten können. Zum Glück hatte Mary Jane sie missverstanden und nicht vermutet, dass Honey sie für tot gehalten hatte.
Auf keinen Fall würde sie das jetzt noch zugeben. Außerdem war sie ziemlich erleichtert, dass sich Mary Jane noch im Hier und Jetzt aufhielt.
»Was würden wir ohne dich machen?«
Bei dieser Bemerkung spürte sie, wie sich alle Spannung löste. Es war, als hätte sie keine Knochen mehr im Leib, nur noch schlappe Muskeln, weich wie Kissen.
Sie sagte noch einmal, wie erleichtert sie war, das zu hören, und was für eine dumme Gans sie gewesen war, auch nur zu denken, dass Mary Jane ohne Abschied einfach weggehen würde.
Dann erzählte sie von Alisons Geburtstagsparty und bekräftigte, dass sie nicht die Absicht hätte, in ein Laken gekleidet oder als scheußliches lila Monster dort hinzugehen, auch nicht als Spinne oder Hexe mit riesiger Hakennase.
»Ich dachte, du hättest vielleicht eine Idee für ein Kostüm. Irgendwas, das ein bisschen gruselig, aber sexy ist. So was stelle ich mir vor.«
Mary Jane zwinkerte, stellte ihre Teetasse ab und fiel sofort in Trance – zumindest sah es so aus. Sie schloss die Augen, hob die Arme, so dass sie mit den Handflächen nach oben seitlich ausgestreckt waren. Dazu machte sie ein summendes Geräusch.
Leicht besorgt, schnappte sich Honey Mary Janes Teetasse und roch daran. Aus gutem Grund. Vor einiger Zeit hatte ihr Tellerwäscher, Rodney (Clint) Eastwood, ein Säckchen mit Zauberpilzen verlegt, die er strikt für den gelegentlichen Eigenverbrauch hortete. Im Restaurant war viel los gewesen. Die Spülmaschine war nicht zur Ruhe gekommen, und Clint hatte auch noch bei den Getränken aushelfen müssen. Er hatte eine Kanne Tee nach der anderen gekocht.
Nach dem Genuss einer großen Kanne Earl Grey hatten sechs Mitglieder des Swainswick Senior Bowling Club angefangen, zu tanzen und sich allgemein so zu verhalten, als wäre der Summer of Love wieder ausgebrochen. Nachdem die restlichen Klubmitglieder das gesehen hatten, wollten sie genau das bestellen, was ihre Kollegen genossen hatten. Erst später erwischte man Clint, der verzweifelt einen Teebeutel nach dem anderen aus den Kannen fischte und seinen verschwundenen Drogenvorrat suchte.
Zum Glück schien das aber diesmal nicht das Problem zu sein. Plötzlich schlug Mary Jane die Augen wieder auf.
»Morticia Addams!«
Honey lehnte sich zurück und war schwer beeindruckt. Sie erinnerte sich an die amerikanische Fernsehserie Die Addams Family und besonders an die hinreißende weibliche Hauptperson.
»Finster. Sexy. Sofort erkennbar«, sagte sie voller Hochachtung. »Das BIN einfach ich!«
»Genau!«
»Langes, enganliegendes schwarzes Kleid mit federigen, fransigen Ärmeln. Ich denke, da kann ich was Passendes finden. Bleicher Teint, dunkles Augen-Make-up, langes schwarzes Haar. Meine Mutter hat noch das Bühnen-Make-up. Die Laienspielgruppe macht im Augenblick eine kleine Pause.«
Tatsächlich waren einige Mitglieder der Seniorentheatergruppe entweder tot umgefallen oder so senil geworden, dass sie sich keinen Text mehr merken konnten.
Lindsey gesellte sich zu Honey und Mary Jane und brachte die frohe Kunde, dass das Flitterwochenpaar endlich wieder aus dem Zimmer aufgetaucht war, die Rechnung bezahlt und ein sehr großzügiges Trinkgeld hinterlassen hatte.
»Sie meinten, es wäre das beste Hotel, in dem sie je übernachtet haben.«
»Woher wollen die das denn wissen? Die haben doch ihr Zimmer kein einziges Mal verlassen.«
Lindsey wedelte Honey mit einer Fünfzigpfundnote vor der Nase herum. »Deswegen hat es ihnen ja so gut gefallen. Sie sind nie aus dem Bett aufgestanden, und niemand hat sie gestört. Könnte man bessere Flitterwochen verbringen?«
Honey stimmte ihr zu und erzählte von der Geburtstagsfeier zum Thema Halloween.
»Ich gehe als Morticia Addams. Ich habe ein langes schwarzes Kleid. Die Ärmel kann ich an den Nähten ein bisschen auftrennen, damit sie fransiger aussehen.«
»Das sollte gehen. Wenn du willst, kann ich dir von Clarissa eine Perücke mit langen schwarzen Haaren besorgen«, meinte Lindsey. »Die hat sie immer bei den Kunstkursen im College getragen.«
»Ich wusste ja gar nicht, dass du mit einer Studentin namens Clarissa befreundet bist«, antwortete Honey mit einem zufriedenen Seufzer. Sie fühlte sich pudelwohl, da ihr Outfit sozusagen auf dem Reißbrett fertig war.
»Nein, sie war Aktmodell. Sie hat nackt Modell gesessen. Die lange schwarze Perücke war so eine Art Feigenblatt.«
Kapitel 2
Zwischen Zärtlichkeiten und der Ankündigung weiterer schöner Dinge grummelte Steve Doherty, er hätte nicht viel für Kostümfeste übrig.
»Kann ich nicht als ich selbst gehen?«
»Nein, du musst der Gomez Addams sein, der zu meiner Morticia gehört.«
»Oder vielleicht als Sherlock Holmes?«
»Sherlock Holmes hat nichts mit Halloween zu tun.«
Ein paar aufregende Spielchen später war seine Ablehnung der Kostümparty nicht mehr ganz so vehement. Bei manchen Männern geht die Liebe durch den Magen; Doherty dagegen konnte man jederzeit mit Sex ködern. Er würde sie also im passenden Kostüm begleiten, und das auch noch gern. Vorausgesetzt, sie zog jetzt sofort ihre Kleider aus.
Das war wirklich nicht zu viel verlangt, und sie hatte ja auch nichts dagegen, zur Sache zu kommen. Ganz im Gegenteil! Und was die Party betraf? Da war er Wachs in ihren Händen.
Sie hätte wissen müssen, dass Ende Oktober nicht ihre Jahreszeit war und dass nicht nur das Green River Hotel die ganze Frau fordern würde. Da waren auch noch die Ansprüche, die ihre Familie an sie stellte. Wenn die Familie über einen herfiel, war sie eben manchmal ein echtes Problem.
Hätte ihr alter Citroën keine Panne gehabt, hätte Ahmed in der schmierigen kleinen Autowerkstatt unter den Brückenbögen sie nicht im Stich gelassen, der Unfall wäre niemals passiert.
»Da haben wir wohl einen winzigen Kobold in der Elektrik«, verkündete Ahmed Clifford – Sohn eines Fish-and-Chips-Buden-Besitzers aus Somerset und einer Witwe mit drei Kindern und einem Marktstand. Ahmed war das einzige gemeinsame Kind der beiden. Er verkündete dieses Urteil, während er sich mit der öligen rechten Hand durch das ebenfalls ölige lange Haar fuhr.
Ahmed sah nicht aus wie der übliche Feld-Wald-und-Wiesen-Automechaniker. Eher wie ein Hauptdarsteller aus einem Bollywood-Film: milchschokoladenbraune Haut, glänzendes, schulterlanges Haar und endlos lange schwarze Wimpern, die alles übertrafen, was Max Factor mit noch so viel Wimperntusche zaubern konnte. Seine Augen schienen unendliche Tiefe zu haben, aber das war auch nötig, denn das Gesicht ringsum war ständig mit Öl verschmiert.
Honey interpretierte diese Aussage resigniert so, dass wohl die elektrische Anlage ihres Autos gemeint war, das heißt das Wirrwarr aus Drähten unter der Kühlerhaube.
»Ich weiß, der Wagen ist ein bisschen launisch, aber ich glaube, das ist ja Teil seines Charmes …«
»… die Elektrik ist beschissen. Eigentlich sogar gefährlich.« Ahmed unterbrach einen immer, ehe man den Satz fertig hatte. »Das ist ein Citroën. Ein französisches Auto. Jeder, der ein bisschen Hirn hat, weiß, dass bei den Franzosen die Elektrik scheiße ist. Die haben einen Kobold am Fließband!« Das war ja wohl ein Witz. Oder glaubte der ernsthaft, dass da ein grüner Kobold bösartig vor sich hin grinste, während er Kabel da wegzog, wo sie hingehörten, und anderswo verlegte, wo sie nicht hingehörten?
»Wenn es den gibt, dann hoffe ich, dass er gut isoliert ist und dass er nicht so leicht …«
»… Feuer fängt. Beim Auto könnte das aber sein. Das ist ja das Schlimme an der Elektrik.«
Ahmed zuckte die Achseln und zündete sich noch eine Zigarette an. Die Tatsache, dass sowohl seine Werkstatt als auch er selbst mit leicht brennbaren Stoffen getränkt waren, schien ihn nicht weiter zu beunruhigen.
»Wie schnell können Sie den Wagen reparieren?« Honey sprach rasch, damit Ahmed sich nicht wieder einschalten und die Frage beantworten konnte, ehe sie sie überhaupt gestellt hatte.
Er stieß den Rauch zischend durch die perlweißen Zähne aus. Dann schüttelte er den Kopf und schaute so traurig wie ein arbeitsloser Bestatter.
»Das ist eine größere Sache. Gar nicht so einfach.«
Honey war, als hätte ihr jemand einen Eiszapfen hinten in die Bluse gesteckt. Einen sehr langen Eiszapfen. Einen von der Sorte, die unten eine Spitze haben, von der Wasser trieft. Als ewige Optimistin hatte sie von Ahmed die Antwort erwartet, das würde er im Handumdrehen hinkriegen, kein Problem. Doch dieses Zischen hatte sie schon öfter gehört. Das gaben Leute von sich, die irgendwas reparierten oder vielmehr andeuten wollten, dass man etwas eben nicht mehr reparieren konnte. Die Stunde hatte geschlagen; ihr Wagen würde einige Zeit auf der Intensivstation dieser Werkstatt verbringen müssen. Hoffentlich würde er sich völlig erholen. Aber es war nicht nur ein französisches Auto. Es war ihr fahrbarer Untersatz, ihr Transportmittel, also überlebenswichtig.
»Ich brauche den Wagen wirklich …«
»… bald zurück. Natürlich. Tut mir leid. Das dauert mindestens eine Woche. Ich habe ohnehin alle Hände voll zu tun, und es kann sich ziemlich lange hinziehen, bis man einen Fehler in der Elektrik gefunden hat.«
Honey stieß einen Seufzer aus. Bath war eine tolle Stadt für Fußgänger, aber es gab Zeiten, da brauchte sie ein Auto. Zum Beispiel, wenn sie im Großmarkt einkaufte, zu ernsthaftem Shopping nach London flitzte, ihre Mutter irgendwo hinfuhr, wo sie gerade unbedingt hinmusste. Ihr Blick schweifte über die drei, vier Autos, die vor der Werkstatt parkten. Zwei oder drei hatten Zettel hinter der Windschutzscheibe und waren zu verkaufen. Ob Ahmed sie wohl auch vermietete?
»Könnten Sie mir …?«
»… ein Auto vermieten? Nein. Tut mir leid.«
»Haben Sie je darüber nachgedacht …?«
»… ein paar Autos zu haben, die ich an Kunden vermieten kann, deren Wagen gerade in der Reparatur sind? Nein. Das kann ziemlich teuer werden. Das liegt an der Versicherung, wissen Sie.«
»Ich wollte eigentlich gerade fragen, ob Sie je darüber nachgedacht haben, zum Theater zu gehen?«
Die Zähne blitzten in seinem dunklen, ölverschmierten Gesicht hinter einem Schleier aus Zigarettenrauch auf.
»Zum Theater nicht. Aber zum Film. Ich hätte nichts dagegen, Filmstar zu werden. Ich kann alle Tanzschritte.«
Plötzlich fing er an, laut zu singen, während er wie ein Bollywood-Superstar die Hüften kreisen ließ, mit den Augen rollte und mit den Händen wedelte – alles zum Klang einer in Urdu gesungenen Rock-and-Roll-Nummer.
»Nein«, erwiderte Honey, nachdem die Vorstellung beendet war. »Zur Bühne. Als Gedankenleser.«
Das alles erzählte sie Doherty in der leicht verrauchten Dämmerstimmung des Zodiac Club.
»Verflixt, jetzt habe ich kein Auto, und meine Mutter will, dass ich mit ihr eine Freundin besuche, die das heulende Elend hat. Ich nehme an, ich muss eins mieten, aber das kostet …«
»Geht’s bei dem Besuch um Leben und Tod?«
»Könnte man so sagen. Der Ehemann ihrer Freundin ist abgehauen, hat nur einen Zettel hinterlassen. Er wolle um die Welt reisen, um sich selbst zu finden. Meine Mutter hat der Freundin meine Dienste angeboten; sie will, dass ich den flüchtigen Gatten für sie suche.«
»Privatdetektivin Driver«, sagte Doherty mit einem Grinsen. »Hast du eine Ahnung, wie viele Leute jedes Jahr aufbrechen, um sich selbst zu finden?«
»Jede Menge, würde ich mal annehmen, aber nicht viele, die Ende achtzig sind. Und nicht viele, deren Frau demjenigen fünf Riesen anbietet, der rausfindet, wo er ist.«
Doherty schluckte. Honey war sich nicht sicher, ob er ihr nicht glaubte oder ob er sich amüsierte. Vielleicht beides.
»Und ehe du fragst, Rhoda ist auch über achtzig. Es geht also um Leben und Tod, weil beide mit einem Fuß im Grab und mit dem anderen auf einer Bananenschale stehen.«
»Hör mal«, sagte er und wirkte immer noch sehr fröhlich. »Ich bin nächste Woche auf einem Kurs in Reading. Du kannst mein Auto haben.«
»Meine Güte«, sagte sie und kuschelte sich an seine Schulter. »Noch ein paar Pluspunkte auf dem Konto!«
Sein Grinsen wurde noch breiter. »Die löse ich später alle ein.«
Dohertys Toyota MR2 war ein Zweipersonenauto. Es hatte kaum Platz für Einkäufe, aber sie wollten ja nur Rhoda Watchpole besuchen, eine der ältesten Freundinnen ihrer Mutter; mindestens siebenundachtzig Jahre alt.
Rhoda wohnte in einer Dreizimmerwohnung im zweiten Stock eines Hauses, das ausschließlich Bewohner über sechzig hatte. Die Eingangstür war breit genug für Rollstühle. Sie ging sehr langsam zu, damit Leute, die nicht sonderlich gut zu Fuß oder mit einem Rollator unterwegs waren, problemlos ins Gebäude kamen. Für den Fall der Fälle war auch immer Personal auf dem Gelände.
Gloria Cross, wie immer großartig gekleidet, diesmal mit pflaumenblauer Wildlederjacke und karamellfarbenem Pullover zu einer sahneweißen Hose, drückte auf den Klingelknopf von Rhodas Wohnung. Honey ihrerseits steckte in verwaschenen Jeans, schwarzem Pullover, abgestoßenen Stiefeln und einer wattierten Jacke, die leicht nach nassem Hund roch.