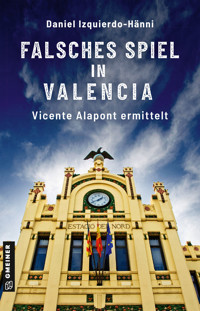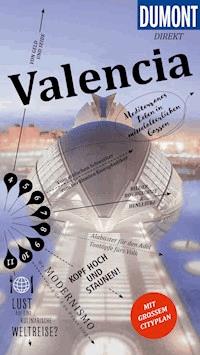Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Taxifahrer und Ex-Inspector Vicente Alapont
- Sprache: Deutsch
Nach einem traumatischen Fall hat Vicente Alapont seinen Job als Inspektor bei der Mordkommission der Policía Nacional an den Nagel gehängt und fährt jetzt in seiner Heimatstadt Valencia Taxi. Als sich einer seiner Stammgäste das Leben genommen haben soll, will er dies nicht glauben und fängt an, auf eigene Faust zu ermitteln. Rasch zieht eine alteingesessene Winzerfamilie Alaponts Aufmerksamkeit auf sich. Doch kann er seinem wiedergewonnenen Spürsinn trauen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Izquierdo-Hänni
Mörderische Hitze
Alapont ermittelt in Valencia
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © rh2010 / AdobeStock
ISBN 978-3-8392-7368-5
-1-
43 Grad markiert die Temperaturanzeige, die hoch oben auf einem Werbepfosten über dem Straßenverkehr im Zentrum von Valencia thront. Wo sich normalerweise Linienbusse, Lieferwagen, Pkws, Taxis, Motorräder über die dreispurige Avenida im Herzen der Stadt drängen und die Fußgänger die Bürgersteige bevölkern, sind an diesem Hitzetag nur ein paar wenige unterwegs – und zwar jene Unglücklichen, denen nichts anderes übrig bleibt. Alle anderen versuchen, den Extremtemperaturen zu entfliehen: Sie sind entweder draußen am Strand, in der Hoffnung, im Mittelmeer etwas Abkühlung zu finden, oder sie haben sich zu Hause oder im Büro verschanzt. Egal wo, Hauptsache, die Klimaanlage funktioniert. »Wie, um Himmels willen, kommt man auf die abstruse Idee, unsere Stadt im August zu besuchen?«, hat sich Vicente Alapont gefragt, als er ein junges Pärchen aus den Niederlanden vom Flughafen zum Hotel nahe des Rathausplatzes gefahren hat. Valencia hat als Reisedestination zweifellos einiges zu bieten, aber doch nicht während der Sommermonate, wo man schon bei normalen Temperaturen erst so ab 19 oder 20 Uhr abends auf die Straße kann, ohne einen Hitzeschlag zu bekommen.
Als Valenciano mag er die mediterranen Temperaturen seiner Heimatstadt, und auch im Juli oder August machen ihm 32 oder 34 Grad nichts aus, aber alles hat seine Grenzen! Die Aircondition in seinem Wagen hat er voll aufgedreht, auch wenn man vom lauten Rauschen des Gebläses die Musik aus dem Autoradio kaum vernehmen kann, aber wie sonst würde er diese Extremtemperaturen aushalten. Drei oder vier Mal während des Sommers kommt es zu diesem Wetterphänomen, bei dem der heiße, trockene Wüstenwind aus Afrika übers Mittelmeer rüber zur spanischen Halbinsel weht. Während einer Ponentà fällt die für Valencia übliche hohe Luftfeuchtigkeit, die einem die verschwitzten Kleider am Körper kleben lässt, dank der Saharawinde innert kürzester Zeit steil nach unten. Im Gegenzug klettert das Quecksilber jeweils auf über 40 Grad, sodass man sich im wahrsten Sinne des Wortes vorkommt wie in einem Heißluftbackofen. Dann ist es so trocken und heiß, dass die Schweißperlen verdampfen, bevor sie sich überhaupt bilden können.
Vicente Alapont, den außer seiner Familie und ein paar engen Freunden alle einfach bei seinem Familiennamen rufen, steuert sein Taxi über den flimmernden Asphalt der Calle Colón, auf welchem man zweifelsohne Spiegeleier braten könnte. Obwohl es nicht einmal Mittag ist, fühlt er sich müde, irgendwie schlapp und schläfrig. Auch dies ist eine Konsequenz der Ponentà, zumal es sogar nachts nicht richtig abkühlt. Bei 28 Grad um 3 Uhr in der Früh ist an einen erholsamen Schlaf nicht zu denken.
Selbstverständlich hat auch er eine Klimaanlage zu Hause, doch für die Nachtruhe ist die künstlich-kalte Luft nicht gerade das Gesündeste. Schon mehr als einmal hat er sich eine Erkältung eingefangen, nur weil er das Gerät schlecht ausgerichtet hatte und es genau auf das Kopfende seines Bettes blies. Als ihn ein Motorroller wie ein wilder Kamikaze überholt, ihm dabei den Weg abschneidet und er voll auf die Bremse treten muss, platzt dem sonst ausgeglichenen Vicente Alapont der Kragen. »Warum, zum Teufel, kurve ich an einem solchen Tag durch die Gegend, wenn doch keine Seele unterwegs ist?« Gerade mal drei Fahrten hat er diesen Vormittag gemacht, und nur jene des holländischen Paares hat etwas Geld in die Fahrtenkasse gespült. Denn im Gegensatz zu den Einheimischen sind die Touristen wesentlich großzügiger in Sachen Trinkgeld, schließlich sind fünf oder zehn Euro für viele Ausländer beinahe Kleingeld. Rasch überschlägt er die Tageseinnahmen, keine lausigen 40 Euro! Immer noch verärgert vom Beinahe-Zusammenstoß mit dem Zweirad, tippt er, etwas zu energisch, auf den Off-Schalter seines Taxameters, sodass das grüne Lämpchen als Freizeichen auf dem Dach seines weißen Toyota erlischt. Es reicht, genug für heute! ¡Ya basta!
Doch, was tun mit einem solchen angebrochenen Hitzetag? Obwohl, die Antwort liegt auf der Hand: Nichts, denn alles andere wäre Wahnsinn. Also ab nach Hause, die Klimaanlage starten und richtig ausrichten, und dann eine schöne, lange Siesta auf dem Sofa machen, und zwar so lange, bis die Sonne untergeht und man sich wieder rauswagen kann. Doch vorher möchte er, wenn auch nicht groß, etwas zum Mittag essen, und da sich seine alte Stammkneipe auf halbem Weg zu seinem Zuhause befindet, ist es für Alapont klar, dass er dort einkehren wird.
Die wenigen Schritte bis zur Taberna de Pablo kommen ihm so vor, als würde er die Sahara bei prallster Mittagssonne durchqueren. Sein Taxi hat er kurzerhand am Straßenrand abgestellt. Dies ist zwar nicht ganz korrekt, aber erstens ist bei dieser Hitze niemand unterwegs, der Parkbußen schreiben würde, und zweitens ist die weiß markierte Spur, auf welcher er seinen Wagen stationiert hat, den Linienbussen und Taxen vorbehalten. Und zu dieser Gilde gehört er ja, seitdem er seinen Job als Inspektor bei der Policía Nacional an den Nagel gehängt und die Taxilizenz seines Schwagers übernommen hat. Das ist vor etwas mehr als einem Jahr gewesen, seither verdient Alapont als Taxi-Quereinsteiger seine Brötchen.
Gerade an Ponentà-Tagen läuft die etwas altersschwache Klimaanlage in Pablos Taverne gefährlich nahe am Kollaps, daher lässt der Besitzer die Metallstoren vor den Fenstern seines Ecklokals unten, und somit die heiße Sonne draußen. Lediglich halb hochgezogen ist der Rollladen vor dem Eingang, sodass die etwas größer gewachsenen Gäste nicht selten ihren Kopf anschlagen. Im Verlauf der Jahre hat Alapont diese Lektion gelernt und bückt sich automatisch, um so reinzuhuschen. Von draußen, vom gleißenden Sonnenlicht kommend, müssen sich seine Pupillen erst an die gedämpfte Beleuchtung im Lokal gewöhnen. Als Erstes erkennt er Pablo, wie er hinter seiner Theke steht und dabei ist, einen Standventilator zusammenzuschrauben, den er gleich ums Eck bei Hao-Fo in dessen China-Billigladen gekauft hat. Das Zusammenstecken des Gerätes ist zwar nicht wirklich eine körperlich anstrengende Arbeit, doch dem Wirt, der ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hat, läuft der Schweiß in Strömen von der Stirn. Für alle gut hörbar wettert er vor sich hin, während er den Tresen als Werkbank benutzt.
»Glaubst du wirklich, dass ein solches Ding bei dieser Bullenhitze etwas nutzen wird?«, ruft Alapont beim Reinkommen dem Kneipenbesitzer scherzhaft zu. Dieser verdreht die Augen und zuckt mit den Schultern. Offensichtlich noch einer, dem die heißen Saharawinde zu schaffen machen. »Ich weiß nicht, ob ich an die globale Klimaerwärmung glauben soll, so wie dies dauernd im Fernsehen gesagt wird, aber dies ist schon die zweite Ponentà in vier Wochen. Ich glaube, ich wandere nach Schweden oder Alaska aus«, schimpft Pablo, während er den Ventilator ans Stromnetz anschließt. Anstatt zu kühlen, wirbelt das doofe Ding lediglich die abgestandene Luft etwas durcheinander, doch wirklich stören tut dies niemanden. Denn die Taberna de Pablo gehört zu jenen unzähligen Kneipen in Spanien, in denen sich die immer gleichen Gäste treffen und denen es nichts ausmacht, dass der Tresen seit der Eröffnung vor 20 oder 30 Jahren der gleiche ist und dass die eingerahmten Fotos an den Wänden – Fußballmannschaften, heimatliche Landschaften und Gruppenfotos fröhlich zusammensitzender Menschen – längst vergilbt sind. Wirklich gemütlich und behaglich im klassischen Sinne ist es nicht in Pablos Kneipe, dafür ist es besonders informell und entspannt. Sozusagen das pure Gegenteil zur gegenüberliegenden Polizeizentrale, von wo die meisten Stammgäste stammen. Muss drüben salutiert werden, spielen bei Pablo die Dienstgrade keine Rolle. Entscheidend jedoch ist: Bei Pablo gibt es guten Kaffee, immer frisch zubereitete Tapas und reichhaltige Mittagsmenüs, abgesehen davon, dass man immer jemanden zum Plaudern trifft. Und darauf kommt es schließlich an! Und wenn es, wie an einem Hitzetag wie heute, in der Taverne üppig heiß ist, so nimmt man dies gerne in Kauf.
»Was willst du essen?«, fragt der Wirt, während er mit einem feuchten Tuch die Tresen sauber wischt.
»Ich brauche zuerst einen Kaffee, habe miserabel geschlafen. Gib mir doch ein cortado del tiempo.«
Laut zischend lässt Pablo an der großen Espressomaschine einen Kaffee ein, mischt ihn mit Milch – fifty-fifty – und stellt diesen, zusammen mit einem Glas voller Eiswürfel, vor seinen Gast auf die Theke. Behutsam, um ja keinen Tropfen des leckeren Lebenselixiers zu verschütten, gießt Alapont den Milchkaffee über die Eiswürfel, bis das Glas voll und die Tasse leer ist. Warum wohl muss er in diesem Moment an die schmelzenden Eisberge am Nordpol denken? Und gleich schießt ihm ein zweiter Gedanke durch den Kopf: In Grönland gibt es sicher keine Ponentà! Dort sollte man jetzt sein …
»¡Vicente-Luis Alapont de Pablos!«
Wer zum Henker ruft da seinen vollständigen Namen durchs Lokal? Als er sich umdreht, erkennt er hinter sich, an einem kleinen Tisch nahe der ratternden Klimaanlage, einen ehemaligen Kollegen, der ihm mit seinem Glas zuwinkt. Es ist der Gefreite Sánchez, ausgerechnet … Der kleine Kerl ist zwar ein netter Typ, aber er ist die Klatschbase der Policía Nacional. Eigentlich sollte doch ein altgedienter Gesetzeshüter wie er etwas von Diskretion verstehen, doch wenn man Sánchez etwas anvertraut, so weiß es am nächsten Tag jeder in der Jefatura Superior de Policía Nacional von Valencia. Trotzdem schnappt sich Alapont seinen Eiskaffee und geht rüber. Nach einem Vormittag am Steuer und Fahrgästen, die entweder schwiegen wie ein Grab oder kein Spanisch konnten, ist er froh um etwas Konversation. Doch mehr als ein trockenes »¡Hola Sánchez!« kommt ihm als Begrüßung nicht über die Lippen, während er einen Stuhl vom Nachbartisch herüberzieht und sich hinsetzt.
»Was machst du an einem Ponentà-Tag auf der Straße? Wir haben Dienstpläne, an die wir uns halten müssen, aber du? Bist ja jetzt dein eigener Chef«, kommentiert Sánchezetwas ironisch und zeigt auf die zwei Uniformierten, die mit ihm am Tisch sitzen.
»Das sind Rocío Heredia und Aitor Zabaleta, beide erst seit Kurzem in Valencia im Dienst. Sie kommt aus Sevilla, er aus dem Baskenland.«
Die beiden grüßen, indem sie ihre halb leeren Biergläser heben. Alapont tut das Gleiche mit seinem Kaffee, in welchem die Eiswürfel beinahe schon geschmolzen sind. Dabei nimmt er die jungen Beamten ins Visier. Der Typ, Zabaleta, entspricht voll und ganz der landesweiten Vorstellung eines Basken: ein großer, kräftiger Kerl, beinahe schon ein Hüne. Sie hingegen entspricht mit ihren blauen Augen und den blonden Haaren, die zu einem Rossschwanz zusammengebunden sind, überhaupt nicht dem Klischeebild einer Andalusierin. Jedenfalls nicht so, wie sie Georges Bizet in seiner Oper Carmen beschrieben hat.
»Kollegen, dies ist Alapont, einer der besten Inspektoren, die wir in Valencia je gehabt haben, bis er seine Freistellung beantragt und den Job an den Nagel gehängt hat. Jetzt macht er als Taxifahrer die Straßen unserer Stadt unsicher.«
Dieser Spruch geht ihm mittlerweile gehörig auf die Nerven. Jedes Mal, wenn er Sánchez trifft, lässt dieser den immer gleichen Kommentar vom Stapel. Zu Beginn war es ja noch lustig, mittlerweile wirkt es nur noch abgedroschen. Aber es ist zu heiß, um sich aufzuregen, denkt sich Alapont, und leert in einem schnellen Zug das, was noch von seinem Eiskaffee übrig ist. »Freut mich, euch kennenzulernen. Dienstschluss?«
»Ja endlich, bei dieser Hitze hält man es drüben in der Jefatura kaum aus, jedes zweite Klimagerät ist ausgestiegen.« Der junge Polizeibeamte hebt zum Beweis seinen Arm und zeigt allen am Tisch seine Schweißflecken in der Achselhöhle.
»Aitor, du bist ein Ferkel! Musst du wirklich deine Ausdünstungen unter meine Nase halten?«
Aha, die junge Polizeibeamtin sieht zwar nicht aus wie eine Andalusierin, aber ihr starker Akzent beweist das Gegenteil. Und den typisch südspanischen Charakter besitzt sie offensichtlich auch, hält sie sich doch theatralisch die Nase zu, während sie den anderen Ellbogen ihrem Kollegen in die Rippen rempelt. Kaum merklich kaut sie auf ihrer Unterlippe herum, während sie Alapont anvisiert. »Dann bist du also jener Inspektor, der seinen Dienst geschmissen hat, nachdem …«
Alapont hat keinen Bock, alte Geschichten aufzuwärmen, und fällt ihr daher ins Wort. »Vergiss es Heredia, das ist Schnee von gestern.«
Wie ein Schutzengel, der ihn davor bewahrt, von der Vergangenheit erzählen zu müssen, erscheint Inspektor Fernando García in der Türe. Da er etwas kleiner und gedrungener ist, läuft er nicht Gefahr, sich den Kopf am nur halb hochgezogenen Rollladen zu stoßen. Auch er bleibt im Türrahmen stehen, auch seine Augen müssen sich erst an das schummrige Licht gewöhnen.
»Fernando, schließ’ die Tür, die Hitze kommt sonst rein!« Irgendjemand am Nachbarstisch schreit quer durch das Lokal. In der Taberna de Pablo kennt schließlich jeder jeden, ist das Lokal doch die inoffizielle Kantine der Polizeizentrale, gleich auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Gran Via Fernando el Católico. Und obwohl Alapont keinen Dienstausweis mehr besitzt, gilt er immer noch als einer von ihnen.
Alapont und García umarmen sich freundschaftlich, schließlich kennen sie sich, seit sie in jungen Jahren gemeinsam auf Streife gewesen sind. Und bis zu Alaponts Freistellung waren sie als Ermittler ein perfekt eingespieltes Team. Zusammen setzen sie sich an den letzten, noch freien Tisch. Mal schauen, was Pablos Köchin Adelaida Leckeres als Mittagsmenü zubereitet hat.
-2-
An klaren Tagen ist Marokko zum Greifen nah, schließlich trennen keine 15 Kilometer die andalusische Küste und somit die europäische Landmasse von Afrika. Über diese Meerenge kamen einst die Mauren auf die Iberische Halbinsel, wo sie für 700 Jahre das Kalifat al Andalus errichteten und so die spanische Kultur bis in die heutigen Tage prägen. Allein die spanische Sprache ist gespickt mit arabischen Ausdrücken, bestes Beispiel hierfür ist der Name dieser Südregion, die sogar auf Deutsch nahe an der ursprünglichen Bezeichnung ist: Andalusien. Und auch heute noch beeinflusst die Nähe zum afrikanischen Kontinent das Leben im einstigen al Andalus, allen voran in den beiden Hafenstädten Algeciras und Tarifa. Ununterbrochen wechseln die Fährschiffe über von Spanien nach Marokko und zurück, und mit ihnen Menschen und Waren – legale wie auch illegale. Den Schmuggel als selbstverständliche Erwerbstätigkeit zu bezeichnen, mag zwar nicht gerecht sein all jenen gegenüber, die ihrer geregelten Arbeit nachgehen und brav ihre Steuern bezahlen, aber trotzdem … Die Drogenschieber, die mit ihren 350 PS-starken Schnellbooten gerade mal 15 Minuten brauchen, um die Meerenge zu überqueren und Tonnen an Haschisch und Marihuana an der Grenzpolizei vorbeischmuggeln, gehören hier zum Alltag. Ebenso wie die einen oder anderen der etwas über 9.000 Arbeitnehmer, die tagtäglich die EU-Außengrenze überschreiten, um in der britischen Enklave Gibraltar ihren Jobs nachzugehen, und die auf dem Rückweg nach Feierabend ein, zwei Stangen zollfreie Zigaretten dabeihaben. Dieser Tabak lässt sich bestens unter Hand an Freunde und Bekannte verkaufen – ein kleiner Zustupf für die Haushaltskasse.
So gesehen ist Antonio-Jesús Salama ein eher kleiner, unbedeutender Fisch in einem großen Teich voller Haie und Barrakudas. Aufgewachsen in der Altstadt von Tarifa, welche von den einfachen Häusern und den engen Gassen her durchaus irgendwo in Marokko oder Algerien liegen könnte, ist Toni, wie ihn alle nennen, früh von der Schule abgegangen. Warum mit Grammatik und Algebra Zeit verlieren, wenn man mit dem Verkauf von Gras an die vielen Surfer und Hippies aus Mittel- und Nordeuropa, die seinen Heimatort für sich entdeckt haben, Geld machen kann? Und zwar mehr, als etwa ein Hafenarbeiter oder ein Hotelgärtner im Monat verdient. Für jemanden aus einfachen Verhältnissen wie Toni, mit einem arabischen Familiennamen wie Salama und einem ebensolchen Äußeren – dunkler Teint, dichtes, schwarzes Haar – bilden solche einfachen Jobs die Perspektive im Leben. Dann doch lieber die Gelegenheit nutzen und versuchen, ein Stück des Kuchens für sich selbst abzuschneiden. Und so verdient er seit bald zehn Jahren ein Taschengeld, das es ihm erlaubt, seinen Eltern etwas Geld abzugeben und sich sogar ein Auto zu leisten. Es handelt sich dabei zwar um einen Gebrauchtwagen, dafür hat er aber dem Autoverkäufer die 3.500 Euro bar in die Hand gedrückt. Über die Jahre ist der hoch gewachsene Emigrantensohn innerhalb der Organisation aufgestiegen und ist jetzt, wie sie in den amerikanischen Mafiafilmen sagen würden, ein Soldat. Doch Antonio-Jesús »Toni« Salama ist der Meinung, dass er längst eine Beförderung verdient hat, schließlich will er mehr als nur ein einfacher Fußsoldat sein. Nicht nur, um sich einen richtigen, schönen und vor allem neuen Wagen leisten zu können, sondern auch um von den jungen Frauen in seinem Quartier mit Respekt angeschaut zu werden.
Ziemlich genau auf halber Strecke zwischen Tarifa und Algeciras, in den Hügeln über der Meerenge, befindet sich ein bekannter Aussichtspunkt, zu welchem Hobby-Ornithologen aus halb Europa pilgern. Ihre Aufmerksamkeit gilt Zugvögeln wie dem Weißstorch, dem Schwarzmilan oder dem Schlangenadler, die in den Winden der Straße von Gibraltar ihre Kreise ziehen. Auf diesem Parkplatz stehen aber auch immer irgendwelche Wohnmobile von Touristen herum, welche die Fernsicht rüber nach Afrika genießen wollen. Doch weder die Vögel noch den Ausblick interessieren Toni, kennt er doch beides seit seinen Kindheitstagen. Gelangweilt lehnt er an der Motorhaube seines grauen Renault Mégane, spielt auf seinem Handy Candy Crush und raucht eine Zigarette nach der anderen. Irgendwo dort drüber hält er sich versteckt, denkt er sich und meint damit seinen obersten Boss. Obwohl, niemand weiß wirklich, wo der Chef des Drogenschmugglerrings untergetaucht ist. Über Jahre hinweg hatte Luis-Miguel Hidalgo eine perfekt organisierte Struktur an Haschischlieferanten, Schnellbootkapitänen, Lastenträgern und Fahrern zwischen Marokko und Spanien aufgezogen und so, möchte man den Medien glauben, ein Vermögen von über 30 Millionen Euro angehäuft. Dies, bis vor etwa zwei Jahren die Polizei in einer groß angelegten Razzia seine Hacienda stürmte. Damals ist el Luismi, wie ihn alle respektvoll, zum Teil auch schon ehrfürchtig nennen,in letzter Minute in seinem Helikopter entkommen und ist seither angeblich in Marokko untergetaucht. Gesehen hat den Drogenboss seit dessen Flucht niemand, trotzdem bekommt Toni immer wieder Anweisungen und Aufgaben, die, so stellt er sich vor, aufgrund der klaren Hierarchien innerhalb der Organisation letztendlich von el Luismi selbst stammen müssen. Ob dem so ist, weiß Toni nicht, doch er möchte es glauben, denn nur dann kann er wirklich Karriere innerhalb der Bande machen.
Mit etwas zu hohem Tempo fährt ein blauer Geländewagen von der Landstraße auf den ungeteerten Parkplatz ab, gerät auf dem Erdreich und den Kieselsteinen etwas ins Schlingern und kommt knapp neben dem grauen Renault zum Stehen. Von Diskretion hält der Fahrer nicht viel, drehen sich doch alle anwesenden Touristen erschrocken um. Doch Toni kennt den Typen schon zu lange, um sich zu wundern, also schnippt er die soeben angezündete Ducados-Zigarette weg und geht um den Four-Wheel-Nissan herum. Obwohl der Fahrer des Offroaders wie er selbst Andalusier mit maurischen Wurzeln ist, könnte er problemlos als einer jener hochgewachsenen Nordlichter durchgehen, die am Strand von Tarifa im Wind surfen – Holländer, Deutsche oder Schweden. Aufgrund seiner blonden Haare und seiner blauen Augen wird Jesús Bennasar, arabischer könnte ein Familienname nicht sein, von allen kurz und einfach el Rubio genannt. Doch für Toni ist der Blonde hingegen einfach el jefe, der Chef, von dem er seine Anweisungen entgegennimmt.
»Chico, du hast bewiesen, dass man dir vertrauen kann. Das hat sogar der Chef dort drüber mitbekommen.« El Rubio bleibt in seinem Wagen sitzen, während er mit Antonio spricht und mit dem Kopf nach Marokko rüber nickt. »El Luismi will, dass du so rasch wie möglich nach Valencia fährst und dort ein Problem löst.«
»Klar, kein Problem!« Also doch, der Big Boss weiß also, wer er, Antonio-Jesús Salama, ist. Und, wer weiß, vielleicht ist dies der Auftrag, der ihm die langersehnte Beförderung bringen könnte. So oder so ist es ein guter Grund, auf sich selbst stolz zu sein.
»Einer unserer Transporteure dort oben macht Probleme, die halten sich nicht an unsere Abmachungen. Die Polizei schnüffelt dort schon rum, wir müssen sichergehen, dass die von der Bodega los Monteros kein Wort sagen, keinen Fehler machen.«
»Bodega los Monteros ist der Name?«, fragt Toni, um sicherzugehen, seine Anweisungen richtig entgegenzunehmen.
El Rubio nickt, zieht sein Mobiltelefon aus der Brusttasche seines verknitterten Hemdes und hält es dem jungen Kerl, der an seinem Wagen steht, hin. »Da schau, merke dir diese Gesichter. Dieser ältere Mann da heißt Luis Montero, er ist der Vater und gibt den Ton an.«
Mit einem Fingerwisch geht er die Fotogalerie durch. »Dies ist die Tochter, deren Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, sie ist aber auch nicht wichtig. Vor allem merken musst du dir jedoch diesen Typen, Roberto Montero, den Sohn. Er schmeißt den Laden in Valencia.«
Dann greift el Rubio nach einer Kartonschachtel, die auf dem Beifahrersitz liegt, und reicht sie durchs Autofenster. Toni erkennt das orange-blaue Logo sofort, schließlich ist es nicht das erste Mal, dass er ein solches Prepaid-Handy ausgehändigt bekommt. Maroc Telecom steht in blauen Lettern auf der Packung.
»Ruf mich an, wenn du an Alicante vorbei bist, und ich gebe dir dann weitere Anweisungen. Jetzt kannst du beweisen, was du wirklich draufhast! Mir, und el Luismi.« Ohne einen weiteren Kommentar startet Jesús Bennasar den Motor und braust mit seinem Geländewagen ebenso schnell davon, wie er gekommen ist. Zufrieden mit dem ungewöhnlichen Auftrag zündet sich Toni eine neue Zigarette an und macht ein paar Schritte hin zum Abgrund – tatsächlich hat man von hier eine großartige Sicht. Als Kind ist er oft mit seinem Onkel hierhergekommen, um die Frachtschiffe, Öltanker und Containerriesen zu zählen, die tagtäglich die Meerenge von Gibraltar durchqueren und am Horizont entschwinden. Doch jetzt ist nicht der Moment für Sentimentalitäten, seine Zukunft in der Organisation steht auf dem Spiel. Also, hoch nach Valencia!
-3-
Es gibt nur noch wenige Lokale in Valencia, in denen die Paella auf dem offenen Feuer zubereitet wird – zu zeitaufwendig, zu umständlich und, besonders seit ein paar Jahren, zu streng die behördlichen Hygienevorschriften in der Gastronomie. Alapont kennt allerdings einen jener Orte, an welchem man sich noch die Mühe und die Zeit nimmt Feuer anzufachen, um so das traditionelle Reisgericht so zuzubereiten, wie es die Tradition verlangt. Also fährt er nicht etwa ans Meer, wo sich die Touristenkneipen befinden, sondern hoch in die Hügel der Sierra Calderona. Besonders gut gelaunt ist Alapont nicht nur, weil er sich auf ein leckeres Mittagsmahl freut, sondern weil er sich in bester Begleitung befindet. Denn mit Fernando García verbinden ihn nicht nur die Jahre, in welchen sie als Inspektoren bei der Policía Nacional miteinander den Verbrechern das Handwerk legten, sondern ein ganzes, gemeinsames Berufsleben. Beide entstammen der gleichen Kadetten-Promotion, waren damals schon mehr als nur Dienstkollegen und sind seither Freunde, und zwar jene Kategorie, die beinahe schon zur eigenen Familie gehört. Alapont war es, der Fernando einst eine Freundin seiner Schwester vorgestellt hatte, mit dem Resultat, dass er zwei Jahre später Trauzeuge auf deren Hochzeit gewesen ist. Dafür ist Fernando der Patenonkel von Alaponts Tochter Lucía.
»Der 30. Mai ist schon über zwei Monate her, seither stehe ich in deiner Schuld. Und gleich wie Spielschulden sind Essenseinladungen Ehrensache!«
In Spanien wird der Namenstag gefeiert, als würde es sich um einen Geburtstag handeln, und unter den beiden Freunden ist es zur Tradition geworden, dass der eine den anderen zu dessen santo zum Essen einlädt. San Fernando ist jeweils Ende Mai, also liegt es jetzt an Alapont, die Zeche zu übernehmen.
Es ist nicht viel los auf der sechsspurigen Schnellstraße, die von Valencia aus zu den Bergen der Sierra Calderona im Westen führt, man merkt, dass August und somit Ferienzeit ist. Wo sich normalerweise zur Rushhour lange Blechlawinen bilden, ist heute freie Fahrt angesagt. Nach etwa zehn Minuten fährt Alapont von der Autobahn ab und folgt der CV-310 in Richtung des Naturschutzgebietes mit seinen 600 und 900 Meter hohen Gipfeln, den spektakulären Felswänden und den immergrünen Pinienwäldern. Obwohl er diese Ausflugsgegend bestens kennt, faszinieren ihn von Neuem die alten, herrschaftlichen Häuser entlang des Paseo Delicias, der Hauptstraße, welche durch Náquera führt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts suchten die begüterten Familien Valencias in diesem kleinen Luftkurort Zuflucht vor der Sommerhitze unten in der Stadt. Die feudalen Villen und weitläufigen Gärten zeugen vom Reichtum vergangener Generationen und, da die meisten Herrenhäuser renoviert und die Grünanlagen gepflegt sind, von deren Erben und Erbeserben.
»Da, schau, sieben Schlafzimmer, fünf Badezimmer, 800 Quadratmeter für schlappe 1,25 Millionen Euro! Auch wenn wir dreimal wiedergeboren würden, könnten wir uns so was nicht leisten.«
Alaponts Beifahrer scrollt auf seinem Handy durch die Homepage einer Immobilienplattform, einfach aus Spaß und im tristen Bewusstsein, dass sein Beamtenlohn als Inspektor nie und nimmer für ein Häuschen in der Gegend reichen würde.
»Habt ihr dieses Jahr überhaupt den Teuerungsausgleich erhalten?« Alapont weiß nur allzu gut, wovon er spricht, sind es doch die Beamten, die direkt Madrid unterstellt sind, die als Erste daran glauben müssen, wenn die Regierung sparen muss und Löhne einfriert.
Inspektor Garcías Worte, obwohl nur wenige, sprechen Bände: »Kein Kommentar!«
Kaum haben die beiden die kleine Ortschaft hinter sich gelassen, wird die Straße kurvenreicher. Doch nicht nur deshalb drosselt Alapont die Geschwindigkeit, sondern weil gleich rechts die unübersichtliche und steile Rampe runter zu ihrem Fahrtziel kommen muss. Das Hinweisschild, eine alte Paella-Pfanne, in welcher von Hand gemalt Casa Fermín steht, ist über die Jahre von einem wilden Zitronenbaum fast zugewachsen.
»Gut so, je weniger Leute wissen, dass man dort unten essen kann und daran vorbeifahren, umso besser für uns.« Alapont ist alles andere als ein Snob, doch ein Geheimtipp ist eben nur so lange einer, als dieser eben geheim bleibt. Gerade in den letzten Jahren, in welchen Valencia vom internationalen Tourismus entdeckt worden ist, ist es schon öfters vorgekommen, dass kleine, unbekannte Lokale von Gästen auf TripAdvisor gut bewertet wurden und plötzlich in Mode kamen. Dafür findet man, was früher nie ein Problem gewesen ist, keinen Platz mehr, abgesehen davon, dass dann meistens die Preise steigen, die Qualität jedoch immer mehr zu wünschen übrig lässt.
Vorsichtig rollt er die abschüssige Zufahrt runter und stellt seinen Wagen am Straßenrand unter einer hohen Palme ab. Richtige Parkplätze gibt es nicht, so wie auch das Casa Fermín im Grunde genommen kein richtiges Restaurant ist. In den 1960er-Jahren hatte einst Großvater Fermín angefangen, in einer kleinen, einfachen Hütte Gäste zu bewirten, heute führt sein Enkel, der ebenfalls den Namen Fermín trägt, von allen jedoch einfach nur Junior genannt wird, zusammen mit seiner Frau Elena diese Tradition weiter. Und zwar auf ihre eigene Art und Weise, zumal sie unter der Woche keine Einzelreservierungen annehmen, sondern lediglich in einer großen Pfanne eine Paella Valenciana für jene Zahl an Besucher zubereiten, die sich bis zum Vorabend angemeldet haben. Mal sind es sechs, mal acht, selten mehr als zehn.
Obwohl Alapont schon länger nicht mehr hier gewesen ist, begrüßt ihn Junior aufs Herzlichste und führt die beiden Freunde an einen der wenigen Tische im Schatten der Laube. »Ihr seid aber früh dran, Elena hat noch nicht angefangen.« Fermín zeigt auf die Feuerstelle, wo seine Gattin gerade mit der Paella-Pfanne hantiert. Fernando schaut auf seine Armbanduhr: Stimmt, es ist knapp 13 Uhr, viel zu früh, um in Spanien Mittag zu essen. Doch das macht den beiden nichts aus, so haben sie Zeit, um in Ruhe wieder mal miteinander zu plaudern. »Was soll ich euch zu trinken bringen?« Die Sommerhitze ist auch hier oben zu spüren, doch das Wasser des kleinen Stauwehrs und das Blätterrauschen der Pappeln vermitteln ein Gefühl der Frische. Verstärkt wird diese Sensation bei Vicente Alapont und Fernando García durch die beiden eisgekühlten Biere, die Junior vor ihnen auf den Tisch stellt.
»Und, wie geht’s in der Jefatura?« Da Alapont ja immer wieder in Pablos Taverne zu Gast ist und dort die eine oder andere Geschichte aus dem Hauptquartier der Policía Nacional mitbekommt, formuliert er seine Frage gleich nochmals neu. »Ich meine, wie geht es dir in der Jefatura?« Wie eine Vorankündigung auf das gesprochene Wort, das gleich folgen wird, setzt sein Gegenüber ein schiefes Lächeln auf. »Na ja, immer das Gleiche. Alltag in einer Gesellschaft, deren Gewaltbereitschaft von Kain und Abel abstammt.« Als wolle Fernando seinen fatalistischen Gesichtsausdruck wegspülen, nimmt er einen großen Schluck seines kühlen Bieres. »Obwohl, sie haben endlich Inspektor Ortega freigestellt.« Jetzt ist es Alapont, der sein Glas hebt.
»Oh, gut! Darauf trinke ich!«
Respekt und Ehrlichkeit gegenüber seinen Mitmenschen sind Werte, die Alaponts Mutter ihm von klein an beigebracht hat. Respekt und Ehrlichkeit sind aber auch Tugenden, die während seiner Zeit als Fahnder öfter arg unter Druck geraten sind. Dass man sich als Polizist mit Gaunern und Ganoven herumschlagen muss, gehört zum Alltag, dass man es aber mit solchen miesen Typen auch in den eigenen Reihen zu tun hat, damit hatte Alapont einfach ein Problem. Auch auf die Gefahr hin, vom einen oder anderen Kollegen als Nestbeschmutzer und Kameradenschwein betitelt zu werden, sagte er bei einer internen Untersuchung der Dienstaufsichtsbehörde gegen Inspektor Ortega aus. Mal ein Auge zuzudrücken, ist das eine, sich schmieren zu lassen, und zwar immer wieder, etwas anderes. Fernando García hat den Bruch zwischen seinem damaligen Partner und jenen Kolleginnen und Kollegen, die Inspektor Ortega gedeckt haben, hautnah miterlebt. Wobei er auch heute noch nicht wirklich weiß, ob dies der wirkliche Grund gewesen ist, weshalb sich sein Freund vom Polizeidienst verabschiedet hat. Oder hat Alapont einfach zu viel Dinge gesehen, die eigentlich kein Mensch sehen sollte, und Situationen erlebt, die sicherlich nicht einfach zu verdauen waren? Gerade einer der letzten Fälle, das Verschwinden einer 17 Jahre jungen Frau, ist diesem ungewöhnlich nahe gegangen, obwohl er dies nicht zugeben mag. Aber gleich den Job an den Nagel hängen und sich hinter das Steuer eines Taxis setzen? Doch der Inspektor möchte kein Salz in eine offene Wunde streuen, irgendwann – sicher nicht heute – wird ihm Alapont den wahren Grund für seinen Berufswechsel erklären.
»Und, hast du es jetzt im Griff mit der Paella?«, scherzt Fernando, um ein unverfängliches Thema anzusprechen. Alapont winkt ab. Er isst zwar gerne, aber das Kochen war nie sein Ding. Trotzdem ärgert es ihn als Valenciano, dass er es noch nie geschafft hat, eine wirklich gute Paella zuzubereiten. Entweder war der Reis zu weich oder zu hart, einmal fehlte Salz, ein andermal war zu viel drin. Und wenn beides stimmte, so war das Resultat trotzdem nur so lala … Also will er Elena beim Kochen genau über die Schulter schauen.
Mit einem großen Strohhut auf dem Kopf und einer langen Kelle in der Hand stellt sich diese vor die Paella-Pfanne, die so groß wie ein Wagenrad ist. Und zwar nicht wie irgendeines Pkws, sondern vielmehr vom Durchmesser eines Lastwagenreifens. Großzügig gießt sie Olivenöl hinein, dreht und schwenkt die Pfanne so lange, bis sich das Öl schön gleichmäßig verteilt hat. Als dieses wirklich heiß ist, legt sie die Hühnchen- und Kaninchenstücke hinein, gibt die dazugehörenden Lebern dazu, bestreut das Ganze mit ein paar Prisen Salz und brät alles – unter ständigem Umrühren – knusprig-kross an. Dann greift sie zu einer Schüssel, in welcher sie das Gemüse vorbereitet hat – geschälte, weiße Bohnen und garrofó, eine grüne, breite, lange und vor allem lokale Bohnensorte – und schmort dieses ebenfalls ein paar Minuten lang mit. Anstatt die Tomaten selbst zu schälen und in kleine Stücke zu schneiden, nimmt Elena eine große Büchse pelati und leert diese, zischend, hinzu. Zum Schluss schreckt sie alles mit Wasser ab und füllt die Paella-Pfanne bis auf einen Fingerbreit unter den Rand mit Wasser, nochmals genau darauf achtend, dass alles schön eben auf dem Feuer steht. Um dem Gericht die typisch gelbe Farbe zu geben, streut sie eine fertige Paella-Gewürz- und Farbmischung hinzu, die es in jedem Supermarkt zu kaufen gibt. Ursprünglich wurde dafür Safran verwendet, doch da die feinen, getrockneten Blütenfäden des Krokus teurer sind als Gold, findet man heute in jeder spanischen Küche diese gelbe Streumischung.
Alles muss eine Viertelstunde vor sich hin kochen, also bestellt Alapont zwei frische Biere, einen Teller mit jamón serrano sowie Manchego-Käse. Schließlich lässt es sich mit trockenem Mund und leerem Magen nur schlecht plaudern.
»Und, bereitest du dich immer noch auf den Iron Man vor?« In jedem Wort, in jeder Silbe von Fernandos Frage schwingt leiser Hohn mit. Schließlich gehört der Inspektor zu jenen, die es wie der einstige britische Premierminister Winston Churchill halten: Sport ist Mord! Beinahe ein Kopf kleiner als Alapont, bringt er das gleiche Gewicht auf die Waage.