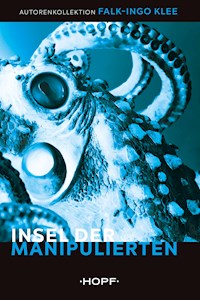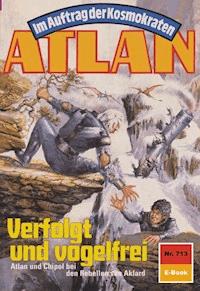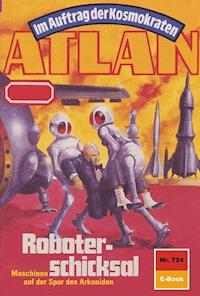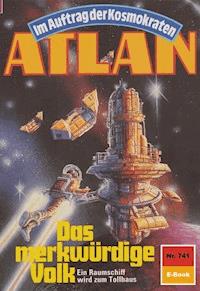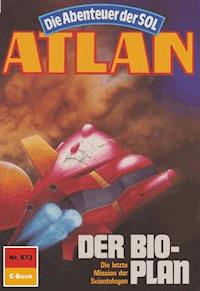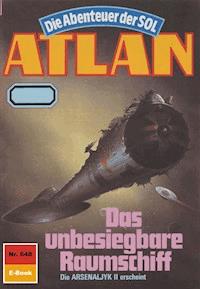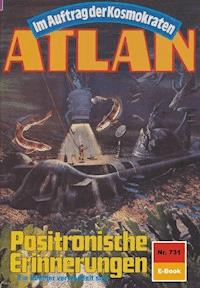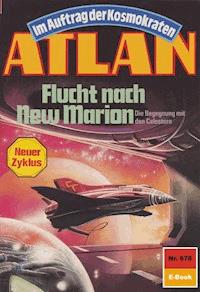Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Frank Wilhelm, ehemaliger Medizinstudent, Ex-Privatdetektiv und als Schwiegersohn des Firmeninhabers nun Juniorchef eines Gießener Bestattungsunternehmens, bekommt Besuch von der Mordkommission. In einem Sarg seines Instituts, der für die Einäscherung vorgesehen ist, liegt nicht nur der Verstorbene, sondern auch noch ein unbekannter junger Asiate, der auf äußerst perfide Weise umgebracht wurde. Ein furchtbarer Verdacht steht im Raum ... Wilhelm will die Ermittlungen gegen sich, seinen Schwiegervater und die Mitarbeiter des Bestattungsinstituts als Verdächtige nicht einfach so hinnehmen und beschließt, eigene Nachforschungen anzustellen. Das ist schwieriger als gedacht und mörderisch dazu, denn der oder die Täter beherrschen eine "Mörderische Kunst" ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
1.
Als die Türklingel schrillte, brach das Schnarchgeräusch abrupt ab. Man hörte das Knarren morscher Matratzenfedern, was signalisierte, dass der Schläfer sich einfach umgedreht hatte und nicht daran dachte, Morpheus’ Arme zu verlassen.
Erneut und diesmal stürmischer begehrte jemand Einlass in die Wohnung. Schlaftrunken setzte sich der Mann im Bett auf, gähnte ausgiebig und tastete nach seiner Brille auf dem Nachttisch. Umständlich setzte er sie auf und blickte auf den Wecker.
Die Türglocke stand nicht mehr still. Mit einer Verwünschung auf den Lippen verließ der Grauhaarige sein zerwühltes Nachtlager, streifte einen verwaschenen Bademantel über den schmuddeligen Schlafanzug und schlurfte zur Tür.
»Ja, ja, ich komme ja schon«, rief er ärgerlich. »Wissen Sie eigentlich, dass heute Sonntag ist?« Wütend setzte er nach: »Es ist noch nicht mal acht Uhr!«
In seiner Rage warf er noch nicht mal den obligatorischen Blick durch den Spion, sondern nahm einfach die Sicherheitskette ab, drehte den Schlüssel im Schloss und riss die Tür auf.
»Ich hoffe, Sie haben gute Gründe für diesen …« Abrupt brach er ab. »Ach so, Sie sind’s. Was, um alles in der Welt, wollen Sie denn hier? Und dazu in aller Herrgottsfrühe?«
»Morgen, Rinn!« Der Besucher grinste. »Willst du mich nicht hereinlassen? Oder soll ich dir die Fragen im Hausflur beantworten?«
»Kommen Sie!« Der ältere Mann zog den Besucher in den Korridor und schloss die Tür hinter ihm. »Hier in die Küche.«
Der Grauhaarige ging voraus und deutete auf den einzigen freien Stuhl.
»Na, aufräumen und saubermachen könntest du ja auch mal wieder.« Der Jüngere ließ seinen Blick über das Sammelsurium aus leeren Bierflaschen, benutzten Tellern und Bestecken, Töpfen mit Essensresten, angebrochenen Konserven und überquellendem Mülleimer schweifen. »So was zieht Ungeziefer an.«
»Sind Sie nur gekommen, um mir das zu sagen?«
»Werde nicht frech!« Der Besucher machte eine drohende Handbewegung. »Sind wir alleine, oder hast du wieder einen fremden Kerl im Bett?«
»Wie kommen Sie denn darauf?«
»Rinn, verlangst du ernsthaft, dass ich mit dir darüber diskutiere?« Allein der Blick ließ den Angesprochenen förmlich zusammenschrumpfen. »Sind wir allein?«
»Ja. Was gibt’s?«
»Kannst du dir das nicht denken?« Der Mund des Besuchers verzog sich zu einem breiten Grinsen, doch das Gesicht selbst vermittelte nicht den Eindruck von Heiterkeit, sondern von Entschlossenheit.
Leichthin verkündete er: »Du musst mal wieder jemanden entsorgen.«
»Sie wissen doch, dass das nicht einfach ist. Was sage ich? Nicht einfach – es wird immer schwerer. Wenn man mich erwischt …«
»Zweieinhalb Riesen, Rinn!« Der Jüngere griff in die Jackentasche und zog ein Bündel Hundertmarkscheine hervor. »Du weißt, wie gering dein Risiko ist. Und mit diesem Geld kannst du dir ein paar knackige junge Burschen leisten.«
Im faltigen Antlitz des Grauhaarigen wetterleuchtete es, man sah, wie Angst und Gier um die Vorherrschaft kämpften. »Abgemacht, ich tu’s. Wann bringen Sie die Leiche?«
»Junge, du hast die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt. Heimservice – du holst ab. Die Adresse gebe ich dir noch.«
»Aber das ist unmöglich, Herr Kalle. Ich besitze nur einen Kleinwagen. Darin bringe ich einen Toten nie und nimmer unter. Und dann der Austritt der Körperflüssigkeiten …«
»Jetzt hör auf zu jammern, du Depp«, wurde der Ältere barsch zurechtgewiesen. »Der Körper wird in Folie eingeschweißt, ist also problemlos zu transportieren.«
»Womit denn?«
»Rinn, du weißt, dass du in der Sudetenlandstraße wohnst?«
»Logisch. Und?«
»Ein Autovermieter ist fast vor deiner Haustür, und zwei weitere sind gleich um die Ecke. Die leben davon, dass sie Autos verleihen.«
»Okay. Wann und wo?«
»Ich melde mich.« Der Besucher blätterte fünf Hunderter auf den Tisch. »Anzahlung, Rest bei Erledigung. Du weißt, was dir geschieht, wenn du versuchst, mich zu leimen?«
Rinn nickte eingeschüchtert.
»Na, dann ist ja alles klar.« Kalle tippte mit einem Finger jovial an die Schläfe und verließ die Wohnung mit einem fröhlichen »Schönen Sonntag noch!«
2.
Die Ausstattung wirkte dem Gewerbe angemessen. Sonnenstrahlen wurden durch geschickt angebrachte Jalousien und Vorhänge geschickt am Eindringen gehindert, und was sich an Tageslicht in den Raum verirrte, wurde gelenkt, geleitet und durch Gardinen gebremst. Halogenlampen und Deckenfluter übernahmen den Part der Sonne, nicht grell und aufdringlich, sondern gezielt gesteuert und eher diffus.
Dem zeitlosen Mobiliar sah man auf den ersten Blick an, dass es aus massivem Holz bestand. Ob Kirschbäume, Palisander oder irgendwelche Tropenhölzer für diese Schreinerkunst ihr Leben gelassen hatten, war nicht auf Anhieb zu erkennen. Mit dem gleichen Material waren die Wände verkleidet, ein dunkelgrauer Teppich aus dichtem, Schall schluckenden Flor bedeckte den Boden.
Keine Pflanze hätte in diesem Halbdunkel mehr als einen Monat überdauert, dennoch waren etliche Spezies des Pflanzenreichs in Kübeln vertreten. Exotische Palmfarne, Lorbeerbäumchen und strenge, stammlose Palmen mit starren Wedeln vermittelten eher Düsternis als frisches Grün. Die Heiterkeit ihrer südlichen Heimat war ihnen gründlich ausgetrieben worden, denn es waren Geschöpfe, die der Mensch geschaffen hatte: naturidentisch. Weniger verschämt gesagt: künstlich.
Da der Fortschritt vor keiner Branche haltmachte, war neben dem obligatorischen Telefon in mitternachtsblau – was im Prinzip schwarz ist – natürlich auch ein PC vorhanden. Sein Gehäuse war in Anthrazit gehalten, und die Konsole prangte in dunklem Stahlgrau. Ein wenig gewöhnungsbedürftig waren die Regaldekorationen: Urnen aller Art und Couleur standen da mehr oder weniger dekorativ herum. Keine offerierte sich als Sonderangebot, sondern signalisierte unmissverständlich die Vergänglichkeit des Lebens.
Das zarte Läuten der Tür ertönte, eine Mischung aus Armsünderglöcklein und Heilsbotschaft. Sonnenlicht huschte über die Schwelle, dann fiel ein massiger Schatten in den Raum. Der Mann im dunklen Zwirn hinter dem Schreibtisch wurde lebendig. Er sprang nicht auf, wie es in anderen Branchen üblich war, wenn ein Kunde das Geschäft betrat, sondern er erhob sich würdevoll und ging gemessenen Schrittes auf die Frau zu. Mit gesenktem Kopf deutete er eine Verbeugung an und schüttelte seinem Gegenüber die Hand. Der Händedruck war zuversichtlich, die Miene auch, aber Leiden und Mitleid waren trotzdem wie eingemeißelt.
Frank Wilhelm deutete auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch, zog behutsam die Tür ins Schloss und nahm etwas umständlich hinter dem wuchtigen Büromöbel Platz. Für einen kurzen Augenblick musterte er die Besucherin. Dieses berufsmäßige Taxieren hatte zweierlei Gründe. Zum einen diente es der Einstufung in die richtige Preiskategorie, und zum anderen der Einschätzung des Seelenfriedens des Klienten.
Die Frau war etwa vierzig Jahre alt und füllig. Ordinär sah sie nicht aus, eher gewöhnlich. Ihre barocken Formen konnte das schwarz-weiß gestreifte Kostüm kaum kaschieren. Geistig hakte der Bestatter seine Liste ab: Konfektionskleidung, also mittlere Preisklasse, die Wimperntusche war nicht tränenverschmiert, und an das dunkelblonde, kurz geschnittene Haar hatte erst heute ein Friseur Hand angelegt. Demzufolge war sein Gegenüber ziemlich gefasst, mit Gefühlsausbrüchen war nicht zu rechnen.
»Gnädige Frau, was kann ich für Sie tun?«, fragte Wilhelm salbungsvoll und geschäftstüchtig zugleich.
»Mein Mann ist gestern Abend verstorben, und da wollte ich …«
»Natürlich, verstehe, gnädige Frau.« Er erhob sich und reichte seinem Gegenüber erneut die Hand. »Darf ich Ihnen zum Heimgang des teuren Verblichenen mein aufrichtiges Beileid aussprechen?«
»Danke.«
Der Bestatter nahm wieder Platz. Da er in der Stimme der Frau keinen weinerlichen Unterton festgestellt hatte, konnte er also ohne übertriebenen Pathos gleich zur Sache kommen.
»Sie möchten also, dass wir Ihren Trauerfall übernehmen?«
Die Witwe nickte stumm.
»Hatte Ihr Gatte besondere Vorstellungen? Oder haben Sie bestimmte Wünsche?«
»Es soll so wenig wie möglich kosten.«
Wilhelm, der bereits nach seinem Musterbuch fingerte, sah überrascht auf. Auf »Nicht zu teuer, aber massiv soll der Sarg sein!« hätte er getippt, aber so unverblümt hatte ihm bisher kaum jemand gesagt, dass er den Verstorbenen ausgesprochen billig unter die Erde bringen wollte. Die Frau hatte den Blick bemerkt und deutete ihn richtig. Verlegen knetete sie die Griffe ihrer Handtasche zwischen den Fingern.
»Wir sind nicht sehr vermögend. Mein Mann war Frührentner, und ich bin seit einem halben Jahr arbeitslos.«
»Verstehe.« Der Bestatter hatte sich wieder in der Gewalt. Mit einem gewinnenden Augenaufschlag präsentierte er den Katalog, blätterte ihn auf und tippte auf eine Seite. »Hier haben wir ein paar ausgesprochen preiswerte Modelle.« Er schob den Band über den Schreibtisch. »Vielleicht dieses hier?«
Die Besucherin betrachtete das Foto eingehend.
»Ist das der billigste Sarg?«
»Nein, das ist dieser hier.« Wilhelm zeigte auf ein anderes Bild. »Importmodell aus Osteuropa, industriell gefertigt. Wie Sie sehen, ohne Schnörkel und überflüssigen Zierrat, die Form folgt allein der Funktionalität.« Er verkniff sich, zu sagen, dass es der sogenannte ›Armensarg‹ war, den auch die Sozialämter bezahlten. »Er wird häufiger genommen.«
»Gut, den nehme ich auch.«
»Gern, gnädige Frau.« Der Bestatter blätterte die Särge weg und zeigte andere Abbildungen. »Möchten Sie ein besonderes Arrangement? Sehen Sie hier: Leuchter? Lebensbäumchen? Vielleicht ein Bukett auf dem Sarg als letzter Gruß? Oder Blumenschmuck?«
»Nein, nein, das kann ich mir alles nicht leisten.«
»Ich hätte da noch ein besonderes Angebot. Leihkränze, die wir während der Trauerfeier in der Kapelle aufstellen. Sie bestehen aus synthetischer Tanne, sind aber von echter kaum zu unterscheiden und werden mit Schleifen Ihrer Wahl geschmückt. Pro Stück macht das nur zwanzig Mark.«
»Zu kostspielig«, wehrte die Dunkelblonde ab.
Frank Wilhelm seufzte unhörbar. Er hatte nur wenig Hoffnung, noch an der einen oder anderen Dienstleistung zu verdienen.
»Soll es ein christliches Begräbnis sein? Ich meine, mit Pfarrer?«
»Mein verstorbener Mann ist schon vor Jahren aus der Kirche ausgetreten.«
»Also nein.«
Er machte sich Notizen.
»Vielleicht etwas Orgelspiel? Das ist ja eher neutral, oder?«
»Hm.« Man sah, dass sie überlegte. »Gut, Orgel ist in Ordnung.«
»Gewiss, gnädige Frau. Möchten Sie zehn Minuten oder eine Viertelstunde?«
»Ist das nicht egal?«
»Leider nicht.« Der Bestatter zuckte bedauernd mit den Schultern. »Der Musiker wird nach Zeit bezahlt.«
»Das Orgelspiel kostet also etwas?«
»Ja.« Wilhelm setzte ein gequältes Lächeln auf. »Jedes Extra muss extra bezahlt werden.«
»Dann lassen wir es weg.«
»Wird gemacht.« Obwohl er die Antwort schon kannte, fragte er routinemäßig: »An welche Art der Beisetzung und an welche Grabstätte haben Sie denn gedacht?«
»Sie wissen ja … Ich muss mit dem Pfennig rechnen.«
»Natürlich, gnädige Frau. Die preiswerteste Beisetzung ist die Feuerbestattung und ein anonymes Urnengrab.«
»Dann machen wir das so.«
Wilhelm nickte, erhob sich und ging an die hintere Wand. Geräuschlos zog er ein Paneel zur Seite. Eine Vielzahl von matt schimmernden Chromstangen wurde sichtbar, an denen die unterschiedlichsten Totenhemden, Sargauskleidungen und -decken hingen.
»Wenn Sie vielleicht mal einen Blick darauf werfen wollen.« Ein wenig frustriert vom kargen Ergebnis seiner Beredsamkeit kommentierte er: »Sie wissen ja – wie man sich bettet, so liegt man.«
Die Witwe warf ihm einen merkwürdigen Blick zu, sagte aber nichts und machte auch keine Anstalten, aufzustehen.
»Pardon, gnädige Frau, das ist mir so herausgerutscht«, dienerte der Bestatter und schloss den Wandschrank wieder. »Verstehe, das preiswerteste. Also Rupfen.«
Mit Leichenbittermiene kehrte er an seinen Schreibtisch zurück.
»Sind noch Behördengänge zu machen, die wir für Sie erledigen können?«
»Nein. Brauchen Sie den Totenschein?«
»Ja.«
Die Frau öffnete ihre Handtasche und reichte ihm das Papier. Wilhelm warf nur einen kurzen Blick darauf.
»Ach, Ihr Mann ist zu Hause verstorben?«
»Ja. Ist das so ungewöhnlich?«
»Das nicht, aber meist werden wir in die Klinik gerufen.« Er las erneut in dem Dokument. »Frau … Huber, wann sollen wir bei Ihnen vorbeikommen?«
»So schnell wie möglich. Geht es heute Nachmittag? So gegen fünfzehn Uhr?«
Wilhelm blätterte in seinem Terminkalender. »Ja, das passt. Wir werden pünktlich da sein.« Er reichte seinem Gegenüber die Hand. »Ihr Trauerfall ist bei uns in besten Händen. Auf Wiedersehen, Frau Huber.«
Eilfertig huschte er zur Tür, ließ die Witwe hinaus und kehrte an seinen Schreibtisch zurück.
Die Tür, die zum Sarglager führte, öffnete sich geräuschlos. Ein großer, hagerer Mann in typischer Schreinerkluft betrat den Raum.
»Du hattest Kundschaft, Frank?«
»Wenn man es so nennen will«, brummte Wilhelm.
»Ich habe es dir ja gesagt: Gestorben wird immer.« Vergnügt rieb sich der Ältere die Hände. »Bestatter ist ein krisensicherer Beruf.«
»Da wäre ich mir nicht so sicher, Schwiegervater.« Der Jüngere nahm die PC-Tastatur in Betrieb. »In einigen Großstädten entstehen schon Ketten von Discount-Bestattern, und diese Beerdigung ist nun schon die zweite total abgespeckte Version in dieser Woche.« Sarkastisch setzte er hinzu: »Wenn das Schule macht, dann sollten wir eine Do-it-yourself-Abteilung einrichten. ›So baue ich mir einen Sarg aus fünf Brettern‹ und ›So hebe ich mein Grab selbst aus‹.«
»Die Leute müssen eben sparen.« Der Hagere fuhr sich mit der Hand über die Stirn. »Sogar am Tod.«
• •
Frank Wilhelm war das, was man einen passabel aussehenden jungen Mann nannte. 1,80 Meter groß, schlank und sportlich, volles braunes Haar, blaue Augen, aber kein Model-Typ. Dazu waren die oberen Schneidezähne etwas zu groß geraten, der Mund zu breit, und die Nase wies dort einen leichten Höcker auf, wo ihm einst ein Faustschlag das Nasenbein gebrochen hatte. Danach hatte er mit dem Boxsport aufgehört, zumal auch seine leicht überdimensionierten Lauschorgane öfters zur Zielscheibe gegnerischer Attacken wurden. ›Blumenkohlohren‹ blieben ihm so erspart.
Er entstammte einer alteingesessenen Gießener Arztfamilie, der Vater war ein angesehener Pathologe. Als braver Sohn hatte er also folgsam nach dem Abitur an der Gießener Justus-Liebig-Universität mit dem Medizin-Studium begonnen, nach dem siebten Semester aber die Brocken hingeworfen. Er sah auf einmal keinen Sinn mehr darin, später mal Menschen aufzuschneiden oder einzugipsen, mit Spritzen zu traktieren oder bis an sein Lebensende Pülverchen und Tabletten zu verschreiben, außerdem war ihm die mittelhessische Metropole auf einmal zu eng und zu spießig. Es zog ihn in die Großstadt, weg von zu Hause und dem bürgerlichen Alltagstrott.
Als er daheim ankündigte, dass er das Studium der Humanmedizin an den Nagel hängen und aus dem elterlichen Haus ausziehen wollte, war die Familie – wie nicht anders zu erwarten – alles andere als begeistert. Nachdem auch das von seinem Vater verordnete und schon beim Militär erfolgreiche »Eine-Nacht-Überschlafen« zu keinem Sinneswandel geführt hatte, fand er sich quasi auf der Straße wieder. Zwar hatte man ihn nicht des Hauses verwiesen, doch der Umgangston war mehr als eisig, und der monatliche Scheck war gestrichen.
Mit ein paar persönlichen Habseligkeiten war Frank Wilhelm nach Frankfurt getrampt, um sich dort den Duft der großen weiten Welt um die Nase wehen zu lassen. Zwei Tage lang genoss er Freiheit und Großstadt, dann holte ihn das herbstlicher werdende Klima in die Realität zurück. Das Übernachten auf Parkbänken oder am Main war nichts für einen an Zentralheizung und fließend warmes Wasser gewohnten jungen Mitteleuropäer, also benötigte er ein Dach über dem Kopf.
Er kam in einer Wohngemeinschaft unter, wo man natürlich einen aktiven Part zum Lebensunterhalt verlangte. Also jobbte der Medicus in spe a. D. und verdingte sich als Kistenschlepper im Großmarkt, Lagerarbeiter, Baugehilfe, Nachtwächter und nahm fast jede Arbeit an, für die man keine besondere Qualifikation brauchte.
Eine unerwartete Wendung nahm sein Leben, als er bei einem Schoppen Apfelwein in Frankfurt-Sachsenhausen einen leibhaftigen Detektiv traf und mit diesem ins Gespräch kam. War es Zufall oder Schicksal, dass er zwei Tage später in einer Zeitung die Anzeige fand ›Ausbildung zum Privatdetektiv in nur zwei Tagen‹? Gut: der Lehrgang sollte DM 995,- kosten, aber war es das nicht? Unabhängigkeit, Handy, schnelle Autos und kein Chef, der buchhalterisch mit der Stoppuhr die Arbeitszeit kontrollierte? Später vielleicht sogar sein eigenes Büro? Der Gießener sah das Schild schon vor seinem geistigen Auge: Frank Wilhelm, internationale Ermittlungen aller Art.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, und da traf es sich gut, dass die schon etwas gebrechliche Großmutter gar nicht so weit weg in Taunusstein in einer Seniorenresidenz wohnte. Nach wie vor war sie ihrem Lieblingsenkel Frank auch finanziell zugetan, und so war es kein Problem für ihn, die Seminargebühren aufzutreiben.
Schlechter als ›mit Auszeichnung bestanden‹ schnitt keiner der sieben Lehrgangsteilnehmer ab, und so klapperte der frischgebackene Schnüffler mit seinem Diplom unter dem Arm die Frankfurter Detekteien ab. Die schienen alle auf ihn gewartet zu haben. In den großen Büros, die in ganz Deutschland oder sogar international arbeiteten, wollte sich schon die Empfangsdame totlachen, als er seine Urkunde vorzeigte. Als er sich daraufhin auf die kleinen Agenturen verlegte, waren es meist Klitschen oder Ein-Mann-Betriebe, die mehr recht als schlecht lebten und keinen Juniorpartner brauchen konnten.
Fast war Wilhelm schon geneigt, aufzugeben, als er doch noch auf eine Art Lizenznehmer traf, der in anderen Städten auf Partner zurückgreifen konnte, dem es aber auch möglich war, eigene Niederlassungen zu errichten.
»Wenn du dir jetzt einbildest, mit deinem Crash-Kurs Sherlock Holmes zu sein, bist du bei mir falsch.« Alfons Kock gab das Diplom zurück. »Aber ein Anfang ist gemacht. Ein paar Tage Einweisung bekommst du von mir, und dann kannst du anfangen.«
Der frischgebackene Privatdetektiv wollte sich überschwänglich bedanken, doch Kock hob abwehrend die Hände.
»Du kannst mich Alfons nennen, das Duzen ist bei uns üblich.« Er musterte den Jüngeren abschätzend. »Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Sicherstellung von Fahrzeugen im Auftrag von Banken und angeblich gestohlener finanzierter Wagen.«
»Verstehe. Zahlungsrückstände und nicht eingehaltene Raten.«
»Genau. Und es sind nicht nur Golfbesitzer, sondern auch BMW- und Porschefahrer.«
»Hört sich nicht sonderlich aufregend an.«
»Du wirst dich wundern.« Kock grinste breit. »Bei den Allerweltsmodellen bekommst du es oft mit ahnungslosen Hausfrauen und keifenden Schwiegermüttern zu tun, die dich mit geschwungenem Besen und der Androhung, die Polizei zu holen, vom Hof jagen wollen, die Jungs mit den Luxusschlitten dagegen sind von ganz anderem Kaliber. Mal kommen die mit einem Rechtsverdreher, aber es kann dir auch passieren, dass die ein paar Typen aufbieten, die dir eins auf die Zwölf geben wollen.«
»Ängstlich war ich noch nie.«
»Gut. Wie ich den Unterlagen entnommen habe, stammst du aus Gießen.«
»Richtig«, bestätigte Wilhelm.
»Ich habe vor, dort eine Zweigstelle zu gründen. Es macht einfach mehr Sinn, vor Ort präsent zu sein. Du wärst dann für Gießen, Wetzlar, Marburg und Alsfeld zuständig.« Kock fixierte sein Gegenüber. »Du bekommst ein Büro in Gießen, eine Halbtagskraft und die notwendige technische Ausrüstung. Basis ist Fixum plus Erfolgsprovision.«
Frank Wilhelm überlegte nicht lange. Frankfurt war eigentlich doch nicht das, was er sich vorgestellt hatte, ein wenig Heimweh kam hinzu, und die Aussicht, unabhängig zu sein und trotzdem Geld zu verdienen, gab den Ausschlag. In der Main-Metropole hatte er nämlich einen ehemaligen Kommilitonen getroffen, der auf Biochemie umgesattelt und ihm dieses Studium in den leuchtendsten Farben geschildert hatte. Das kam seinen Neigungen entgegen, und da die Sicherstellung von Autos meist abends oder am Wochenende erfolgte, ließ sich die Arbeit ideal mit dem Hörsaal verbinden.
»Einverstanden, Alfons. Du kannst auf mich zählen!«
»Prima. Willkommen an Bord.«
• •
Was mit so einem maritimen Spruch begonnen hatte, endete schon gut ein Jahr später desillusioniert wieder in der Provinz. Die meisten Neuwagen verfügten jetzt über eine Wegfahrsperre, und da war weder mit Nachschlüsseln und sonstigen Hilfsmitteln etwas zu machen sprich sicherzustellen.
Frank Wilhelm erkannte den Ernst der Lage nicht so recht, denn er hatte im ›Schaukelpferd‹ die Liebe seines Lebens getroffen. Die Kneipe in der Licher Straße lag genau gegenüber dem Uni-Gelände, wo Recht und Wirtschaft gelehrt wurden, und war stark von Studenten frequentiert. Bettina studierte Betriebswirtschaft und hatte eine Vorlesungspau-se genutzt, sich im Biergarten vom ›Schaukelpferd‹ eine Erfrischung zu gönnen.
Bei Frank Wilhelm war es Liebe auf den ersten Blick, und da die attraktive Brünette ihn auch nicht unsympathisch fand, schwebte der diplomierte Privatdetektiv fortan auf Wolke sieben durch die Stadt. Die Beziehung zur Dame seines Herzens erforderte mehr Zeit, als Job und Biochemie zuließen. Da er aber weiterhin von etwas leben musste, blieb er weiterhin auf Spurensuche und hängte das Studium an den Nagel.
Mittlerweile war er neunundzwanzig Jahre alt, glaubte, alle Facetten des Lebens zu kennen und war sich sicher, seine Traumfrau gefunden zu haben. Obwohl er von Bettina nicht viel mehr wusste, als dass sie die einzige Tochter eines Geschäftsmannes war, machte er ihr schon drei Monate nach der ersten Begegnung einen ganz altmodischen Heiratsantrag. Erst als er den obligatorischen Antrittsbesuch bei ihren Eltern machte, erfuhr er, dass ihrem Vater eines der bekanntesten Bestattungsunternehmen in Gießen gehörte. Eine solch miserable Recherche hätte einem gestandenen Privatdetektiv natürlich nicht unterlaufen dürfen, doch gegen derart übermächtige Gefühle hatte die Logik eben keine Chance.
Mit dem Sicherstellen von Autos und dem Hinterherschnüffeln ihrer Standplätze ging es, wie gesagt, deutlich bergab, und als Kock Frank Wilhelm mitteilte, das Gießener Büro wegen mangelnder Rentabilität schließen zu müssen, griff er auf das Angebot seines Schwiegervaters zurück, als Juniorchef in dessen Firma einzutreten. Da es ihn, bedingt durch den Beruf des Vaters, nicht vor Leichen grauste, bestand er die Prüfung zum zertifizierten Bestatter mit Bravour.
Das stimmte auch den Herrn Professor ein wenig versöhnlich, denn nun hatten beide als berufliche Grundlage eines gemein: Sie lebten von den Toten.
3.
Raj Samparad wusste nicht genau, wie alt er war. Hier, in Aripaka im Distrikt Wisagapatnam, spielte das auch keine Rolle. Es gab andere Dinge, die viel wichtiger waren. Zum Beispiel, wie man sich anderen Kasten gegenüber und untereinander zu verhalten hatte.
Da waren die Brahmanen, die Priester, die von niemandem Nahrung annahmen. Die Gavara, der höchste Bauernstand innerhalb der vierten Kaste akzeptierten Nahrung von allen höher stehenden Kasten, lehnten jedoch Essen ab, das von niederen Kasten zubereitet wurde. Zur vierten Varna gehörten auch die Schudra genannten Arbeiter und Bauern. Mangali, die Barbiere und die Wäscher, akzeptierten Nahrung von allen Kasten der Zweimalgeborenen und von allen Schudra, abgesehen von den Palmzapfern; auch von ihresgleichen nahmen sie keine Nahrung an.
Eine extreme Ausnahme bildeten die Kamsali. Sie erhoben den Anspruch, einst Brahmanen gewesen zu sein, bevor sie von den heutigen Priestern verdrängt wurden. Wie die ranghöchsten Kasten trugen sie die heilige Schnur, die geistige Wiedergeburt – zwei Mal geboren – bedeutete. Und wie die Brahmanen lehnten die Kamsali, die Zimmerleute und Schmiede es ab, Nahrung von anderen Kasten anzunehmen. Allerdings nahm auch keine andere Kaste von ihnen Essen an.
Samparad gehörte zur Familie eines Mala, eines Landarbeiters, der zur untersten Kaste gehörte – zu den Haridschan, den Unberührbaren. Wie seine Eltern und Geschwister arbeitete er für den Komati, der fast alles Land hier im Dorf besaß. Der Komati gehörte zur dritten Klasse der Zweimalgeborenen und durfte die heilige Schnur tragen.
Weitere wichtige Persönlichkeiten in Aripaka waren der Munsif, der Ortsvorsteher, und der Karanam, der Schreiber, der zugleich der Dorfastrologe war. Ihm oblag es, den günstigsten Zeitpunkt für Aussaat und Ernte zu errechnen. Von seinem Können hing das Wohl und Wehe des ganzen Dorfes ab.
Über sein weiteres Leben machte sich Raj keine Illusionen. Irgendwann würde er heiraten – natürlich eine Haridschan, und er und seine Frau würden für den Komati und später für seine Kinder arbeiten, so lange es ging. Im Alter mussten die eigenen Kinder für sie sorgen – als Landarbeiter auf den Feldern des Herrn, dem auch er gedient hatte.
Abwechslung würde nur der wiederkehrende Monsun bringen, die Opfer für die Dorfgöttin, das Erntedankfest und die Prozessionen zu den Tempeln, um die Götter gnädig zu stimmen. Er wusste nicht, was draußen in der Welt vorging, und von Europa, ganz zu schweigen von Deutschland, hatte er noch nie gehört. Das sollte sich bald ändern.
• •
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich im Dorf die Kunde, dass in das Haus des Komati ein Fremder eingezogen war. Nicht nur das war eine kleine Sensation, nein, der Besucher hatte eine helle Haut. Eine weiße Haut!
Wer konnte, schlich sich nach beendeter Feldarbeit in die Nähe des Anwesens, um vielleicht einen Blick auf den merkwürdigen Menschen zu erhaschen. Nicht, dass man sich vor ihm fürchtete, aber der Komati sah es nicht gerne, wenn sich die unteren und untersten Kasten seinem Grundstück näherten.
Ängstlich, sich immer wieder umsehend, zwängte sich Raj durch ein Gebüsch mit süßlich duftenden Blüten, huschte über einen von prächtigen Blumenrabatten gesäumten Weg und verharrte hinter einer Baumgruppe. Das Gebäude mochte noch etwa fünfzig Schritt entfernt sein, aber näher traute er sich nicht heran. Zu leicht konnte es passieren, dass der Herr oder einer seiner Diener ihn erwischte und dann nicht nur ihn bestrafte, sondern auch seine Brüder und Schwestern.
Von der Familie des Komati war niemand zu sehen, auch der geheimnisvolle Fremde nicht. Dafür machte er ein merkwürdiges Gebilde aus, das er noch nie zu Gesicht bekommen hatte. Es musste eine Maschine sein, doch wozu sie diente, konnte er nicht einmal erraten. Sie stand unter einer in Kopfhöhe gespannten Plane direkt neben der Veranda an der Vorderfront. Kein Geräusch deutete darauf hin, dass das Ding in Betrieb war.
Enttäuscht wollte sich der junge Arbeiter abwenden, als plötzlich der Herr mitsamt dem Unbekannten hinter dem Haus hervorgeschlendert kam. Raj stockte fast der Atem. Der Fremde hatte tatsächlich eine weiße Haut, trug einen hellen Anzug und eine Kopfbedeckung, die er als Tropenhelm kannte.
Gebannt verfolgte er die beiden mit seinen Augen und übersah dabei fast, dass sie sich seinem Standort immer mehr näherten. Erst als er ihre Stimmen hören konnte, wurde ihm bewusst, in welcher Situation er sich befand. Geschmeidig ließ es sich auf die Knie nieder, robbte ein Stück rückwärts und schlängelte sich lautlos durch die Sträucher.
An diesem Abend war er der gefragteste Mann in den Hütten der Haridschan, denn er hatte den Weißhäutigen mit eigenen Augen gesehen und ein unbekanntes Gerät dazu.
• •
Der hellhäutige Mann blieb nicht lange ein Fremder. Schon am nächsten Tag ließ der Komati das ganze Dorf zusammenrufen und stellte ihn als Arzt aus dem fernen Europa vor. Im Auftrag der Regierung würde er eine Gesundheitsstudie durchführen, und dazu müssten alle Einwohner Aripakas untersucht werden. Wer krank sei, würde kostenlos behandelt, und für die Zeit, in der dadurch nicht gearbeitet werden konnte, wolle er, der Zweimalgeborene, als Opfer für die Götter höchstpersönlich den Lohn weiterzahlen.
Der Komati tuschelte kurz mit dem Mediziner, dann sprach er ein paar Begrüßungsworte im hier gebräuchlichen Dialekt, worauf wiederum der Großgrundbesitzer das Wort ergriff.
Raj verstand nicht viel von der Rede. Er wusste zwar, dass es Ärzte gab, die anders behandelten als die Heiler und Kräuterkundigen im Ort – einer war sogar mal aus einer fernen Stadt gekommen und hatte einen Vortrag über Sauberkeit gehalten – aber damit war sein Wissen auch schon erschöpft.
Klar war: Jeder hatte am kommenden Tag auf dem Dorfplatz anzutreten, wo der weiße Arzt sie untersuchen wollte und auch seine Maschinen aufbaute. Der Karanam würde Listen führen und alle aufschreiben.
• •
Am nächsten Morgen staunten die Bewohner von Aripaka nicht schlecht, was da an moderner Zivilisation mitten in ihrem Ort stand. Nebeneinander parkten zwei fast lastwagengroße, allradgetriebene Wohnmobile, deren labormäßige Ausstattung einer modernen Klinik in nichts nachstand. Ein Röntgengerät gehörte ebenso dazu wie Kühleinrichtungen, Vorrichtungen zur Kreuzprobe, also der Verträglichkeit von Spender- und Empfängerblut und ähnlicher Typisierungen. Automaten, die selbstständig Analysen und Serumbestimmungen vornahmen, waren ebenso Standard wie elektronische Apparaturen aus dem Diagnostikbereich.
Unter dem Dach eines Vorzelts hatte der Mediziner ein paar Tische mit Spritzen, Kanülen und einfachen Instrumenten als eine Art mobile Ambulanz aufgebaut, zwei Schwestern und ein Sanitäter indischer Herkunft gingen ihm dabei zur Hand.
Hinter den Fahrzeugen dröhnte ein Notstromaggregat und schleuderte blau-graue Abgaswolken in die stickige, feuchtigkeitsgeschwängerte heiße Luft des indischen Subkontinents.
Da das Wort des Komati fast so etwas wie Gesetz war, hatten sich alle Bewohner der Siedlung eingefunden, selbstverständlich strikt getrennt nach Kasten. Geduldig harrten sie in der Gluthitze aus, ließen sich vom Dorfschreiber registrieren und beobachteten neugierig, was sich da vorne an den Fahrzeugen tat. Spektakulär war es nicht. Alte Leute bekamen eine Packung mit blauer Schrift, Kinder und Mütter mit Säuglingen eine mit grünem Aufdruck. Da kaum jemand in Aripaka lesen konnte, erläuterten die Schwestern den Gebrauch der Mittel. Zusammen mit dem Sanitäter, der auch dolmetschte, nahm der Arzt den jüngeren Dorfbewohnern Blut ab.