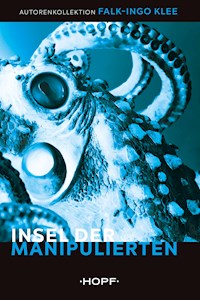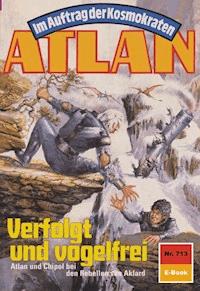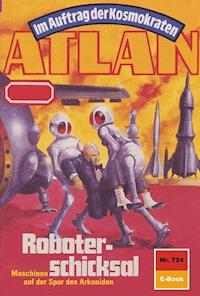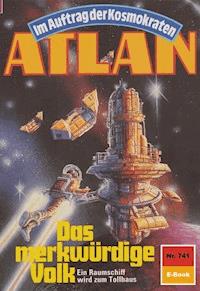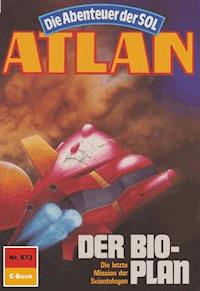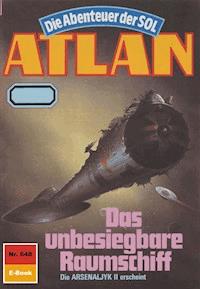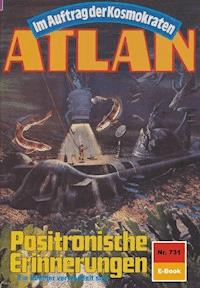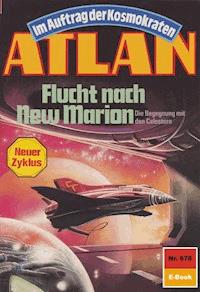Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Frank Wilhelm, genannt der "Undertaker", ehemaliger Medizin-Student, Ex-Privatdetektiv und Schwiegersohn eines Bestattungsunternehmers, wird in einem Hotel in der mittelhessischen Metropole Gießen indirekt Zeuge eines Überfalls auf eine russische Prostituierte. Wenig später wird eine junge Frau tot aus der Lahn gefischt, die offensichtlich aus Osteuropa stammt und auf bestialische Art und Weise umgebracht wurde, kurz darauf gibt es ein weiteres Mordopfer. Die Polizei versucht fieberhaft, diesen furchtbaren Mörder zu finden und dingfest zu machen, und auch Frank Wilhelm beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln. Das ist schwieriger als gedacht - und mörderisch dazu, denn der oder die Täter agieren als Mörderisches Phantom ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
1.
»Hallo, Süßer, du gewählt richtiges Nummer«, gurrte eine Frauenstimme mit starkem osteuropäischem Akzent. »Hier ist Irena. Womit ich dich kann verwöhnen?«
»Ich stehe auf russische Mädchen. Kommst du aus Russland?«
»Da, Towaritsch«, bestätigte die Prostituierte und verfiel dabei unwillkürlich in ihre Muttersprache und das kommunistische Vokabular der ehemaligen Sowjetunion, denn die zwei Worte hießen übersetzt schlicht und einfach ›Ja, Genosse!‹ »Ja, ich Russin und kommen aus Towaritsch«, schwindelte die Hostess geistesgegenwärtig. »Ist kleines Dorf in Nähe von Moskau.«
»Gut. Machst du Hausbesuche?«
»Ja, ich kommen zu Hause, kein Problem«, flötete sie in die Muschel. »Haben du Wünsche sind besonders?«
»Nein. Kannst du in einer Stunde bei mir sein?«
»Wo ist Haus?«
»Ich wohne im Hotel gegenüber vom Autohaus Gießen hier in der Marburger Straße.«
»Geht gut, Süßer. Ich kommen pünktlich.«
»Okay, aber Diskretion ist wichtig. Ich erwarte keine aufgedonnerte Nutte, sondern eine junge Frau, die dem Portier nicht auffällt. Ist das klar?«
»Wie du wünschen. Was ist Nummer von deine Zimmer?«
»Fünfundzwanzig. Klopfe zweimal an, dann weiß ich Bescheid, dass du da bist.«
»Ich pochen doppelt an Tür. Du nicht bereuen, Irena gewählt zu haben. Schon jetzt ich nur Lust auf dich und kaum erwarten, zu verwöhnen dich, mein starkes Mann.«
»Ich erwarte dich dann. Bis gleich«, gab der Anrufer eher lakonisch zurück und legte auf.
• •
Es klopfte zweimal. Der Hotelgast huschte auf Strümpfen zur Tür und öffnete. Eine üppige Rothaarige stand auf dem Gang, kein Rubensmodell, aber mit gut proportionierten weiblichen Rundungen. Sie konnte kaum älter als zwanzig sein.
»Hallo, Süßer, da ich bin …«
»Doch nicht hier auf dem Flur!«, zischte der Uniformierte, sah hastig nach links und rechts und zog das Mädchen ins Zimmer.
»Entschuldigung, ich wollte nicht machen Probleme.«
»Schon gut.«
»Gefallen ich dir?«
Das Freudenmädchen wippte aufreizend mit dem Po und zog den Minirock noch etwas höher.
»Was machen dir besondere Freude?«
»Zieh dich aus. Ich will dich nackt sehen!«
»Das kosten doppelt, Süßer!«
Der Freier griff in seine Hosentasche, zückte einen zerknüllten Fünfhundert-Mark-Schein und warf ihn achtlos auf den Tisch.
»Genügt das?«
»Sehr genügen.«
Mit flinken Fingern griff die Prostituierte nach der Banknote und ließ sie in ihrer Handtasche verschwinden, dann begann sie, sich mit aufreizenden Bewegungen zu entkleiden.
»Du kannst dir den Striptease sparen, Mädel. Runter mit den Klamotten und dann ab aufs Bett mit dir.«
»Ah, ich lieben Soldaten. Wissen immer, was wollen und kommen gleich zur Sache.«
Der Hotelgast gab keine Antwort und verschwand im Bad. Als er zurückkam, trug er noch immer seine Uniform und hatte die Hände hinter dem Rücken verschränkt.
»Ah, verstehen, schnelle Nummer.« Die Rothaarige räkelte sich wollüstig auf den Kissen. »Bundeswehr immer marsch, marsch.«
»Genau!«
Der Soldat ließ sich neben der üppigen jungen Frau auf der Matratze nieder, dann schossen seine Hände vor. Mit der Linken presste er ihr einen mit Äther getränkten Wattebausch auf die Nase, während er ihr mit der Rechten mit aller Kraft den Mund zuhielt.
Für Irena kam diese Attacke völlig überraschend. Instinktiv schrie sie, gleichzeitig schlug sie reflexhaft um sich und versuchte, den Angreifer abzuwehren. Die kreatürliche Angst verlieh ihr Bärenkräfte, aber ihre Hilferufe wurden zu einem dumpfen Gurgeln erstickt, und mit jeder Anstrengung atmete sie das betäubende Gas tiefer und intensiver ein. Die Körperbewegungen wurden immer unkoordinierter und kraftloser, dann verlor sie endgültig das Bewusstsein.
Keuchend und mit vor Anstrengung verzerrtem Gesicht erhob sich der Uniformierte, träufelte erneut reichlich Äther auf die Watte, legte sie in einen in Krankenhäusern üblichen Zellstoff-Mundschutz und band ihn dem Mädchen vors Gesicht. Narkotisiert, völlig reg- und wehrlos, lag die Prostituierte nun auf dem Bett.
Der Bundeswehrsoldat betrachtete die nackte Frau mit einer Mischung aus Zufriedenheit und Triumph, dann ging er erneut ins Bad und kam mit einer gefüllten, großkalibrigen Spritze mit 250 ml Inhalt zurück, der aber die Nadel fehlte.
Beinahe versonnen bestrich er die Kunststoffhülle mit einem Gleitmittel, beugte sich über die Rothaarige und bugsierte den Zylinder vorsichtig in ihre Scheide. Als der nahezu darin verschwunden war, drückte er das Injektionsgerät mit einem Ruck noch ein Stückchen tiefer und spritzte der Bewusstlosen den Inhalt dann durch Druck auf den Kolben in ihre Gebärmutter.
Mit einem lustvollen Glitzern in den Augen zog er das Plastikinstrument langsam wieder heraus und griff zu einem Röhrchen, in dem üblicherweise Brausetabletten aufbewahrt wurden. Er schüttelte ein Tampon heraus, führte es in die Scheide ein und stand auf.
Mit einem diabolischen Lächeln im Gesicht, ohne noch einen Blick auf sein Opfer zu werfen, holte der Uniformierte seinen Fünfhunderter aus der Börse der Betäubten, raffte Irenas Kleidung zusammen und packte sie mit seinen eigenen Sachen und den benutzten Utensilien in den Koffer. Zuletzt entfernte er noch mögliche Fingerabdrücke, nahm der jungen Frau die Maske mitsamt Watte ab und spülte beides durch die Toilette.
»Das war’s, du Russennutte! Ich war dein letzter Kunde auf Erden, der nächste erwartet dich in der Hölle!«
2.
Die Ausstattung wirkte dem Gewerbe angemessen. Sonnenstrahlen wurden durch geschickt angebrachte Jalousien und Vorhänge am Eindringen gehindert, und was sich an Tageslicht trotzig und schüchtern zugleich in den Raum verirrte, wurde gelenkt, geleitet und durch Gardinen gebremst. Halogenlampen und Deckenfluter übernahmen den Part der Sonne, nicht grell und aufdringlich, sondern gezielt gesteuert und eher diffus.
Dem zeitlosen Mobiliar sah man auf den ersten Blick an, dass es aus massivem Holz bestand. Ob Kirschbäume, Palisander oder exotischere Gewächse für diese Schreinerkunst ihr Leben gelassen hatten, war nicht auf Anhieb zu erkennen. Mit dem gleichen Material waren die Wände verkleidet, ein dunkelgrauer Teppich aus dichtem, Schall schluckenden Flor bedeckte den Boden.
Keine Pflanze hätte in diesem Halbdunkel mehr als einen Monat überdauert, dennoch waren etliche Vertreter des Pflanzenreichs in Kübeln vertreten: Exotische Palmfarne, Lorbeerbäumchen und strenge, stammlose Palmen mit starren Wedeln vermittelten eher Düsternis als frisches Grün. Die Heiterkeit ihrer ursprünglichen Heimat war ihnen gründlich ausgetrieben worden, denn es waren Geschöpfe, die der Mensch geschaffen hatte: naturidentisch. Weniger verschämt gesagt: künstlich.
Da der Fortschritt vor keiner Branche Halt macht, war neben dem obligatorischen Telefon in mitternachtsblau – was im Prinzip schwarz ist – auch ein PC vorhanden. Sein Gehäuse war in Anthrazit gehalten, und die Konsole prangte in aufreizendem Stahlgrau. Ein wenig gewöhnungsbedürftig waren die Regaldekorationen: Urnen aller Art und Couleur standen da mehr oder weniger dekorativ herum. Keine offerierte sich als Sonderangebot, sondern signalisierte unmissverständlich wie ein Manifest die Vergänglichkeit des Lebens.
Das zarte Läuten der Tür ertönte, eine Mischung aus Armsünderglöcklein und Heilsbotschaft. Ein paar der zu dieser Jahreszeit schon wärmenden Sonnenstrahlen huschten über die Schwelle, dann fiel ein Schatten in den Raum. Der Mann im dunklen Zwirn hinter dem Schreibtisch wurde lebendig. Er sprang nicht auf, wie es in anderen Branchen üblich war, wenn ein Kunde das Geschäft betrat, sondern er erhob sich würdevoll und ging gemessenen Schrittes auf die Frau zu. Mit gesenktem Kopf deutete er eine Verbeugung an und schüttelte seinem Gegenüber die Hand. Der Griff war zuversichtlich, die Miene auch, aber Leiden und Mitleid waren trotzdem wie eingemeißelt.
Frank Wilhelm deutete auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch, zog behutsam die Tür ins Schloss und nahm etwas umständlich hinter dem wuchtigen Büromöbel Platz. Für einen kurzen Augenblick musterte er die Besucherin. Dieses berufsmäßige Taxieren hatte zweierlei Gründe. Zum einen diente es der Einstufung in die richtige Preiskategorie, und zum anderen der Einschätzung des Seelenlebens des Klienten.
Die zierliche alte Dame mochte so in den Siebzigern sein und verbreitete jene Mischung aus Anstand, Kultur und Würde, die die höheren Töchter der früheren großbürgerlichen Familien einst ausgezeichnet hatte. Sie trug einen dunklen Übergangsmantel, der zwar nicht mehr der neuesten Mode entsprach, aber aus feinem weichen Leder bestand und tadellos verarbeitet war. Dem Material und der Passform nach stammte das Kleidungsstück bestimmt nicht von der Stange. Geistig hakte der Bestatter seine Liste ab: Keine Konfektionsware, also gehobene Preisklasse, zartes Rouge färbte die bleichen Wangen rosig, der Blick war nicht tränenumflort, und die weißen Haare waren so sorgfältig frisiert, als stünde ein Opernbesuch bevor. Demzufolge war sein Gegenüber ziemlich gefasst, mit Gefühlsausbrüchen war nicht zu rechen.
»Gnädige Frau, was kann ich für Sie tun?«, fragte Wilhelm salbungsvoll und geschäftstüchtig zugleich.
»Mein Bruder ist gestern Nachmittag verstorben, und da wollte ich …«
»Natürlich, verstehe, gnädige Frau.«
Er erhob sich und reichte der alten Dame erneut die Hand.
»Darf ich Ihnen zum Heimgang des teuren Verblichenen mein aufrichtiges Beileid aussprechen?«
»Danke.«
Der Bestatter nahm wieder Platz. Da er in der Stimme der Frau keinen weinerlichen Unterton ausgemacht hatte, konnte er ohne übertriebenes Pathos gleich zur Sache kommen.
»Sie möchten also, dass wir Ihren Trauerfall übernehmen?«
Die Weißhaarige nickte zustimmend.
»Ja, denn außer mir hat Arthur keine Angehörigen mehr, die sich um die Beisetzung kümmern könnten. Seine Ehe war kinderlos, und nach dem Tod seiner Frau bin ich zu ihm gezogen und habe ihm den Haushalt geführt. Männer sind in solchen Dingen ja so unpraktisch.«
»Hatte Ihr Herr Bruder besondere Vorstellungen? Oder haben Sie bestimmte Wünsche?«
»Mein Bruder war bis zu seiner Pensionierung Direktor eines Gymnasiums, müssen Sie wissen. Da gab es Lehrpläne, Dienstanweisungen und Vorschriften, und als gewissenhafter Beamter hat Arthur das verinnerlicht. Auch privat hat er nichts dem Zufall überlassen und natürlich auch seine Beerdigung geplant.«
Die alte Dame nestelte am Verschluss ihrer Krokodilleder-Handtasche, zog ein mit Schreibmaschine geschriebenes DIN-A 4-Blatt hervor und reichte es Frank Wilhelm.
»Danke, sehr freundlich«, murmelte der Bestatter und vertiefte sich sogleich in den Inhalt.
Das Ganze las sich wie ein makabrer Einkaufszettel, auf dem der Tote penibel vermerkt hatte, wie er unter die Erde gebracht werden wollte: Sarg Eiche massiv mit patinierten Kupferbeschlägen, keine Zierelemente. Kleidung: eigener schwarzer Anzug. Sargbukett: weiße Lilien. Orgelspiel: Requiem von Mozart, Köchelverzeichnis Nummer soundso und so weiter und so fort.
Wilhelm legte das Papier zur Seite. Zweifellos war der Verstorbene ein Pedant gewesen, aber was er verfügt hatte, konnte einem Bestatter gefallen. Es war ein Trauerfall der gehobenen Preisklasse, und unter dem Strich würde es ein gutes Geschäft für die Firma werden.
»Wenn Sie keine anderen Vorstellungen haben, werden wir alles so arrangieren, wie es Ihr Herr Bruder gewünscht hat.«
»Ich werde mich hüten, an seinen Vorgaben etwas zu ändern!«, sagte die Frau abwehrend und entsetzt zugleich. »Arthur würde es fertigbringen, mir nachts als Geist zu erscheinen, nur weil ich die falschen Blumen gewählt habe.«
»Das wollen wir selbstverständlich beide nicht.«
Wilhelm verwandelte sich in ein mimisches Chamäleon. Anteilnahme und Mitleid bestimmten nach wie vor seinen Gesichtsausdruck, doch ein paar beruflich selten genutzte Muskelgruppen im Antlitz ließen ein wenig Heiterkeit erkennen, die allerdings den optisch erkennbaren Schmerz über das traurige Ereignis nicht überlagerten.
»Gnädige Frau, Sie sagten, dass Ihre Schwägerin schon vor Ihrem Herrn Bruder verstorben ist. Vermute ich richtig, dass demzufolge bereits ein Familiengrab existiert?«
»Ja, es gibt eine Gruft auf dem Neuen Friedhof.«
»Gut, dann brauchen wir diesbezüglich nicht tätig zu werden.«
Der Bestatter machte sich ein paar Notizen.
»Alles Weitere steht ja hier in der Verfügung. Haben Sie den Totenschein dabei?«
»Natürlich.«
Die alte Dame kramte erneut in ihrer Tasche und legte das gewünschte Papier auf den Schreibtisch.
»Bitte sehr.«
Frank Wilhelm nahm die Bescheinigung und warf einen kurzen Blick darauf.
»Wie ich sehe, hat ein niedergelassener Arzt den Totenschein ausgestellt, und ich denke, dass es der Hausarzt war. Demnach ist Herr Meyer in seiner Wohnung verstorben?«
»In seinem Haus«, betonte die Frau. »Ist das bei Herzstillstand so ungewöhnlich?«
»Um Gottes willen, nein. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch – es ist keine Neugier, sondern nur die für uns wichtige Frage, wo wir Ihren Herrn Bruder abholen sollen.« Der Bestatter gab sich zerknirscht. »Es hätte ja auch eine Klinik sein können, Frau …?«
»Auch Meyer – Ruth Meyer. Ich bin unvermählt geblieben, denn mein Verlobter ist im 2. Weltkrieg gefallen, und ein anderer Mann kam für mich nie mehr in Frage.«
»Das tut mir leid, gnädige Frau.«
»Lassen wir das, es ist nun schon eine zu alte Geschichte.«
Verstohlen sah sie sich im Raum um, als wollte sie sich vergewissern, dass sie unbeobachtet waren, dann beugte sie sich mit Verschwörermiene zum Bestatter vor.
»Sagen Sie, lässt es sich einrichten, dass in der Gruft noch Platz für einen dritten Sarg ist?«, erkundigte sich Ruth Meyer und knetete dabei verlegen die Bügel ihrer Handtasche.
Frank Wilhelm bedachte sein Gegenüber mit einem merkwürdigen Blick.
»Ich fürchte, ich verstehe den Sinn Ihrer Frage nicht ganz, gnädige Frau.«
Die weißhaarige alte Dame errötete wie ein verliebter Teenager, den die Eltern in flagranti erwischt hatten.
»Nun, sehen Sie, ich bin die Letzte der Familie, es gibt keine weiteren Verwandten mehr. Und da mich der liebe Gott ja nicht ewig leben lässt, brauche ich für später auch ein Plätzchen, wo man mich zur letzten Ruhe bettet.«
»Ach, so meinen Sie das.«
Um ein Haar hätte der Bestatter befreit aufgelacht, verkniff sich diesen akustischen Heiterkeitsausbruch jedoch in letzter Sekunde. »Natürlich gibt es da Möglichkeiten, gnädige Frau, sogar mehrere. Sie können zum Beispiel mit unserem Institut einen Bestattungsvorsorge-Vertrag abschließen …«
»Danke, junger Mann …«
»Wilhelm, Frank Wilhelm.«
Er zog eine Visitenkarte aus der Tasche und schob sie über den Tisch.
»Bitte entschuldigen Sie, dass ich mich nicht gleich vorgestellt habe.«
»Schon gut, Herr Wilhelm.«
Ruth Meyer griff nach dem bedruckten Karton und steckte ihn ein.
»Bitte keine Details, das überlasse ich Ihnen. Mir reicht es, zu wissen, dass ich dort einmal unterkomme.«
»Das ist kein Problem. Wenn Sie mich anrufen, können wir einen Termin vereinbaren, und ich komme zu Ihnen nach Hause, um alles Nötige zu besprechen. Sie können natürlich auch gerne hier vorbeikommen, falls Ihnen das lieber ist.«
Der Bestatter deutete ein gewinnendes Lächeln an, zückte seinen Terminkalender und blätterte darin.
»Wenn es Ihnen recht ist, würden wir Ihren Herrn Bruder noch heute abholen. Passt es Ihnen um vierzehn Uhr?«
»Ja, das geht in Ordnung.« Die Frau erhob sich und reichte Wilhelm die Hand. »Vielen Dank einstweilen.«
»Ich habe zu danken, gnädige Frau.«
Frank Wilhelm ergriff die dargebotene Rechte und drückte sie so, wie es sich für einen geprüften Bestatter geziemte: Nicht zu fest, denn der seelische Schmerz eines Hinterbliebenen sollte nicht durch körperlichen Schmerz noch vertieft werden, nicht lasch, weil das Inkompetenz vermittelte und mangelnde Anteilnahme, auch nicht herzlich, denn es galt ja nicht, ein freudiges Ereignis zu feiern, nein, Wilhelms Händedruck vermittelte Mitgefühl, Kompetenz und Zuversicht.
»Gnädige Frau, Ihr Trauerfall ist bei uns in besten Händen.«
Würdevoll und fürsorglich zugleich begleitete er die alte Dame zum Ausgang und öffnete die Tür wie ein Kavalier der alten Schule.
»Auf Wiedersehen, gnädige Frau!«
• •
Frank Wilhelm war das, was man einen passabel aussehenden jungen Mann nannte. 1,80 Meter groß, schlank und sportlich, volles braunes Haar, blaue Augen, aber kein Model-Typ.
Dazu waren die oberen Schneidezähne etwas zu groß geraten, der Mund zu breit, und die Nase wies dort einen leichten Höcker auf, wo ihm ein Faustschlag sehr praktisch die anatomische Lage des Nasenbeins verdeutlicht hatte. Danach hatte er mit dem Boxsport aufgehört, zumal auch seine leicht überdimensionierten Lauschorgane öfters zur Zielscheibe gegnerischer Attacken wurden. Eine Existenz als ›Blumenkohlohren‹ blieb ihnen so erspart.
Er entstammte einer alteingesessenen Gießener Arztfamilie, der Vater war ein angesehener Professor und Chef der Gießener Pathologie. Als braver Sohn hatte er folgsam nach dem Abitur an der Justus-Liebig-Universität mit dem Medizin-Studium begonnen, dann aber nach dem siebten Semester die Brocken hingeworfen. Er sah auf einmal keinen Sinn mehr darin, später mal Menschen aufzuschneiden oder einzugipsen, mit Spritzen zu traktieren oder bis an sein Lebensende Pülverchen und Pillen zu verschreiben, außerdem war ihm die mittelhessische Metropole auf einmal zu eng und zu spießig. Es zog ihn hinaus in die Großstadt, weg von zu Hause und dem bürgerlichen Alltagstrott.
Als er daheim ankündigte, dass er das Studium der Humanmedizin an den Nagel hängen und aus dem elterlichen Haus ausziehen wollte, war die Familie – wie nicht anders zu erwarten – außer sich vor Begeisterung. Nachdem auch das von seinem Vater verordnete und schon beim Militär erfolgreiche »eine Nacht überschlafen« zu keinem Sinneswandel führte, fand er sich quasi auf der Straße wieder. Zwar hatte man ihn nicht des Hauses verwiesen, doch das Umgangsklima war mehr als eisig, und der monatliche Scheck gestrichen.
Mit ein paar persönlichen Habseligkeiten war Frank Wilhelm nach Frankfurt getrampt, um sich dort den Duft der großen weiten Welt um die Nase wehen zu lassen. Zwei Tage lang genoss er Freiheit und Großstadt, dann holte ihn das herbstlicher werdende Klima in die Realität zurück. Das Übernachten auf Parkbänken oder am Main waren nichts für einen an Zentralheizung und fließend warmes Wasser gewöhnten jungen Mitteleuropäer, also benötigte er ein Dach über dem Kopf.
Er kam in einer Wohngemeinschaft unter, doch dort verlangte man natürlich einen aktiven Beitrag zum Lebensunterhalt. Also jobbte der Medicus in spe a. D. und verdingte sich als Kistenschlepper im Großmarkt, als Lagerarbeiter, Baugehilfe, Nachtwächter und nahm fast jede Arbeit an, für die man keine besondere Qualifikation brauchte.
Eine unerwartete Wendung nahm sein Leben, als er bei einem Schoppen Apfelwein in Frankfurt-Sachsenhausen einen leibhaftigen Detektiv traf und mit diesem ins Gespräch kam. War es Zufall oder Schicksal, dass er zwei Tage später in einer Zeitung die Anzeige fand: ›Ausbildung zum Privatdetektiv in nur zwei Tagen‹? Gut, der Lehrgang sollte DM 995,- kosten, aber war es das nicht? Unabhängigkeit, Handy, schnelle Autos und kein Chef, der buchhalterisch mit der Stoppuhr die Arbeitszeit kontrollierte? Später vielleicht sogar ein eigenes Büro? Der Gießener sah das Schild schon vor seinem geistigen Auge: Frank Wilhelm, internationale Ermittlungen aller Art.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, und da traf es sich gut, dass die schon etwas gebrechliche Großmutter gar nicht so weit weg in Taunusstein in einer Seniorenresidenz wohnte. Nach wie vor war sie ihrem Lieblingsenkel Frank auch finanziell zugetan, und so war es kein Problem für ihn, die Seminargebühren aufzutreiben.
Schlechter als ›Mit Auszeichnung bestanden‹ schnitt keiner der sieben Lehrgangsteilnehmer ab, und so klapperte der frischgebackene ›Schnüffler‹ mit seinem Diplom unterm Arm die Frankfurter Detekteien ab. Die schienen alle schon auf ihn gewartet zu haben. In den großen Büros, die in ganz Deutschland oder sogar international arbeiteten, wollte sich schon die Empfangsdame totlachen, als er seine Urkunde vorzeigte, und als er sich daraufhin auf die kleinen Agenturen verlegte, waren es meist Klitschen oder Ein-Mann-Betriebe, die mehr schlecht als recht lebten und keinen Juniorpartner brauchen konnten.
Fast war Wilhelm schon geneigt, aufzugeben, als er doch noch auf eine Art Lizenznehmer traf, der in anderen Städten auf Partner zurückgreifen konnte, dem es aber auch möglich war, eigene Niederlassungen zu errichten.
»Wenn du dir jetzt einbildest, mit deinem Crash-Kurs Sherlock Holmes zu sein, bist du bei mir falsch.« Alfons Kock gab das Diplom zurück. »Aber ein Anfang ist gemacht. Ein paar Tage Einweisung bekommst du von mir, und dann kannst du anfangen.«
Der frischgebackene Privatdetektiv wollte sich überschwänglich bedanken, doch Kock hob abwehrend die Hände.
»Du kannst mich Alfons nennen, das Duzen ist bei uns üblich.«
Er musterte den Jüngeren abschätzend.
»Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Sicherstellung von Fahrzeugen im Auftrag der Banken und angeblich gestohlener finanzierter Wagen.«
»Verstehe. Zahlungsrückstände und nicht eingehaltene Raten.«
»Genau. Und es sind nicht nur die Golfbesitzer, sondern auch BMW- und Porschefahrer.«
»Hört sich nicht sonderlich aufregend an.«
»Du wirst dich wundern.« Kock grinste breit. »Bei den Allerweltsmodellen bekommst du es oft mit ahnungslosen Hausfrauen und keifenden Schwiegermüttern zu tun, die dich mit geschwungenem Besen und der Androhung, die Polizei zu holen, vom Hof jagen wollen, die Jungs mit den Luxusschlitten dagegen sind von ganz anderem Kaliber. Mal kommen die mit einem Rechtsverdreher, aber es kann dir auch passieren, dass die ein paar Typen aufbieten, die dir eins auf die Zwölf geben wollen.«
»Ängstlich war ich noch nie.«
»Gut. Wie ich den Unterlagen entnommen habe, stammst du aus Gießen.«
»Richtig«, bestätigte Wilhelm.
»Ich habe vor, dort eine Zweigstelle zu gründen. Es macht einfach mehr Sinn, vor Ort präsent zu sein. Du wärst dann für Gießen, Wetzlar, Marburg und Alsfeld zuständig.«
Kock fixierte sein Gegenüber.
»Du bekommst ein Büro in Gießen, eine Halbtagskraft und die notwendige technische Ausrüstung. Basis ist Fixum plus Erfolgsprovision.«
Frank Wilhelm überlegte nicht lange. Frankfurt war eigentlich doch nicht das, was er sich vorgestellt hatte, ein wenig Heimweh kam hinzu, und die Aussicht, unabhängig zu sein und trotzdem Geld zu verdienen, gab den Ausschlag. In der Rhein-Main-Metropole hatte er nämlich einen ehemaligen Kommilitonen getroffen, der auf Biochemie umgesattelt und ihm dieses Studium in den leuchtendsten Farben geschildert hatte. Das kam seinen Neigungen entgegen, und da die Sicherstellung von Autos meistens abends oder am Wochenende erfolgte, ließ sich die Arbeit ideal mit dem Hörsaal verbinden.
»Einverstanden, Alfons, du kannst auf mich zählen!«
»Prima. Willkommen an Bord!«
• •
Was mit so einem maritimen Spruch begonnen hatte, endete schon ein gutes Jahr später ganz dröge in der Provinz. Die meisten Neuwagen verfügten jetzt über eine Wegfahrsperre, und da war weder sicherzustellen noch mit Nachschlüsseln etwas zu machen.
Frank Wilhelm erkannte den Ernst der Lage nicht so recht, denn er hatte im ›Schaukelpferd‹ die Liebe seines Lebens getroffen. Die Kneipe in der Licher Straße lag genau gegenüber vom Uni-Gelände, wo Recht und Wirtschaft gelehrt wurden, und war stark von Studenten frequentiert. Bettina studierte Betriebswirtschaft und hatte eine Vorlesungspause genutzt, sich im Biergarten vom ›Schaukelpferd‹ eine Erfrischung zu gönnen.
Bei Frank Wilhelm war es Liebe auf den ersten Blick, und da die attraktive Brünette ihn auch nicht unsympathisch fand, schwebte der diplomierte Privatdetektiv fortan auf Wolke sieben durch die Stadt. Die Beziehung zur Dame seines Herzens erforderte mehr Zeit, als Job und Biochemie zuließen. Da er aber weiterhin von etwas leben musste, blieb er weiterhin auf Spurensuche und hängte das Studium an den Nagel.
Mittlerweile war er neunundzwanzig Jahre alt, glaubte, alle Facetten des Lebens zu kennen und war sich sicher, seine Traumfrau gefunden zu haben. Obwohl er von Bettina nicht viel mehr wusste, als dass sie die einzige Tochter eines Geschäftsmanns war, machte er ihr schon drei Monate nach ihrer ersten Begegnung einen ganz altmodischen Heiratsantrag. Erst als er den obligatorischen Antrittsbesuch bei ihren Eltern machte, erfuhr er, dass dem zukünftigen Schwiegervater eins der renommiertesten Bestattungsunternehmen in Gießen gehörte. Eine solch miserable Recherche hätte einem gestandenen Privatdetektiv natürlich nicht unterlaufen dürfen, doch gegen derart übermächtige Gefühle hatte die Logik keine Chance.
Mit dem Sicherstellen von Autos und dem Auskundschaften ihrer Standplätze ging es, wie gesagt, deutlich bergab, und als Kock Wilhelm mitteilte, das Gießener Büro mangels Rentabilität schließen zu müssen, griff er auf das Angebot seines Schwiegervaters zurück, als Juniorchef in dessen Firma einzutreten. Da es ihm, bedingt durch den Beruf des Vaters, nicht vor Leichen grauste, bestand er die Prüfung zum zertifizierten Bestatter mit Bravour.
Das stimmte auch den Herrn Professor ein wenig versöhnlich, denn nun hatten beide als berufliche Grundlage eines gemein: Sie lebten von den Toten.
3.
Es hatte schon immer einen besonderen Nimbus, dieses Sibirien, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Schon zur Zarenzeit hatte man angefangen, die Bodenschätze abzubauen, und als dann die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, kurz UdSSR genannt, quasi die Nachfolge des russischen Reiches antrat, gehörte Sibirien mit seinen Rohstoffvorkommen natürlich zum Kernland der Sowjetunion.
Sibirien – das ist ein riesiges Gebiet von über sechs Millionen Quadratkilometern und damit fast so groß wie der Erdteil Australien. Es erstreckt sich vom Ural im Westen bis zum Pazifischen Ozean im Osten über 7.200 Kilometer, grenzt im Süden an China und die Mongolei an und misst bis zum Nordpolarmeer im Norden immerhin rund 3.200 Kilometer.
Weniger als fünfzig Millionen Menschen bevölkern dieses riesige Gebiet, doch noch nicht einmal zwei Prozent davon gehören zu den alten Sibiriern, die auf den Spuren der Kosaken ins Land gekommen waren und zu Zeiten Iwan des Schrecklichen mit der Kolonialisierung begonnen hatten. Russische Pioniere dominieren, die seit 1950 dem Ruf der Kommunistischen Partei gefolgt waren, das Land und die Industrie aufzubauen oder ganz einfach der Verlockung erlegen waren, dort mehr Geld zu verdienen als im gesamten Rest der Sowjetunion.
Swetlana gehörte zur dritten Generation der russischen Pioniere. Schon ihre Großeltern waren zu neuen Sibiriern geworden, und sie selbst hatte nie etwas anderes kennengelernt. Winter war die Jahreszeit, wenn das Wasser gefror, und das waren oft neun Monate im Jahr. Wochenlang blieb die Sonne unsichtbar, und wenn sich schwarze, an den Rändern hell schimmernde Wolken zeigten, wurde es nicht nur noch dunkler, sondern es war auch ein Anzeichen für aufkommende Schneestürme, die tagelang ohne Unterbrechung andauern konnten. Die furchtbare Purga regierte dann das Land.
In besonders strengen Wintern konnten die Temperaturen unter minus 50 Grad Celsius fallen. Das Vieh musste in den Ställen bleiben, lediglich Enten und Gänse trotzten der Kälte. Wie Wissenschaftler in Versuchen herausgefunden hatten, hielt das Federvieh mehr Frost aus als Eisbären, die bei minus 80 Grad Celsius verendeten, während die Gänse selbst minus 100 Grad Celsius fröhlich schnatternd überstanden.
Der Atem von Mensch und Tier blieb bewegungslos in der Luft stehen, Dunst waberte zwischen den Häusern, und die Atmosphäre trug nicht einmal mehr die Vögel. Wie Federbälle fielen die Spatzen vom Himmel, Eis grub tiefe Rinnen in die Straßen, und die hölzernen Behausungen, vom Sturm gebeutelt und ächzend unter der Last der weißen Pracht, wurden zunehmend windschiefer, Risse zeigten sich in Brettern und Balken, Farbe blätterte ab.
Spezielle Lastwagen mit riesigen, von Ketten ummantelten Ballonreifen mühten sich in Konvois während der wenigen Stunden mit Tageslicht durch den Schnee, um die Siedlungen mit lebensnotwendigen Gütern zu versorgen, und wo auch das versagte, wurden Raupenschlepper eingesetzt, um die Vorposten der menschlichen Zivilisation am Leben zu erhalten. Zuverlässig kamen sie nie, denn das Wetter war unberechenbar, und was sie mitbrachten, war nicht einmal zu erahnen, denn die Planwirtschaft hatte ihre eigenen Gesetze.
Es kam vor, dass man in einem Monat kein Speiseöl bekam, das es dafür in den nächsten vier Wochen aber reichlich gab, dafür aber kein Salz. Brot und Mehl konnten knapp werden, weil in einem Getreidesilo Feuer ausgebrochen war und nicht gelöscht werden konnte, weil der Brunnen zugefroren war.
Ein Auto besaß nur der örtliche Parteisekretär der KPdSU, der kommunistischen Partei der Sowjetunion, doch seine Karosse hatte längst den Geist aufgegeben. Die tiefen Temperaturen ließen Motoren einfrieren, Reifen platzen und Batterien den Geist aufgeben, Schmiermittel wie Öle und Fette wurden zu einer geleeartigen Masse. Metallteile wurden spröde und rissig, brachen oder platzten auf. Fahrzeuge hatten in Sibirien eine Lebensdauer von zwei Jahren, aber das war im Plan nicht vorgesehen.
So war also auch der Funktionär im Winter mit Skiern oder dem Pferdeschlitten unterwegs. An stillen Tagen hörte man das Knirschen des Schnees unter den Kufen drei Kilometer weit, und die weiße Landschaft war in ein gleißendes, fast überirdisch glänzendes Licht gehüllt. Trotz aller Widrigkeiten fühlte man sich eins mit der Natur, und es waren solche Stunden, die die Sibirier mit der Welt versöhnten.
Eher mürrisch wurden sie, wenn der Frühling kam. Nicht, dass sie etwas dagegen hatten, dass die Kälte wich, aber Straßen, Wege, Gärten und Felder verwandelten sich dann durch die Schneeschmelze in eine Sumpflandschaft, bei jedem Schritt blieb man im Morast stecken. Die als Aborte genutzten Sickergruben tauten auf und begannen zu stinken, Abfälle, die man während der kalten Jahreszeit einfach nach draußen geworfen hatte und die durch den Frost konserviert wurden, zersetzten sich unter den ansteigenden Temperaturen in übel riechende organische Zerfallsprodukte.
Danach wurde es für drei Monate Sommer, und der kam mit solcher Macht, dass die Natur förmlich explodierte. Knospen an Bäumen und Sträuchern platzten über Nacht auf, unzählige Blüten entfalteten sich, es gab Blumen und Früchte im Überfluss, aber auch riesige Schwärme stechwütiger Mücken.
Die Sonne ging kaum unter, und wo vor ein paar Wochen noch rotglühende Öfen in den Häusern gegen die Eiseskälte angebullert hatten, herrschte jetzt lähmende Hitze. Dreißig Grad und mehr zeigte das Thermometer an, und es gab Tage, wo sich das Quecksilber sogar der Vierzig-Grad-Marke näherte.
Nichts deutete darauf hin, dass schon in wenigen Wochen wieder Väterchen Frost das Land unter seine eisige Knute zwingen würde, aber jeder stellte sich darauf ein. Die Kinder sammelten die Früchte wilder Beeren, die eingekocht wurden, man erntete das in den Gärten angebaute Gemüse wie Kohl, Rote Beete, Zwiebeln und Knoblauch, und man schlug Feuerholz, um im Winter die großen Ziegelöfen in den Holzhäusern zu heizen.
All das konnte natürlich nur nach Feierabend gemacht werden, denn die Dörfler waren zwar Bauern, doch sie waren Angestellte der örtlichen Kolchose, der staatlichen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Neben Ackerbau wurde auch die Zucht und Mast von Vieh betrieben sowie eine Imkerei.
Abwechslung vom Alltag gab es kaum. Ein, zwei Mal während des Sommers kam eine Art mobiles Kino nach Brasolsk, nach der Schneeschmelze im späten Frühjahr und vor Anbruch des Winters gab es Veranstaltungen der regionalen Komsomol, der kommunistischen Jugendorganisation der UdSSR, der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken. Wie nahezu alle Kinder in dem sowjetischen Riesenreich war auch Swetlana eine Komsomolzin.
• •
Wegen der geringen Einwohnerzahl des Ortes gab es in Brasolsk kein Dorfgemeinschaftshaus oder eine ähnliche Einrichtung. Zusammenkünfte, Parteiversammlungen und Veranstaltungen fanden in dem scheunenähnlichen Anbau des Hauses statt, in dem der örtliche Parteisekretär der KPd-SU wohnte, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Praktischerweise war er auch gleichzeitig Bürgermeister.
Der Sommer hatte dieses Jahr überraschend lange ge